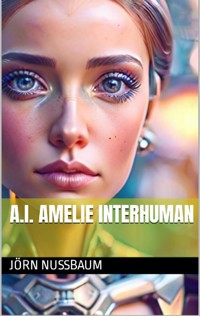3,49 €
3,49 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Jenseits des Horizonts“ ist mehr als ein Roman. Es ist eine Geschichte, die berührt – ehrlich, tiefgründig und nah am Leben. Ein Mann, der sich selbst verloren hat. Eine Beziehung, die zerbricht. Und eine Wahrheit, die sich nur jenen zeigt, die bereit sind, wirklich hinzusehen. Inspiriert von persönlichen Erfahrungen erzählt dieser Roman von Transformation, Selbstverantwortung und dem Weg zurück zu sich selbst – jenseits von Schuld, Angst und alten Mustern. Für Leserinnen und Leser, die sich nach Sinn, Tiefe und innerem Wachstum sehnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Jenseits des Horizonts
Eine Reise ins Bewusstsein
Jörn Nussbaum
Impressum
Copyright © 2024 Jörn Nussbaum
Alle Rechte vorbehalten.
Angaben gemäß § 5 TMG / § 55 RStV
Jörn NussbaumLeukstraße 984028 LandshutDeutschland
E-Mail: [email protected]: www.literaturzauber.com
Die Handlung und alle Figuren dieses Buches sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit realen Personen, lebend oder verstorben, sind rein zufällig.
Ohne ausdrückliche Genehmigung des Autors darf dieses Buch weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form reproduziert, gespeichert oder übertragen werden.
WIDMUNG
Ich widme dieses Buch all jenen, die mich auf meiner Schreibreise begleitet haben.
Ihre Liebe, Unterstützung und Weisheit haben diesem Werk Leben eingehaucht.
Besonderer Dank gilt meiner Frau Sylvia,
Ihre inspirierende Kraft hat den Samen des Schreibens in mir gesät. Ihr Blick über den Tellerrand des Bewusstseins hat mir das Tor zu meinem geöffnet.
Meinen Söhnen Julian und Noah für ihren Glauben an mich. Ihre Motivation ist der Antrieb hinter meinen Worten.
In Liebe und Dankbarkeit
DANKSAGUNG
Ein besonderer Dank geht an die Mitwirkenden, die maßgeblich zum Gelingen dieses Buches beigetragen haben:
Sylvia Nussbaum:
Von Herzen vielen Dank für Deine unglaubliche Unterstützung. Ohne Dich würde es dieses Buch nicht geben.
Leyla Dogan:
Herzlichen Dank für Deinen wertvollen Beistand und Deine motivierende Unterstützung.
Stefanie Arual:
Für den entscheidenden Anstoß in die richtige Richtung danke ich Dir von Herzen. Deine Inspiration hat einen bleibenden Einfluss auf dieses Werk gehabt.
Linda von Bewusstsein.Seele.Geist:
für deine unglaubliche Unterstützung, die weit über das hinausgeht, was ich jemals erwartet hätte. Deine inspirierenden Zitate und tiefgründigen Gedanken auf deiner Instagram-Seite: „Bewusstsein.Seele.Geist.“ haben mich auf dieser Reise begleitet und immer wieder daran erinnert, was wirklich zählt.
Allen Bewusstseinslehrern und -lehrerinnen:
Ein aufrichtiges Dankeschön für Eure Weisheit, die meine persönliche Reise mit tiefer Bedeutung und Verständnis bereichert hat.
Eure Beiträge haben dieses Buch zu dem gemacht, was es ist.
Morgenstunde
Sechs Uhr und zehn Minuten. Auf die Minute pünktlich begann der Wecker auf Roberts Handy mit maximaler Lautstärke zu klingeln. Er hatte sich bewusst für einen gnadenlosen Piepton entschieden, um sicherzugehen, dass er auf jeden Fall geweckt würde. Dennoch verfluchte er diese Entscheidung jeden Morgen.
„Nein!“, schrie sein Gehirn, noch bevor er einen klaren Gedanken fassen konnte. Der Alarm war so penetrant, dass er sogar Komapatienten aufgeweckt hätte.
Er lehnte sich aus dem Bett. Mit ausgestrecktem Arm griff er nach dem Telefon auf dem Nachtschränkchen. Dabei versuchte er, das Kreuz auf dem Bildschirm zu erwischen, um den lästigen Lärm abzustellen.
Noch schlaftrunken verfehlte er beim ersten Versuch das Symbol, bevor er es beim zweiten Mal endlich traf. Seine Motorik ließ zu wünschen übrig. Das trieb ihn fast in den Wahnsinn.
Oh, wie er das hasste!
Er setzte sich auf die Bettkante und schloss noch einmal kurz die Augen, um darauf zu warten, dass das Gebimmel in seinem Kopf leiser wurde. Dann zwang er sich endgültig aufzustehen.
Noch benommen zog er sich einen leichten Morgenmantel sowie seine Hausschuhe an. Er verließ das Schlafzimmer, ohne das Licht einzuschalten.
Er begab sich direkt in die Küche. Kaffee war das Einzige, was er um diese Uhrzeit benötigte – eine schöne, große Tasse Kaffee. Er knipste die indirekte Beleuchtung unter den Hängeschränken an. Die schien ihm zumindest nicht ins Gesicht. Die Maschine hatte er bereits am Vorabend vorbereitet. Robert bevorzugte es am Morgen einfach und unkompliziert.
Früher bereitete er das Frühstück für seine Frau zu, doch jetzt, da er allein lebte, genügte ihm eine Tasse Kaffee zum Wachwerden.
Während der Apparat vor sich hin brühte, schaltete er den Fernseher ein – einen Nachrichtensender. Und so begann der Tag schon mit einer Fülle an negativen Informationen. Auch der Blick aufs Smartphone bot keine besseren Neuigkeiten – Umweltkatastrophen hier, Unglücke dort und von Krieg und Terroranschlägen ganz zu schweigen.
Im Nu war der Kaffee fertig.
„Diese neue Maschine ist wirklich schnell“, freute er sich, jedoch hielt dieser positive Gedanke nicht lange an. Nachdem er den Kühlschrank geöffnet hatte, stellte er fest, dass keine Milch mehr da war.
„Großartig“, dachte er: „Was für ein beschissener Start in den Tag.“
Er nahm einen großen Schluck und obwohl er seinen morgendlichen Wachmacher normalerweise mit etwas Soja-Hafer-Milch trank, tat ihm die warme Flüssigkeit gut.
Mit einer großen, dampfenden Tasse ging er ins Bad.
„Soll ich duschen oder mich rasieren? Wie kann man nur so antriebslos sein?“, dachte er. Beim Blick in den Spiegel verzog er keine Miene. Er hätte den Spiegel eher eingeschlagen, als hineinzulächeln. Er fühlte sich leer und ausgelaugt. Alles erschien ihm beschwerlich und sinnlos.
Er entschied sich für eine ausgiebige Katzenwäsche – das musste für heute reichen. Das Hemd von gestern? Warum nicht? Etwas mehr Deo und ein zusätzlicher Spritzer Aftershave sollten ausreichen, um nicht sofort unangenehm aufzufallen.
Dicke Regentropfen prasselten gegen das Fenster im Badezimmer. Robert schaute hinaus in die noch dunklen Straßen von Chicago, um sich ein Bild der Lage zu machen.
Er schüttelte den Kopf und dachte bei sich: „Ich sollte direkt wieder ins Bett gehen.“
Auf den nass schimmernden Straßen war bereits reges Treiben zu sehen. Langsam erwachte die Stadt zum Leben. Der Chicago River zog sich wie ein schwarzes Band durch das Wirrwarr von Straßen und Häusern. Sogar aus dieser Höhe konnte man die Wellenmuster erkennen, die der Sturm auf der Wasseroberfläche hinterlassen hatte.
Für die Jahreszeit waren fünf Grad Celsius vergleichsweise mild. Allerdings würde der Sturm diesen Vorteil wohl nicht spürbar machen. Immerhin schneite es nicht.
Er hasste die Stadt, den Verkehr und die vielen Menschen. Um sein Apartment in der New East Side hätten ihn wohl die meisten Leute beneidet, doch das interessierte ihn nicht.
Zwei Schlafzimmer, zentrale Lage, mit Blick auf den Fluss. Etliche Parks in Laufnähe, der Lake Michigan vor der Tür und sogar ein Jachthafen. Kurzum, eine Traumwohnung in exzellenter Lage.
Seit Jennys Weggang hatte ihn nichts mehr wirklich erfreut. Nicht einmal, wenn sein Team, die Chicago Bulls, erfolgreich Körbe warf, was ihn früher tagelang in Hochstimmung versetzte.
Achtzehn Jahrelang waren sie ein Paar gewesen.
Was war passiert?
Die ersten Jahre schienen fantastisch zu laufen, zumindest aus seiner Perspektive. Gemeinsam bereisten sie die Welt. Erkundeten Europa, Afrika und Asien. Sie teilten Interessen im Sport, sowohl gemeinsame als auch individuelle. Jeder genoss seine Freiräume und Privatsphäre. Zusammen lachten und weinten sie, zumindest im Kino.
Beim Essen wurde ununterbrochen gesprochen – über alles Mögliche, und genau das liebte er. Genauer gesagt, hatte er geliebt.
Natürlich gab es auch schwierigere Zeiten. Ja, sie hatten sich auch einmal Hilfe geholt, einen Paartherapeuten.
Na ja, er hielt das eigentlich für Geldverschwendung, doch Jenny zuliebe war er mitgegangen. Er hatte sich sogar darauf eingelassen. Sie hatte das Gefühl, ihn nicht mehr erreichen zu können, und fürchtete, ihre Liebe zu verlieren. Das wollte sie doch nicht. Der ursprüngliche Plan war doch, zusammen alt zu werden. Das wünschten sich doch beide.
Klar merkte Robert, dass sie sich verändert hatten. Nach zehn Jahren Beziehung war das doch ganz normal. Zumindest dachte er das damals.
Es lag ja nicht an ihm. Er hatte sich nicht verändert, oder doch? Zugegeben, er war manchmal etwas launisch, um nicht zu sagen schlecht gelaunt. Er spürte, dass kleiner Ärger manchmal noch für Stunden auf seiner Brust lastete. War das eine Depression gewesen?
Er hatte keine Ahnung. Bevor er weiter darüber nachdenken konnte, hatte Jenny bereits vorgeschlagen, sich professionelle Hilfe zu holen.
Danach lief es auch wirklich recht gut, besser. Dachte er zumindest. Jetzt wusste er gar nicht mehr, was er denken sollte. Zum Denken war jetzt auch keine Zeit. Er musste los. Die Arbeit wartete auf ihn.
Es gab eine Zeit, da kam es ihm gar nicht wie Arbeit vor, aber ganz schleichend und ohne, dass er es bemerkte, veränderte sich alles. Dabei liebte er seinen Job. Direkt nach dem College hatte er es zu einer der großen Marketingagenturen des Landes – ja, der Welt – geschafft: Van Dort & Partner.
Es war eine spannende Zeit gewesen. Alles war neu: Geld, Erfolg, Reisen, das Apartment und sein Auto.
Doch jetzt fühlte er sich leer. Lag es daran, dass er alles erreicht hatte, oder daran, dass er auf dem falschen Weg war? War dieser Zustand erst nach der Trennung entstanden oder war er schon vorher vorhanden?
Darüber nachzudenken, schien ihm im Augenblick zu anstrengend.
Er zog die Jacke an, die er am Vortag, als er nach Hause gekommen war, achtlos hatte fallen lassen,82 und griff in die Jackentasche. Seine Hand umschloss den Schlüsselbund. Hervorragend, so musste er ihn zumindest nicht mehr suchen. Er schaltete das Licht aus und verließ die Wohnung.
Auf dem Flur war kein Geräusch zu hören. Er zog die Tür ganz vorsichtig hinter sich zu. Bloß nicht zu laut sein. Manchmal hatte er das Gefühl, dass seine Nachbarin aus dem gegenüberliegenden Apartment nur darauf wartete, dass er seines verließ, um selbst auf der Bildfläche zu erscheinen.
Als Nächstes verwickelte sie ihn in ein spirituelles Gespräch, ganz gleich zu welcher Uhrzeit.
Das fehlte ihm noch. Beim letzten Mal hatte er in regelmäßigen Abständen freundlich genickt und interessiert „Oh“ und „Ah“ gesagt. Zum Dank hatte sie ihn dann mit selbst gebackenen, veganen Keksen und einer Packung Räucherstäbchen beglückt!
Die Stäbchen landeten direkt im Müll. Den Keksen gab er sogar eine Chance. Aber ihr Schicksal schob dies nur um wenige Minuten hinaus.
„Verrückte Alte!“, dachte er.
Dieses Mal erreichte er erleichtert den Aufzug, ohne Frau Garcia zu treffen. Er drückte auf B2 und die Tür schloss sich. Zuvor kam noch der gut gemeinte Warnhinweis einer vom Band kommenden Frauenstimme: „Doors closing.“
„Guten Morgen, Honey. Na, wie war deine Nacht?“, fragte Robert und erschrak beinahe über den Klang seiner eigenen Stimme. Das waren die ersten Worte, die er gesprochen hatte, seitdem er am Vorabend seine Wohnung betreten hatte. Die Fahrstuhltür schloss sich, und die Reise vom 19. Stockwerk in die Tiefgarage begann.
Als der Aufzug sein Ziel erreichte, verabschiedete er sich von „Honey“ und trat in die Tiefgarage.
Der wohlbekannte Geruch aus Gummi, Öl, Abgasen und feuchtem Beton begrüßte ihn.
Gedankenverloren lief er zu seinem Parkplatz. Wäre ihm jemand begegnet, hätte er es wohl gar nicht bemerkt. „Muscle Memory“, dachte er und drückte auf den Türöffner seines Autos.
Nichts passierte.
Erst jetzt blickte Robert nach vorn. Die Fläche, wo sein Wagen eigentlich stehen sollte, war leer.
Gestohlen?
Das kann doch nicht sein! Kurz schossen ganz viele unsortierte Gedanken durch seinen Kopf, doch dann fiel es ihm wieder ein: das Old Dublin Inn.
Auf dem Nachhauseweg war er direkt daran vorbeigefahren und als er sah, dass genau vor dem Eingang ein Parkplatz frei war, hatte er sich spontan für einen kleinen Absacker entschieden. Als aus dem Kleinen ein Großer wurde, ließ er den Wagen stehen und ging die zwei Blocks zu Fuß nach Hause.
Am Vorabend war es zwar kalt, aber trocken und windstill gewesen, sodass die paar Meter ihm nicht sonderlich in Erinnerung geblieben waren. Jetzt sah die Sache natürlich vollkommen anders aus.
„Kann man nichts machen?“, dachte er.
Er ging zum Treppenhaus und stand wenige Minuten später im Foyer des Gebäudes. Bevor er allerdings in den Sturm hinaustrat, zog er sein Telefon aus der Tasche und schaltete über eine App die Standheizung ein. Wenn er schon tropfnass bei seinem Auto ankommen sollte, dann wollte er zumindest in ein warmes Fahrzeug steigen.
„Schon beeindruckend, diese technischen Möglichkeiten“, dachte er.
„Mr. Moretti“, schallte es durch den Flur. Robert drehte sich um und sah das freundliche Gesicht des Portiers. Er war Anfang dreißig und sah wie ein irischer Lausbub aus. Rote kurze Haare und viele Sommersprossen auf der hellen Haut.
„Guten Morgen, Frank, scheußliches Wetter!“, sagte er und lächelte.
„Guten Morgen. Immerhin schneit es nicht. Mir ist nur aufgefallen, dass Sie keinen Schirm dabeihaben. Wenn Sie möchten, könnte ich Ihnen meinen geben.“
„Danke, Frank, das ist sehr freundlich von dir, aber ich denke nicht, dass der Schirm bei diesem Sturm viel nutzen würde“, antwortete er und schüttelte den Kopf. Dann drehte er sich wieder um und trat durch die Tür.
„Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Moretti“, hörte er Franks Stimme, bevor sich die Tür hinter ihm schloss.
„Der Typ ist wohl immer gut gelaunt“, dachte Robert und seufzte, „schrecklich!“
Der Weg zu seinem Auto war genauso unangenehm, wie er es sich vorgestellt hatte. Schon nach wenigen Metern hatte er nasse Füße. Seine Hose klebte an den Beinen und der Wind wirbelte durch seine Haare.
Bei gutem Wetter wäre der kleine Spaziergang wohl nicht erwähnenswert gewesen, doch unter diesen Bedingungen waren selbst fünf Minuten eine Ewigkeit.
Als er sein Auto fast erreicht hatte, drückte er auf die Entriegelung. Er öffnete die Fahrertür, und eine wohlige Wärme von ungefähr 21,5 Grad Celsius empfing ihn.
„Wunderbar“, dachte er, zog die Tür zu und freute sich darüber, dass den Rest die Soft-Close-Automatik erledigte. Er liebte dieses Auto, selbst wenn ein Audi Q7 für einen Single etwas zu groß war.
Er schaltete die Sitzheizung ein und startete den Motor. Die nassen Haare hingen ihm tropfend über die Stirn. Das störte ihn kaum. Doch die nasse Hose war äußerst unangenehm. Eiskalt klebte der Stoff an seinen Oberschenkeln.
Für einen kurzen Moment überlegte er, ob er nach Hause fahren sollte, um sich umzuziehen.
Er war ohnehin immer der Erste im Büro. Die Assistenten und Sekretärinnen kamen ab etwa acht Uhr, während die Manager nicht vor neun Uhr eintrudelten.
Robert war meistens schon kurz nach sieben im Büro. Er schätzte diesen Moment der Stille, bevor so langsam das Leben einkehrte.
„Ach, was soll’s“, dachte er, drehte die Heizung auf die maximale Temperatur, richtete die Luftdüsen auf sich aus und fuhr los.
Im Radio lachte der Moderator und erzählte, dass Frank Sinatra sicherlich den nächsten Song nicht bei so einem Wetter geschrieben hätte, und spielte das Lied „My Kind Of Town“.
Frank Sinatras charismatische Stimme erklang und als er die Textzeile „This is my kind of town, Chicago is …“ sang, ergänzte Robert leicht verfälscht: „Chicago, let you down.“
Office Time
Der Handtrockner in der Herrentoilette war ohrenbetäubend laut. Robert versuchte vergeblich, zu hören, ob sich jemand von draußen der Tür näherte, doch der Lärm machte das unmöglich. In Unterhosen stand er vor dem Gebläse. Mit einer Hand hielt er seine Hose an den Luftauslass, mit der anderen versuchte er, das Hosenbein zuzuhalten. Die heiße Luft blähte das Bein wie einen Heißluftballon auf. Er spürte, wie sie durch den Stoff drang. Die dunklen Wasserflecken verblassten allmählich.
Robert drehte die Hose immer wieder, um eine Überhitzung zu vermeiden. Vor Jahren hatte er versucht, seine nassen Socken so zu trocknen. Damals hielt er es für eine geniale Idee – bis der Polyesteranteil in den Strümpfen zu heiß wurde und schmolz. Diesen Fehler wollte er nicht wiederholen und legte kleine Pausen ein, um zu lauschen, ob es auf dem Flur ruhig blieb.
So war es auch.
Die Uhr zeigte viertel vor acht. Die ersten Kollegen würden bald eintreffen. Bis dahin wollte Robert fertig sein – der Gedanke, in Boxershorts erwischt zu werden, war ihm unangenehm. Er kontrollierte seine Hose. Trocken! Erleichtert schlüpfte er hinein, zog den Reißverschluss zu und schloss den Gürtel. Dann noch die Schuhe, und die peinliche Szene war überstanden.
Nach den Herausforderungen des heutigen Morgens war er froh, alles wieder in Ordnung zu haben. Er hatte diesen Gedanken noch nicht abgeschlossen, als die Tür aufgerissen wurde und ein junger Mann, Ende zwanzig, in den Waschraum stürmte. Auch er war klitschnass. Ihn hatte es sogar noch schlimmer erwischt. Nicht nur die Hose, sondern auch sein Hemd war durchnässt.
Als er Robert sah, erschrak er.
„Entschuldigung, Herr Moretti, es tut mir leid. Um diese Uhrzeit habe ich mit niemandem gerechnet. Sonst hätte ich die Tür so nicht aufgestoßen.“
„Kein Problem, Carl. Es ist doch nichts passiert.“
„Sie kennen meinen Namen, Herr Moretti?“, fragte er erstaunt.
„Aber sicher, und bitte, nenn mich Robert.“
„Wirklich? Ich meine, danke. Sehr gern!“
Carl war erst seit ein paar Tagen in der Firma.
Natürlich wusste Robert darüber Bescheid. Carl hatte sich trotz seiner begrenzten Berufserfahrung bereits einen guten Ruf in der Branche erworben. Eine Tätigkeit bei Van Dort & Partner zu erhalten, galt als Auszeichnung.
Abgesehen davon, dass er klitschnass war, sah er hervorragend aus. Sein Hemd war Slim-Fit geschnitten, was er sich mit seiner sportlichen Figur auch erlauben konnte.
Selbst Robert erkannte, dass er ein gut aussehender junger Mann war. Als Junior-Entwickler im Development-Department für Marketingtechnologie würden sich ihre Wege regelmäßig kreuzen.
Warum genau, wusste Robert nicht, doch er freute sich auf die Zusammenarbeit. Sein Bauchgefühl sagte definitiv Ja zu Carl.
„Ich gehe dann mal besser, damit du dich trockenlegen kannst. Pass nur auf, dass du das Material nicht überhitzt, sonst stehst du am Ende noch ohne Hose da!“, lachte Robert, strich seine Oberschenkel glatt und ließ einen ziemlich verdutzten Carl zurück.
Der Junge erinnerte ihn an seine Anfänge in der Firma, als noch alles neu war und wie ein großes Abenteuer auf ihn wartete. Seine Karriere lag vor ihm wie ein roter Teppich, bereit, betreten zu werden.
Das waren noch Zeiten. Damals träumte er davon, ganz nach oben zu kommen. Partner zu werden. Geld, Frauen, Erfolg – das waren alles Dinge, an die er dachte.
Er musste schmerzlich erkennen, dass erfüllte Träume oft eine innere Leere hinterlassen. Das Ziel war erreicht, der Traum war verflogen.
Robert machte sich auf den Weg zu seinem Büro. Dafür musste er das Großraumbüro durchqueren, das sich langsam füllte.
Es war natürlich kein gewöhnliches Büro. Van Dort & Partner war ja auch kein durchschnittlicher Laden, sondern ein global operierendes Multimillionen-Dollar-Unternehmen.
Er war maßgeblich an der Gestaltung der Raum- und Inneneinrichtung beteiligt. Dieser Bereich sollte nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch den Kunden die moderne, weltoffene Art von Van Dort & Partnern vermitteln. Natürlich stand auch die Kreativität des Unternehmens im Fokus.
Dafür wurde ein lichtdurchfluteter, offener und dynamischer Arbeitsbereich geschaffen. Arbeitsinseln ermöglichten es jedem Mitarbeiter, seinen individuellen Bereich zu haben und dennoch erreichbar zu bleiben. Das sollte die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen allen fördern und gleichzeitig Raum für konzentriertes Arbeiten bieten. So entstanden die unterschiedlichsten Angebote.
Sitzecken für den kreativen Austausch, geschwungene Gänge, offene und geschlossene Arbeitszimmer sowie Einzel- und Gruppenarbeitsplätze. Die Büroumgebung bot zahlreiche Annehmlichkeiten wie Pflanzen, einen Kicker, Darts und sogar eine Playstation. Kreative Arbeit benötigt Raum zur Entfaltung. Hier sollten die Mitarbeiter genau das haben. Die Ergebnisse bewiesen, dass die Investition erfolgreich war.
Van Dort gehörte zu den Big Playern in der Branche aufgrund der außergewöhnlichen Ideen des Teams. Durch die strategische Ausrichtung waren sie dabei, nicht nur ihre Position zu halten, sondern sie auch noch auszubauen. Die Zeiten, die Van Dort benötigte, um Marketingziele und Zielgruppen zu definieren, Strategien zu entwickeln und umzusetzen bis hin zur Präsentation des Ganzen, waren rekordverdächtig.
Roberts Position als Partner könnte man am ehesten als die eines Feuerwehrmanns beschreiben. Er hatte eine Vielzahl unterschiedlicher Projekte zu betreuen und trug am Ende die Verantwortung für die erfolgreiche Umsetzung.
Sein „Spezialgebiet“ war allerdings die Neukundenakquise. Das machte ihm richtig Spaß. Er hatte ein gutes Händchen dafür. Er liebte es, die von der Konkurrenz entwickelten Strategien zu analysieren und zu bewerten. Wenn er zu dem Ergebnis kam, dass er die Ansprüche potenzieller Kunden besser erfüllen konnte, wandte er sich an sie mit einem Angebot. In den meisten Fällen konnte er so neue Kunden gewinnen.
Roberts Büro war durch die natürliche Lichtflut der großzügigen Fensterfront geprägt. Seine Vorliebe für offene Räume spiegelte sich hier wider – keine Wände, sondern eine geschickt arrangierte Bürogestaltung. Eine gemütliche Sitzecke lud zu informellen Gesprächen ein, während der große Tisch perfekt für Meetings geeignet war. Roberts Schreibtisch war das Herzstück des Raumes, umgeben von modernster Technik für Präsentationen und Kundeninteraktionen. Grünpflanzen belebten die Raumecken und verliehen eine angenehme Atmosphäre, die die Balance zwischen Offenheit und Intimität perfekt unterstrich.
Gersten-Gras-Smoothie
Frances betrat den Raum und grüßte: „Guten Morgen, Chef. Kaffee schwarz, kein Zucker und ein Spinat-GerstenGras-Smoothie.“
Sie war eine attraktive Frau in ihren Dreißigern, mit schulterlangen, braunen Haaren, die einen deutlichen roten Schimmer aufwiesen. Winzige Sommersprossen um ihre Nase verliehen ihr ein mädchenhaftes Aussehen. Sie arbeitete seit zwei Jahren als seine Assistentin und er mochte sie von ganzem Herzen.
Frances hielt ihm einen weißen Keramikbecher und ein großes Glas mit leuchtend grüner Flüssigkeit entgegen.
„Spinat-Gras … was?“, erwiderte Robert angewidert und betrachtete den Smoothie.
„Das meinen Sie nicht ernst, Frau Anderson. Nicht um diese Uhrzeit!“
„Ein guter Morgen oder ein Dankeschön, liebe Frances, hätte mir völlig gereicht. Lieb von Dir, Frances, dass Du auf meine Gesundheit achtest. Danke, Frances, für eigentlich alles“, grinste sie ihren Chef an.
Er musste das erste Mal seit Langem lachen.
„Danke, Frances, weltbeste Assistentin.“
„Na geht doch.“
Lächelnd übergab sie ihm die Becher. Er stellte den Kaffee rechts neben die Tastatur seines Computers. Dann roch er vorsichtig an dem giftgrünen Smoothie.
„Keine Angst, der beißt nicht!“, feixte Frances.
Robert führte das Glas ganz langsam an seine Lippen, kippte es vorsichtig so weit, dass seine Lippen gerade benässt wurden.
„Mmmmh, lecker“, bemerkte er und nahm einen großen Schluck.
„Siehste, gelegentlich mal etwas Neues ausprobieren und alte Glaubensmuster über Bord werfen“, kommentierte Frances den mutigen Zug ihres Chefs.
„Wow, wie man sich täuschen kann. Grün ist nun mal irgendwie grün, der schmeckt aber … Na ja, wonach schmeckt der eigentlich? Banane ist da auf alle Fälle drin und Zitrone. Der Name lässt doch wohl auch auf Spinat schließen, doch was ist Gersten-Gras?“
„Du kennst Hordeum vulgare nicht? Wo warst du denn die letzten Jahre? Schon mal etwas von Superfood gehört? Nein, Spaß beiseite. Gekauft habe ich den Smoothie, da mir die Farbe für dich gefallen hat.“
Robert blieb der Mund offen stehen.
„Nicht dein Ernst, du hättest mich vergiften können.“ „Ach was“, winkte Frances ab.
„Zum einen hält sich der Laden schon, seit ich hier angefangen habe, und zum anderen habe ich das Zeug gegoogelt. Das Gersten-Gras-Pulver ist ein Nährstoffwunder. Neben unzähligen Mineralien enthält es viele Vitamine und noch einiges mehr.“
„Na gut, dann bin ich ja jetzt fit für den Tag. Was steht an?“
Er nahm noch einen Schluck von seinem grünen Smoothie, öffnete sein MacBook und klickte auf den Terminkalender. Bevor er sich noch einen Überblick verschaffen konnte, erzählte ihm Frances alles der Reihe nach – ohne auch nur einen Blick in ihre Unterlagen zu werfen. Namen, Zeiten und Details. Sie war einfach unglaublich und wenn man ganz ehrlich war, überqualifiziert.
„Halt, halt, halt, Superbrain. Nicht alle Menschen haben deine Auffassungsgabe. Zwei Fragen“, Robert hielt Frances zwei Finger hin und sah sie mit einem Fragezeichen auf der Stirn an.
„Okay, schieß los“, war ihre knappe Antwort.
„Danke. Erstens: Was ist mit den Chinesen? Haben wir einen Dolmetscher? Zweitens: Was ist das für ein großer Block von 14 bis 20 Uhr?“
Frances überlegte kurz und antwortete dann gelassen: „Auch diese drei Fragen kann ich dir natürlich beantworten. Erstens triffst du dich mit der chinesischen Delegation um 12 Uhr zum Lunch. Zweitens ist unser Dolmetscher krank, aber ich arbeite an einer Lösung. Zu deiner letzten Frage: In diesem Zeitfenster kommt ein gewisser Elmar DeBough, seines Zeichens Sein-Potenzial-Coach und Chakra-Therapeut.“
„Sein-Potenzial? Was ist denn das schon wieder?“
Robert legte seine Stirn in Falten und blickte Frances an.
„Chef, das hatten wir doch heute schon. Denk an deinen Smoothie. Du musst gelegentlich etwas Neues ausprobieren.“
Frances kniff in Zeitlupe das linke Auge zu und gab einen Daumen nach oben.
„Bist du bei dem Essen dabei?“, wechselte Robert das Thema.
„Wenn eure Hoheit es wünschen“, erwiderte sie.
„Ich wünsche es“, sprach König Robert mit einer wohlwollenden Geste seines Arms.
„Euer Wunsch sei mein Befehl“, lachte Frances und verbeugte sich.
„Ach ja, Meeting mit Paul um zehn, nicht vergessen.“
Paul Dubois war der Creative Director. Er hatte einen sympathischen französischen Akzent und stammte aus Kanada, genauer gesagt aus Quebec. Er war ein Genie und konnte sein Team immer zu Bestleistungen motivieren. Er selbst hatte ebenfalls geniale Ideen. Er mochte ihn sehr, fand jedoch seinen alternativen Kleidungsstil gewöhnungsbedürftig, obwohl er hundertprozentig zu ihm passte. Selbst die konservativsten Kunden hatten kein Problem mit seinen Pluderhosen.
Die nächste Stunde verbrachte er damit, E-Mails zu beantworten, was ihm heute schwerfiel. Er stützte sein Kinn ab und fuhr mit den Zähnen unter den Nagelrand seines rechten Ringfingers. Sein Blick schweifte in die Ferne, ohne einen bestimmten Punkt zu fixieren.
„Jenny“, dachte er. Obwohl er mit offenen Augen an seinem Schreibtisch saß, war es ihm, als stünde sie vor ihm.
Er kannte sie so gut, dass er jedes Fältchen und jedes Härchen sehen konnte. Ihr Lächeln hatte ihn immer verzaubert. Sie anzusehen, war das Schönste für ihn. Wenn sie lächelte, strahlte sie von innen nach außen. Ihre Augen leuchteten und ihre weißen Zähne blitzten.
Robert wurde von tiefer Betroffenheit überwältigt, als er daran dachte, dass Jenny schon lange nicht mehr gelächelt hatte. Unbemerkt von ihm schien sie einen Teil ihrer Lebensfreude verloren zu haben. Warum? Sie hatte doch auch das Apartment, die Reisen, den Lebensstil und vieles mehr gewollt.
Bevor er sich jedoch der Beantwortung dieser Frage widmen konnte, betrat Frances sein Büro. Sie hatte einen Stapel Unterlagen, eine Flasche Mineralwasser und ein Sandwich dabei.
Robert blickte auf und schaffte es gerade noch, halbwegs konzentriert zu wirken. „Na, was bringst du mir denn da Schönes?“
Frances beugte sich noch vorn und ließ den Stapel Unterlagen mit einem leichten Plumps auf seinen Tisch fallen. Jetzt griff sie nach der Wasserflasche, die sie unter dem linken Arm eingeklemmt hatte. Holte einen Apfel aus ihrem Ausschnitt und legte ihn neben die Sandwich-Box, die oben auf dem Dokumentenstapel lag.
„Ist da noch mehr zu holen, wo der Apfel herkommt?“, grinste Robert.
Frances lachte, strich sich die Bluse glatt und erwiderte: „Ich wusste, dass du das sagen würdest. Aber leider nein, das ist alles, was da war!“
Immer noch grinsend schob er sein Kinn Richtung Sandwich: „BLT?“ Frances legte den Kopf etwas zur Seite, grinste ihrerseits und antwortete: „VLT!“
„Bevor du fragst: Natürlich vegan – Shiitake-Pilze mit einer Maronencreme, Salat und Tomaten, das Ganze mit veganer Mayonnaise verfeinert. Falls du dich nicht traust, habe ich dir noch diesen wunderschönen Apfel mitgebracht. Schneewittchen hatte sicher keinen schöneren.“
Frances hauchte den Apfel, der optisch wirklich perfekt war, an und polierte ihn an ihrer Bluse. Sie streckte ihren Arm aus und hielt Robert das gute Stück vor die Nase.
„Du planst, mich zu vergiften, entweder mit VLT oder mit Schneewittchens Apfel, alles klar“, feixte er, woraufhin Frances lachte.
„Was hätte ich denn davon? Nichts als Scherereien. Apropos, falls du in fünfzehn Minuten noch unter den Lebenden wandelst, wartet Paul in der Meeting-Area ‚Passion‘ auf dich. Ansonsten sind das die Entwürfe für die Mega-Diaper-Kampagne, das deutsche Oatmeal und ein Überblick über aktuelle Social-Media-Kampagnen.“
„Passion?“, fragte Robert.
„Hattest du nicht die Idee, dass die Kreativen die Räume umbenennen? Na egal, der ehemalige Raum 369, okay?“
Er nickte und hob den Finger: „Noch eine Frage: Was ist mit den Chinesen?“
„Das erfährst du von Paul. Jetzt tank erst einmal neue Energie mit deinem französischen Alpenwasser und VLT – wahlweise Apfel.“
„Bakterienverseuchte Biowaffe, wolltest du wohl sagen? Wer weiß, mit wem du in letzter Zeit herumgeknutscht hast?“
Robert stupste den Apfel mit einer leichten Schnippbewegung an, die gerade ausreichte, um ihn auf die Seite zu kippen.
„Frechheit!“, gab Frances zurück.
„Wo ich doch nur auf dich warte“, streckte ihm die Zunge heraus, drehte auf dem Absatz um und verließ das Büro.
„Meint sie das ernst? Nein, nein, sicher nicht. Frances ist schlagfertig, das war es, mehr nicht“, dachte er.
Robert entschied sich für das Sandwich, das noch nicht einmal schlecht schmeckte. Während er aß, blätterte er durch die Unterlagen. Der Entwurf für die deutsche Frühstücksflocken-Kampagne war einfach nur gruselig. Der Kunde wollte einen aufwendigen TV-Spot für den amerikanischen Markt haben. Das Skizzenbuch zeigte einen Schützengraben, aus dem deutsche Soldaten – an ihren Pickelhauben gut zu erkennen – Müslipackungen wie Handgranaten zum Feind hinüberwarfen. Die darauffolgende Verbrüderung sollte wohl die unglaubliche Kraft dieser Flocken visualisieren. Robert fand es allerdings völlig daneben.
Er legte die Unterlagen zur Seite, schüttelte den Kopf, klappte seinen Laptop zu und stand auf. Bevor er sein Büro verließ, stellte er sich ans Fenster und ließ den Blick in die Ferne schweifen.
Wieder einmal waren seine Gedanken bei Jenny. Er atmete tief ein und ihm war, als hätte er einen gewaltigen Stein auf seiner Brust.
Zumindest lenkte ihn die Arbeit ab. Zu Hause hatte er sich noch gefragt, ob er an einer Depression litt. Dank Frances hatte er jedoch schon ein paar Mal gelächelt, und der Tag war bisher doch recht erfreulich verlaufen. Er hatte einen giftgrünen Smoothie, ein VLT und einen angehauchten Apfel genossen.
Robert machte sich auf den Weg.
Paul
„Bonjour, mon ami!“, begrüßte er Paul, der gerade damit beschäftigt war, den Beamer zum Laufen zu bringen.
Er kniete hinter dem kleinen Tisch, auf dem das Gerät stand.
Paul schaute auf, grinste wie gewohnt und sagte: „Ah, mon cher, welsch Freude, disch zu sehen und wie immer punktlich wie eine Schweizer Uhrwerk.“
„Frances hat mich mehrfach daran erinnert. Wenn überhaupt, musst du sie loben.“
„Isch werde ihr von ganzem Herzen danken“, erwiderte Paul mit einem eindeutig französischen Akzent.
„Sag mal, konntest du schon einen Blick auf das Storyboard für die Müsli-Flocken werfen?“, fragte Robert.
Paul zog die Kabel des Beamers ab, steckte sie wieder ein, tippte auf der Tastatur seines Laptops herum und wunderte sich, dass nichts passierte.
„Oh, mon Dieu, warum geht das nischt?“
Er blickte kurz zu Robert, der ihn fragend ansah.
„Mais oui, habe isch gesehen. Hat mir gut gefallen. Mal etwas autre, äh, etwas anderes.“
Robert trat einen Schritt auf ihn zu, legte seine Hand auf den Beamer, tastete nach dem Powerswitch auf der Rückseite des Geräts und betätigte ihn.
Sofort begann der Beamer zu brummen. Offensichtlich sprang der eingebaute Ventilator an und einige Leuchtdioden blinkten.
„Mon Dieu, du bist mein Held. Merci. Isch un die Technik.“
Paul stand auf, strich sich die Hose glatt und eine Strähne aus der Stirn.
„Du schaust so unglücklich aus, mon ami. Was bedrückt disch? Ist es de Flockmusli?“
Robert musste lachen.
„Oh Mann, Flockmusli, das müssen wir unbedingt verwenden. Das könnte der Slogan des Jahrzehnts werden! Flockmusli, köstlich! Nein, ehrlich, alles gut!“
Paul blickte ihn musternd an.
„Robert, isch kenne disch schon so lange. Wenn es nisch das Musli ist, dann peut-être, äh vielleischt deine Madame? Wenn du einen Freund benötigst, isch bin da für disch, okay?“
„Danke Paul, ich weiß das zu schätzen, ehrlich, aber es ist alles in bester Ordnung.“
Seine Stimme zitterte ein wenig. Paul sah ihn musternd an.
„Also gut, très bien alors, dann lass uns anfangen, aber wenn du misch brauchst, du weißt Bescheid, bien.“
Robert bedankte sich bei ihm auf Französisch: „Merci vraiment, mon ami, j'apprécie beaucoup“, und machte es sich in einem der Loungesessel bequem.
Paul startete seine Präsentation über die neuen Kunden aus dem Land der Mitte.
Der Vortrag war darauf ausgerichtet, Robert auf das anstehende Lunch-Meeting vorzubereiten. Inhaltlich umfasste es einen Crashkurs über die teilnehmenden Manager als auch einen ausführlichen Bericht über das Unternehmen selbst.
QuantumSphere ist nicht einfach nur ein Hightech-Unternehmen, sondern der Marktführer in zahlreichen Schlüsseltechnologien.
Der Konzern war führend in der Entwicklung künstlicher Intelligenz, Cloud-Computing, Robotik, Medizintechnik sowie Energietechnologie. Smartphones, Tablets, Laptops, Wearables und andere Geräte waren nur die Spitze des Eisbergs.
Seit der Markteinführung des bahnbrechenden QuantumPhones im Jahr 2005 kannte jedes Kind den Firmennamen. Das QP One war das erste Smartphone seiner Art und legte den Grundstein für alle nachfolgenden Generationen von Geräten. Seitdem hatte sich die Vernetzung der Menschheit und der Welt in einem unglaublichen Tempo weiterentwickelt. Die handlichen Geräte waren aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken.
Als QuantumSphere die Agentur mit der Bitte um ein Konzept für die Markteinführung ihres neuen Produkts ansprach, wurde dies sofort zur Chefsache erklärt. Die Information, dass eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie bei der Einführung des ersten Telefons bevorstand, löste große Aufregung aus.
Selbst für Van Dort & Partner, die regelmäßig anspruchsvolle Aufträge abwickelten, war das zu erwartende Auftragsvolumen in einem Bereich, der nur selten erreicht wurde. Bei der Übermittlung einiger Eckdaten der Produktbeschreibung musste sich der Seniorchef Henry van Dort notariell zur Verschwiegenheit verpflichten, da das Ganze streng geheim war.
Robert hatte erst vor wenigen Tagen eine Produktvorstellung erhalten und konnte kaum glauben, was heutzutage technisch möglich war. Es war ein wahrer Quantensprung!
Das Gerät sah auf den ersten Blick wie jedes andere handelsübliche Mobiltelefon aus, doch seine Fähigkeiten reichten weit darüber hinaus.
Die revolutionärste Innovation war zweifellos die Möglichkeit, es an jede beliebige Glasscheibe zu halten, die sich augenblicklich in einen Bildschirm verwandelte. Mit einem voll funktionsfähigen Touchscreen ausgestattet, ermöglichte es die direkte Anzeige von Videos, Bildern und Informationen. Obwohl keine physische Verbindung zwischen dem Gerät und der Glasscheibe besteht, erfassen feinste Sensoren die Bewegungen des Benutzers, wodurch eine direkte Eingabefunktion per Berührung möglich ist. Daneben gibt es natürlich noch die üblichen Funktionen in höchster Qualität. Natürlich mehrere leistungsstarke Kameras, eine ausgezeichnete Klangqualität und eine Vielzahl von Apps, die es einem ermöglichen, praktisch alles zu tun, was man sich vorstellen kann.
Paul hatte schon einige Ideen und Werbekonzepte entwickelt. Alles noch schemenhaft, eine Art Brainstorming, um dem Kunden bereits die eine oder andere Vision zu präsentieren.
„Gibt es schon einen Namen für das Produkt, oder soll es einfach QP17 heißen?“, fragte Robert, der den Ausführungen aufmerksam gefolgt war.
„Tatsächlich habe isch mir einige Gedanken dazu gemacht. Aufgrund der neuen Ausrichtung und Fähigkeiten des Gerätes kam isch auf die Ideen, zwei … Die Erste wäre QuantumPhone-X, kurz QP-X. Das X repräsentiert die außergewöhnlichen possibilités, äh, Möglichkeiten. Meine Idee deux für einen neuen Namen wäre QuantumLeap. Dieser Name betont die bahnbrechende Verbesserung gegenüber di Vorgängermodellen. Was denkst du?“
Paul stand mit verschränkten Armen vor ihm und man sah, dass ihm seine Vorschläge gefielen, um nicht zu sagen, dass sie perfekt für ihn waren.
„Tatsächlich gefallen mir beide ausgezeichnet. Wenn ich es entscheiden dürfte, würde ich mich wohl für QP-X entscheiden. Klingt stark, kraftvoll und innovativ. Es gefällt mir! Gut gemacht, très bien Paul, bravo!“, sagte er und erhob sich von seinem Sessel. Er klatschte in die Hände, um seine Begeisterung auszudrücken.
„Gibt es hier schon etwas zu feiern?“, fragte eine angenehme, sanfte Stimme. Robert wusste sofort, wem sie gehörte. Es war Henry, Henry van Dort, der hinter ihnen den Raum betreten hatte.
„Schön, dich zu sehen, Henry“, erwiderte er und streckte seine Hand aus. Die beiden Männer tauschten einen kräftigen und angemessenen Handschlag aus. Henry sah aus, als käme er gerade aus dem Urlaub. Seine Haut war braun gebrannt und um seine Augen, die in einem wunderbaren Bergseeblau strahlten, hatten sich sympathische Lachfältchen gebildet. Das ehemals dunkelblonde Haar war größtenteils mit grauen Strähnen durchzogen. Sein Kleidungsstil war klassisch und elegant. Ohne Zweifel wäre Henry, gäbe es eine Aristokratie in Chicago, als Lord durchgegangen. Er begrüßte Paul genauso freundlich wie seinen Partner Robert.
„Mein lieber Robert, schön, dass ich dich noch antreffe. Ich hatte schon befürchtet, zu spät zu kommen“, sagte er.
„Was kann ich für dich tun?“
„Ich wollte euch zwei nicht stören, aber wenn ihr fertig seid, würde ich noch gern unter vier Augen mit dir sprechen.“
Paul nickte Henry zu und signalisierte ihm, dass er bleiben sollte.
Daraufhin nahm er seine Unterlagen auf den Arm und verabschiedete sich.
„Messieurs, isch muss misch entschuldigen. Isch habe noch viel Arbeit vor mir für das deutsche Flockmusli. Bonne journée, mes amis.“
Paul schnappte sich noch seinen Laptop, nickte beiden zu und verließ den Besprechungsraum.
Robert klopfte ihm beim Vorbeigehen auf die Schulter. Paul verstand die Geste und was er damit ausdrücken wollte. Danke für deinen Vortrag sowie dein freundschaftliches Gesprächsangebot. Ich werde darauf zurückkommen.
„Wollen wir uns kurz setzen?“, fragte Henry und zeigte auf die Couchecke.
„Gerne.“
Daraufhin nahm Robert Platz, während Henry zwei kleine Mineralwasserflaschen aus der Minibar nahm und ihm eine davon reichte. Robert bedankte sich, und die beiden prosteten sich zu.
„Auf dein Wohl, mein Freund“, sagte Henry.
„Auf deines“, erwiderte er und die beiden nahmen einen großen Schluck.
Henry knöpfte sein einreihiges Sakko auf und setzte sich ihm gegenüber. Der Anzug war aus feinstem Stoff und seine bläuliche Farbe stand ihm großartig. Das weiße Hemd, das passende Einstecktuch sowie die dezenten Manschettenknöpfe rundeten das Bild ab. Er war optisch der perfekte Gentleman.
„Wie geht es dir?“, begann Henry das Gespräch.
Das war keine Frage, die Robert einfach nur mit gut hätte abtun können. Henry schaute ihn forschend, liebenswert, ja fast väterlich an.
„Alles in bester Ordnung, vielleicht etwas aufgeregt, da mein Mandarin nicht besonders gut ist.“
„Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Achtzehn Jahre oder sogar etwas länger?“
Robert überlegte kurz. Er hatte Jenny bereits in seinem ersten Jahr bei Van Dort & Partner kennen gelernt; Henry täuschte sich nicht.
„Du hast recht, etwas über achtzehn Jahre müssten es jetzt sein. Zeit für eine goldene Nadel, meinst du nicht?“, schlug er vor.
Henry lachte: „Wir wollen es mal nicht übertreiben, aber wenn du den Deal mit QuantumSphere in trockenen Tüchern hast, wer weiß.“
Er machte eine kurze Pause und legte die Stirn in Falten, bevor er weitersprach.
„Robert, wir kennen uns viel zu lange, als dass ich mit dir um den heißen Brei reden müsste, oder?“
Robert nickte zustimmend und fügte mit einem resignierten Ton hinzu: „Dann kann ich mir wohl die goldene Nadel abschminken.“
„Kannst du! Seit du mir von eurer Trennung erzählt hast, habe ich dich im Auge behalten. Nicht falsch verstehen. Ich wollte für dich da sein, hättest du mich gebraucht. Dir nicht auf die Nerven gehen. Bisher bist du nicht auf mich zugekommen, und ich habe dich gewähren lassen. Ich glaube, das war ein Fehler.
Das wollte ich dir sagen, damit ist jetzt Schluss. Ich werde dich von nun an unterstützen und in die richtige Richtung schubsen!“
„Wow, okay, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, entgegnete Robert überrascht.
„Du musst gar nichts sagen. Du musst nur offen sein, die Situation als Chance ansehen und das Beste daraus machen“, erklärte Henry.
Robert dachte still vor sich hin: „Sie ist weg, und ich soll das Beste daraus machen. Das ist leichter gesagt als getan.“
„Mir geht’s doch gut, Henry. Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst“, gab er als Antwort.
„Seit du Partner geworden bist, hast du dich verändert. Das habe ich schon wahrgenommen. Davor ging es für dich steil bergauf. Du hattest Ziele, die es noch zu erreichen galt – jedenfalls kam es mir so vor. In dem Moment, als du sie erfüllt hattest, kam, wie soll ich das sagen, na ja, irgendwie eine Leere über dich. Du warst immer noch der liebe, engagierte Robert, der du immer warst, aber du begannst langsam, aber sicher, deine positive Art zu verlieren. Ich würde sagen, dass dein inneres Strahlen etwas Staub angesetzt hat. Es wird Zeit, sie wieder zum Strahlen zu bringen“, stellte Henry fest.
„Ich glaube, du übertreibst etwas. Na gut, ich war in letzter Zeit vielleicht etwas neben der Spur, aber meine Arbeit hat darunter sicherlich nicht gelitten!“, erwiderte Robert.
Seine Stimme verriet, dass er, sosehr er auch Henry mochte und das väterlich-freundschaftliche Verhältnis schätzte, sich nicht sonderlich wohlfühlte.
„Es geht mir in keinster Weise um die Arbeit, Robert. Es geht mir um dich. Um dich und dein Seelenheil“, erklärte Henry und atmete tief ein, während er einen Moment nachdachte.
„Ich wünsche mir, dass du wieder glücklich wirst, das Leben als das erkennst, was es wirklich ist. Dass du verstehst, warum du hier bist, wer du bist und welche unglaublichen Möglichkeiten sich dir eröffnen. Ich weiß, dass ich dich nur da abholen kann, wo du gerade bist, aber ich bin überzeugt, dass du so weit bist.“
„Hast du getrunken, Henry?“, fragte Robert und hielt die Mineralwasserflasche an seine Nase.
Er roch daran und zuckte mit den Schultern.
„Nein, das habe ich nicht. Und ich kann dir nur empfehlen, die Finger vom Alkohol zu lassen. Das wäre auf alle Fälle sehr hilfreich für deine bevorstehende Reise.“
„Ich bin mir nicht ganz sicher, was du mir damit eigentlich sagen möchtest, aber ich finde es gewiss schön, dass du mir ein so guter Freund geworden bist. Ich fürchte nur, dass ich unser Gespräch hier beenden muss, da ich gleich ein scharfes Date habe. Cheers!“, sagte Robert und hob die Wasserflasche hoch, nickte Henry zu und genehmigte sich noch einen Schluck.
Henry stand auf und trat hinter ihn. Er legte seine rechte Hand auf Roberts Schulter.
„Bitte, tu dir selbst einen Gefallen und sei offen. Öffne dein Herz. Alles andere ergibt sich dann von ganz allein. Das Coaching heute Nachmittag mit DeBough ist mein Geschenk an dich. Dank dir kann die halbe Firma davon profitieren. Lass es zu. Es lohnt sich. Wenn du hinterher darüber sprechen willst – und das wirst du –, bin ich für dich da!“
Henry packte fester zu, um seinen Worten mehr Nachdruck zu verleihen.
Robert wusste nicht so recht, wie er das Gespräch einordnen sollte, aber er spürte, dass es Henry ernst damit war.
„In Ordnung, ich bin mir zwar bislang nicht ganz sicher, worum es hier wirklich geht, aber ich werde mir den Vortrag von DeBough anhören und versuchen, nein, ich werde offen dafür sein. Versprochen! Ich werde heute schon konstant mit neuen Dingen konfrontiert, also warum nicht auch damit? Und jetzt fahre ich nach Chinatown und hole für uns den Auftrag, okay?“
„Natürlich tust du das, aber zuvor musst du noch bei Frances vorbeischauen, sie hat etwas für dich.“
Henry trat hinter ihm hervor und streckte ihm die rechte Hand entgegen.
Robert ergriff sie, und die beiden tauschten erneut einen festen Handschlag aus. Henry verharrte einen Moment und legte dann sanft seine linke Hand auf Roberts, bevor er mit ruhiger Stimme sagte: „Am Ende wird alles gut, du wirst sehen.“
Seine Worte hatten eine beruhigende Wirkung, wodurch er sich etwas entspannte und Henry ein dankbares Lächeln schenkte.
Robert blieb noch kurz stehen.
„Okay“, dachte er. „Was jetzt?“ Das Gespräch mit Henry hatte ihn sehr berührt. Tief in seinem Inneren wusste er, dass er mit allem, was er gesagt hatte, ins Schwarze getroffen hatte. Jedoch passte es einfach nicht zu seinem Selbstbild.
„Oh Gott, wer bin ich überhaupt?“, dachte er, schüttelte den Kopf und schob seinen linken Ärmel hoch, um auf seine Armbanduhr zu blicken.
„Elf Uhr. Fahrzeit, je nach Verkehr, etwa zwanzig Minuten. Laufzeit vom Parkhaus bis zum Crystal Jade noch einmal zehn Minuten. Nun ja, dann muss ich das Haus um elf Uhr fünfundzwanzig spätestens verlassen. Oje, ich muss los.“
Robert schaute sich noch einmal um und begab sich dann direkt zum Büro von Frances.
Noch bevor er sie sehen konnte, rief er lauthals: „Frances, wo bist du? Wir müssen los!“
Frances saß an ihrem Schreibtisch und blickte ihn mit einem verkniffenen Gesichtsausdruck an.
„Langsam, Brauner, ganz ruhig. Was soll die Aufregung? Es reicht, wenn wir in vierzig Minuten im Auto sitzen.“
„Niemals! In zwanzig Minuten fahren wir los. Ich habe keine Lust, zu spät zu diesem Meeting zu kommen. Das Parkhaus ist riesig, wenn wir Stockwerk um Stockwerk nach einem freien Platz suchen …“
Weiter kam Robert nicht. Frances gab ihm eine Time-out-Geste, und er machte eine Pause.
„Das habe ich doch schon alles bedacht“, erwiderte Frances.
„Du kennst mich doch jetzt schon über zwei Jahre. Wir benötigen heute kein Parkhaus. Ich habe mit dem Manager von Crystal Jade alles abgesprochen. Wir parken direkt am Restaurant, genauso wie unsere chinesischen Freunde. Aktuell gibt es von der Echtzeit-Verkehrsübermittlung keinerlei Verzögerungen. Die Fahrzeit beträgt genau fünfzehn Minuten.“
„Was ist mit dem Übersetzer? Hast du einen bekommen?“
Die in ihm aufsteigende Panik, zu spät zu kommen, versiegte schon wieder, dank der wunderbaren Planung von Frances. Sie kannte dieses Verhalten von ihm nur zu gut. Das war unter anderem der Grund, warum sie im Vorfeld alles perfekt geplant hatte.
„Klar, habe ich einen Dolmetscher bekommen“, antwortete Frances.
„Und? Wo treffen wir ihn?“, erkundigte er sich.
„Sie“, antwortete Frances und zwinkerte ihm zu. „Hübsch?“, fragte Robert chauvinistisch.
„Sitzt vor dir und ja, hübsch ist sie auch!“, lachte Frances, stützte ihr Kinn mit der Hand ab und verdrehte die Augen Richtung Decke, ähnlich einem Pin-up-Girl aus den 1940er-Jahren.
„Na, das kann ja was werden“, seufzte Robert und schüttelte den Kopf, während er sich die Hand vor die Augen hielt.
„Méiguānxi, Robert. Wǒ de pǔtōnghuà kěnéng yǒudiǎn shēngrǒu, dàn zhǐyào jiā xiē rùnhuá yóu jiù méi wèntí le.“
War das wirklich Frances gewesen? Er war überrascht, damit hatte er nicht gerechnet.
„Das klang ja richtig echt“, lachte er: „Was hast du denn gesagt?“
„Keine Angst, Robert, mein Mandarin ist zwar schon etwas eingerostet, aber mit etwas Öl wird es gehen“, übersetzte Frances ihre Aussage.
„Na dann hoffe ich mal, dass du gesagt hast, was du denkst gesagt zu haben, nicht dass wir unserem möglichen Topkunden Mumpitz erzählen.“
Frances grinste und erwiderte: „Du kannst mir vertrauen, Boss! Ehrlich!“, dann lachte sie.
„Den ersten Teil hätte ich dir ja abgenommen, aber dein ‚ehrlich‘, Boss, und dann noch dieses Gelächter, du Teufel. Was soll ich bloß mit dir machen? Ich habe jetzt wohl keine andere Wahl mehr.“
Robert faltete die Hände wie zum Gebet und blickte Richtung Himmel.
„Meine Nerven, sobald wir im Lokal sind, gibt es erst einmal einen Baijiu.“
„Fēicháng lèyì. Du kennst Baijiu, erstaunlich“, nickte Frances ihrem Chef wohlwollend zu.
„Bevor wir gehen, hat Henry noch etwas für dich hier gelassen. Es hängt da hinter dir an der Wand. Dieser kleine Beutel gehört auch dazu!“
„Was ist das?“, wollte Robert wissen.
„Na ja, das Große sieht aus wie ein Kleidersack. Ich nehme mal an, dass da ein Anzug für dich enthalten ist. In dem Beutel wird wohl ein Rasierer sein. Jedenfalls hat Henry das angedeutet. Er hat zu mir gesagt: „Frances, sorg dafür, dass er sich frisch macht und rasiert. Lass ihn auf keinen Fall in seinem alten Hemd zum Meeting gehen.“
Robert drehte sich um und öffnete den Kleidersack. Was er sah, gefiel ihm sehr.
„Armani! Wow! Chic!“, sagte er und rieb den anthrazitfarbenen Stoff zwischen Daumen und Zeigefinger. Er schloss den Reißverschluss wieder, schulterte den Sack und nahm den kleinen Beutel entgegen.
„Na dann werde ich mich mal aufhübschen, wenn der Chef das so möchte.“
Robert verschwand, wie schon am Morgen, im Waschraum. Dieses Mal klebte er allerdings einen Zettel an die Tür, den man unmöglich übersehen konnte. Zusätzlich bat er Victoria, eine der Sekretärinnen, die in der Nähe der Tür ihren Arbeitsbereich hatte, um Hilfe.
„Victoria, könntest du mir bitte einen Gefallen erweisen und die Tür zum Spa-Bereich im Auge behalten? Ich muss mich kurz umziehen, und ich möchte nicht verantwortlich sein, dass ein Kollege hinterher traumatisiert ist.“
„Aber gerne. Gar kein Problem!“, war Victorias Antwort.
Wenige Minuten später kam er frisch rasiert aus dem Sanitärbereich. Er sah einwandfrei aus und roch hervorragend. Henry hatte an alles gedacht – nicht nur an Roberts Lieblings-Aftershave, sondern auch an Rasierseife und einen Rasierer vom Feinsten – einen klassischen Rasierhobel ohne Schnickschnack und ohne Plastikmüll.
So gefiel es ihm. War er beim Aufstehen noch lustlos und unmotiviert gewesen, fühlte er sich jetzt besser. Es war erstaunlich, was ein paar Spritzer Wasser im Gesicht bewirken konnten. Der Anzug saß obendrein wie angegossen. Er zog noch die Hemdsärmel aus dem Sakko heraus, überprüfte den Sitz der Manschettenknöpfe, bedankte sich bei Victoria, entfernte den Zettel von der Tür und ging zurück zu Frances.
„Na, ready?“, fragte Robert, als er wieder vor Frances stand.
Diese hatte nur ein „Wow“ für ihn übrig.
„Erstaunlich, was ein schöner Anzug bewirken kann“, wollte sie sagen, doch weiter kam sie nicht.
Er unterbrach sie. „Überlege deine nächsten Worte weise; sie könnten deine letzten sein.“
Robert verschränkte seine Arme und setzte den fiesesten Blick auf, den er draufhatte. Frances klappte ihren Laptop zu, steckte ihr Telefon in die Handtasche und stand auf.
„Ready, Boss!“
The Crystal Jade
Der Verkehr war überschaubar und sie kamen gut voran. Robert fuhr, während Frances das Auto von innen begutachtete. Sie blickte nach hinten.
„7-Sitzer?“
„Ja, mit Anhängerkupplung, Standheizung und Wärmebildkamera“, grinste er.
„Ziemlich groß für eine Person. Hast du einen Kinderwunsch?“, fragte sie scherzhaft.
„Du steigst gleich aus, wenn du so weitermachst!“, erwiderte er mit einem strengen Blick und hob den rechten Zeigefinger, um seine Drohung zu unterstreichen.
Frances kicherte.
„Meinetwegen, viel Spaß mit den QuantumSphere-Jungs. Wǒ hěn xiǎng zhīdào nǐ de biǎoxiàn. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Performance.“
Robert brummelte: „Also gut, du darfst bleiben“, und wechselte das Thema.
„Ich bin neugierig auf die vier. Wie waren noch mal ihre Namen?“
Frances holte ihr Handy heraus und schaltete es ein. Nach erfolgreicher Gesichtserkennung scrollte sie zweimal nach links und tippte dann auf die Galerie. Dort hatte sie unter „Screenshots“ die Fotos der vier Männer gespeichert. Die Namen kannte sie auswendig.
Frances streckte den Arm aus und hielt ihr Telefon so weit nach vorn, dass Robert einen Blick darauf werfen konnte, ohne den Verkehr aus den Augen zu lassen.
„So, das hier ist Wei-Liang Chen, der Chef des Produktmanagements“, erklärte sie und wischte dann weiter.
„Und das ist Xuefeng Liu. Der Marketingdirektor. Die Betonung liegt auf ‚der‘, es gibt keinen über ihm.“
Frances wischte erneut und fuhr fort: „Hier haben wir Jianjun Wang, zuständig für Werbung und Kommunikation.
Er war maßgeblich am Rollout des QP-14 bis 17 beteiligt. Und schließlich haben wir noch Shengli Zhang, den Leiter des Finanzmanagements. Er war bis vor kurzem im Topmanagement der Dynasty-Finance-Bank. Und, hast du dir die Namen gemerkt?“, fragte sie leicht spöttisch.
„Machst du Witze? Ich weiß nicht, wie ich mir überhaupt die Namen merken soll! Wie schaffst du das nur?“, fragte Robert ernsthaft.
„Man muss es wollen und manchmal auch wissen, wie es geht. Du musst lernen, wie du deinem Gehirn dabei helfen kannst, dir solche Dinge dauerhaft zu merken. Schau dir nur mal die vier Herren an. Sie sind alle unterschiedliche Individuen, richtig?“, fragte Frances. Robert nickte.
„Das ist schon sehr hilfreich. Da jeder anders aussieht, fällt es mir besonders leicht. Ich schaue jeden der Reihe nach an und begrüße ihn mit seinem vollen Namen. Es klingt dann so: „Hallo, Herr Wei-Liang Chen. Ich sehe, Sie tragen eine blaue Krawatte, Herr Chen. Wei-Liang Chen, der Produktmanager von QS. Herr Chen, darf ich Wei-Liang sagen?“ und so weiter. Das mache ich zwei- bis zehnmal und schon sitzen die Namen“, erklärte Frances.
„Oje, das hätte ich wohl auch tun sollen“, seufzte Robert.
„Ich weiß doch, dass dein Kopf gerade woanders ist. Kein Problem, wir bekommen das hin“, ermutigte sie ihn.
„Danke, Frances. Glaub mir, ich weiß, was ich an dir habe!“
Er betätigte den Blinker, bremste ab und wartete auf eine Lücke im Gegenverkehr. Als sich eine bot, überquerte er die entgegenkommende Fahrbahn und fuhr auf den kleinen Parkplatz des chinesischen Restaurants.
Nachdem Robert den Wagen geparkt hatte, bewegte er den Schalthebel auf P und schaltete den Motor aus.
„Einen Moment bitte“, sagte er zu Frances mit einem charmanten Lächeln und stieg aus. Galant öffnete er die Beifahrertür, um ihr beim Aussteigen zu helfen. Frances nahm diese Hilfe dankend an.
„Vielen Dank, ein wahrer Gentleman“, kommentierte sie seine freundliche Geste.
„Es ist mir ein Vergnügen, Teuerste“, antwortete er und schloss die Tür hinter ihr.
Gemeinsam gingen sie auf den Eingang zu, der schon allein sehenswert war. Ein großes, geschnitztes Tor aus einem antiken chinesischen Gutshof war in die moderne Glasfassade eingearbeitet.
Der Empfangsbereich war atemberaubend und bildete einen Übergang vom modernen Chicago ins historische China.
Sobald man durch die Tür getreten war, wurden die Sinne herausgefordert.
Ein angenehmer Duft von Räucherstäbchen, Sandelholz, verschiedenen Kräutern und Jasmin umhüllte sie. Das Ziel war es, den Gast atmosphärisch einzufangen und eine entspannende Wirkung zu erzielen, die nicht verfehlt wurde.
Dazu kam eine dezente musikalische Untermalung mit klassischen chinesischen Instrumenten, die sehr harmonisch klang und das Ambiente perfekt abrundete.
Eine charmante, junge Chinesin in einem traditionellen Kleid begrüßte die beiden freundlich und reichte ihnen ein heißes Tuch auf einem schönen chinesischen Porzellanteller. Frances und Robert nahmen es dankend entgegen und reinigten ihre Hände.
„Herr Moretti, es ist uns eine Ehre, Sie und Ihre Begleitung im Crystal Jade begrüßen zu dürfen“, sagte die junge Dame. Mit einer sanften Geste deutete sie auf den Mann neben ihr, der im selben Stil gekleidet war.
„Chan wird Sie zu Ihrem Tisch führen. Lee, der Mann zu Ihrer Linken, wird Ihre Garderobe entgegennehmen.“
„Sehr gerne“, antwortete Robert höflich.
Er drehte sich zu Frances und half ihr, den Mantel abzulegen. Anschließend reichte er ihn Lee, der ihn mit einer Verbeugung entgegennahm. Danach zog er seinen eigenen aus. Chan wartete diskret. Als beide so weit waren, sagte er sehr freundlich: „Wenn Sie mir bitte folgen möchten, meine Dame, mein Herr, begleite ich Sie zu Ihrem Tisch.“
„Ja, gerne“, war Roberts knappe Antwort.
Chan nickte und streckte die rechte Hand vor, um die Richtung vorzugeben, dann ging er langsam los.
Das war auch gut so, denn es gab noch einiges zu sehen. Der geräumige Eingangsbereich verjüngte sich nach hinten und wurde zu einem relativ langen Gang. Gleich am Anfang ging man durch einen Bogen, der an den Eingang zu einem traditionellen chinesischen Haus erinnerte. Ab hier bestand der Boden aus einer Art Kopfsteinpflaster. Zumindest sah es so aus. Durch den Torbogen wurde es etwas dunkler und da man noch durch vier weitere schritt, war die Atmosphäre perfekt. Zwischen den Toren, entlang der Wände, standen indirekt beleuchtete Buddha-Statuen, dazu die Musik und der Duft.
„Das würde Jenny gefallen“, dachte er und musste zwangsläufig an die großartigen Urlaube denken, die sie gemeinsam in Fernost verbracht hatten.
„Wer weiß, vielleicht bekomme ich eines Tages die Gelegenheit, ihr dieses …“, weiter wollte Robert jetzt nicht denken, denn er merkte, dass es ihn tief im Herzen schmerzte.
Der letzte Torbogen war geschlossen. Chan öffnete eine wunderschöne alte Tür und das Lokal lag vor ihnen. Nach dem Steinboden betraten sie nun uralte hölzerne Dielen.
Die Beleuchtung war dezent und atmosphärisch nicht zu überbieten. Was dem aufmerksamen Beobachter sofort auffiel, waren die vielen unterschiedlichen Tische und Stühle. Nicht die klassischen Hochglanzmöbel mit Drachenkopf, sondern viel eher eine Ansammlung von Einrichtungsgegenständen, die auf einem Antikmarkt in Shanghai oder Peking zum Kauf angeboten wurden. Robert gefiel es sehr und auch Frances war begeistert.
„Unglaublich, mega! Ich bin doch mal sehr gespannt, wie hier wohl die Preise sind“, sagte Frances.
Chan führte sie zielstrebig in den hinteren Bereich des Speisesaals. Dort war ein großzügiger, abgetrennter Bereich und wie er richtig erkannte, waren die vier Herren schon da.
„Jetzt wird’s ernst! Los geht’s!“, sagte Robert mehr zu sich als zu Frances.
Chan blieb stehen und trat zur Seite, sodass Frances und er an ihm vorbeigehen konnten.
Er verbeugte sich, und Robert dankte ihm dezent mit einer kleinen Anerkennung.
Die vier Männer erhoben und verbeugten sich auf eine sehr höfliche Art. Robert und Frances taten es ihnen gleich.
„Fēicháng zūnjìng de Gen xiānshēng, Liú xiānshēng, Wáng xiānshēng hé Zhāng xiānshēng: hěn róngxìng néng jiàn dào nǐmen, wǒ jiào Fúlǎngxīsī, shì Moretti xiānshēng de zhùliè. Wǒmen de fānyìshì bìngrén le, suǒyǐ wǒ bìxū dānshēn bǎochí zhè jù fānyì. Qǐng jiùshì shìyòng, wǒ ruò ràng zhèngzài shījìan shàng cuòwù le nǐmen de yǔyán“, begann Frances.
Robert staunte zwar, verstand aber nur Bahnhof.
„Na, das kann ja heiter werden“, dachte er.
Wei-Liang Chen verbeugte sich und erwiderte einen langen Satz auf Chinesisch. Dann verbeugte er sich erneut und beendete den Satz auf Englisch.
„Liebe Frances, ich bin beeindruckt von Ihren Sprachkenntnissen. Es ist uns eine Freude und Ehre zu erkennen, dass Sie mit uns auf Augenhöhe in unsere Geschäftsbeziehung gehen wollen. Dafür danke ich Ihnen schon jetzt. Bitte nehmen Sie Platz.“
Robert fiel ein Stein vom Herzen.
„Ich bin wirklich sehr erleichtert, dass Sie unsere Sprachen sprechen. Ich bin leider nicht so talentiert wie meine charmante Kollegin. So ist es natürlich viel leichter. Vielen, vielen Dank.“
„Da wir uns in der chinesischen Geschäftswelt bewusst sind, dass es für Ausländer schwierig ist, unsere Geburtsnamen richtig auszusprechen, verwenden wir westliche Namen. Wir haben uns schon so daran gewöhnt, dass wir uns sogar untereinander mit ihnen ansprechen. Deshalb würden wir Ihnen dies auch gerne anbieten. Zu mir können Sie Mark sagen“, erklärte Wei-Liang Chen und schaute nach links zu Xuefeng Liu, dem Marketingleiter.
„Ich heiße Leroy, L wie Liu, nicht wahr?“, sagte er.
„Ich bin Jack, freut mich!“, erwähnte der Kommunikationsmanager Jianjun Wan.
„Last but not least“, grinste der Finanzmanager Zhang und stand auf.
„Ich bin Thomas, angenehm“, und nahm wieder Platz.
„Vielen, vielen Dank, Mark, Leroy, Jack und Thomas.“
Robert sprach die Namen betont langsam und respektvoll aus. Dabei blickte er der Reihe nach jedem in die Augen und senkte leicht den Kopf.
„Darf ich uns auch noch einmal vorstellen? Das ist meine sehr talentierte, zuverlässige rechte Hand und Assistentin Frances. Und wenn Sie schon so großzügig mit den Vornamen sind, dann können Sie mich gerne ‚Chao‘ nennen.“
Die vier lachten, und Leroy griff nach der Flasche Baijiu, einem Weißschnaps, und füllte sechs Gläser.
Er stellte zwei davon vor Robert und Frances und nahm sich selbst eines. Leroy hob es in die Höhe und strahlte über das ganze Gesicht.
„Ganbei, ganbei!“
Jetzt erhoben alle die Gläser, stießen an und aus allen Mündern kam: „Ganbei, ganbei!“
„Der hat es in sich“, sagte Robert. Das Husten von Frances bestätigte seine Aussage.
Leroy wollte erneut die Gläser füllen, doch Robert hielt seine Hand darüber.
„Nein, vielen Dank. Ein anderes Mal gerne. Zum einen muss ich noch Auto fahren und zum anderen findet heute noch ein Coaching in der Firma statt. Da sollte ich vor meinen Kollegen doch einen guten Eindruck machen.“
Leroy nahm die Flasche zurück und stellte sie zur Seite. Mark winkte den Kellner zu sich und sagte etwas auf Chinesisch. Es klang überlegt und freundlich.
„Vielen Dank für das Treffen in diesem wunderschönen Lokal“, eröffnete Frances die Gesprächsrunde.
„Schon beim Betreten verändert sich die Wahrnehmung. Der erste Eindruck ist sensationell, obwohl wir noch gar nichts gegessen haben.“
„Das freut uns wirklich sehr“, antwortete Jack.
„Seit der großen Öffnung unter Deng Xiaoping in den späten 70er-Jahren hat China eine faszinierende Entwicklung durchgemacht. Viele positive Veränderungen sind entstanden, jedoch gibt es auch Schattenseiten. Viele Menschen in China streben danach, alte Traditionen zugunsten eines modernen, konsumorientierten Lebens nach westlichem Vorbild hinter sich zu lassen. Altes wird häufig entsorgt und vergessen. Dieses Lokal baut jedoch eine wunderbare Brücke zwischen Tradition und Moderne. Wir sind sicher, dass Sie begeistert sein werden, sobald Sie die Speisen probiert haben.“
„Das klingt wunderbar. Aber wie schafft es QuantumSphere, diese Brücke zu schlagen?“, fragte Robert neugierig.
Die vier tauschten kurz Blicke aus und waren sich einig, dass Jack die Frage beantworten sollte.
„Ähnlich wie ein Samen nur auf dem richtigen Boden gedeihen und zu einem kräftigen Baum heranwachsen kann, muss auch ein Unternehmen aus kleinen Einheiten wachsen, um eine feste Struktur zu bilden.
Jeder Mitarbeiter stellt für sich eine solche Einheit dar, doch nur gemeinsam können wir stark sein. Damit jeder Einzelne seine Fähigkeiten bestmöglich einbringen kann, muss das Umfeld stimmen. Für den Samen ist das der Boden. Für den Menschen sind es seine Familie, Freunde und das Umfeld, in dem er lebt, sowie sein Team bei der Arbeit und seine Aufgabe.
In den Anfängen haben wir viele Fehler gemacht. Wachstum stand an oberster Stelle, die Arbeitsbedingungen orientierten sich ausschließlich am Produkt und der wirtschaftlichen Effizienz. Vor allem die Mitarbeiter in der Produktion wurden ausgebeutet und es gab keine Innovationen.
Wir versuchten, den westlichen Firmen nachzueifern und kopierten viele Dinge, erreichten dabei aber nur eine mäßige Qualität. Der große Wandel kam, als wir erkannten, dass wir uns wieder auf traditionelle Werte konzentrieren müssen: Gemeinschaft, Respekt vor Älteren, Selbstdisziplin und Bescheidenheit.“
„Das klingt gut. Aber wie führt die Besinnung auf traditionelle Werte zum unglaublichen Erfolg von QuantumSphere?“, fragte Robert neugierig.
Jack nickte und fuhr fort: „Das ist eigentlich ganz einfach und auch nichts Neues. Die Besinnung auf Traditionen hat uns wieder auf den Weg der Weisheit geführt, zum Beispiel auf die Lehren von Konfuzius.
Er hatte schon vor zweieinhalbtausend Jahren verkündet: 'Wenn die Sprache nicht stimmt, ist das Gesagte nicht gemeint'. Ein ehrlicher Umgang mit allen Menschen im Unternehmen ändert die Sichtweise. Der Westen lehrte uns schon vor langer Zeit, eine Corporate Identity zu etablieren, es war jedoch nur eine Floskel und keine gelebte Kultur. Was ist das Wort ohne die Tat? Wenn Sie etwas verändern wollen, müssen Sie es tun. Am Anfang steht die Idee, der Gedanke, wie es sein soll. Wenn Sie jetzt ihre gesamte Belegschaft mit ins Boot nehmen und alle an einem Strang ziehen, dann ist der Erfolg unvermeidlich.