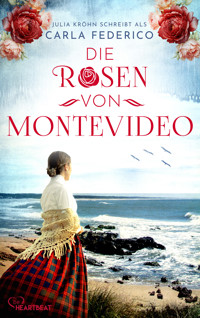4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Chile-Saga
- Sprache: Deutsch
Punta Arenas 1881: In der südlichsten Stadt der Welt kämpfen zwei sehr unterschiedliche Frauen um ihre Zukunft und ihre Freiheit - und um die Liebe: Emilia, die Tochter deutscher Auswanderer, flieht von zu Hause, um einem dunklen Familiengeheimnis zu entkommen. Die zurückhaltende Rita hingegen hat einen ganz anderen Wunsch: Sie will von den Chilenen als Weiße anerkannt werden, denn sie ist die Tochter einer Weißen und eines Mapuche und wird deshalb brutal verfolgt. Im sturmgepeitschten Patagonien entscheidet sich das Schicksal der beiden Frauen.
Große Gefühle und atemberaubende Landschafen: »Jenseits von Feuerland« ist der zweite Teil der dramatischen und emotionalen Auswanderer-Saga von Bestsellerautorin Julia Kröhn.
Alle drei Bände der Chile-Saga von Carla Federico (Julia Kröhn):
Im Land der Feuerblume
Jenseits von Feuerland
Im Schatten des Feuerbaums
eBooks bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 985
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
PROLOG
ERSTES BUCH
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
ZWEITES BUCH
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
DRITTES BUCH
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
VIERTES BUCH
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
Epilog
Personenverzeichnis
Historische Anmerkung
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Punta Arenas 1881: In der südlichsten Stadt der Welt kämpfen zwei sehr unterschiedliche Frauen um ihre Zukunft und ihre Freiheit – und um die Liebe: Emilia, die Tochter deutscher Auswanderer, flieht von zu Hause, um einem dunklen Familiengeheimnis zu entkommen. Die zurückhaltende Rita hingegen hat einen ganz anderen Wunsch: Sie will von den Chilenen als Weiße anerkannt werden, denn sie ist die Tochter einer Weißen und eines Mapuche und wird deshalb brutal verfolgt. Im sturmgepeitschten Patagonien entscheidet sich das Schicksal der beiden Frauen.
»Jenseits von Feuerland« ist der zweite Teil der dramatischen und emotionalen Auswanderer-Saga von Bestsellerautorin Julia Kröhn.
Julia Kröhn schreibt als
Carla Federico
PROLOG
Magellanstrasse, Dezember 1892
Sprühender Nebel und Dunstschwaden erwarteten sie, nachdem sie den Atlantik verlassen hatten und in die Magellanstraße eingefahren waren. Zunächst glitt das Schiff lautlos auf dem dunklen Wasser, doch plötzlich wurde das Grau vor ihren Augen so dicht, dass der Kapitän befahl, den Anker werfen zu lassen. Erst Stunden später, der Abend nahte schon, erwuchsen aus einem Lufthauch heftige Windböen. Der Nebel riss wie ein Schleier, und das Meer war nicht länger abgründig schwarz, sondern leuchtete in vielen Farben: Es funkelte grün und türkis, wo Sonnenstrahlen darauffielen, dunkelviolett, wo die schroffen Küsten Schatten warfen.
Das Schiff nahm wieder an Fahrt auf, kam nun an steil aufragenden Basaltfelswänden vorbei, an zerklüfteten Klippen und an öden Heiden, die oft von den ebenso wilden wie kalten Südwinden der Antarktis gepeitscht wurden. Keine fruchtbaren Wiesen bedeckten sie, sondern dürre Algen, über denen Seevögel kreisten – Albatrosse mit schwanenweißem Gesicht und mächtigen Flügeln, Regentaucher, die der Algen bald überdrüssig waren und hungrig nach Fischen auf das Wasser herabschossen, Meerlerchen mit ihrem gebogenen Schnabel und Raubmöwen, deren Kreischen zu ohrenbetäubendem Lärm anwuchs. Auf die Heidelandschaft folgten sanfte Hügel, die Sonne leuchtete ein letztes Mal golden auf, dann sog die Nacht alle Farben aus dem Land. Das Wasser wurde pechschwarz, und bleich trat am Abendhimmel die Mondsichel hervor.
Emilia seufzte.
»Ja, nun weißt du alles«, wiederholte sie. »Doch ich frage mich, ob du mit diesem Wissen leben kannst.«
ERSTES BUCH
Das Ende der Welt1881~1882
1. Kapitel
Die junge Frau rannte um ihr Leben.
Trotz allem, was geschehen war, fand sie die Kraft, zu fliehen und ihre Schmerzen zu ignorieren – es waren schreckliche Schmerzen. Ihr Körper war über und über von Kratzern, Schrammen und blauen Flecken übersät. Ihre Füße brannten, als hätte sich ihre Haut aufgelöst und als würde sie auf rohem Fleisch laufen. Ihr Kopf dröhnte, ihre Kehle schien zu zerbersten. Und dennoch hielt sie nicht inne, legte vielmehr an Tempo zu und wurde erst dann langsamer, als der Durst übermächtig wurde. Als sie ein Rauschen hörte, blieb sie erstmals stehen und hob den Kopf.
Das Rauschen stammte von einem kleinen Fluss, dessen Wasser in der Sonne türkis funkelte. Sie wankte darauf zu, doch ehe sie ihn erreichte, verfingen sich ihre Füße im Gestrüpp; sie stolperte, verlor die Balance, fiel auf trockene Erde. Ächzend und mit geschlossenen Augen robbte sie weiter, zerkratzte sich die Hände noch mehr, schürfte sich die ohnehin blutigen Knie weiter auf. Unbarmherzig brannte die Sonne auf sie herab.
Durst, sie hatte so schrecklichen Durst, und das Wasser, es war doch so nah!
Aber sie konnte es nicht erreichen – noch nicht. Immer wieder wurde sie von ihrem ausgelaugten Körper gezwungen, liegen zu bleiben, und jedes Mal fürchtete sie, von alles vernichtender Schwärze überwältigt zu werden. Doch sie gab nicht auf, robbte weiter, und endlich tauchten ihre Finger in das kühle Nass. Die Spitzen ihres langen schwarzen Haars fielen hinein, die Strömung spielte mit ihnen, und schließlich versenkte sie ihren ganzen Kopf im Fluss, öffnete den Mund und ließ das kalte Wasser einfach hineinfließen. Während sie mit Mühsal schluckte, fühlte es sich an, als würden kleine Messer in ihre Brust schneiden, aber zugleich kehrten neue Lebenskräfte in ihren geschundenen Körper zurück.
Prustend tauchte sie nach einer Weile wieder auf. Das nasse Haar hing über ihr Gesicht. Sie strich es zurück, starrte auf den Fluss, der verschwommen ihr Spiegelbild reflektierte – und erkannte sich nicht wieder. War das ihr Gesicht, ihr Körper, ihre Hände, die sie nun ausstreckte, um sich zu waschen, um ihre blutigen Füße zu betasten und Dornen und Stacheln herauszuziehen?
Sie war sich fremd geworden, wusste nicht mehr, wie sie aussah, wer sie war, und sie wusste auch nicht mehr, wie sie hieß.
»Mein Name«, fragte sie laut in die Stille, »wo ist mein Name geblieben?«
Nachdem sie sich notdürftig gereinigt hatte, blieb sie steif sitzen. Die Luft wurde kühler, das Haar trocknete im Wind. Plötzlich zuckte sie zusammen und blickte sich ängstlich um. Ein Geräusch war erklungen, ganz nah an ihrem Ohr – Hufgetrampel, Gelächter, Stimmen, ein Schuss, das Klirren von Säbeln. Sie duckte sich unwillkürlich, sah sich schnell nach einem Versteck um.
Sollte sie versuchen, zu den kümmerlichen, verdorrten Bäumen dort hinten zu laufen? Oder sich einfach ganz flach auf den Boden legen und hoffen, dass die Farbe ihres Wollkleides mit der der Erde verschmolz und die Reiter nicht auf sie achten würden? Allerdings – wenn diese das glitzernde Wasser sahen, würden sie gewiss rasten und trinken. Sie würden sie sofort entdecken, und dann würden sie sie töten. Daran bestand nicht auch nur der geringste Zweifel.
Sie lauschte wieder, hob schließlich vorsichtig den Kopf; das Hufgetrampel klang zwar näher, aber noch war niemand zu sehen. Rasch sprang sie auf, unterdrückte einen Schmerzenslaut, als sich Steinchen in die blutigen Fußsohlen gruben, und wankte zu den Bäumen. Die Äste reichten bis zur Hüfte, sie konnte mühelos auf die niedrigen klettern und sich von dort aus weiter hinaufziehen. Doch der Baum war kahl und bot nicht sonderlich viel Schutz vor Blicken. Wenn nur einer der Soldaten zufällig den Kopf hob, war es um sie geschehen. Er würde sie erschießen, wenn sie viel Glück hatte, mit seinem Säbel aufspießen, wenn sie ein wenig Glück hatte, oder ihr Kleid zerfetzen, ihr ins Gesicht schlagen und sie schänden, wenn sie gar kein Glück hatte.
Das Geäst knirschte, sie war sich nicht sicher, ob es nicht zu morsch war, um ihrem Gewicht standzuhalten. Aber jetzt gab es kein Zurück mehr. Die Soldaten kamen um die Ecke, deuteten auf das Wasser, ritten darauf zu. Ein Kondor zog am blauen Himmel seine Kreise, warf seinen Schatten auf sie.
Die Soldaten sprangen von den Pferden, stürzten auf das Wasser zu, johlten lustvoll, als es ihre trockenen Kehlen nässte. Wahrscheinlich wuschen sie sich ihre blutigen Hände darin. Es musste viel Blut sein. Sie hatten so viele getötet.
Die Soldaten waren am helllichten Tag in der Mission eingefallen, als die junge Frau und ihre Familie gerade beim Essen zusammengesessen waren. Ihre Mahlzeit war wie immer einfach, aber reichlich ausgefallen: Es hatte gekochte Bohnen und Kichererbsen gegeben, flache, noch heiße und krosse Fladen sowie Nüsse der Pinienbäume, die die Größe von Datteln hatten.
Sie leckte sich über die trockenen Lippen und schluchzte auf, als sie daran dachte, dass es für alle, mit denen sie gegessen hatte, die letzte Mahlzeit gewesen war.
Ihre Großmutter war tot.
Ihr Vater auch.
Die Soldaten, die wie aus dem Nichts gekommen waren, hatten die ganze Mission ausgerottet. Sie hatte als Einzige überlebt.
Die Soldaten stapften knietief ins Wasser, spritzten sich lachend nass.
Sie hielt den Atem an, während sie sie beobachtete, und umkrampfte den Ast so fest, dass sich die Rinde in ihre Handinnenfläche bohrte. Doch der Schmerz war so nichtig – gemessen an ihrer Todesangst. Ja, sie hatte Todesangst. Sie wusste nicht mehr, wie sie hieß, sie wusste nicht, wie sie ohne ihre Familie in einer grausamen Welt bestehen sollte, in der Soldaten wahllos mordeten. Aber sie wusste, dass sie leben wollte.
Irgendwann hatten die Soldaten ihren größten Durst gelöscht und sich ausreichend gewaschen, doch sie machten nach wie vor keine Anstalten, wieder auf ihre Pferde zu steigen und weiterzureiten. Einer der Männer schichtete Steine und Holz aufeinander, um ein Lagerfeuer zu entzünden, ein anderer spießte etwas auf seinen Säbel auf und hielt es über die Flammen. Aus der Ferne sah es aus wie Trockenfleisch.
Die junge Frau würgte. So viele Menschen hatten diese Soldaten heute getötet – und trotzdem war ihnen der Appetit nicht abhandengekommen. Trotzdem konnten sie lachen. Ja, sie lachten laut und aus vollem Halse.
Zunächst verstand sie nicht, was sie derart amüsierte. Später – die Rinde hatte sich so tief in ihre Hand gebohrt, dass Blut den Baumstamm herunterperlte – trug der Wind einige Sätze zu ihr. Sie lauschte erschaudernd – und fassungslos. Denn es waren ausgerechnet ihre heutigen Opfer, über die sie grölend spotteten.
»Habt ihr den dummen Pfaffen gesehen?«, rief einer. »Er hat sich tatsächlich vor die Wilden gestellt, um sie zu schützen!« Er klopfte sich vor Belustigung auf die Schenkel, ein anderer dagegen schüttelte den Kopf. »Was für ein Narr muss er gewesen sein, dass er sein Leben für ein paar Rothäute hergab«, meinte er verächtlich.
Die Frau schluckte schwer. Die Menschen, die der Soldat verächtlich Rothäute nannte, waren sie selbst, ihre Familie, ihr ganzer Stamm. Und der Pfaffe war niemand anderer als Bruder Franz.
Tränen stiegen auf, als sie sich erinnerte, wie er gestorben war. Er war als Erster dieser Meute zum Opfer gefallen. Furchtlos hatte er sich den Soldaten entgegengestellt und das Kreuz hochgehalten, das er ansonsten über seiner Brust trug. Es hatte ihm keinen Schutz geboten. Gewehrsalven hatten ihn niedergemäht, hatten diesem langen, abenteuerlichen Leben so schnell und blutig und unbarmherzig ein Ende gesetzt. Im Jahr 1848 war Pater Franz mit den ersten Kapuzinern nach Chile gekommen, um die Mapuche zu evangelisieren – nicht aufdringlich oder gar gewalttätig wie andere Priester, sondern behutsam und freundlich. Nach und nach hatte er das Gespräch mit den Kaziken, den Stammesoberen, gesucht, hatte sich den Sitten der Mapuche angepasst, hatte mit ihnen nicht nur Lebenserfahrung, sondern auch Essen und Kleidung getauscht – und hatte irgendwann vorsichtig Freundschaft geschlossen. Er hatte bei ihnen gewohnt, seine Mission gegründet – und hatte nun sterben müssen wie ein wildes Tier.
Die junge Frau biss sich auf die Lippen, um nicht laut aufzuschluchzen. Tonlos formten ihre Lippen seinen Namen, und sie sprach eines seiner Gebete, die er sie gelehrt hatte.
Er hatte gewusst, dass Gefahr drohte, hatte mehrfach sorgenvoll erwähnt, dass die chilenische Regierung darauf aus war, Araukanien zu unterwerfen – das Gebiet der Mapuche, der Ureinwohner Chiles. Doch es war für ihn undenkbar gewesen, sich selbst in Sicherheit zu bringen und seine Mission im Stich zu lassen.
»Wie kann man sich nur einbilden, man könne die Wilden bekehren?«, spottete nun einer der Soldaten. »Man kann auch Tiere nicht taufen, warum also Rothäute?«
»Unmöglich, sie zu zivilisieren«, pflichtete ihm ein zweiter bei. »Bockig sind sie ... ungebildet ...«
Die Frau biss sich noch fester auf die Lippen. Sie sollte bockig sein, ungebildet?
Aber sie konnte doch schreiben und lesen! Und sie konnte Farben herstellen und Stoffe weben – noch nicht so gut wie ihre Großmutter, aber doch schon sehr geschickt.
»Ich habe mal von einem Pfaffen gehört«, grölte der Soldat weiter, »der tatsächlich glaubte, man müsse einem Wilden nur eine lateinische Bibel in die Hand drücken – und prompt sei der bekehrt.«
Die letzten Worte gingen in Gelächter unter.
Die junge Frau schüttelte den Kopf. Pater Franz hätte nie auf so plumpe Maßnahmen zurückgegriffen. Er hatte sich nicht aufgedrängt, aber er hatte seinen Mapuche-Freunden immer wieder vom wahren Gott und seinem Sohn Jesus Christus erzählt. Noch vor ihrer Geburt hatte sich der ganze Stamm taufen lassen – zwei Männer ausgenommen, die sich dagegen wehrten, von der Vielweiberei abzulassen. Später übernahmen deren Söhne – stolz und wortkarg beide – die Sitte ihrer Väter, wenngleich sie zumindest in einem auf den Rat von Pater Franz hörten: Anders als üblich übernahmen sie nicht die Frauen ihrer Väter, sondern suchten sich neue. Diese Männer gingen sonntags nie zur Kirche, die Pater Franz eigenhändig gebaut hatte, und beteten nicht vor dem Essen, wie Pater Franz es sie gelehrt hatte. Für sie selbst, ihre Großmutter und ihren Vater Quidel hingegen war es so selbstverständlich gewesen.
Nein, sie waren keine unzivilisierten, dummen, bockigen Wilden! Sie waren Christen – und rechtschaffene Händler! Aber die Soldaten sahen das offenbar anders.
»Sie sind doch selbst schuld, dass es ihnen jetzt an den Kragen geht!«, rief einer. »Über Jahre haben ihre Häuptlinge alle Gesetzesbrecher Chiles aufgenommen und bei sich leben lassen. Sie haben doch nicht ernsthaft gedacht, sie könnten damit durchkommen.«
»Seit wann können Rothäute denken?«, gab ein anderer grinsend zurück.
Und wieder ein anderer meinte: »Seid froh, dass wir einen Grund hatten, die Grenzposten zu überschreiten. Eins sage ich euch – heute und hier: Mit den Rothäuten ist’s nun endgültig vorbei. Vielleicht können sich ein paar verkriechen, aber ein eigenes Land werden sie nie wieder haben.«
Und abermals folgte Gelächter, das der jungen Frau schier die Ohren zerriss. Schläge ins Gesicht hätten nicht schmerzhafter sein können als dieser Laut.
Irgendwann ebbte er ab, die Stimmen wurden leiser. Bis eben hatte sie völlig starr gehockt, nun lockerte sie den Griff etwas. Ihre Hände fühlten sich taub an, die Lippen, auf die sie sich gebissen hatte, ebenso. Auch die Furcht, von den Soldaten entdeckt zu werden, fiel von ihr ab: Die Dunkelheit senkte sich schnell wie immer über das Land, und die Schatten der Berge fielen als Erstes auf den Baum, auf dem sie hockte. Niemand würde sie noch hier oben entdecken können. Ob es jedoch auch sicher genug war, nach unten zu klettern und weiterzulaufen – dessen war sie sich nicht so sicher. Sie entschied zu warten, bis der Himmel kohlschwarz war.
Die Stimmen waren nun endgültig verstummt. Einige der Soldaten brieten immer noch Fleisch über dem Feuer, andere wärmten ihre Hände über den Flammen, manche hatten sich auf den bloßen Boden gelegt und schnarchten.
Bis zu diesem Moment hatte sich die junge Frau nach nichts anderem gesehnt, als dass sie nicht mehr lachten und spotteten – doch die Stille, die folgte, war noch qualvoller.
Mit der Stille kamen die Erinnerungen. Daran, wie sie heute Morgen neben ihrer Großmutter in der Ruca gesessen war. Daran, wie diese Körner gestampft hatte, um später daraus Farben anzurühren. Auch an die üblichen Geräusche der Mission erinnerte sie sich: das Gackern der Hühner, die Stimmen der Kinder, die von Pater Franz unterrichtet wurden und gerade das Alphabet aufsagten, das Plaudern der Frauen, die in den kleinen Gärten etwas pflanzten oder ernteten oder Unkraut rupften, das Murmeln der älteren Männer, die über frühere Zeiten sprachen und Chica oder Muday tranken. Jeder tat, was ihm zu tun bestimmt war – ohne unnötige Hast und Übertreibung, ohne Ahnung auch, dass Gefahr in der Luft lag.
Gewiss, in den letzten Wochen hatten sich Geschichten herumgesprochen, die von niedergemetzelten Männern, ermordeten Kleinkindern, vergewaltigten Frauen kündeten, aber sie hatten nur davon gehört, es nicht gesehen und deswegen nicht recht glauben wollen – desgleichen nicht, dass die wenigen, die überlebten, später an Hunger starben, weil ihre Ernte vernichtet war. Und selbst wenn es wahr war – es trug sich in einer anderen Welt zu, die nichts mit ihnen zu tun hatte. Die junge Frau erinnerte sich daran, laut gelacht zu haben, als Pater Franz einen chilenischen General – Saarvedra war sein Name – als Teufel beschimpfte.
Der Teufel machte ihr keine Angst. Pater Franz behauptete, er trüge einen Ziegenschwanz und stinke nach Schwefel, doch sie wusste nicht, wie Schwefel roch. Das wusste sie auch heute noch nicht, obwohl sie in die Fratze von nicht nur einem, sondern so vieler Teufel geblickt hatte – aber sie wusste nun, wie das Pulver von Gewehren, wie Blut und Gewalt und Tod rochen.
Die Soldaten hatten die Männer erschossen, die Rucas angezündet, die Tiere erstochen, die Frauen geschändet. Eine der Frauen hatte sich gewehrt und hatte es irgendwie geschafft, ein Messer an sich zu bringen, doch anstatt damit auf einen der Soldaten loszugehen, hatte sie sich darauf fallen lassen und war wortlos und mit weit aufgerissenen Augen verblutet. Ähnlich starr und gebrochen war der Blick ihrer Großmutter auf sie gerichtet gewesen. Die junge Frau wusste nicht, würde es vielleicht nie wissen, woran diese gestorben war: ob am Schrecken, ob von Schüssen getroffen oder einem Säbel niedergestreckt oder ob durch eigene Hand. Sie wusste nur, dass die Großmutter nach dem Vater der wichtigste Mensch in ihrem Leben gewesen war. Sie hatte sie nach dem frühen Tod der Mutter großgezogen und ihr beigebracht, Stoffe zu fertigen.
Doch anstatt um sie trauern zu können, hatte sie zusehen müssen, wie auch der Kazike starb – der Stammesführer, dem stets so viel an prächtiger Kleidung gelegen war. Groß war er, korpulent und mächtig stolz auf sein weißes Hemd, sein buntes Stirnband, das – so spottete Pater Franz häufig – dem eines Schotten glich, und den Lederstiefeln, die aus noch warmer Haut gemacht worden waren. Nach dem Angriff der Soldaten war das Hemd des Kaziken nicht länger weiß gewesen und die Schuhe nicht länger hellbraun, sondern beides rot, blutrot.
Blut quoll auch aus der Brust des Vaters – des freundlichen, stillen Vaters, der oft unterwegs war, um Handel zu treiben, und der so viele Sprachen kannte, auch die der Soldaten. Er hatte noch versucht, auf sie einzureden, war jedoch erbarmungslos von Schüssen durchsiebt worden.
»Vater!«, hatte sie geschrien. »Vater!« Sie war zu ihm gerobbt, zutiefst verwundert, dass sie überhaupt noch lebte.
Er rührte sich nicht, doch sein Blick war noch nicht so leer und starr wie der der Toten. Sie hörte, dass er etwas zu ihr sagte – und auch jetzt hallten diese Worte in ihren Ohren wider.
»Du musst weiterleben! Flieh! Du weißt, wohin du gehen musst.«
Der Boden hatte unter den Hufen vibriert. Sie hatte ihren Kopf auf die blutige Brust des Vaters gelegt und sich tot gestellt. Ein Soldat war an ihr vorbeigeritten, ohne sie zu beachten, und als sie den Kopf vorsichtig wieder angehoben hatte, hatte ihr Vater nicht mehr geatmet. Das Geschrei war langsam verebbt, die Kampfgeräusche erstorben, und sie war Richtung Wald gekrochen. Im Schatten der Bäume war sie aufgestanden und hatte zu laufen begonnen.
Du musst weiterleben! Flieh! Du weißt, wohin du gehen musst!
Immer schneller war sie gerannt, immer weiter von der Mission fort, durch Wälder, wo Araukarien und Winterrinden dicht nebeneinanderstanden – eigentlich die heiligen Bäume der Mapuche. Für sie waren sie nicht mehr heilig. Nichts konnte heilig sein für jemanden, der seinen Namen nicht mehr wusste, der alles verloren hatte.
In ihrem Herzen war es so schwarz wie nun der Himmel. Ja, es war Nacht geworden, fast alle Soldaten schnarchten schon. Sie ließ den Ast los, klammerte sich stattdessen an den Baumstamm und kletterte langsam nach unten. In der Finsternis sah sie nicht recht, worauf sie stieg, und als sie auf den Boden sprang, ertönte ein Knacken. Etwas Hartes rammte sich in ihre Fußsohle, sie stolperte, fiel, krachte gegen den Baum. Die harte Rinde zerkratzte ihr Gesicht, sie schmeckte salziges Blut.
»Habt ihr das auch gehört?«, vernahm sie nicht weit von sich die Stimme eines Soldaten.
Im fahlen Schein des Lagerfeuers erhoben sich einige Köpfe. Sie wusste, dass sie geduckt bei den Bäumen stehen bleiben sollte, den Atem anhalten, keinen Mucks machen – und darauf hoffen, dass die Männer das Knacken auf ein wildes Tier schoben. Doch sie konnte nicht reglos stehen, konnte nicht geduldig warten. Sie musste rennen, rennen, rennen. Immer weiter. Immer schneller.
Sie hörte nicht, ob die Soldaten ihr nachkamen, sie hörte nur die Stimme ihres Vaters.
Du weißt, wohin du gehen musst.
Ja, sie wusste es. Sie wusste nicht, wie sie hieß, wie sie mit all dem fertig werden sollte, aber sie wusste, dass sie überleben wollte – und welchen Zufluchtsort er gemeint hatte: die Siedlung am Llanquihue-See. Die Siedlung der Deutschen, die seine Freunde gewesen waren.
Sie rannte und rannte. Nun hörte sie doch etwas – Pferdegetrampel nämlich, Rufe der Soldaten, Schüsse, die durch die Nacht hallten.
Sie trafen sie nicht. Die Pferde waren zwar schneller als sie, aber das Land ihr ungleich vertrauter. Immer wieder versteckte sie sich hinter Bäumen oder im Gebüsch, watete durch Flüsse oder schlug Haken durch tiefes Dickicht. Sie schüttelte ihre Verfolger nicht ab und glaubte schon, an den Schmerzen in all ihren Gliedern umzukommen. Aber irgendwie ging es immer weiter, und als nach einer langen, erschöpfenden Nacht der Morgen graute, war sie nach wie vor am Leben.
2. Kapitel
Emilia Suckow streckte ihr Gesicht in die Sonne und ließ sich von ihren Strahlen necken. Es war der erste warme Frühlingstag in diesem Jahr, und auch wenn die Winter am Llanquihue-See nie wirklich beißend kalt waren, war es nach dem vielen Regen, unter dessen grauem Schleier das Land seine Farben verloren hatte, eine Wohltat, dieses kraftvolle Erwachen der Natur zu erleben. Strahlend blau war der Himmel, und die Vulkane auf der anderen Seite des Sees glitzerten in ihrem weißen Gewand. Emilia sah sich um, aber da niemand sie beobachtete, zögerte sie das Ende ihrer Pause noch ein wenig hinaus. Die Arbeit ging hier ohnehin nie aus, warum sie nicht einmal warten lassen und den Frühling genießen?
In jedem Winter ihres Lebens hatte sie sich nach Sonne und Wärme gesehnt – doch in diesem Jahr hatte sie noch ungeduldiger als sonst auf den Frühling gewartet. Denn in diesem Frühling würde sie heiraten.
Sie lächelte, wenn sie an das große Fest dachte, und es wurde ihr gleich noch wärmer, diesmal nicht wegen der Sonne, sondern vor Glück.
Seit sie denken konnte, hatte sie zwei große Wünsche gehegt: Sie wollte ihren Freund aus Kindertagen, Manuel Steiner, heiraten. Und sie wollte einmal in ihrem Leben nach Deutschland reisen.
Deutschland, das war die Heimat ihrer Eltern, die diese vor einigen Jahrzehnten verlassen hatten. Der Traum vom eigenen Land hatte sie nach Chile gelockt und sie die gefährliche Reise über zwei Ozeane ebenso überstehen lassen wie die harten Anfangsjahre, da sie den Urwald eigenhändig hatten abholzen müssen, um später Felder zu beackern und Rinder zu züchten. Bis vor wenigen Monaten war Emilia das Leben am großen Llanquihue-See, wo eine Siedlung von europäischen Einwanderern an die nächste schloss, als ziemlich eintönig erschienen. Sie hatte sich ihre Zukunft in der einstigen Heimat der Eltern ausgemalt, wo es große Städte gab – Städte mit Kopfsteinpflaster anstelle nackter Erde, mit Frauen, die ihre Haare zu Löckchen drehten, anstatt zu strammen Zöpfen zu binden, und mit Männern in Fracks statt zerrissener Bauernkleidung. Städte also, in denen alles nobler und reicher war und nicht nach Kuhmist stank wie das Leben hier. Doch nachdem sie mit Manuel versucht hatte, dorthin aufzubrechen, sie schon in Valparaiso kläglich gescheitert waren und sie beinahe im Bordell gelandet war, hatte sie eines gelernt: dass manche Länder nur so lange bunt, schillernd und verheißungsvoll waren, wenn man sie sich in Gedanken ausmalte, nicht aber, wenn man sie bereiste. Das hieß: Vielleicht war Deutschland tatsächlich bunt, schillernd und verheißungsvoll, die Fahrt dorthin aber viel zu mühselig und gefährlich, als dass sie sie in Kauf nehmen wollte. Leichtfertig hatte sie darum diesen einen großen Wunsch aufgegeben, um sich ganz auf ein anderes Ziel zu konzentrieren – auf ihre Hochzeit mit Manuel, die von Tag zu Tag näher rückte. Sie lächelte, wenn sie an ihn dachte, und zugleich erwachten Sehnsucht und Wehmut.
Seit über einer Woche hatte sie ihren Verlobten nicht mehr gesehen, weil er wieder einmal aufgebrochen war, um in den umliegenden Siedlungen, Dörfern und Städten Handel zu treiben. Sie gab zwar vor, sich daran gewöhnt zu haben, aber insgeheim haderte Emilia damit, dass es ihn nie lange zu Hause hielt und dass ihn – auch nach dem gescheiterten Abenteuer in Valparaíso – die Fremde ebenso lockte wie die Aussicht, ein Geschäft abzuschließen, das ihn um ein paar Pesos reicher machen würde.
Immerhin war ihr das Leben an der Seite eines Händlers nicht fremd. Auch ihr Vater Cornelius Suckow war oft wochenlang nicht daheim, sondern reiste meist zwischen Valdivia und Valparaíso hin und her, um den Transport von Waren zu überwachen oder diese zu veräußern. Viel zu selten kam er zurück zu ihrer Siedlung, und als Emilia nun an ihn dachte, vermisste sie ihn genauso wie Manuel.
Allerdings – es gab noch so viel für die Hochzeit zu tun, und das würde sie fürs Erste von trübsinnigen Gedanken abhalten.
Emilia löste seufzend ihren Blick vom See und stapfte durch das sumpfige Gras. Wie immer im Frühjahr waren die schmalen Wege, die von Haus zu Haus führten, voller Schlamm, und sie musste darauf achtgeben, nicht auszurutschen. Als sie am Garten vorbeikam, den die ersten Siedlerfrauen einst angelegt hatten, hielt sie nach Blumen Ausschau, aus denen sie für ihre Hochzeit einen Haarkranz flechten konnte: Die Rosen würden erst viel später erblühen, aber die ersten Fuchsien und Veilchen reckten schon ihre Köpfchen in die Sonne. Mit einem grünen Kleid geschmückt, wenngleich noch fruchtlos, waren die Orangen-, Apfelsinen- und Pfirsichbäume; karg und verkümmert dagegen wirkten das Feigenbäumchen und der Strauch, wo im Sommer die Johannisbeeren wachsen würden. Verwaist war das Plätzchen, wo bis vor Kurzem der Myrtenbaum gestanden war: Er war für das letzte Weihnachtsfest gefällt worden, und man hatte ihn – wie es für die Deutschen in Chile zum Brauch geworden war – anstelle von Goldnüssen mit Blumen geschmückt.
Emilia sog den durchdringenden Geruch nach Erde und Blumen ein, dann wanderte ihr Blick Richtung Wald. Wenn die Blumen im Garten für den Haarkranz nicht reichten, würde sie sicherlich die eine oder andere wunderschöne Blüte in einer der Lichtungen finden.
Die Rodungsgrenze, die einst bis zum See gereicht hatte, war Jahr für Jahr weiter ins Landesinnere verschoben worden. Emilia konnte sich gar nicht recht vorstellen, wie die ersten Siedler die großen, schweren Araukarien gefällt hatten – mit einem lauten Krachen, wie erzählt wurde, das den Boden über Meilen hatte erzittern lassen. Kleinere Bäume hatten sie auch in den letzten Jahren geschlagen, und obwohl das Männerarbeit gewesen war, so hatte Emilia oft beim Entrinden helfen müssen – auch wenn sie immer versuchte, sich davor zu drücken.
Während sie gen Wald blickte, vermeinte sie, aus den Augenwinkeln plötzlich eine Bewegung wahrzunehmen. Sie fuhr herum, glaubte erst, es wäre eine Fliege, die ihren Kopf umsurrte, sah dann aber etwas Dunkles zwischen den Bäumen hervorkommen, mehr schwankend als gehend und aus der Entfernung kaum größer als ein Strich. Sie riss die Augen auf und starrte konzentriert darauf. Der Strich wurde breiter, doch sie konnte noch nicht erkennen, ob es ein Tier oder ein Mensch war, der nun aus dem Wald trat. Emilias Hand fuhr instinktiv an die Brust. Nicht oft kamen Fremde zur Siedlung – und schon gar nicht unangekündigt. Sollte sie fortlaufen und nach den anderen rufen oder besser selbst nachschauen, wer oder was da aus dem Wald kam?
Als die Gestalt größer wurde, erkannte sie eindeutig, dass sie auf zwei Füßen lief. Und die langen Haare – es waren doch Haare und kein Umhang? – deuteten darauf hin, dass es eine Frau war. Doch irgendetwas war an dieser Frau höchst merkwürdig. Schon vorher war sie mehr gehumpelt als gegangen, nun schwankte ihr Oberkörper so stark hin und her, als wäre sie betrunken.
Die Starre fiel von Emilia ab. Ohne darüber nachzudenken, lief sie auf die junge Frau zu und kämpfte sich durch das harte Colihuegras, das schmerzhaft in die Füße schnitt und blutige Kratzer hinterließ. Doch diese Kratzer waren nichts im Vergleich zu den Wunden, die diese fremde Frau zeichneten. Fast jedes Fleckchen Haut war von einem dunklen Schleier bedeckt – getrocknetem Blut.
Emilia schrie auf. Ob dieses panischen Lauts zuckte die Frau zusammen, blieb erstmals stehen und blickte sich um, als erwache sie aus einem bösen Traum. Nur mehr wenige Schritte trennten die beiden voneinander.
Emilia schlug die Hand vor den Mund, um einen neuerlichen Aufschrei zu dämpfen. Am schwarzen Haar und der braunen Haut erkannte sie, dass die junge Frau eine Mapuche sein musste. So frei von Runzeln ihr Gesicht war, war sie wohl in ihrem Alter. Dennoch sackte sie nun auf die Knie wie ein kraftloses, altes Weib. Emilia sah, dass nicht nur Gesicht, Hände und Leib mit Kratzern und Blut bedeckt waren, sondern auch die Fußsohlen. Das eine Auge war blau verschwollen, in den verfilzten Haaren hingen Blätter, Nadeln und Zweige.
»Gütiger Himmel! Was ist denn mit dir passiert?«
Der Blick der Frau traf sie, als sie sich über sie beugte, doch in den schwarzen Augen las sie weder Erleichterung, auf jemanden zu treffen, noch Furcht vor einer Fremden, sondern nur Leere.
Emilia wusste nicht, von welchem Schrecken dieser leere Blick kündete, dennoch krampfte sich ihr Herz zusammen. Sie hatte sich den Tod, so er denn menschliche Gestalt annehmen würde, immer als alten Mann gedacht – nun glaubte sie kurz, ihm in der Gestalt dieses Mädchens zu begegnen.
»Was ist passiert?«, fragte sie wieder.
Eigentlich erwartete sie keine Antwort – das Mädchen sah nicht so aus, als würde es sie verstehen oder als hätte es genügend Kraft, zu reden.
Doch plötzlich öffnete es den Mund.
»Bitte ... bitte ... hilf mir.«
Die Stimme war erschreckend leise, aber Emilia verstand die Worte. Obwohl das Mädchen nichts mit einer Deutschen gemein hatte, sprach es dennoch diese Sprache.
»Was ...«, setzte Emilia an und brach ab, als sie sah, wie der Oberkörper der Frau erneut heftig wankte. Ihre Hand schnellte zu der Schulter, um sie zu stützen, und kurz blieb sie stehen, um laut rasselnd ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen. Doch alsbald machte sie sich von Emilia los, sprang auf und stolperte auf blutigen Füßen weiter.
»Hinter ... mir ... her ... Bitte hilf mir ... schnell ...«
Emilia konnte sich keinen Reim auf die Worte machen, aber plötzlich ertönte Hufgetrampel. Es war ein vertrautes Geräusch, denn die Siedler besaßen einige Pferde, befremdend war jedoch, dass sich so viele Reiter – dem Vibrieren des Bodens nach mindestens ein Dutzend – auf einmal näherten.
Die Fremde war zusammengezuckt. Als sie die Augen aufriss, stand keine Leere mehr darin, sondern Angst, pure, blanke Todesangst.
»Soldaten«, presste sie mühsam hervor, »das sind Soldaten. Sie sind hinter mir her ... Sie wollen mich töten ...«
Ihre Stimme versagte, ihr Fuß blieb im Gras hängen, und sie drohte zu fallen. Rasch griff Emilia wieder nach ihrer Schulter, um sie zu stützen. Sie wusste nicht, was das alles zu bedeuten hatte – nur, dass die Frau in höchster Gefahr war und dass sie ihr helfen musste.
»Komm mit!«
Hastig zog sie die junge Frau in Richtung der Häuser. Jeder Schritt schien der Unglücklichen Qualen zu bereiten, denn sie keuchte herzerweichend. Dennoch begann sie nun zu laufen, und auch Emilia beschleunigte angstvoll ihre Schritte. Das Pferdegetrampel hinter ihrem Rücken kam indes immer näher.
»Schnell! Helft mir! So helft mir doch!«
Irgendwie hatte die beiden es geschafft, bis zum Haus zu rennen, doch auf der Schwelle war die junge Frau plötzlich auf die Knie gesunken. Trotz der Panik in ihren Augen – sie konnte nicht mehr weiter. Emilia versuchte, sie hochzuziehen, aber es gelang ihr nicht. Obwohl der Körper so schmächtig war, war er viel zu schwer für sie.
»So helft mir doch!«
Endlich kam ihr eine der Frauen, die hier in diesem Haus lebten, entgegengeeilt: Es war Annelie von Graberg, Manuels Großmutter und irgendwie auch die von Emilia. Sie waren zwar nicht blutsverwandt, aber Emilia hatte viele Stunden ihrer Kindheit im Haus der Grabergs und an Annelies Seite verbracht.
Wie so oft trug Annelie eine Kochschürze umgebunden. Man traf sie meistens vor dem Herd an – aber in diesen Tagen kochte sie noch mehr als sonst, galt es doch, verschiedene Gerichte auszuprobieren, die sie für Emilias Hochzeit zubereiten wollte.
»Gütiger Himmel!«, rief sie beim Anblick des geschundenen Mädchens entsetzt. »Was ist denn diesem armen Geschöpf zugestoßen? Wo kommt sie her?«
Mehl staubte von ihren Händen, als sie sie über dem Kopf zusammenschlug.
»Sie wird von Soldaten verfolgt!«, rief Emilia atemlos. »Wir müssen sie ins Haus bringen!«
Anstatt ihr zu helfen, wich Annelie zurück. In ihren Augen stand aufrichtiges Mitleid, aber die schlimmen Verletzungen des Mädchens stießen sie offenbar zu sehr ab, um beherzt zuzugreifen.
Eine andere tat es an ihrer statt – Barbara Glöckner, die, von den Schreien alarmiert, ebenfalls nach draußen geeilt kam. Barbara war eine Tirolerin aus dem Zillertal, deren Familie sich schon vor Jahrzehnten den deutschen Siedlern angeschlossen hatte, und sie war gerade damit beschäftigt gewesen, Emilias Hochzeitskleid zu nähen.
Beherzt packte sie das Mädchen unter dem einen Arm, indes Emilia den anderen ergriff, und wenig später hatten sie es mit vereinten Kräften in die Stube geschleppt – keinen Augenblick zu früh. Als Emilia sich umblickte, sah sie, wie die Reiter aus dem Wald kamen.
»Wir ... wir müssen sie irgendwo verstecken!«, rief Emilia. Annelie starrte erst fassungslos auf die Soldaten, die nun auf das Haus der Grabergs zugaloppierten, dann auf die verwundete Frau.
»Wer hat sie nur so zugerichtet?«, schrie sie auf. »Warum sind ihre Beine so blutig?«
»Sie scheint tagelang gelaufen zu sein«, meinte Barbara nachdenklich.
»Ihre Haut ist so dunkel«, stellte Annelie fest, »das ist eine Mapuche ...«
»Ganz gleich, wer sie ist, wir müssen ihr helfen!«, rief Emilia dazwischen. »Sie hat gesagt, dass die Soldaten sie töten wollen!«
Das Mädchen rührte sich nicht mehr – es war in tiefe Ohnmacht versunken. So hörte es auch nicht, wie die Männer von den Pferden sprangen, mit lauten Schritten aufs Haus zutraten, klopften.
Die anderen Frauen zuckten angstvoll zusammen.
»Was sollen wir nur tun?«, rief Annelie ein ums andere Mal. »Wenn wenigstens Lu und Leo da wären«, seufzte Barbara. Lu und Leo waren die älteren Brüder von Manuel und somit Emilias zukünftige Schwäger – stattliche Männer alle beide, die es auch mit einer Truppe von Soldaten aufnehmen würden. Doch wie so oft waren sie auf der Jagd, damit es bei der Hochzeit genügend Fleisch gab.
Emilia huschte zum Fenster und blickte nach draußen. Das Klopfen wurde lauter, einige der Soldaten riefen durcheinander. Obwohl in der Siedlung fast nur Deutsch gesprochen wurde, hatte Emilia ein wenig Spanisch gelernt – vor allem nach der missglückten Reise nach Valparaíso, auf der ihr nicht zuletzt die mangelnden Sprachkenntnisse fast zum Verhängnis geworden waren. Sie glaubte zu verstehen, dass die Männer auf eine Rothaut fluchten.
»Was sollen wir nur tun?«, rief Annelie wieder.
Barbara zuckte hilflos die Schultern. Das Mädchen rührte sich nicht. Das Pochen war mittlerweile so durchdringend, dass Emilia befürchtete, die Tür würde brechen.
Da ertönte hinter ihnen eine Stimme.
»Wollt ihr nicht aufmachen?«, fragte Christine Steiner ungeduldig, Manuels Großmutter väterlicherseits und eine der ersten deutschen Siedlerinnen am Llanquihue-See – aufgrund ihrer Lebensleistung respektiert, aufgrund ihrer Strenge gefürchtet.
»Sie dürfen das Mädchen doch nicht finden!«, sagte Emilia verzweifelt. »Sie wollen sie töten.«
Christine hatte eben noch hinter dem Webstuhl gesessen. Nun schob sie ihn beiseite und erhob sich mit unterdrücktem Ächzen. Ihr weißes Haar löste sich wegen der abrupten Bewegung aus dem Knoten im Nacken und wehte im Luftzug wie Spinnweben. Ohne Fragen zu stellen, befahl sie resolut: »Barbara, Annelie! Ihr versteckt das Mädchen oben in der Stube! Und du, Emilia, du kommst mit mir raus. Du musst übersetzen. Und gib mir meinen Stock!«
Die Frauen folgten dem Befehl augenblicklich. Emilia fand den Stock nicht sofort, sondern stolperte in der Aufregung fast über den Webstuhl. Christine seufzte ungeduldig, das Pochen wurde noch lauter, dann war der Stock endlich gefunden, und Emilia reichte ihn der alten Frau.
Annelie und Barbara hatten das Mädchen mittlerweile nach oben gebracht, doch Emilia war sich sicher: Wenn die Soldaten sich gewaltsamen Einlass verschafften, würden sie es dort sofort finden. Das Herz klopfte ihr bis zum Hals, und ihre Hände wurden schweißnass, als sie an Christines Seite den Soldaten entgegentrat.
Als die Tür abrupt geöffnet wurde, stürmten die Soldaten nicht ins Haus, wie Emilia insgeheim befürchtet hatte, sondern wichen zurück. Für einen Moment blendete sie die Sonne so stark, dass sie nichts als dunkle Schemen sah. Sie presste die Augen zusammen, ganz anders als Christine, die ihren Blick über die Männer schweifen ließ – oder zumindest so tat. Eigentlich war Christine Steiner halb blind und konnte schon seit Monaten nicht mehr ihrer liebsten Beschäftigung nachgehen – Sinnsprüche auf Kopfkissen zu sticken –, aber vor den Männern wollte sie keine Schwäche zeigen.
»Was ist das für ein Lärm?«, fuhr sie die Soldaten an und gab Emilia ein Zeichen, dass sie ihre Worte ins Spanische übersetzen sollte, was diese hastig tat. Noch ehe einer der Soldaten etwas entgegnen konnte, fügte sie harsch hinzu: »Tüchtige Männer arbeiten zu dieser Tageszeit auf dem Feld und brüllen nicht herum.«
Wie so oft schlug sie einen tadelnden Tonfall an. Christine Steiner war eine rechtschaffene Frau, und sie hielt viel auf Anstand und Sitten, sonderlich freundlich aber war sie nie gewesen. Vor allem, wenn sie über frühere Zeiten sprach, klang sie nörgelnd. Damals hätten sie zwar mehr Hunger gelitten, so behauptete sie immer wieder aufs Neue, dennoch sei alles besser gewesen. Ein jeder hätte gewusst, wo sein Platz wäre und was er zu tun hätte. Viel zu verwöhnt waren die Jungen heutzutage, viel zu undankbar und faul.
»Also«, fuhr Christine die Männer an, »was wollt ihr hier?« Während Emilia auch diese Frage übersetzte, schob sich eine Wolke vor die Sonne, und sie konnte die Soldaten erstmals genauer betrachten. Sie waren allesamt mit Säbeln bewaffnet, zwei von ihnen auch mit Gewehren. Die Uniformen waren zerrissen und fleckig, doch sie wollte lieber nicht ergründen, woher die Flecken stammten: ob nur von Erde und Schlamm oder von Blut. In jedem Fall sahen sie furchterregend aus mit den gegerbten Gesichtern, den breiten Schultern, den rohen Händen. Kein Wunder, dass das Mapuche-Mädchen solche Angst vor ihnen hatte. Menschlich wirkte einzig, dass zumindest einige von ihnen verlegen den Blick vor der alten Frau niederschlugen.
»Wir sind Soldaten«, erklärte schließlich einer, obwohl das angesichts der Uniformen nicht notwendig gewesen wäre. »Wir sind von der Regierung beauftragt, das Land der aufrührerischen Rothäute zu besetzen.«
Noch bevor Emilia den Satz zu Ende übersetzen konnte, unterbrach Christine sie bereits schroff: »Und was wollt ihr dann hier?«, herrschte sie die Männer an. »Hier am See leben nur deutschstämmige Chilenen. Euer Vaterland ist längst das unsere geworden, und wir dienen ihm genauso gut wie ihr.« Der Soldat runzelte die Stirn – es war nicht klar, ob als Ausdruck von Ärger oder von Unsicherheit: »Das glauben wir gerne, gute Frau. Aber wir haben Anlass zur Vermutung, dass sich hier eine der aufständischen Rothäute versteckt.«
Emilia unterdrückte ein Schaudern. Vorhin, als das Mädchen von den Soldaten gesprochen hatte, die es töten wollten, war ihr nicht recht klar gewesen, was hier vor sich ging. Nun begriff sie langsam.
Es wurde am See nicht oft darüber geredet, aber die Gerüchte waren auch bis zu ihnen gedrungen: Gerüchte darüber, dass die Regierung beschlossen hatte, das Gebiet der Ureinwohner Chiles zu erobern. Araukanien nannten diese selbst es – Indianerland die Soldaten. Offiziell war nur die Rede davon, das wilde Volk zu unterwerfen, doch hinter vorgehaltener Hand war auch von blutigen Massakern die Rede, bei denen ganze Stämme ausgerottet wurden.
Christines Gesicht blieb ausdruckslos. »Wie ich schon sagte«, erklärte sie ohne auch nur das geringste Zeichen von Verunsicherung, »hier leben keine Rothäute, sondern deutsche Siedler. Die Regierung, die euch beauftragt hat, Araukanien zu besetzen, hat uns dieses Land einst geschenkt. Wir haben es gerodet, wir haben hier Getreide angebaut, also sind wir es auch, die bestimmen, was hier passiert. Ihr habt hier nichts verloren. Also geht! Verschwindet!«
Emilia wagte kaum, die letzten Worte zu übersetzen, und fügte zur Sicherheit ein flehentliches Bitte hinzu. Ob dieses nun den Soldaten, offenbar war er der Offizier der Truppe, gnädig stimmte oder Christines schroffer Befehl – in jedem Fall trat er mit unschlüssigem Gesicht zurück. Ein anderer jedoch war nicht bereit zu weichen. »Das Mädchen versteckt sich hier«, erklärte er zornig. »Ich habe es gesehen, wie es in Richtung eurer Siedlung lief.«
Diesmal gelang es Emilia nicht, den Schauder zu unterdrücken. Eiskalt rieselte es ihr über den Rücken. Wenn die Männer so beharrlich nach einem harmlosen Mädchen suchten, dann hatte das wohl nur einen Grund: Sie wollten die unliebsame Zeugin einer schrecklichen Bluttat ausschalten, damit diese die Gerüchte über die Massaker nicht bestätigen konnte.
Der Soldat, der vorgab, das Mädchen gesehen zu haben, schritt auf Christine zu, doch die wich keinen Jota. Sie schien keineswegs verängstigt, vielmehr verärgert, und das wohl weniger, wie Emilia insgeheim vermutete, weil das arme Mädchen, sondern vielmehr ihre Ruhe in Gefahr war. Christine misstraute grundsätzlich allen Fremden.
»Ach«, höhnte sie jetzt. »Ihr habt ein Mädchen gesehen! Und die Regierung Chiles beauftragt also ein Dutzend Männer, um einem solchen Mädchen nachzujagen? Ich sage euch etwas: Als wir Deutschen einst hierherkamen und das Land besiedelten, da war keiner da, um uns zu helfen. Damals hätte die Regierung ruhig ein paar Soldaten schicken können, aber stattdessen mussten wir jede Araukarie mühsam selbst fällen. Und wir mussten ganz alleine die Straßen bauen, die den See mit Puerto Montt verbanden. Mein guter Mann Jakob, Gott hab ihn selig, ist von den Ästen eines Baums fast erschlagen worden. Er hat zwar überlebt, konnte danach jedoch nie wieder laufen.«
Emilia hörte Jakob Steiners Namen nicht zum ersten Mal. Christine erzählte oft Geschichten aus der entbehrungsreichen Anfangszeit – sie waren faszinierend beim ersten Mal, ziemlich langweilig allerdings, wenn man schon um ihren Ausgang wusste und sie dennoch Wort für Wort wiederholt wurden.
»Das tut uns alles herzlich leid, gute Frau«, murrte der Offizier. »Aber das ändert nichts daran, dass sich das Mädchen hier irgendwo versteckt hat. Lasst uns vorbei, damit wir nach ihm suchen können.«
Wieder machte er einen Schritt auf Christine zu – wieder wich sie nicht zurück.
»Lasst uns ins Haus!«, forderte der Mann.
»Dieses Haus haben meine Söhne errichtet, nicht ihr. Und darum werdet ihr es nicht betreten.« Herausfordernd hob sie den Stock, auf den sie sich bis jetzt gestützt hatte. »Was ist? Wollt ihr euch gewaltsam Zutritt verschaffen? Hat euch die chilenische Regierung auch damit beauftragt, deutsche Frauen niederzuschlagen, die aus dieser Einöde hier ein fruchtbares Land gemacht haben? Unser Weizen wird bis nach Valparaíso verkauft und nährt dort die Menschen. Und das soll der Dank sein?«
Der Offizier runzelte die Stirn – auch der andere blickte nicht mehr ganz so kalt, sondern vielmehr beschämt. Der Rest wirkte der ganzen Sache überdrüssig. »Es ist doch nur ein Mädchen«, murmelte einer. »Es ist die Mühe nicht wert«, meinte ein anderer. Obwohl er nur raunte, verstand Emilia auch seine nächsten Worte: »Auch wenn es etwas erzählt – wer glaubt denn so einem jungen Ding?«
Stille senkte sich über sie. Man konnte förmlich sehen, wie es hinter der Stirn des jungen Offiziers arbeitete. Im Töten war er gewiss schneller als im Denken, durchfuhr es Emilia.
»Wie viel meiner kostbaren Zeit wollt ihr noch verschwenden?«, fragte Christine ungeduldig, die den Stock nun wieder sinken ließ, aber sich nicht mehr darauf stützte – als wäre sie noch eine junge, kräftige Frau, die den ganzen Tag auf dem Feld oder im Kuhstall stand.
»Die Rothäute sind gefährlich«, entgegnete der Offizier. »Ihre Überraschungsangriffe sind im ganzen Land gefürchtet.« Christine lachte spöttisch auf. »Sehe ich so aus, als hätte ich vor irgendetwas Angst? Pah! Dazu bin ich viel zu alt. Und vom Leben zu oft geprüft worden.«
»Trotzdem – es gibt viele Aufstände der Rothäute. Erst vor Kurzem haben sie Traiguén überfallen.«
Emilia musste sich mit aller Macht zusammenreißen, damit sie nicht empört den Kopf schüttelte. Der Angriff auf Traiguén, so hatte es ihr Vater erzählt, war kein Akt der Rebellion gewesen, sondern der verzweifelte Kampf ums Überleben – leider kein besonders aussichtsreicher: Die Stammesführer der Mapuche waren nicht mächtig wie einst und konnten die oftmals zerstrittenen Stämme nicht einen, was dringend notwendig gewesen wäre, um gegen die Chilenen Erfolg zu haben. Der Überfall auf Traiguén war folglich gescheitert und ihren Gegnern gerade recht gewesen, um noch grausamer zurückzuschlagen und der Freiheit Araukaniens endgültig ein Ende zu setzen.
Der Offizier starrte Christine missmutig an.
»Es ist eure Entscheidung, ob ihr unseren Schutz annehmt oder nicht.«
»Ich habe mich noch gegen jede Art von Gesindel zu wehren gewusst«, entgegnete Christine.
Emilia kannte das spanische Wort für Gesindel nicht und war darüber auch ganz froh. Christine Steiner ließ keinen Zweifel daran erkennen, dass sie auch diese Soldaten für solches hielt.
Wieder senkte sich ein Augenblick der Stille über sie – dann hob der Offizier die Hand. Kurz konnte Emilia nicht deuten, was er vorhatte, und fürchtete, dass er sich doch noch gewaltsam Zutritt ins Haus verschaffen würde. Aber stattdessen wandten sich die Soldaten ab und bestiegen die Pferde. Es dauerte gefühlte Ewigkeiten, bis sie endlich alle im Sattel saßen, doch immerhin weigerte sich keiner, dem Befehl des Offiziers zu folgen. Sie gaben den Pferden die Sporen und ritten davon, ohne sich noch einmal umzudrehen. Alsbald erinnerten nur mehr die Hufspuren in der schlammigen Erde, dass sie da gewesen waren.
Emilia zitterte am ganzen Leib, als sie zurück ins Haus eilten. Auch Christines Gesicht wirkte etwas bleicher und faltiger als sonst. Trotzdem sagte sie nichts, sondern setzte sich wieder stumm an den Webstuhl, als hätte sie mit dem Grund der Aufregung nichts zu schaffen.
Emilia stürzte hoch in den ersten Stock, wohin Annelie und Barbara das Mädchen gebracht hatten. Es lag in dem Bett, in dem Emilia ansonsten schlief. Barbara hatte sich an seiner Seite niedergelassen und strich ihm mit einem feuchten Tuch über das Gesicht.
»Keine Angst«, murmelte sie. »Hab doch keine Angst.« Offenbar hatte das Mädchen sein Bewusstsein wiedergefunden. Emilia trat näher, während sie rasch berichtete, dass die Soldaten fortgeritten waren. Das Gesicht der jungen Frau war nun sauberer als vorhin, doch umso deutlicher konnte man die Kratzer und die blutig gebissenen Lippen sehen. Zaghaft öffnete sie den Mund, formte einen Namen, tonlos erst, dann glaubte Emilia ihn zu verstehen.
Quidel.
Emilia riss die Augen auf. »Quidel, das ist doch ...«
»Das ist der Mapuche-Freund deines Vaters, nicht wahr?«, rief Annelie aufgeregt.
Während Annelie, Barbara und Emilia sich verdutzt anblickten, versuchte das Mapuche-Mädchen wieder, etwas zu sagen. Es sprach so leise, dass Emilia sich dicht über das Gesicht beugen musste, um es zu verstehen.
»Bitte ... bitte helft mir ...«
Emilia griff vorsichtig nach der Hand und drückte sie leicht. Die Finger waren eiskalt.
Ihr Vater Cornelius hatte oft von Quidel erzählt – einem Mapuche, mit dem er einst Freundschaft geschlossen hatte. Die beiden hatten sich vor vielen Jahren in Valdivia kennengelernt, als sie gemeinsam für den Straßenbau gearbeitet hatten. Später hatte Quidel eine Weile hier in der Siedlung am Llanquihue-See gelebt, ehe er zu seinem Stamm zurückgekehrt war.
»So alt, wie sie ist, muss sie Quidels Tochter sein«, stellte Annelie leise fest.
Der Mund des Mädchens schloss sich wieder, es presste die Augen zusammen. In dem übergroßen Bett wirkte es klein und hilflos – ein Anblick, der Emilia rührte.
Sie beugte sich noch dichter zu dem geschundenen Gesichtchen.
»Wir sind Freunde deines Vaters«, sagte sie rasch. »Wir kümmern uns um dich. Hab keine Angst mehr und ruh dich aus! Du bist hier in Sicherheit.«
3. Kapitel
Die Wärme tat so gut. Zunächst war es gar nicht wichtig, woher sie rührte. Die junge Mapuche-Frau genoss einfach nur das Wohlbehagen, als die Schmerzen in ihren Gliedern nachließen. Erst später bemerkte sie, dass das Bett, in dem sie lag, ein besonders weiches war. Kein Fell bedeckte es wie ihre Schlafstatt in der Ruca ihrer Großmutter, sondern Leinen, sauber und glatt.
Eine der Frauen hatte ihre blutigen Füße mit etwas eingerieben, das nach wilden Kräutern roch, und sie dann ebenfalls mit Leinen verbunden. Und man hatte ihr etwas zu essen gegeben. Sie hatte geglaubt, nie wieder etwas essen zu können, doch als ihr der Geruch von Eintopf aus Kartoffeln und zartem Lammfleisch in die Nase gestiegen war, hatte sich ihr Magen vor Hunger schmerzhaft verkrampft. Sie hatte die Bissen so schnell hinuntergewürgt, dass sie sie kaum kaute. Die Frauen hatten ihr daraufhin die Schüssel weggezogen und darauf bestanden, dass sie langsamer essen müsse, sonst würde ihr das Fleisch wie ein Stein im Magen liegen. Später hatte sie Brühe bekommen, kräftige, salzige Rinderbrühe.
Dann war sie eingeschlafen, traumlos und tief. Als sie am frühen Morgen erwachte und kurz nicht wusste, wo sie sich befand, kroch wieder Unbehagen in ihr hoch. Doch sie fühlte sich träge, viel zu träge, um den schrecklichen Erinnerungen ins Gesicht zu sehen. Weit über ihr schienen sie zu kreisen wie Raubvögel, doch sie waren nicht hungrig genug, um sich auf sie zu stürzen und auf sie einzuhacken. Sie blickte sich suchend um und erkannte, dass nicht weit von ihrem Bett die blonde Frau saß, der sie gestern als Erste begegnet war. Erst starrte diese sie sorgenvoll an, dann breitete sich Erleichterung in ihren Zügen aus. Offenbar bot sie nicht mehr den schrecklichen Anblick von gestern.
Schweigend maßen sie sich eine Weile. Die Mapuche-Frau wollte etwas sagen, doch ihre Kehle fühlte sich wie ausgedörrt an. Nur ein Stöhnen brachte sie zustande.
»Warte!«, rief die blonde Frau. Sie erhob sich, ging nach draußen und kam wenig später mit Essen wieder. Ja, schon wieder bekam sie etwas zu essen!
Diesmal war es dunkles, aus ganzen Körnern gebackenes Brot – außen knusprig, aber innen saftig weich. Butter schmolz darauf und troff über ihre Hände. Es tat weh, die Bissen durch die wunde Kehle zu würgen, trotzdem konnte sie sich abermals nicht beherrschen, langsam zu essen.
Als sie satt war, überkam sie plötzlich Angst – keine Angst vor den Erinnerungen, sondern davor, dass es nicht so bleiben würde. Dass man sie aus dem Bett werfen würde, weil sie eine Rothaut war. Dass sie nichts mehr zu essen bekommen würde.
Doch die blonde Frau blieb an ihrer Seite und lächelte sie überdies scheu an. Und auch die Frauen, die später immer wieder nach ihr sahen, wirkten freundlich. Sie redeten auf sie ein, und obwohl die Worte, die sie zu ihr sagten, sie nicht erreichten, spürte sie dennoch, dass es fürsorgliche waren. Anfangs waren es viele fremde Gesichter, die sie nicht unterscheiden konnte. Doch in den Tagen, die folgten und die sie weiterhin im Bett verbrachte, lernte sie die Namen kennen, die zu den Gesichtern gehörten.
Da gab es Annelie, die ihr die Mahlzeiten brachte, wenn es die blonde Frau nicht tat, und die glücklich lächelte, wenn sie hungrig aß. Manchmal kicherte sie – nicht aus Spott, wie die Mapuche-Frau zunächst befürchtet hatte, sondern aus Unsicherheit. Die ganz alte Frau, Christine mit Namen, stand oft mit gerunzelter Stirn daneben. Vor ihr hatte die Mapuche-Frau am meisten Angst, denn Christine lächelte nie. Aber auch sie schien nichts dagegen zu haben, dass sie zu essen bekam und in dem Bett liegen durfte. Die Frau mit den leuchtend braunen Augen und den Grübchen auf den Wangen hieß Barbara. Das Deutsch, das sie sprach, war am schwersten zu verstehen, es klang kehlig und rauh. Und dennoch war die Stimme von Barbara schön, insbesondere wenn sie sang. Und sie sang oft, auch dann, wenn sie ihre Wunden mit frischem Leinen verband.
Die meiste Zeit verbrachte die blonde Frau bei ihr, die Emilia hieß und wunderschöne blaue Augen hatte. Sie war viel jünger als die anderen, wahrscheinlich so alt wie sie, siebzehn oder achtzehn Jahre. Manchmal lächelte sie sie an. Manchmal redete sie auf sie ein. Warum sie denn nichts mehr sagen würde? Sie würde doch des Deutschen mächtig sein!
Die Mapuche-Frau wollte ihr so gerne den Gefallen tun, aber sie konnte nicht. Sie konnte das Essen schlucken, aber sie konnte keine Silbe hervorbringen und das Lächeln nicht erwidern. Sie konnte nur hoffen, dass die Erinnerungen nicht wiederkehrten. Und sie konnte beobachten. Anfangs hatte sie nur das Bett wahrgenommen, in dem sie lag. Später bestaunte sie die übrige Einrichtung des Zimmers, das ganz anders war als die vertraute Ruca, so viel heller und höher und größer. Vor den Fenstern hingen weiße Gardinen, gegenüber vom Bett befand sich ein Spiegel. Am faszinierendsten waren der eiserne Ofen und die Kommode.
»Die ist aus Mahagoni«, erklärte Emilia, die ihrem Blick gefolgt war. »Ein Zimmermann aus Valdivia hat sie gebaut. Sie war sehr teuer ...«
Die Mapuche-Frau hatte keine Ahnung, was Mahagoni war. Sie wusste nur, dass es dergleichen in der Ruca nicht gegeben hatte. Dort waren sie auf Fellen oder Leder am Boden gelegen oder gesessen. Kurz vermeinte sie, den erdigen Geruch zu schmecken, den die Großmutter ausgeströmt hatte, und prompt stiegen Tränen hoch – Tränen der Sehnsucht und der Trauer. Doch sie schluckte sie schnell wieder herunter. Sie ahnte, dass sie nicht wieder damit aufhören könnte, wenn sie erst einmal zu weinen begann.
Nicht nur die Einrichtung bestaunte die Mapuche-Frau, sondern auch die Kleidung, die die Frauen trugen. Am merkwürdigsten waren ihre Strümpfe und Schuhe – so etwas kannte sie nicht. Seit sie denken konnte, war sie immer barfuß gelaufen, zumindest im Frühling und Sommer. Nur im Winter, wenn der Boden zu kalt war, hatte sie manchmal lederne Stiefel angezogen. Doch diese Frauen gingen offenbar nie bloßfüßig. Sie erinnerte sich an Erzählungen ihres Vaters, wonach nur die vornehmsten Chileninnen Schuhe trugen. Nun, offenbar waren auch die deutschen Siedlerinnen sehr vornehm.
Als sie an den Vater dachte und an seine samtige Stimme, stiegen wieder Tränen auf – und wieder unterdrückte sie sie mit aller Macht. Sie war sich sicher, dass sie sterben würde, wenn sie sich den Erinnerungen hingab.
Für gewöhnlich versank sie in gnädiger Schwärze, wenn sie abends einschlief. Doch in der vierten Nacht wurde sie von bedrohlichen Träumen verfolgt. Soldaten tauchten darin auf, mit Säbeln und Gewehren, und plötzlich sah sie auch das weiße Hemd des Kaziken, wie es sich langsam rot färbte, sah ihren Vater, wie er reglos vor ihr gelegen war und ihr mit letzter Kraft befohlen hatte, zu fliehen.
Sie erwachte im Morgengrauen laut schreiend, und auch als sie die Augen aufschlug und sich im weichen Bett wiederfand, glaubte sie immer noch das Lachen der Soldaten zu hören, das Getrampel ihrer Pferde, die Schüsse ihrer Gewehre. Sie würden auch sie holen. Sie würden nicht zulassen, dass ihnen eine Rothaut entkommen war.
»Still!« Emilias Stimme drang durch das Grauen. »Sei still! Es ist alles gut! Ich bin doch da!«
Als sie in die gütigen blauen Augen blickte, verstummte sie kurz. Doch dann fiel ihr Blick auf den fremden Mann, der neben Emilia stand – ein großer, weißer Mann wie die Soldaten, die das Dorf überfallen hatten –, und sie schrie abermals auf.
»Besser, du gehst«, sagte Emilia zu ihm. »Dein Anblick macht ihr Angst, Manuel!«
Der Mann schüttelte verwirrt den Kopf. »Aber ich tue ihr doch gar nichts!«
»Allein dass du hier bist, ist für sie unerträglich.«
»Was kann ich denn dafür, dass ich nach meiner Handelsreise wieder nach Hause gekommen bin?«
»Halte dich einfach von ihr fern! Sie hat gewiss Schlimmes durchgemacht. Sie braucht noch Zeit ...«
Der Mann mit dem Namen Manuel schüttelte weiterhin den Kopf. Aber schließlich fügte er sich Emilias Worten und verließ den Raum.
Die Mapuche-Frau hörte zu schreien auf. Die Bilder aus dem bösen Traum verblassten. Sie war in Sicherheit. Niemand würde ihr etwas antun. Sie lag in einem warmen Bett, und es gab diese Frauen, die sich um sie kümmerten.
Später ließ sich Emilia auf einem Stuhl neben ihrem Bett nieder. Der Stuhl sah sehr merkwürdig aus – bis jetzt hatte sie ihn gar nicht bemerkt. Er stand nicht auf vier Beinen, sondern auf einem gebogenen Stück Holz, und Emilia wippte leicht vor und zurück.
»Das ist ein Schaukelstuhl«, erklärte sie, als sie ihren verwunderten Blick bemerkte.
Die Mapuche-Frau senkte die Augen. Sie erwartete, dass Emilia sie wieder bestürmen würde zu reden. Doch stattdessen hatte sie heute etwas anderes vor. Sie hielt ein Buch in den Händen – ein Buch, wie auch Bruder Franz so viele besessen hatte –, und dieses schlug sie nun auf.
»Ich dachte, ich könnte dir etwas vorlesen«, sagte Emilia. »Wir haben alle lesen gelernt. Von Jule. Das ist eine der ersten deutschen Siedlerinnen gewesen, die sich hier niedergelassen haben. Jule war eine ganz ungewöhnliche Frau. Sie hatte keinen Mann und keine Kinder, sondern lebte ganz alleine, und sie sagte immer, dass ihr das am liebsten wäre und dass sie niemanden bräuchte. Sie hat sehr viel von Medizin verstanden, und wenn jemand krank war, ist er damit immer zu ihr gegangen. Leider ist sie vor einiger Zeit gestorben, und seitdem kümmert sich Barbara um die Kranken. Sie hat viel von Jule gelernt, aber so viel wie Jule weiß sie nicht. Jule war eine strenge Lehrerin. Wehe, wenn wir zu langsam lernten! Aber vielleicht war das gut so, denn so können wir alle lesen. Die Bücher sind im Übrigen aus Valdivia. Annelie fährt regelmäßig dorthin und kauft sie. Als Jule noch lebte, hat sie eine Bibliothek gegründet, und heute wacht Annelie darüber. Wir besitzen mittlerweile viele Bücher. Das hier, das heißt Fünfzig Fabeln für Kinder von D. Speckter. Wir haben auch Märchenbücher. Von den Gebrüdern Grimm und von Wilhelm Hauff. Und Liederbücher von Reinick. Ich könnte dir auch Arabesken vorlesen. Oder Robinson der Jüngere von Campe, das ist eine sehr spannende Geschichte.«
Sie sprach ohne Pause und schien sich gar nicht darum zu kümmern, ob die Mapuche-Frau ihr zuhörte und sie verstand. Doch genau das führte dazu, dass diese sich deutlich entspannte.
Gut ... es war alles gut. Emilia würde nicht zulassen, dass ihr Böses geschah. Sie war in Sicherheit.
Als Emilia aus dem Buch vorzulesen begann, konnte die Mapuche-Frau auch an den jungen Mann denken, den Mann, der Manuel hieß, ohne vor Angst zu erschaudern. Er war zwar so groß wie die Soldaten, und seine Schultern waren ebenso breit. Aber er hatte nicht so böse gelacht wie sie. Eigentlich war er sogar ziemlich gut aussehend, mit diesen braunen Augen und den rötlich braunen Locken. Wie alt er wohl war? So alt wie sie und Emilia?
Während Emilia weiter vorlas, dachte sie an die Männer ihres Stammes, Männer mit langen, glänzenden Haaren und kohlschwarzen Augen, Männer, die ihr Gesicht mit der Farbe bemalten, die ihre Großmutter hergestellt hatte. Es hätte nicht mehr lange gedauert, dann wäre sie die Frau von solch einem Mann geworden. Sowohl ihre Großmutter als auch ihr Vater hatten befunden, dass sie nun alt genug dafür wäre.
Aber daran wollte sie nicht denken. Daran durfte sie nicht denken. Nicht an ihren Vater, nicht an ihre Großmutter, nicht an Bruder Franz. Sie würde weinen, wenn sie daran dachte, und sterben, wenn sie zu lange weinte.
Emilia hörte zu lesen auf und ließ das Buch sinken. »Was hast du denn?«, fragte sie.
Hatte sie etwa aufgeschluchzt?
»Nicht aufhören!«, schrie die Mapuche-Frau panisch und ohne darüber nachzudenken, was sie da sagte. »Hör nicht auf zu lesen!«
Emilia riss verwundert die Augen auf. »Du sprichst ja endlich wieder. Und du kannst sogar sehr gut Deutsch!«