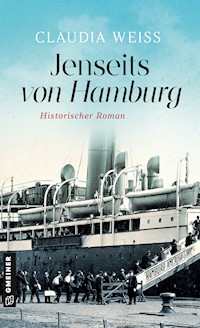
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Im Sommer 1906 sind die Hamburger Auswandererhallen überfüllt. Eine Woche müssen die Menschen hier ausharren und alle Formalitäten für die Auswanderung in die USA erledigen, bevor sie auf die großen Ozeandampfer zur Weiterreise dürfen. Hier kreuzen sich die Wege von Ljuba und ihrer Tochter Dascha mit anderen Reisenden. Ihre Geschichten, Träume und Ängste verweben sich, und kaum einer geht, wie er kam. Doch letztlich ist alles gut, wie es ist. Auch wenn nichts so ist, wie es zunächst scheint.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claudia Weiss
Jenseits von Hamburg
Historischer Roman
Zum Buch
Zwischen Hoffnung und Zweifel Jenseits von Hamburg liegt die Auswandererstadt auf der Elbinsel Veddel. Im heißen Sommer 1906 müssen hier jede Woche Tausende Menschen für sieben Tage ausharren, sich auf ansteckende Krankheiten untersuchen lassen, sowie sämtliche Formalitäten erledigen, die für die Auswanderung nach Amerika nötig sind. Erst dann dürfen sie auf einen der großen Überseedampfer im Hafen. Ljuba wartet zusammen mit ihrer Tochter Dascha auf die Weiterfahrt. Sie fühlt sich dauernd verfolgt. Doch was verfolgt sie wirklich? Dascha hofft auf ein freies Leben. Doch was bedeutet frei? Die beiden Brüder David und Mashel träumen von einer anderen Welt. Doch träumen sie den gleichen Traum? Der für Recht und Ordnung verantwortliche Polizeikommissar sehnt sich nach Sicherheit. Doch wessen Interessen hat er zu dienen? Die Wege der Menschen kreuzen sich auf den Gassen der Auswandererstadt. Ihre Geschichten, Träume und Ängste verweben sich – und kaum einer von ihnen geht, wie er kam.
Claudia Weiss ist promovierte und habilitierte Historikerin mit Schwerpunkt Osteuropa, insbesondere Russland. Sie hat mehrere Jahre in Lehre und Forschung in Deutschland, Frankreich und Russland gearbeitet. Neben Fach- und Sachbüchern veröffentlichte sie bereits mehrere historische Romane. Mehr Informationen zur Autorin unter: www.claudiaweiss.com
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © Ullstein Bild – Süddeutsche Zeitung
ISBN 978-3-8392-7546-7
Mittwoch, der 4. Juli 1906
12:10 Uhr
Die Sonnenstrahlen glitzerten auf dem graublauen Elbwasser und verbanden sich zu einem leuchtenden Netz. Es tanzte auf den kurzen Wellen den Schleiertanz des Lebens. Trocknete Dascha sich die Augen, ja, blinzelte sie nur, fiele auch dieser Schleier. Und offenbarte all das, was sie zurückließ am Ufer der Alten Welt.
In einem nicht enden wollenden Strom bestiegen Hunderte Menschen die »Batavia« über schmale Gangways, die von kleinen schwankenden Tendern zur Reling des Oberdecks reichten. Der gewaltige Ozeandampfer der HAPAG-Flotte lag bei Brunshausen in der Elbe vor Anker, einige Kilometer von Hamburgs Hafen entfernt, und sollte mit der nächsten Flut auslaufen. Sein Tiefgang erlaubte es nicht, weiter in den Hafen einzufahren. Darum wurde er über die Tender vom Wasser aus beladen. Das Lachen und aufgeregte Geplapper der an Bord kletternden Menschen füllte die Luft, durchbrochen von dem Geschrei der Möwen, die enge Schleifen über den Köpfen der Reisenden zogen und mit scharfem Blick nach etwas Essbarem Ausschau hielten.
Die junge Frau fühlte ihr Herz, hin- und hergerissen zwischen Lachen und Geschrei, Hoffnung und Schmerz. Eine Woche war es her, dass sie zusammen mit ihrer Mutter in einem überfüllten Zug die Elbbrücken auf dem Weg in die Hamburger Auswandererstadt überquert hatte. Es war die letzte Station vor der großen Überfahrt über den Atlantischen Ozean: eine Welt für sich, nicht mehr hier, in Hamburg, doch auch noch nicht dort, wohin ihre Reise gehen sollte. Diese sieben Tage hatten nahezu alles verändert, was in ihrem Leben eine Bedeutung hatte. Langsam lösten sich die ersten Tränen aus ihren hellblauen Augen und rollten mit einem sanften Kribbeln die Wangen hinab. Sie widerstand dem Drang, sie fortzuwischen. Als sie den Hals erreichten, hatten sie bereits ihre Wärme eingebüßt. So schnell veränderten sich Empfindungen. Wenn man es zuließ.
Auf dem Oberdeck wurde es immer voller. Die Menschen drängten weiter zu den engen Stiegen, die nach unten zu den Schlafdecks führten. Die Pritschen waren nicht nummeriert, so versuchte jeder, einen guten Platz für sich und die Seinen zu ergattern. Nah genug an den Schotten, um frische Luft zu haben, doch weit genug von ihnen entfernt, um vor Zug und dem Hin und Her der Passagiere geschützt zu sein. Schließlich dauerte die Reise von Hamburg nach New York an die sieben Tage.
Sie hatte keine Eile. Dafür war der Moment des Abschieds zu gewaltig. Doch auch er würde vergehen, verrinnen wie ihre Tränen. Vom Bug des Dampfers ertönte dreimal das tiefe Horn, dann wurden die Gangways eingeholt und die Tender drehten bei. Die Möwen zogen immer weitere, höhere Kreise und folgten schließlich den Booten zurück zum Hafen.
Eine kleine, von schwerer Arbeit gezeichnete Hand legte sich auf die Schulter der jungen Frau und streichelte sie sanft.
»Komm, mein Kind, es ist an der Zeit zu gehen.«
Donnerstag, der 28. Juni 1906
4:00 Uhr
Das Rattern des Zuges gab den vielfältigen Schlafgeräuschen im Wagon den Rhythmus vor. Weißes Mondlicht schien durch das Fenster und wanderte über die ruhenden Menschen. Ljuba lehnte an der Wagonwand und hatte ihre Beine vorsichtig zwischen den Taschen und Leibern der anderen ausgestreckt. An ihrer Schulter lehnte der Kopf ihrer Tochter Dascha. Hin und wieder streiften einige Haare ihre Wange, die sich aus dem Zopf des jungen Mädchens gelöst hatten. Die sanfte Berührung hielt Ljuba davon ab, sich ganz in der Schläfrigkeit zu verlieren, in die sie das monotone Rattern wiegte. Sie blickte durch das Fenster hinaus in das erste Morgengrauen, das ganz langsam im Nordosten über den Horizont aufstieg. Sie konnte nicht schlafen. Schon lange konnte sie die Nächte nicht mehr durchschlafen. Seit jenem Ostersonntag 1905.
Als sie damals nach der in der Kirche von Wolossowo durchwachten Osternacht am frühen Morgen die Bauernkate ihres Schwiegervaters Iwan Antonow betrat, rief sie freundlich den Ostergruß »Christus ist auferstanden«. Als Antwort bekam sie jedoch nicht die obligatorische Formel »Ja, er ist wahrhaftig auferstanden«, sondern Iwan Antonows Faust ins Gesicht. Er warf sie auf den Tisch, riss ihre Röcke hoch und rammte sein Gemächt in sie hinein.
»Wärest du meinem Sohn eine bessere Frau gewesen, hätte er nicht auf der Straße betteln und sich erschießen lassen müssen, Weib.«
Der brennende Schmerz im Unterleib und die aufgeplatzte Unterlippe raubten Ljuba die Stimme. Das Blut aus ihrer Nase lief in ihren Rachen. Es schmeckte eisern und ließ sie würgen. Als sie in die vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen ihrer fünfzehnjährigen Tochter blickte, die ihr ahnungslos über die Türschwelle gefolgt war, packte sie eine Welle verzweifelter Scham.
Erst nachdem der Alte endlich von ihr abgelassen hatte, begriff Ljuba das ganze Ausmaß dessen, was geschehen war. Mitja, ihr Mann, war tot. Erschossen. Am 9. Januar bereits, vor dem Winterpalast in Sankt Petersburg. Zusammen mit zahlreichen weiteren Menschen, die sich dort zu einem friedlichen Aufmarsch versammelt hatten, um den Zaren um Brot zu bitten. Doch dessen Soldaten schossen in die hilflose Menge. Der Tod Hunderter hatte jenem Sonntag seinen neuen Namen gegeben. Blutsonntag nannten ihn die Leute, und anstatt für Ruhe zu sorgen, hatte er die Revolution in Russland erst richtig vorangetrieben. So hatte es Monate gebraucht, bis die Nachricht von Dmitrij Martows Tod endlich bei seiner Familie in dem kleinen Dorf Raskulizy, gut achtzig Werst südwestlich von Sankt Petersburg, eingetroffen war.
Erst am Nachmittag vor Palmsonntag hatte Iwan Antonow vom Tod seines Sohnes erfahren. Mit seinen sechzig Jahren war der Alte immer noch der Bolschak, das Familienoberhaupt, der Martows und führte seine drei Söhne, deren Frauen und Kinder streng. Ljuba hatte ihren Mann seit der letzten Ernte nicht mehr gesehen. In den siebzehn Jahren, die sie verheiratet waren, hatten sie nur wenig Zeit miteinander verbracht. Denn kaum war ihre Tochter geboren, hatte der Bolschak Mitja nach Sankt Petersburg in die Fabrik geschickt, um dort ein Zubrot für die Familie zu verdienen. Und auch, um Ljuba für sich zu haben. Denn war der Mann nicht da, nahm der Bolschak sie sich, wann immer er wollte. Und war sie nicht gefügig, so schlug er sie so lange, bis sie keinen Ton mehr von sich gab. Vier Jahre hatte Ljuba das ertragen müssen. Dann wurden endlich ihre stillen Gebete erhört und sie hatte eine Anstellung im Haushalt der Orlows gefunden, einer adligen Familie, die auf ihrem Landsitz bei Wolossowo lebte. Die Tochter hatte sie mitnehmen können, alles Geld jedoch, das sie verdiente, nahm der Bolschak. Aber ihr Leben war leichter geworden. Nach Raskulizy kam sie nur noch zu den Festtagen und zur Ernte zurück. Mit Mitjas Tod drohte sich alles zu verändern. Auch als Witwe gehörte Ljuba weiterhin zum Haushalt von Iwan Antonow und er konnte nach Belieben über sie bestimmen. Ohne seine Erlaubnis durfte sie noch nicht einmal das Dorf verlassen. Aber nicht nur über sie, auch über ihre Tochter hatte der Alte verfügen können. Und dass er es getan hätte, daran hegte sie keinen Zweifel.
Ljuba fröstelte. Der Zug war ein wenig langsamer geworden. Der Himmel verfärbte sich in ein dunkles Violett. Vorsichtig änderte sie ihre Sitzposition. Ihre Hüfte schmerzte und das linke Bein, das kürzere, fühlte sich taub an. Es würde nicht mehr lange dauern, dann waren sie endlich in Hamburg, der letzten Station ihrer Reise vor der Überfahrt nach Amerika. Bis dorthin würde der lange Arm des Bolschak nicht reichen. So betete sie zumindest inständig. Etwas anderes blieb ihr auch nicht übrig. Sie hatte keine Wahl gehabt. Sie hatte diesen Weg gehen müssen, wohl wissend, dass er nicht nur beschwerlich, ja, vielleicht nicht zu schaffen war. Zumal für sie als Krüppel. Sie hasste dieses Wort. Nur wenn sie ganz mit sich allein war, drängte es sich in ihre Gedanken hinein und zeigte seine grimmige Fratze. So biss sie die Zähne zusammen, wenn der Schmerz sie quälte. Sie hatte es bis hierher geschafft, und mit Gottes Hilfe würde sie auch das letzte Stück der Strecke schaffen. Sie hatte keine Wahl gehabt. Auch nicht, als sie den schmutzigen Preis für diesen Weg hatte bezahlen müssen. Mochte Gott in seiner Gnade ihr verzeihen. Und ihr Kind es nie erfahren.
4:50 Uhr
Die Mutter hat gesagt: »Sei ganz leise! Mucksmäuschenstill!« Darum drückt er sich die eine Hand auf den Mund, die andere auf die Schulter und hält sich selbst fest, damit er nicht aufspringt. Auch sein Atem ist ganz leise. Nur sein Herz pocht so laut, dass er jeden einzelnen Schlag in seinen Ohren dröhnen hört. Es hämmert so kräftig gegen seinen Brustkorb, als ob es ausbrechen und fortlaufen wollte, so wie er. Aber er ist mucksmäuschenstill, hat die Augenlider zusammengepresst. So stark, dass er rote Sternchen und Blitze sieht. Es poltert und kracht. Der Boden bebt. Das Beben schwingt durch seinen Körper, lässt ihn beben. Ein scharfer Geruch dringt in seine Nase, beißt in seinen Hals. Aber er atmet ganz leise weiter. Kein Hüsteln kommt über seine Lippen, sosehr es auch kratzt. Mucksmäuschenstill. Dann hört er sie schreien. Ganz hoch und grell.
»Mashel, wach auf, es ist nur die Bremse, die quietscht. Wir sind wohl bald da.« Er fühlte eine große Hand sanft über seinen Kopf streicheln. »Vielleicht macht gleich jemand die Wagontür auf und wir können hinausschauen.«
Vorsichtig blinzelte Mashel durch die Finger seiner linken Hand, die sein Gesicht verdeckte. Das Quietschen hallte noch nach und der Wagon ruckelte. Vor ihm hockte David, sein großer Bruder, lächelte ihn an und griff nach seiner rechten Hand, die sich fest in seine linke Schulter verkrallt hatte.
»Komm, steh auf, wir versuchen mal, ob wir da vorne durch das Fenster hinaussehen können.«
Als Mashel sich von der Hand seines Bruders hochziehen lassen wollte, spürte er seine Hosenbeine. Sie klebten nass in seinem Schritt. Er befreite sich aus dem Griff und sank zurück auf seinen an die Wand gelehnten Koffer. »Ich bleib lieber sitzen.«
»Ach, nun komm schon. Vielleicht können wir ja bereits die Schiffe sehen.« David lächelte Mashel aufmunternd zu. Aber der presste die Lippen zusammen und schüttelte nur den Kopf. Schulterzuckend wandte David sich um und versuchte, sich an den auf Koffern und Bündeln hockenden Menschen die drei Schritte vorbeizuschieben zu dem kleinen beschlagenen Fenster. Von dort sollte es möglich sein, einen Blick aus dem überfüllten Wagon der vierten Klasse der Preußischen Eisenbahn hinaus in den frühen Sommermorgen zu erhaschen. Fast zwölf Stunden waren die beiden Brüder jetzt schon zusammen mit gut fünfzig anderen Menschen eingepfercht, seit der Sonderzug am Nachmittag des 27. Juni 1906 den Auswandererbahnhof Ruhleben vor Berlin verlassen hatte, um die dort registrierten, desinfizierten und auf ansteckende Krankheiten untersuchten Auswanderer weiter auf direktem Weg nach Hamburg in den Hafen zu bringen, von wo jede Woche mehrere große Ozeandampfer nach Amerika ablegten.
Viele der Reisenden schliefen noch, gleich neben Mashel schnarchte ein kräftiger Mann in seinen schwarzen Bart hinein. Eine junge Frau stillte ihr Baby inmitten von Koffern, Taschen, Bündeln und Paketen. »Warum hält der Zug?«, »Sind wir schon da?«, »Wo sind wir denn?«. Aus jedem Winkel des Halbdunkels mischten sich neugierige Fragen in das dichter werdende Stimmengewirr.
Mashel versuchte, seine Beine ein wenig auszustrecken, da sie drohten, taub zu werden. Die nassen Hosenbeine klebten an der Haut. Er zischte wütend.
»Was hast du?« David war zurück und schaute ihn fragend an.
»Ach, nichts. Es ist nur so eng und stickig hier drin. Ich bin müde und mir tun die Beine weh.«
»Auf dem Dampfer wirst du auch nicht viel mehr Platz haben, Brüderchen. Aber in New York, da wirst du in einem weichen Federbett schlafen und Tante Rahel singt dir leise ›Shlof main Fegele‹. Die Bettlaken duften nach Fliederwasser und auf der Fensterbank brennt eine Kerze zum Shabbat. Der einzige Lärm, den du dann hörst, werden die fröhlichen Stimmen der Amerikaner auf den Straßen sein, wenn sie abends nach Hause kommen und ihren Nachbarn eine gute Nacht wünschen.«
Im Moment konnte Mashel allerdings keinen Fliederduft riechen, sondern die sauren Ausdünstungen verschwitzter, ungewaschener Menschen in zu lange getragener Kleidung. Auch der herüberziehende Qualm einer Papirossa, die ein älterer, ihm schräg gegenübersitzender Mann in tiefen Zügen inhalierte, konnte dem Geruch nicht die Spitze nehmen. Dafür erinnerte er Mashel schmerzlich an das Scheunenviertel in Berlin, in dem er sich in den vergangenen Monaten schon beinahe heimisch gefühlt hatte.
Jeden Tag hatte er dort zusammen mit David dutzendweise Zigaretten gedreht und sie dann anschließend einzeln in den Cafés und Kneipen der Stadt verkauft. Sie waren in Berlin bei entfernten Bekannten eines Freundes ihres Vaters aus Kischinjow untergekommen. Er hatte ihnen gegen ein kleines Entgelt eine Schlafstatt zur Verfügung gestellt und auch einen Vorschuss auf Tabak und Zigarettenpapier gewährt. So konnten sie in das gewinnträchtige Geschäft der Zigarettenherstellung einsteigen. Für fünfundzwanzig Pfennig bekam man das Hülsenpapier, der Tabak für tausend Zigaretten kostete fünfundneunzig Pfennig. Mashel war geschickt mit den Fingern, er rollte die »Manoli«, »Garbáty« und »Muratti« in Windeseile. David stellte sich ungeschickter an, dafür kauften ihm die hübschen Damen gerne Zigaretten ab. Sicherlich, weil er so nett lächeln konnte. Mashel lächelte selten. Ihm kauften eher Männer seine Ware ab. Manchmal gaben sie ihm sogar ein winziges Trinkgeld. Wenn der Tag gut lief, verdienten sie zusammen zwischen vier und fünf Mark in neun bis zehn Stunden. Das reichte für die Miete der Schlafstatt, Kohle zum Heizen, ein einfaches Essen und den neuen Tabak. Wenn es nach Mashel gegangen wäre, wären sie einfach in Berlin geblieben. Die Leute im Viertel sprachen Jiddisch, der Verkauf lief zunehmend besser und mit dem Frühling wurde auch Berlin angenehmer. Aber David wollte weiter nach Amerika. Er träumte davon, eines Tages ein erfolgreicher Bauingenieur zu werden und ebenfalls so fantastische Hochhäuser zu bauen wie die auf der Postkarte, die Tante Rahel ihnen geschickt hatte. Zwar wusste Mashel nicht, wie David ein Studium bezahlen wollte. Schon sein Besuch des Gymnasiums in Kischinjow hatte die Familienkasse schwer belastet. So hörte es Mashel einmal seinen Vater sagen, als er zufällig einem Gespräch seiner Eltern lauschte. Aber er wollte seinem großen Bruder nicht den Traum zerstören. Zu viel war schon in ihrem Leben zerstört worden. David sparte eisern jeden Pfennig, den sie erübrigen konnten, um ihre Reisekasse wieder aufzufüllen. Ihr Geld aus Russland hatten ihnen die Schlepper abgenommen, die sie über die russisch-preußische Grenze bei Thorn gebracht hatten. Den spärlichen vor ihnen verborgenen Rest mussten sie den Bauern geben, die sie ein Stück des Weges nach Berlin auf ihren schweren Fuhrwerken mitnahmen oder ihnen einfach nur ein paar Rüben gegen den bohrenden Hunger verkauften. Zwei Wochen waren sie so unterwegs gewesen, bis sie es endlich geschafft hatten, sich in einem Güterwagon eines Zuges zu verstecken, der nach Berlin fuhr.
Letztlich lag es auch an David, dass sie wieder aus Berlin fortgegangen waren. Auf dem Alexanderplatz waren sie einer Razzia der Ausländerpolizei in die Hände gefallen. Weil sie nicht schon vor der Russischen Revolution von 1905 in Berlin ansässig gewesen waren, hatte David, der schon achtzehn Jahre alt war, die Stadt verlassen müssen. Und ohne David wollte Mashel keinen Tag irgendwo bleiben. Also nahmen sie ihr Erspartes und machten sich auf nach Ruhleben, um von dort nach Hamburg und weiter nach New York zu fahren.
Nun stand dieser Zug auf einem Gleis irgendwo im Nirgendwo. Der nasse Hosenstoff wurde langsam kalt und noch unangenehmer auf Mashels Haut.
»Macht doch mal die Tür auf, dann sieht man wenigstens etwas«, knurrte der Mann mit der Papirossa. Zwei jüngere Burschen, die neben der Wagontür auf ihren Seesäcken saßen, erhoben sich und lösten umständlich die Verriegelung. Quietschend öffnete sich die schwere Tür und sanfte Sonnenstrahlen flossen zusammen mit einem Schwall kühler Morgenluft in den stickigen Wagon. Gierig atmete Mashel die frische Brise ein. David beugte sich über ihn und versuchte, einen Blick hinauszuwerfen.
»Ich sehe nur eine Wiese und weiter hinten ein paar Bäume. Aber keine Stadt und keinen Hafen.« Seufzend setzte er sich neben Mashel und wuschelte ihm durch die dunklen Locken. Ein junges Mädchen, dessen honigfarbenes Haar zu einem strengen Zopf geflochten war, drehte sich erschrocken zu ihm um, als er es versehentlich mit seiner Fußspitze streifte. Mit hellblauen Augen musterte sie David unverwandt. Der murmelte sogleich eine Entschuldigung und zog seinen Fuß so schnell zurück, dass er laut gegen einen Koffer knallte. Dessen Besitzer schnaubte ungehalten. Sie lächelte amüsiert und schmiegte sich an die Schulter der Frau neben ihr. David fuhr sich mit seinen langen Fingern übers Gesicht, als wollte er die peinliche Situation fortwischen. Aber Mashel schien es, als ob sein Bruder auch zwischen seinen Fingern hindurch den Blick nicht von dem Mädchen ließ.
Inzwischen waren die Burschen, die die Tür geöffnet hatten, aus dem Wagon auf den Bahndamm gesprungen.
»Seht ihr was?«, »Müssen wir raus?«, »Nein, hier ist nichts. Aber da kommt ein Schaffner.«, »Wo?«
Binnen weniger Augenblicke war die Türöffnung von Menschen versperrt, sodass weder Licht noch Luft zu Mashel vordrangen. Er schloss müde die Augen. Bis er aus diesem Wagon herauskam und seine Hose wechseln konnte, würde wohl noch einige Zeit vergehen.
6:45 Uhr
Polizeikommissar Kiliszewski verfolgte mit stoischem Blick die gleichmäßigen Streichbewegungen, mit denen Schutzmann Schmidt sein Schwarzbrot butterte. Jeden Morgen traf sich der Kommissar mit den vier ihm unterstellten Schutzmännern. Stets eine Viertelstunde vor Dienstbeginn frühstückten sie gemeinsam, um die Vorkommnisse der vergangenen Nacht und die zu erwartenden Ereignisse des neuen Tages in den Auswandererhallen auf der Hamburger Veddel zu besprechen. Kotremba, Jakusz und Jahnke, die gleich ihren Dienst antraten, hatten ihre Pickelhauben über ihre Uniformjacken auf die Haken an der Wand gestülpt, gleich neben der von Schmidt. Dieser hatte Nachtdienst gehabt und sich mit müdem Gesicht als Erster zu Kiliszewski an den Holztisch gesetzt. Jakusz trank schlürfend einen Schluck heißen Kaffee, den der Kommissar gekocht hatte. Jeden Morgen spendierte er seinen Männern einen Kaffee, um sie bei Laune zu halten. Er wusste, dass ihre Lohntüte klein und Bohnenkaffee teuer war. So wurde seine Geste umso mehr geschätzt.
»Wie verlief die Nacht, Schmidt?«
»Ganz gut, Herr Kommissar. Die abendlichen Rundgänge waren recht friedlich, trotz der Beschwerden einiger Gäste, dass es in den Baracken zu heiß zum Schlafen sei. Wenigstens schienen die Latrinen ordentlich gesäubert zu sein, so war der Gestank auszuhalten. In der Nacht musste ich allerdings einmal gegen drei Uhr das Wachlokal verlassen. Herling von der Verwaltung hatte Ärger mit einer Mutter, die sich um ihren Säugling sorgte. Weil der Arzt nicht zu finden war, wurde sie laut, weshalb Herling mich um Hilfe bat. Als sie mich sah, gab sie Ruhe«, berichtete Schmidt und grinste.
»Das würde ich an ihrer Stelle auch tun«, grunzte Jakusz über seinem Kaffee. »So wie du aussiehst.«
»Und wo war der Arzt?«, fragte Kiliszewski dazwischen.
»Keine Ahnung. Aber Herling sagte, er kümmere sich darum.«
»Haben Sie die ärztliche Abwesenheit ins Protokoll aufgenommen, Schmidt?«
»Jawohl, Herr Kommissar.«
»Gut, ich werde den Hafenarzt darauf ansprechen. Schließlich muss gewährleistet sein, dass immer ein Mediziner anwesend ist. Sonst können wir die Sicherheit vor Ort nicht garantieren. Wir müssen schließlich auch hier sein, ganz gleich, wie heiß die Nächte sind.« Mit Nachdruck stellte Kiliszewski seinen Becher Kaffee ab. Die Sicherheit in der Auswandererstadt hatte für ihn absolute Priorität. Schließlich waren die Hallen überhaupt erst vor viereinhalb Jahren gebaut worden, um den Menschenmassen, die Jahr für Jahr, Monat für Monat, Woche für Woche, ja, Tag für Tag durch Hamburg weiter hinaus in die Welt strömten, ein vernünftiges Maß an Schutz zu gewähren. Ihnen ebenso wie auch den Hamburgern, die mit all diesen Menschen umzugehen hatten. Allein im letzten Jahr, 1905, waren knapp hundertfünfzigtausend Menschen über den Hamburger Hafen in die Neue Welt ausgewandert. Das waren nahezu vierhundert Menschen am Tag. Aber das war Statistik. Im Sommer kamen weit mehr in Hamburg an und auch dann legte nicht jeden Tag einer der großen Überseedampfer ab. So stauten sich die Menschen in der Stadt. Oder eben hier in den Auswandererbaracken auf der Veddel, für deren Ordnung Kiliszewski verantwortlich war.
Im Dezember 1901 hatte die HAPAG, Hamburgs größte und bedeutendste Reederei, die Auswandererhallen eröffnet, um dem Menschenstrom Herr zu werden. Aber das Unterfangen war ein Fass ohne Boden. Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres waren schon knapp neunzigtausend Auswanderer durch Hamburg gereist. Die meisten von ihnen aus Russland, Galizien, Böhmen, der Walachei. Aber auch aus Posen, Schlesien oder der Pfalz. Fast alles arme Leute, deren ganze Habe in wenige Koffer oder auch nur in ein paar große Bündel passte. Doch nicht ihre Armut fürchtete man in der Stadt, sondern die Krankheiten, die sie im Gepäck hatten. Immer wieder war in Russland die Cholera aufgeflammt, hatte Hunderte in den Tod und noch viel mehr in Leid und Elend gerissen. 1892 hatte es diese tückische Seuche nach Hamburg geschafft. Achttausend Menschen fielen ihr innerhalb weniger Wochen zum Opfer. Unter ihnen die zwei wichtigsten in Kiliszewskis Leben: seine Frau und sein kleiner Sohn.
Bei ihrer Beisetzung hatte er sich geschworen, sein Dasein der Sicherheit der Stadt und den in ihr lebenden Menschen zu widmen. Den Einwohnern genauso wie den Auswanderern. Seit damals arbeitete der Kommissar für die Abteilung der Polizei, die für die Überprüfung der Auswanderer zuständig war. Alle Beteiligten hatten schnell verstanden, dass medizinische Kontrollen und eine angemessene Versorgung kranker Auswanderer der Schlüssel für weitere Geschäfte mit diesen Menschen waren. Albert Ballin, der Generaldirektor der HAPAG, hatte gemeinsam mit der Direktion des Bremer Lloyd, der zweiten großen Reederei im Auswanderergeschäft, dafür gesorgt, dass die Auswanderer bereits bei der Überquerung der deutschen Grenzen medizinisch untersucht wurden und ihr Gepäck desinfiziert wurde. Gleiches geschah hier in den Hallen nochmals. Aber was nutzten all solche Kontrollen, wenn der zuständige Arzt, sobald man ihn tatsächlich brauchte, nicht anwesend war?
Missmutig sah der Kommissar aus dem kleinen Fenster der Wachstube. Sie war im Verwaltungsgebäude der Auswandererstadt untergebracht, mit Blick auf den Hafen. In gut zwei Stunden würde der nächste Zug aus Berlin-Ruhleben mit Hunderten weiteren Menschen eintreffen. Dabei waren die Schlafsäle jetzt schon voll. Gestern erst hatte Herr Allen, der Verwalter, wieder bei Doktor Stahmer, dem für die Auswandererhallen verantwortlichen Hamburger Senator, um Aufstockung der Betten in den neun Schlafhallen gebeten. Im letzten Jahr war diese Notmaßnahme, bei der auf die Stockbetten ein drittes Bett gestellt wurde und aus den eigentlich eintausendzweihundert Schlafplätzen eintausendachthundert wurden, nahezu zum Dauerzustand geworden. Da der Platz für so viele Menschen dennoch nicht ausreichte, hatte die Verwaltung acht zusätzliche Baracken gebaut, bis endlich in diesem Frühjahr die Entscheidung gefallen war, die gesamte Anlage um sechs neue Pavillons zu erweitern. Wenn die erst mal fertig waren, würden hier fünftausend Menschen unterkommen und dieser Ort wirklich eine kleine Stadt in der großen Stadt sein. Aber bis es so weit war, hatte Kiliszewski auch noch die gewaltige Baustelle zu beaufsichtigen.
»Jakusz! Kotremba!«
Verschlafen schauten die beiden Männer den Kommissar an.
»Wenn Sie mit der Kontrolle des Morgenzuges fertig sind, gehen Sie noch einmal gründlich die Baustelle ab und kontrollieren Sie, ob die Sicherheitsauflagen eingehalten werden.«
»Jawohl, Herr Kommissar«, antworteten beide wie auf Knopfdruck, während Jahnke wegen seiner ordentlichen Handschrift und seiner außerordentlichen Liebe zu Papier wie immer den Dienst in der Wachstube übernehmen würde.
Schmidt gähnte inzwischen unverhohlen. Kiliszewski zog seine Taschenuhr aus der Weste und sah nach der Zeit.
»Gut, Männer, dann abtreten zum Dienstbeginn.«
Laut scharrten die Stühle über die Holzdielen und die schweren Absätze der Stiefel polterten auf den Boden, als sich die fünf Polizisten erhoben und auf den Weg machten. Jakusz und Kotremba zur Garderobe, um die Uniformjacken überzuziehen, Jahnke an den Schreibtisch der Wachstube und Schmidt hinauf zu den Kammern der Schutzleute, die sich im Dachgeschoss befanden, um sich bis zum Mittag auszuruhen, bevor er sich wieder zu den anderen zum Dienst gesellen würde.
Kiliszewski schenkte sich den Rest Kaffee in seinen Becher und nahm ihn mit nach nebenan in sein Büro, von wo aus er für einen weiteren Tag für Ordnung in den Auswandererhallen sorgen würde. Nachdenklich schaute er durch das gekippte Fenster den beiden Schutzmännern nach, die mit festem Schritt hinaus auf den Weg traten.
Die Morgensonne warf ihre langen Schatten, sodass die Spitzen ihrer Pickelhauben wie in den Sand stechende Speerspitzen anmuteten. Keine Wolke trübte das strahlende Blau des Himmels, nur ein paar Sperlinge schwirrten durch die noch frische Luft, die sich bis zum Mittag sicherlich wieder bis weit über dreißig Grad erhitzen würde. Jakusz und Kotremba gaben eine gute Wachkombination ab, dachte Kiliszewski bei sich. Der ruhige und bedachte Kotremba, der mit seinen ein Meter achtzig die Statur eines gestandenen Seebären hatte, konnte den leicht aufbrausenden, kleingewachsenen Jakusz gut im Zaum halten. Der verlor oft die Geduld mit den Auswanderern, wurde laut und drohend, wo er mit Ruhe mehr erreicht hätte.
Die beiden marschierten hinüber zum Eingangsbereich der Auswandererstadt, auf die sogenannte unreine Seite. Dort begannen sie ihren morgendlichen Rundgang durch die Wohn- und Schlafsäle der erst in der Nacht eingetroffenen Reisenden, die noch durch die Registrierung und vor allem durch die hygienischen und medizinischen Kontrollen mussten. Um halb acht bekamen die Neuankömmlinge ihr Frühstück; ein idealer Zeitpunkt, um sie zu beobachten und von vornherein »gesuchte Personen« herauszufiltern. Erst letzte Woche war wieder ein eindringlicher Brief vom Polizeipräsidenten Roscher persönlich auf Kiliszewskis Schreibtisch gelandet, in dem er dazu angehalten wurde, vor allem unter den russischen Auswanderern nach Sozialisten Ausschau zu halten. Der Rat der Stadt machte sich nämlich zusehends Sorgen, dass deren aufrührerisches Gedankengut sich ungehindert unter den Hamburger Hafenarbeitern verbreitete. Und Streiks oder sogar Aufstände mussten in Hamburg um jeden Preis unterdrückt werden. Jakusz hatte eine feine Nase für Sozialisten, aber leider auch eine zu schnelle Faust. Vor zwei Monaten hatte er sich an einem alten Mann vergriffen, der noch in den überfüllten Speisesaal drängte. Ihn aufzuhalten, war eine Sache, ihm dabei den Arm zu brechen, eine andere. Damals war Schmidt mit ihm auf Rundgang gewesen, und der traute sich im Gegensatz zu Kotremba nicht, Jakusz zu bremsen.
Nach der Überwachung des Frühstücks würden die beiden wie jeden Morgen weiter zum Auswandererbahnhof gehen und den Frühzug abwarten, der bis neun Uhr ankommen sollte. Und dann war es auch mit der Ruhe für Kiliszewski vorbei. Denn wenn heute Vormittag wieder fünfhundert Neuankömmlinge unterzubringen waren, würde die Auswandererstadt endgültig aus ihren Nähten platzen, insofern nicht wenigstens genauso viele bis zum Mittag auf dem Weg zu ihrem Dampfer waren. Aber heute war Donnerstag. Da legte nur der Expressdampfer von Cuxhaven aus ab. Doch vielleicht hatten sie ja auch Glück und es kämen nicht mehr als zweihundert Neue. Die würde man noch in einer der provisorischen Baracken unterbekommen.
Das Klingeln des Telefons riss Kiliszewski aus seinen Überlegungen. Es war ein besonderes Privileg, dass seine Wache ein eigenes Telefon hatte. Geschäftig nahm er den Hörer ab und meldete sich ordentlich in voller Länge.
»Kiliszewski? Roscher hier. Ich muss mit Ihnen sprechen. Es ist dringend.«
Automatisch nahm der Kommissar Haltung an, auch wenn ihn der Polizeipräsident natürlich nicht durch das Telefon sehen konnte.
8:50 Uhr
»Mamotschka, wach auf, jetzt sind wir wirklich endlich da!« Liebevoll knuffte Dascha in die Schulter ihrer schlafenden Mutter, während sie schon neugierig aus dem schmutzigen Fenster hinaus auf den glitzernden Fluss sah. Wie eine sich langsam rekelnde Schlange wand sich die Elbe unter den Brücken hindurch und weiter in den Hamburger Hafen. Vorbei an Lagerschuppen, Speichern und Silos fuhr der Zug langsam auf einen schmalen Bahnsteig zu, weit abseits der stolzen Kirchtürme, die über der Stadt in der Morgensonne leuchteten.
»Kannst du schon das Meer sehen und den großen Dampfer?«
»Nein, ich sehe nur einen hohen Bretterzaun und dahinter Baracken. Aber da, da ist ein Turm mit einer Uhr!« Dascha spürte die Hände ihrer Mutter auf ihren Schultern. Sie roch unangenehm aus dem Mund. Es wurde Zeit, dass sie endlich aus diesem Wagon heraus an die frische Luft kamen. »Hamburg liegt doch gar nicht am Meer, Mamotschka, sondern an einem großen Fluss, der ins Meer fließt. So wie Sankt Petersburg.«
»Hm.« Daschas Mutter schüttelte den Kopf, und ihr Kopftuch streifte Daschas Wange.
Langsam, begleitet von einem lang gezogenen Quietschen der schweren Bremsen, blieb der Zug stehen. Sofort drängten alle Insassen lautstark zu den Türen. Auch Dascha ergriff ihr Bündel und das ihrer Mutter und begab sich in das Gedränge. »Komm, Mamotschka, raus hier. Wir sind da.« Die beiden schoben sich durch das Gewirr aus Menschen und Gepäckstücken Schritt für Schritt zu der engen Wagontür. Endlich konnte Dascha ihren Fuß auf die eiserne Stufe stellen, als sie plötzlich jemand von hinten schubste. Sie stürzte nach vorne. Mit einem Schrei versuchte sie, die Haltestange an der Wagontür zu greifen, da packten sie schon zwei Hände, hielten sie und stellten sie behutsam auf den Boden.
»Oh, vielen Dank!«, stieß sie hervor und schaute ihren Retter an. Es war der junge Mann, der zwei Plätze entfernt von ihr gesessen hatte. Seine dunklen Locken fielen ihm ins Gesicht und ein Lächeln umspielte seine braunen Augen.
»Hast du dir wehgetan?«
»Nein, es geht schon, danke.« Schnell drehte sich Dascha zu ihrer Mutter, um die Röte zu verbergen, die ihr ins Gesicht stieg. »Reich mir die Bündel und sei vorsichtig, wenn du heruntersteigst, es ist steil.« Gerade wollte sie das Bündel nehmen, das ihre Mutter ihr anreichte, aber der junge Mann ergriff es vorher und hob es kurzerhand über sie hinweg in Sicherheit, bevor er ihrer besorgt um sich blickenden Mutter aus dem Wagon half.
»Danke.«
»David, komm!« Ein Junge von vielleicht zwölf Jahren zog an seiner Jacke.
David gab nach und drehte sich zu dem Jungen um, wobei seine Augen Dascha streiften. »Dir tut wirklich nichts weh?«
Sie schüttelte lächelnd den Kopf. Der Klang seiner Stimme verriet, dass er aus dem Süden kam.
»Dascha, hilf mir!« Ihre Mutter hatte bereits ein Bündel geschultert und schob Dascha das andere hin. Sie warf es sich über die Schulter, hakte sich bei ihrer Mutter unter und sie reihten sich ein in die Menschenschar, die den Bahndamm hinunter auf die mit jungen Bäumen gesäumte Wilhelmsburger Straße zusteuerte.
Wie viele Werst mochte sie wohl so mit ihrer Mutter in den vergangenen drei Monaten gegangen sein? Sie unmerklich stützend, damit die ihre schmerzende Hüfte schonen konnte. Es war wie ein ewiges Versteckspiel. Ihre Mutter schluckte den Schmerz verbissen hinunter, und Dascha gab sich müde, als würde sie selbst Halt suchen. So hatten sie viele Wege und Straßen hinter sich gelassen, waren immer weiter gegangen nach Westen. Aber keine von all den Straßen war so gepflegt und ordentlich mit Kopfsteinpflaster verlegt gewesen wie diese. Dascha schien es, als sei sie noch nie in ihrem Leben über eine bessere Straße gegangen. Schon gar nicht in ihrem Dorf in Russland. Dort gab es nur Sandwege, die staubten im Sommer, waren im Winter vereist und im Frühjahr und Herbst schlammig. Rechts von den beiden Frauen stand das graue Elbwasser im Zollhafen und jenseits davon säumten die stolzen Backsteinbauten Hamburgs das Ufer. Schiffsmasten bewegten sich auf dem Wasser auf und ab und Wimpel flatterten in der Morgenbrise. Möwen jagten um sie herum und stiegen auf in den wolkenlosen blauen Sommerhimmel. Noch nie hatte Dascha so viele Schiffe gesehen. Wie prächtig sie waren, geradezu stolz schwammen sie auf dem breiten Fluss, der die frisch angekommenen Auswanderer von der Stadt trennte. Auf der linken Straßenseite schirmte ein hoher Bretterzaun das umfriedete Gelände ab, auf dem die Auswandererhallen lagen. Dascha bemerkte zwei Schutzmänner in dunkler Uniform und mit Pickelhaube auf dem Kopf. Sie standen an den Zaun gelehnt und sondierten mit stechendem Blick Mensch um Mensch die frisch Eingetroffenen, wobei sie ihr besonderes Augenmerk auf die jungen Männer richteten. Einer der Schutzmänner, der kleinere, kräftigere, nahm David, ihren Retter, ins Visier und musterte ihn von oben bis unten. Schnell schaute sie weg. Seit ihrem Aufbruch aus Russland machten ihr Vertreter der Obrigkeit Angst. Auch ihre Mutter war angespannt, als sie die beiden Schutzmänner sah. Sie senkte ihren Blick und verlangsamte ihren Schritt, um das Nachziehen ihres linken Beines zu verbergen. Ein paar Atemzüge später waren sie an den beiden Uniformierten vorbei. Erleichtert – zum wievielten Mal bloß auf dieser Reise? – sah Dascha das Empfangsgebäude der Auswandererhallen vor sich. Es war groß und stattlich, unten aus rotem Backstein, oben weiß verputzt. Seinen gewaltigen Turm samt Uhr hatte sie bereits durch das kleine Wagonfenster erspäht. Aber in voller Größe, nur ein paar Schritte von ihr entfernt, war es weitaus imposanter.
»Schau nur, Mamotschka, gleich sind wir da. Dann können wir uns ausruhen.«
»Ja, mein Kind, gleich sind wir da. Dann haben wir es fast geschafft.« Unruhig schaute sich Daschas Mutter noch einmal nach den Schutzmännern um, aber die hatten ihr Augenmerk längst auf die nachrückenden Ankömmlinge gerichtet.
Vor der Eingangstür drängte sich eine große Menschenmenge zusammen. Dascha wurde von fremden Ellenbogen hin und her geschubst und drohte immer wieder, weggedrängt zu werden. Aber endlich waren die beiden Frauen zusammen mit mindestens zweihundert anderen Reisenden in der großen Empfangshalle angelangt und sahen sich staunend um.





























