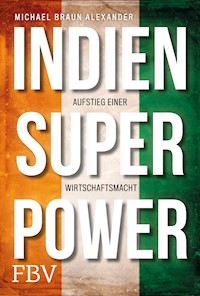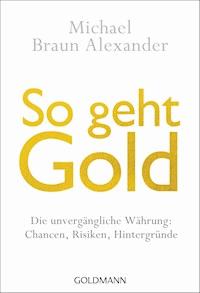11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Benjamin, ein junger Mann aus Berlin, verliebt sich an der Universität Oxford in Alfred, einen farbigen Studenten von den Bahamas. Gemeinsam verbringen sie die Monate vor dem Examen als Untermieter im Pfarrhaus des Arbeitervorortes Jericho. Doch schon bald gerät ihre Freundschaft ins Trudeln – eine Zäsur in Benjamins Leben, die den Abschied von der Sorglosigkeit der Jugend markiert. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Ähnliche
Michael Braun Alexander
Jericho oder Das feine Gesicht des Himmels
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Kevin und Robb
Tiger
Money isn’t everything, but it sure keeps you in touch with your lover. Die Feriengrüße von Ida, meiner Studienfreundin, klebten unter einem Magneten an der Kühlschranktür in der Küche unserer Berliner Wohnung. Ida war kreativ; sie malte ihre Postkarten aus der Sommerfrische immer selbst. Die rote Schrift in Ölfarbe hatte das Papier angegriffen und roch Anfang Oktober noch immer nach Lösungsmittel.
»Unsinn«, hatte Clemens gesagt. »Menschen mit einem guten Sexleben trennen sich nicht.« Genau da hatten wir ein Problem, aber das sagte ich ihm nicht. Es gab vieles, was mir an meinem Freund gefiel; er war wirklich ein netter Kerl, a nice guy. Anderes fand ich weniger beeindruckend. Die Magazine unten in der Schlafzimmerkommode waren noch das geringste Problem: In Touch, Zipper, Advocate – Schmuddellektüre für in die Jahre gekommene Homos. Clemens wußte nicht, daß ich sie gefunden hatte. Schwerer fiel ins Gewicht, daß er die Tragetaschen der Edelläden aufbewahrte, in denen er einzukaufen pflegte. Giorgio Armani und Gianni Versace und Hugo Boss gingen als Tütenaufdruck mit uns durchs Leben, bis die Markenlogos abgeschabt und die Trageriemen durchgewetzt waren.
Auch das mit dem Feuerzeug machte mir zu schaffen. »Wenn jemand nur noch ein einziges benutzt, ist es zu spät«, hatte Ida gewarnt. »Von dem laß die Finger!« Clemens hatte ein goldenes von Dunhill.
Andererseits hatte er einen entscheidenden Vorteil: ein volles Portemonnaie mit Bündeln großer Geldscheine und Stapeln goldener Kreditkarten. Mein Mann fürs Leben konnte sich einen Studenten an seiner Seite leisten. Und ich war überzeugt, wir würden zusammen in Rente gehen.
Mein drittes und letztes Studienjahr am Magdalen College der Universität Oxford begann am Tag nach der Wiedervereinigung Deutschlands.
Während ich am Vorabend meiner Abreise aus Berlin mit einem Auge auf dem Fernsehschirm Hemden bügelte, zusammenfaltete und eines links, eines rechts in den Koffer legte, erleuchtete das teuerste Feuerwerk der deutschen Geschichte den Himmel. Plötzlich war in unserer kleinen Stadt am Horizont des Westens die Mauer zum Denkmal geworden, das Brandenburger Tor kein Grenzstein mehr, sondern Mittelpunkt einer Festwiese, und ganz oben, auf der Retourkutschen-Quadriga, sah man Gespenster laufen, mit schwarzrotgoldenen Fahnen, die sich am Nachthimmel spiegelten, Feuerstreifen in den Farben der wiedervereinten Nation. Achtundzwanzig Jahre hatten Mauern und Stacheldraht Menschen in Ost und West getrennt; jetzt waren sie frei, frei, frei!
Tausende hatten sich auf dem Reichstagsgelände eingefunden und den Straßenverkehr zum Stillstand gebracht, ein Massenchor schreiender, klatschender, trampelnder, hupender, pfeifender Menschen. Live stand links oben in der Ecke des Fernsehschirms. Sektkorken und Feuerwerkskörper flogen durch die Luft; jemand hatte Musik mitgebracht, spielte The Wall von Pink Floyd. Eine Gruppe faßte sich an den Händen und tanzte im Kreis, andere hielten brennende Fackeln und Feuerzeuge in die Berliner Luft. Der erste Tag seit Jahrzehnten, an dem wir stolz waren, Deutsche zu sein; der erste in meinem Leben. Nur daß ich leider Hemden bügeln mußte, zu Hause in Charlottenburg, im reichen Westen.
Der Bundespräsident hatte alles, was Rang und Namen hatte, eingeladen: Politik und Wirtschaft, Fernsehstars, Vorzeigesportler und die Presse. Gekommen war indes die ganze Nation. Ein Sinfonieorchester spielte Beethovens Neunte Open air, ergreifend und ohrenbetäubend. Deutsches Kulturgut schweißte die Menschen aller Stände und Schichten zusammen, gleichgültig, ob Millionär oder Arbeitsloser, klug oder ungebildet, Wessi oder nicht. Das war hier schließlich Tradition: Anläßlich kleinerer oder größerer Feierlichkeiten sang man die Ode an die Freude einstimmig im Chor und klatschte das Freude-schöner-Götterfunken im Schulterschluß mit. Da war es völlig unerheblich, ob es sich um Silvester, den Tag der deutschen Einheit oder die Wiedervereinigung handelte.
Die Fernsehkamera schwenkte zum Präsidenten, der sich mit den Würdenträgern der Nation auf einer Tribüne versammelt hatte. Grauer Mantel, weiß-weises Haar, schmale Schultern, die mühelos den Ballast der deutschen Geschichte stemmten. Die Notizblätter in seinen Händen zitterten nicht einmal, so viele historische Stunden hatte der Mann schon erlebt.
Ein »Endlich« dröhnte aus den Lautsprechern des Reichstagsgeländes. »Endlich, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ist der Augenblick da, auf den wir seit zwei Generationen gewartet haben. Endlich dürfen wir sehen, wie unsere Nation, schicksalhaft zerrissen seit 45 Jahren, wieder eins wird. Endlich …«
Die Massen kümmerten unterdessen die Stilmittel nicht, sie jauchzten und johlten und ließen die mitgebrachten Rotkäppchenflaschen knallen, wir waren schließlich wieder wer.
»Endlich …«, versuchte der Präsident es erneut, aber der Stimmenorkan schwoll weiter an. »Deutschland, Deutschland!« schrie eine Gruppe von Wiedervereinigungsbesuchern, doch die Kamera schwenkte zu schnell weiter, als daß man darüber hätte nachdenken können.
»Endlich, verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger.« Er schaute lächelnd vom Rednerpult auf, Tausenden von Zuhörern, Millionen von Fernsehzuschauern ins Gesicht und auf das Bügelbrett in meiner Küche. »Die Mauer. Ist. Gefallen.«
Ich lächelte zurück. Wiedervereinigung in Berlin. Als die Mauer fiel, waren wir wieder eins. Eine Nation. Ein Volk. »Eine Schicksalsgemeinschaft«, sagte der Präsident.
Meine Mutter kam mit Kopf und Schultern ins Bild, im Trenchcoat und mit blau-gelbem Seidentuch um den Hals, die Reporterin vom Zweiten Deutschen Fernsehen, Abteilung Berlin, in ihrer Arbeitskleidung. In der Hand hielt sie ein Mikrofon; hinter ihr wehte die deutsche Fahne.
Sie sah gut aus für ihr Alter, 47 und seit acht Jahren Witwe. Eine Frau, die sich hatte durchbeißen müssen, ein Sohn und plötzlich kein Mann mehr. Mit 39 hatte sie einen Commodore-Computer gekauft und begonnen, Reportagen für Zeitungen und Magazine zu schreiben. Die meisten hatten in irgendeiner Weise mit England zu tun, wo sie mit meinem Vater vor ihrer Hochzeit als Soldatenbraut gewohnt hatte. Von Regierungskrisen in Westminster bis hin zu Ruderwettkämpfen auf der Themse galt meine Mutter nach wenigen Monaten als Expertin in Sachen englische Lebensart – jedenfalls bei der Berliner Tageszeitung, die auf der Seite drei regelmäßig ihre Beiträge abdruckte.
Einmal hatte sie eine Reportage über die Falklandinseln und einen DIN-A4-Umschlag mit selbstgeschossenen Fotos und unverbindlichem Anschreiben an den Stern geschickt, postwendend einen Scheck erhalten und in eine Geschirrspülmaschine investiert. Danach machte sie für eine Weile nur noch Fotoreportagen. Londonderry kannte sie bald besser als Berlin. Irgendwann erreichte sie schließlich der Anruf von einer Freundin beim ZDF, gefolgt von der Karriere.
»… kommen unterdessen kritische Stimmen aus Paris und London, die fragen, wie sich achtzig Millionen Deutsche in die Europäische Gemeinschaft eingliedern werden. Schon hört man Forderungen, die Bundesrepublik solle als stärkste Wirtschaftsnation Europas größere Verantwortung übernehmen, mit anderen Worten: noch mehr als bisher nach Brüssel überweisen. Heute überwiegt allerdings die Freude hier auf dem Berliner Reichstagsgelände …«
Erst später, weit nach Mitternacht, ging der Feuerwerksjubel in stille Freude über. Mit einem Fackelzug trug man schweigend die Republik der Welt von gestern zu Grabe, und während ich oben auf meinem Koffer saß und mit den Schlössern kämpfte, beendete das Zweite Deutsche Fernsehen mit der Nationalhymne das Programm.
»Gute Nacht«, sagte die Ansagerin mit den braunen Haaren.
»Gute Nacht«, sagte ich und brach mir am Schloß des Koffers einen Fingernagel ab.
Meine Studententage in Oxford hatten unter einem ungünstigen Stern begonnen. Papa hatte an der Universität London studiert, als Bester in seinem Fach: Schiffsingenieurwesen. Er hatte Wert darauf gelegt, der Beste zu sein, bei allem, was er machte. 1964 und 1965 war er der schnellste Schwimmer der Universität gewesen, 1968 machte er seinen Doktor mit distinction. Und er war ein ausgezeichneter Fallschirmspringer. »Unser bester Mann«, sagte sein Ausbilder bei der Bundeswehr.
Als ich klein war, sagte Papa immer, daß sein Sohn auch in England studieren sollte, in Oxford, Cambridge oder London. »Hättest du da Lust zu?« fragte er mich in den Ferien an einem Strand in Dänemark, als wir flache Kieselsteine ins Wasser warfen, sie von Welle zu Welle springen ließen. Ich schüttelte den Kopf, stumm wie ein Fisch. Er klopfte mir nur auf die Schulter und lachte: »Das kommt noch, Ben, das kommt schon noch.« Ich hatte da meine Zweifel. Aber immerhin war ich in der dritten Klasse der einzige, der wußte, daß Oxford auf einer Insel liegt.
Ein Jahrzehnt später kam dann ein Brief: We are glad to inform you …, unterschrieben vom Präsidenten von Magdalen College, Oxford University. Mama holte eine Flasche Champagner aus dem Eisfach und umarmte mich. Sagte, wie stolz sie auf mich sei und wie stolz Papa auf mich wäre, hätte er diesen Tag erlebt. Am Abend lud sie Clemens und mich zum Essen in die Paris-Bar auf der Kantstraße ein. Clemens hatte sich in Schale geworfen – Anzug, Weste, Versace-Krawatte mit szenischen Motiven aus der griechischen Mythologie – und spielte unter der weißen, steifgestärkten Damasttischdecke mit meinem Knie.
Hummer, Steinbutt und edle Weine, daß die Kellner mit ihrem französischen Getue feuchte Augen bekamen. Bien sûr, bien sûr, Madame, une autr’ bouteille. Meine Mutter sah ihn dankbar an und bestellte Cheval Blanc zum Fisch. Geld spielte keine Rolle, wenn der Sohn ein gemachter Mann war.
Clemens und ich hatten wenig Appetit. Ich hatte ihn am Nachmittag im Büro angerufen, doch er hatte keine Zeit gehabt für ein Gespräch – ein Meeting und ein Baustellentermin, bis später dann. Dafür redete meine Mutter für drei, prostete uns mit roten Wangen und dem Glas in der Hand zu. Und Clemens’ Augen fragten mich beim doppelten Espresso, ob das nun das Ende wäre. Drei Jahre Oxford-Studium, welche Beziehung würde das überstehen? Unsere etwa? Long-distance, das stand für long time till we meet again.
Ich schrieb mich für P.P.E. ein, Philosophy, Politics, and Economics, und war von Beginn meines Studiums an das, was man in Oxford am meisten haßte: average, mittelmäßig. Mein Englisch war zwar ganz solide; acht Jahre am Zehlendorfer Gymnasium und die Reisen mit meiner Mutter hatten ihre Spuren hinterlassen. Ich verstand das meiste und konnte in Restaurants souverän die Speisekarte interpretieren. Aber es war eine ganz andere Sache, Aufsätze über die Grundfragen der Philosophie, über Logik, Ethik und die Kritik der reinen Vernunft zu verfassen. Ich las Hume im Original und verstand auch beim zweiten Mal nur die Hälfte. And the use of the English tongue in the papers of yours truly was really very bad.
Ich wurde nicht nach meiner Intelligenz beurteilt, sondern nach dem, was ich in Worte fassen konnte, die ich mir Stück für Stück aus Langenscheidts Taschenlexikon herbeisuchte. In meinen Tutorials, den wöchentlichen Besprechungen mit den Professoren, stotterte ich. Alle dachten, ich hätte nicht nur die Sprache, sondern auch das Denkvermögen eines Kindes.
In Economics mußte ich in einem Jahr das aufholen, was die anderen in der Schule längst absolviert hatten; Wirtschaftswissenschaften wurden in Berlin nur an der Universität unterrichtet, nicht am Gymnasium. Es dauerte drei Wochen, bis ich den Unterschied von Mikro- und Makroökonomie, Lektion eins im VWL-Standard-Textbuch, verstanden hatte. Die anderen P.P.E.-Studenten machten klar, daß sie mich für einen Dummen hielten, dumm und harmlos. Von mir borgte keiner einen Essay, wenn er sein Tutorial verpaßt hatte. Drei Kommilitonen waren aus Eton; sie hatten alle innerhalb einer Woche eine Freundin.
Und mir fehlte Clemens. In den ersten Tagen lief ich verstört durch die Gänge von Magdalen College, rauchte eine Zigarette nach der anderen. Die Kollegen schauten auf den Boden, wenn sie mich sahen. The walking chimney, sagten sie, und es dauerte eine Weile, bis ich das Wort in Langenscheidts Taschenlexikon gefunden hatte: »Kamin, Schornstein« war die Übersetzung.
Nach drei Wochen ging ich zum Präsidenten, um ihn von meiner Abreise in Kenntnis zu setzen, um zu sagen: Ich gebe auf. Seine Haushälterin, eine zierliche Dame in Blümchenkleid mit einem Bartschatten auf der Oberlippe, bot mir in seinem Arbeitszimmer Tee an. Feines blau-weißes Porzellan und ein silbernes Milchkännchen. Die Tasse klirrte, wenn ich sie auf dem Schreibtisch absetzte. Ich saß dem Präsidenten gegenüber in einem rotbraunen Ledersessel und heulte wie ein kleines Kind, erzählte ihm von Berlin und von Clemens, meinem Freund
»Your boyfriend?« fragte der Präsident.
Ich nickte.
Der Präsident stand auf, ging zum Fenster und rührte mit einem Silberlöffel langsam seinen Earl Grey um, wobei der kleine Finger der linken Hand steif aufs Fenster gerichtet war. Er hatte etwas von einem Fuchs; über den Rand der Tasse schaute er mich aus armanifarbenen Augen an, stellte den Tee auf dem Fensterbrett ab, strich sich gedankenverloren durch sein silbergraues Haar und zündete eine Zigarette an.
»Well«, sagte er, »ich verstehe Ihre Situation, Benjamin. Aber meinen Sie, Sie könnten es noch für kurze Zeit ertragen? Nur noch für einen Tag, sagen wir bis morgen früh? Schließlich ist nichts so furchtbar, als daß man es nicht noch bis zum Abend mit sich herumtragen könnte.« Er überlegte einen Augenblick und blies einen Rauchring an die Zimmerdecke. »Selbst ein Aufenthalt in Magdalen College nicht.«
Ich sah ihn mit verheulten Augen an, konnte nicht sprechen; mir saß ein Kloß im Hals.
»Nur mir zuliebe.« Er lächelte mich an. Wie ein Vater.
Ich bat ihn um eine Zigarette. Schweigend saßen wir uns gegenüber, bis zwei zerdrückte Kippen in dem silbernen Aschenbecher lagen, direkt auf dem eingravierten Emblem von Magdalen College. Dann nickte ich, und der Präsident nickte auch.
Am nächsten Vormittag klopfte seine Haushälterin an meine Zimmertür und überbrachte mir die zweite Einladung zum Tee. Sie ließ eine Flasche Sherry da, Selected and bottled for Magdalen College, Oxford, die sie auf meinen Koffer stellte, der gepackt in der Mitte des Zimmers stand.
»Wissen Sie, Benjamin«, sagte sie, »es geht mich natürlich nichts an. Aber ich arbeite seit siebzehn Jahren im College und habe bei unseren Studenten so ziemlich alles gesehen, was man bei jungen Menschen an Problemen sehen kann. Und, not to mention, bei den Herren Professoren. Sie dürfen dabei nur eines nicht vergessen: Sie wissen noch nicht, was für eine Gelegenheit Sie vergeuden, wenn Sie hier nach nicht einmal einem Monat wieder abreisen. Andere junge Leute würden ihren linken Arm hergeben, um hier sein zu dürfen, und sind doch nicht hier.«
An diesem Tag fuhr ich allein ans Meer, setzte mich an der Steilküste auf eine Bank. Das Blau des Ärmelkanals reichte bis an den Horizont, bis an den Himmel. Möwen balancierten kreischend in der Luft, beobachteten die Wellen tief unter ihnen und stießen hinab in die Tiefe, kamen mit einem zappelnden Fisch im Schnabel wieder hoch, den sie noch im Fliegen verschluckten. Die wichtigste Entscheidung meines Lebens war ihnen egal.
Für Clemens war die Sache ganz einfach: »Komm zurück«, sagte er am Telefon und meinte: Ordne dein Leben meinem unter. –»Einen Studienplatz in Oxford aufgeben?« fragte meine Mutter trocken. »Unmöglich«, war ihr Kommentar, »und dumm.« Sie war nach meinem Anruf aus allen Wolken gefallen. Und mein Vater hätte vermutlich ähnlich reagiert, wäre er nicht bereits vor sechs Jahren aus den Wolken über dem Südatlantik in den Tod gestürzt. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich wirklich allein; guter Rat war teuer, doch weit und breit war kein guter Ratgeber in Sicht.
»Meinen Sie, Sie könnten es noch für einen Tag ertragen?« fragte der Präsident am nächsten Tag, schaute mich über den Rand seiner Teetasse an. »Nur bis morgen noch?«
Ich nickte. Und dann noch ein weiteres Mal. Und blieb. Für einen Tag, einen zweiten, eine Woche, einen Monat. Ich lernte Englisch. Ein Doktorand wurde gebeten, mir auf Kosten des Colleges Nachhilfe in Economics zu geben. Philosophie gab ich nach einem Studienjahr ab, Hume ging zurück ins Regal. Und ich gab ein kleines Vermögen für die grünen Telefonkarten von British Telecom aus, so viel, daß Clemens mir Geld schicken mußte.
Aber ich blieb.
Ich schaltete den Fernseher ab und schnitt am Küchentisch unserer Wohnung in Berlin Limonen für Gin Tonic, einen Absacker vor dem Schlafengehen, wie Clemens sich ausdrückte, das beruhigte und entspannte. Die Nation war erfolgreich wiedervereint, meine Hemden gebügelt, die Koffer gepackt. Morgen begann mein drittes Studienjahr in England, und damit die nächste Trennung von Clemens. Ich hörte, wie er im Schlafzimmer den Reißverschluß meiner Reisetasche zuzog.
»Fertig, Tiger!« rief er in die Küche, denn er nannte mich Tiger. »Alles ist gepackt.« Schritte im Flur, Socken auf poliertem Pitchpine. »Du darfst morgen früh nur nicht die Zahnbürste vergessen, dann kannst du fahren.« Er nahm ein Glas und ließ sich auf den Rattanhocker neben dem Kühlschrank fallen, schaute mich erwartungsvoll an. Money isn’t everything, schrie die Kühlschranktür in roter Ölfarbe. Die Eiswürfel klirrten in Clemens’ Glas.
Er spielte mit seinem Ring, einem schlichten, goldenen Ehering, drehte ihn über der weißen Haut an der Wurzel des Fingers linksrum, rechtsrum, zog ihn gedankenverloren ab, setzte ihn wieder auf. Vor genau zwei Jahren hatte er ein Paar gekauft, vor meiner ersten Abreise nach Oxford. Als Erinnerungsstück, damit man wußte, wo man hingehörte, auch wenn man nackt war. Clemens hatte unsere Initialen eingravieren lassen und daneben das Datum unserer ersten Begegnung: BC7.ix.1987.
Mein Freund war Architekt, und das mit Erfolg. Sein Metier war für ihn nicht nur Beruf, sondern Berufung. Er hatte ein eigenes Büro in Berlin eröffnet und innerhalb weniger Monate so viele Aufträge erhalten, daß Räumlichkeiten wie Personal bald an die Grenzen des Gutmachbaren gestoßen waren. Ein dank überwältigender Nachfrage in Kreuzberg eingerichtetes zweites, größeres, schöneres Architektenbüro ermöglichte einem jungen Baumeister von Clemens’ Schlage nur wenige Minuten vom Potsdamer Platz entfernt gesunde Gewinne. Und mir die Befriedigung meiner geheimsten Shopping-Lüste: Bücher, kistenweise. Ich kaufte sie schneller, als ich sie ins Regal stellen (geschweige denn lesen) konnte. Es war klar, daß wir bald eine zweite, größere, schönere Wohnung brauchen würden.
Darüber hinaus hatte Clemens genug Spielraum gewonnen, um aus den vorliegenden Vertragsangeboten die Rosinen herauszupicken – ging es jetzt doch darum, die neue alte Hauptstadt als solche zu erkennen zu geben, während im Osten noch die Einschußkrater des Zweiten Weltkriegs das Mauerwerk der Häuser zierten. Und die weniger vielversprechenden Vorhaben wurden an befreundete Architekten weitergereicht, die sich zu gegebener Zeit revanchieren mußten. Give and take, das war die unausgesprochene Maxime im Metier der Architekten.
Während seiner Studienjahre an der Hochschule der Künste in der Hardenbergstraße hatte Clemens, Weisungen seines Professors befolgend, in schöner Regelmäßigkeit abstrakte Projekte entworfen. Ein »Zentrum philosophischen Denkens« gehörte ebenso dazu wie Kuh- und Schweineställe mit Solarzellen auf dem Dach – Entwürfe, die Clemens vorübergehend an der Nützlichkeit der Architekten-Schule hatten zweifeln lassen. Dann war die Wende gekommen, das Eis des kalten Krieges taute über Nacht, und anstelle abstrakter Strukturen verlangte man nun Handfestes, Solides, schlichtquadratische Mietshäuser, Firmendomizile, Verwaltungsgebäude, achtstöckige Büroblocks. An dieser Rückbesinnung auf das wirklich Nützliche nahm Clemens in vollem Umfang und gewinnbringend teil, baute hier und sanierte dort. Kurz: Clemens hatte sich am rechten Ort zur rechten Zeit als erfolgreicher Geschäftsmann etabliert.
Disziplin und Tüchtigkeit ergänzte ein angenehmes Äußeres, so daß Clemens an und für sich als gute Junggesellenpartie durchging. Dunkelblond, fitneßstudioschlank, einsvierundachtzig, vierundsiebzig Kilo, mit braunen Bambi-Augen und gesunder Müsli-Haut, die innerhalb weniger Sonnentage bräunte. Die Blicke, die ihm beim Bummel durch die Einkaufsstraßen Berlins und Oxfords zufielen, bestätigten das. Er war sechsunddreißig, sechzehn Jahre älter als ich.
Nur einen kleinen Mangel konnte man finden, wenn man es darauf anlegte: das Fehlen von Originalität. Ein Zusammenspiel von Schönheit und Glattheit, das ein wenig an das Aussehen der Models im Otto-Katalog erinnerte, in dem junge Männer mit layoutgeweißten Zähnen und Waschbrettbäuchen in makelloser Feinrippunterwäsche mit Eingriff Kunden und Kundinnen anlächelten, Fantasiegebilde frustrierter Fünfzigjähriger. Die Art von Schönheit, die nur kostbar ist, solange man sie nicht im Bett neben sich hat.
Ich mußte gähnen. »Immer dasselbe, Clemens. Abschied im Januar, Abschied im April, Abschied im Oktober.«
Clemens schaute auf den Boden. »Es ist nur noch ein Jahr, Tiger, dann ist es geschafft.«
»Bitte nenn mich nicht ›Tiger‹. Ben. Ich heiße Ben, nicht Tiger.«
»Ja, ja, ja.« Er nahm mich in seine Arme, gab mir einen Kuß auf die Wange. »Du hast ja recht, Benjamin. Soll ich dir noch die rote Baseballkappe einpacken?«
»Bitte. Warum starrst du mich eigentlich so an, Clemens?«
Grübchen an den Wangen grinsten mich an. »Gehen wir ins Bett, Tiger?«
»Jetzt gleich? Ich bin noch gar nicht müde.«
»Du sollst auch noch nicht schlafen.« Er griff nach meiner Hand und zog mich am Ringfinger ins Schlafzimmer. »Komm.«
– Am frühen Morgen, als die Handwerker die Tribünen auf dem Reichstagsgelände wieder abbauten, machten wir einen letzten Spaziergang durch die Straßen von Charlottenburg, begleitet von vereinzelten Männerstimmen, die grölend die Häuserschluchten füllten, als die wiedervereinten Bürger ihre neugefundene Solidarität in den letzten Biergläsern ertränkten. Meine Sachen waren gepackt. Flugticket und Reisepaß lagen bereit. In ein paar Stunden würde die Putzfrau kommen und die Unordnung der letzten Tage beseitigen. Clemens würde mich nach Tegel fahren, dann weiter ins Büro, und sich eine Woche lang abends verabreden, um nicht alleine in der Wohnung zu sein, zu groß für weniger als ein Paar.
Vor meinem ersten Abflug nach Heathrow, im Jahr vor dem Mauerfall, hatte ich geheult, beim Schließen der Wohnungstür, beim Heruntertragen der Koffer, beim Umarmen mit Clemens auf dem Bürgersteig. All packed and ready to go, am einsamsten fühlt man sich beim Abschied.
In der Hand hielt ich ein Foto. Meine Mutter lachte rechts, Clemens links, ich in der Mitte. Das war unser erster Abend gewesen. »Sehr gutaussehend«, hatte meine Freundin Ida gesagt, als sie die Aufnahme auf meinem Schreibtisch in Oxford liegen sah. Im ersten Moment hielt sie Clemens für meinen Vater. Der Taxifahrer gab mir ein Tempo-Taschentuch. Bis zur Abfertigungshalle in Tegel starrte er auf das Auto vor ihm und ich auf das Foto auf meinem Schoß.
Ida liebte Flughäfen und -reisen. »Die Abfluglounge ist der Eingang in die große weite Welt«, hatte sie einmal gesagt und ihre Arme mit dem klimpernden, sündhaft teuren Silberschmuck weit ausgebreitet. »Dann nimmst du Platz, schaust aus dem Fenster, zählst die immer kleiner werdenden Menschen unter dir und bestellst ein Glas Champagner. Herrlich!«
Mit Champagner war es bei mir nicht getan, ich benötigte stärkere Medizin. Sobald ich meine Bordkarte erhalten und Paß- und Gepäckkontrolle hinter mir hatte, ging ich an die nächstbeste Bar. Die Kellner schauten auf ihre Armbanduhr, wenn ich einen doppelten Gin Tonic bestellte. Elf Uhr morgens und schon im Suff, ein trauriger Fall, dachten die, und noch so jung.
Was wußten sie schon? Wer Flugangst hat, ist ein Einzelkämpfer im Dschungel. Gehören Airbus und Boeing im MTV-Zeitalter nicht zum Lifestyle wie Kondom und Laptop, den Selbstverständlichkeiten der Postmoderne? Ein Versager, wer Flugreisen nicht genießen kann, ein Feigling, wer Angst davor hat. The sky’s the limit. Just do it. Als ich sieben oder acht war, hatte Papa mich in einer Sportmaschine mitgenommen. Er wollte mir zeigen, was er konnte. Loopings zum Beispiel, den Aufstieg senkrecht in die Sonne, den Sturzflug im freien Fall. Er war in eine Wolke geflogen, hatte mir zugezwinkert. Dann stellte er den Motor aus. Der Gurt schnitt in meinen Hals, als wir fielen. Schnapp, machte der Schlüssel, als Papa ihn im Zündschloß drehte. Der Motor schwieg; nur mein Vater fluchte. Wir fielen eine Ewigkeit.
– Die Landung war bilderbuchreif. Papa hatte nur gespielt, mich ärgern wollen, meine Reaktion testen. Unter den Wolken war der Motor mit einem Stottern wieder angesprungen. Papa hatte gelacht. »Und?« fragte meine Mutter, die uns abholte. »Hat’s dir gefallen?« Ich nickte. Aber Papas Flugzeug roch wochenlang nach Urin.
Seitdem hatte ich Angst. Sie kam wie ein schwarzer Schleier, wenn ich eine Flughafenhalle betrat. Am schlimmsten war es beim Abflug, wenn ich dem Piloten ausgeliefert war, die Turbinen mich in den Sitz am Notausgang drückten. Dann preßte ich die Augenlider zusammen. Herrlich, hörte ich Ida mit ausgebreiteten Armen sagen, an denen Silberschmuck klimperte. Meine Hände hinterließen Schweißabdrücke auf den Lehnen, als die Maschine über die Startbahn donnerte, immer schneller, immer lauter, und sich der Stahlrumpf steil gen Himmel streckte. Die Babys an Bord begannen zu schreien. Ihre kleinen Mägen zogen sich zusammen, da half auch das beruhigende Flüstern der Mütter nichts. Fliegen ist im Bauplan des Menschen nicht vorgesehen, Panik sehr wohl, vor allem, wenn man das angestammte Element zehn Kilometer unter sich läßt. Ich hätte auch gerne geschrien, aber dafür war ich zu alt.
Dann begann das Warten. Eineinhalb Stunden Flugzeit, hatte der Pilot gesagt. Im Raucherabteil zählte ich die Minuten über der Nordsee, über Essex, über London. Der Steward fragte, ob ich eine Tablette wollte. Wir waren die peinlichste Reihe im Flugzeug: Ich schneuzte mich nonstop, und die Frau neben mir benutzte ein Spucktütchen, der Alptraum eines jeden Flugbegleiters.
Ich rührte das Tablett mit Hühnchenbrust in Curry- und Dessertschaum in Kirschsoße (mit ganzen Früchten) nicht an. Die Worte der Zeitung in meiner Hand ergaben keinen Sinn. Ich bestellte noch einen Drink, zündete eine zollfreie Zigarette nach der anderen an, bis der Pilot mich per Lautsprecher bat, das Rauchen einzustellen und die Sitzlehne hochzuklappen.
»Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Flug«, lächelten die Stewardessen. Das nun nicht gerade; aber vermutlich hatte Ida recht: »Wenn man von einem Leben ins andere geht«, sagte sie, »dann soll man es so schnell wie möglich tun, Ben. Also stell dich nicht so an.« Und das war das.
Der Bus aus Heathrow schwenkte von St. Clement’s auf den Kreisverkehr am östlichen Ende der Innenstadt ein. Der Turm von Magdalen College, versteinerte Gotik vor strahlend-blauem Vormittagshimmel, wartete am Eingang der Stadt auf meine Ankunft. Neben mir saß ein Professor der Demographie aus Paris, der während der Fahrt eine Stunde und 27 Minuten lang vom Maghreb geschwärmt hatte, einer Gegend am Rande der Sahara, die Fruchtbarkeit im Menschen, nicht aber in der Pflanzenwelt hervorruft. Das höchste Fertility-Gefälle der Welt bestünde zwischen Südeuropa und Nordafrika, sagte er. Er hieß Leclerc und sprach mit französischem Akzent, wobei er sich, um nicht aus dem Fluß zu kommen, in fast jedem Satz der Redewendung that is to say bediente. Er hatte fauligen Mundgeruch.
»Queen’s Lane, letzter Halt vor Gloucester Green«, rief der Busfahrer in den Gang. Ich packte mein Reisegepäck zusammen, als der Bus an der Pförtnerloge von Magdalen College vorbeifuhr. Verborgen hinter den dunkel getönten Scheiben, erkannte ich einige Gesichter, Studenten meines Jahrgangs, die vor mir aus den Sommerferien zurückgekehrt waren und sich schon wieder dem Rhythmus des Collegelebens ergeben hatten. Die Postausbeute des Tages in den Händen, tauschten sie unter den spitzen Bögen der Lodge die letzten Neuigkeiten aus. Wo man sich die hübsche Hautfarbe geholt hatte, welche Freundschaften geendet und welche sich in den drei Sommermonaten neu aufgetan oder vertieft hatten und was sonst von allgemeinem Interesse war.
Ich verabschiedete mich von Professor Leclerc. Er nickte mir zu und wünschte mir viel Erfolg im neuen Studienjahr. »Und im Examen natürlich, das ist ja nun bald. Und kommen Sie in meine Vorlesung. Jeden Donnerstag, morgens um neun in Examination Schools. Wissen Sie, wo ich meine?«
»Im Vorlesungssaal.«
»Genau.«
»Ich bin schon gelegentlich da gewesen.«
»Es geht um Völkerkundliches. That is to say, Geburtenraten, Sterberaten, Lebenserwartung – ganz faszinierende Sachen!«
Hier war sie wieder. Oxford, Stadt der Gelehrsamkeit, Stadt der Genies. Sprungbrett in ein erfolgreiches Leben für die Crème der Jugend der Welt. Ruhm. Geld. Eine Karriere in der City. Toll, wenn man selber ein Genie ist; nicht so toll für die anderen, die Fußmatten, die man nur allzugerne übersah. Der Mythos wollte schließlich bewahrt sein.
Ich stellte mein Gepäck auf den Bürgersteig. Ein Schild der Lufthansa klebte auf dem Koffer, ein weißes Weinglas auf rosafarbenem Grund; Fragile!, stand darunter, handle with care. November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni – acht Monate bis Buffalo.
Die Patina der Kupferkuppel von Queen’s College war noch eine Spur grüner als im Juni, die Stufen, die zum Tor von University College hinaufführten, einige zehntausend Schritte ausgetretener. High Street roch noch eine Spur intensiver nach Abgasen, den schwarzen Dieselnebeln der roten Doppeldeckerbusse, die sich in den Kurven bedrohlich zur Seite neigten. Fast hatte ich gehofft, nach drei Monaten Abwesenheit ein anderes Oxford wiederzufinden, aber nichts hatte sich verändert. Die Stadt mit den drei Baedeker-Sternen atmete noch immer Unvergänglichkeit, hauptberuflich, und begann nach den Sommerferien mit unbeeindruckter Gleichmut das Michaelmas-Trimester, das erste Drittel des neuen akademischen Jahres.
Ich nahm mein Reisegepäck und überquerte die Straße in einem Hupkonzert. Während des Sommers war mir das Berliner Links-Rechts-Links wieder ins Blut übergegangen. Auf High Street schaute ich also links, ein schwarzes Taxi quietschte und kam direkt vor mir zu stehen, der Fahrer schüttelte den Kopf und gestikulierte mit seinen Händen. Das verstand man auch ohne Langenscheidt. Winston Churchill war während eines Aufenthalts in Amerika einmal ein ähnlicher Fehler unterlaufen. Rechts-Links-Rechts. Was seinen Aufenthalt dort erheblich verlängert und die Umsätze der New Yorker Blumenhändler in die Höhe getrieben hatte. Ich rettete mich auf den Bürgersteig und ging, den Koffer in einer Hand, die Reisetasche in der anderen, High Street hinunter. Vorbei am Queen’s Lane Coffee House und an Parmenter’s Sandwichbar, wo die besten Schnitten der Stadt jeden Sommer scharenweise Touristen anzogen, seit ein Gault-Millau-Testesser dort in ein Gurkenbrot gebissen hatte.
Am unteren Ende der Straße thronte Magdalen College: der Turm, die Giebel und Bögen des Klostergangs, die spitzen Türme der Kapelle, die Kastanie zwischen Kreuzgang und New Buildings, deren Krone die Dächer überragte, die Zinnen der Collegemauern. Überall hatte sich der Wein in rote, harte, elastische Blätter verwandelt, die vom Wind wie in Wellen bewegt wurden. Hier und da waren sie noch grün, aber der Herbst hatte in Oxford Einzug gehalten. Die Tauben zogen ihre Kreise, und die Kastanien fielen mit einem dumpfen Geräusch auf die Gehwege und platzten. Conkers war das erste Wort gewesen, das ich vor zwei Jahren hier gelernt hatte; und conk-conk, conk-conk, fielen seitdem die Kastanien. Wie das Ticken einer Uhr. Es wurde wieder einmal Winter. Mein letzter Winter in England.
Ich hatte Clemens kurz nach meinem Coming-out in einer Berliner Schwulenkneipe kennengelernt. Meine Mutter war während unserer zweiwöchigen Flirtphase aufgeregter als ich: der erste Freund ihres ersten Sohns, des einzigen Kindes! Ende der Pubertäts-Pickel, Beginn des Erwachsenseins. Schade natürlich, daß ich kein Mädchen nach Hause brachte. Aber sie konnte die Sehnsucht nach einem Mann gut verstehen. Sie hätte auch gerne einen gehabt, noch dazu einen so gutaussehenden.
Unser erstes Rendezvous fand im Loire statt, einem Restaurant mit französischer Küche beim Charlottenburger Schloß, das Clemens vorgeschlagen hatte. Mit meinen knapp achtzehn Jahren war ich denkbar unangemessen angezogen. Es war nicht nur die Krawatte, die fehlte, sondern mehr noch die mit sechs Taschen an den Beinen besetzte olivgrüne Armeehose, die ich zu diesem Zeitpunkt besonders attraktiv fand. Auch die Springerstiefel fanden nicht das Wohlwollen des Oberkellners, der mir den Katzentisch gleich bei den Toiletten gab. »Ein Glas Rotwein« bestellte ich und überließ ihm mangels einschlägiger Fachkenntnisse die Auswahl.
Als Clemens kam, setzten wir uns um. Sein dunkelblauer Anzug, die goldenen Manschettenknöpfe, der perfekt sitzende Schlips, die manikürten Fingernägel verlangten nach einem besseren Platz, einem Tisch mit Aussicht. Der Oberkellner entschuldigte sich sogar bei mir, ein Versehen, pardon, und schrieb »Austern 24« auf seinen Notizblock. Clemens forderte mich zum Schwelgen auf. Wine them, dine them, sixty-nine them, das wirkte so gut wie immer. Noch nie hatte mich ein Mann so durchdringend angesehen wie er, noch nie hatte ich das Gefühl gehabt, so ernstgenommen zu werden, so erwachsen zu sein. Ich hatte nie gelernt zu flirten; es schien ein Instinkt zu sein, der an einem Berliner Restauranttisch endlich den Schritt vom Unbewußten in den Alltag wagte und in der Region unter meinem Bauchnabel ein wohlig-flaues Gefühl hinterließ.
Als Clemens mir beim Bezahlen der Rechnung mit einem Auge zuzwinkerte, war ich in ihn verliebt.
»Also?« fragte meine Mutter am nächsten Morgen. Sie saß beim Kaffee-und-Zigarette-Frühstück in der Küche, als ich nach Hause kam und aus dem Mund nach Alkohol roch. »War es vielversprechend?«
»Ja«, sagte ich, »natürlich.« Wenn man vorher noch nie verliebt war, denkt man das nach einem guten Essen.
Ich ließ High Street hinter mir und tauchte zwei Stufen hinab ins Pförtnerhaus von Magdalen College. Die Porters’ Lodge überblickte das Eingangstor des Colleges. Hier mußte jeder Besucher hindurch, egal, ob Student oder nicht. Es stellte für Touristen, die während der Sommermonate in Scharen von venezianischen Ausmaßen in Oxford einfielen, eine Barriere dar und für manche ein unüberwindliches Hindernis. Bemannt mit vier Pförtnern, war die Lodge unser Burgtor, zugleich Postamt und Schlüsseldienst, Erste-Hilfe-Lazarett, Teesalon, Feldbett.
Welche Qualifikationen man für den Wachdienst mitbringen mußte, war umstritten. Es gab einen ehemaligen Polizisten, einen gescheiterten Gelehrten der theologischen Fachschaft, einen Ex-Piloten der Royal Air Force, den Gatten einer College-Putzfrau mit dicken Warzen im Gesicht, aus denen schwarze Haare wuchsen, kurz: Männer aus den verschiedensten Bereichen des Lebens; doch was sie in diesem überheizten und verrauchten Raum zusammengeführt hatte, wußte niemand genau. Nur ihre Leibesfülle hatten John Jack James Elias gemeinsam. Und die Uniform: hellblaues Hemd, dunkelblaue Hose, die Krawatte mit dem Wappen des Colleges, weiße Lilien auf schwarzem Grund. Es war unmöglich, an ihnen unbemerkt vorbeizukommen, und Studenten ergriffen häufig unkonventionelle Maßnahmen, um die Mauern des Colleges nach Mitternacht hinter sich zu lassen, sei es durch das Nachttor in Longwall Street oder, hatte man seinen Schlüsselbund vergessen, über den Mülltonnenunterstand neben der Bibliothek, der in greifbarer Nähe des Mauererkers plaziert war.
Ich ließ Koffer und Reisetasche vor dem Notizbrett des Rudervereins am Eingang stehen und betrat die Lodge, wo mich der bekannte Dunst aus Körpergeruch und abgestandenem Rauch einhüllte. Ich hielt die Luft an, nahm die Post aus meinem Fach, einen Brief mit dem Stempel von Barclays Bank und eine Postkarte von Clemens, die er schon vor einer Woche abgeschickt haben mußte, damit sie mich pünktlich zum Beginn des Trimesters erreichte. Dreieinhalb Worte: »Kopf hoch, Dein C.«, rührend.
»Welcome back, junger Mann!« rief einer der Pförtner hinter mir. Ich drehte mich um, begrüßte ihn – es war Warzen-Jack – und erstattete ihm den gewünschten Kurzbericht zur Lage der Nation im wiedervereinten Deutschland, woraufhin er wissend und verständnisvoll nickte. Er hätte sich das schon so gedacht. Dann entschied er, daß wir genug Konversation betrieben hatten, um zu wichtigeren Dingen zu kommen, setzte seine Brille auf, die an einer Kette um den Hals hing, und blätterte in einem dicken grünen Notizbuch mit der Aufschrift Student Accommodation, wobei er bei jeder neuen Seite seinen Zeigefinger an den Lippen befeuchtete.
»Hier!« Mit einem Kugelschreiber machte er einen Haken hinter meinem Namen. »Cloisters Attic Nummer neun. Sie haben Glück, junger Mann, alle Zimmer oben im Klostergang sind im Sommer renoviert worden, komplett von Grund auf.«
Er nahm seine Brille ab und blickte mich erwartungsvoll an, als hätte er selber die Waschbecken installiert.
»Wunderschön, mit Blick auf die Gärten und Addison’s Walk und die Hirsche, ganz wunderschön. Richtige kleine Liebesnester, hat meine Frau gesagt, Pecky.« Er zwinkerte mir zu. »Warten Sie, ich hole eben die Schlüssel.«
Es dauert Monate, bis man in Worte fassen kann, daß eine langjährige Freundschaft ins stille Wasser geraten ist. Die Routinen der Tage und Nächte, der Wochen, der Jahre ersticken die Zweifel am liebgewonnenen Stundenplan in einer zähen Lehmschicht aus Sicherheitsdenken: Frühstück am Morgen, Sex nach der Tagesschau, am Wochenende ein Ausflug ans Meer, im Juli drei Wochen Urlaub in Italien, und im nächsten Jahr fahren wir an die Côte d’Azur, denn im Salzkammergut waren wir schon – die planbare, risikolose Lebensversicherung einer glücklichen, ereignislosen Partnerschaft bis ins hohe Alter. Nach Jahren der Regelmäßigkeit mutiert man zwangsläufig zum Konservativen, Bewahrenden, Passiven.
Es sprach vieles für meine Freundschaft mit Clemens, für ein Leben voller Spielzeug aus dem Designerkatalog: die Gaggenau-Küche, der Alessi-Kessel, die Anlage von Bang & Olufsen, die Fliesen im Bad von Villeroy & Boch, bis auf die in der Gästetoilette, die ihre Nutznießer in weißem Marmor erfreute; unsere Lebensqualität bestand aus Marken-Labels erster Güte.
Doch ich ahnte, selbst ohne Vergleiche mit anderen Männern ziehen zu können, daß ich nicht im Nirwana weilte. In einem Zwölf-Gänge-Menü, in dem ich schon vor dem Hauptgang satt war, hatte man mich an einen Stuhl gefesselt, während Teller und Terrinen und Schüsseln und Platten in unendlicher Folge aufgetragen wurden. Man stopfte mich wie eine Mastgans, und Clemens sagte: »Iß!« Allein der Anblick der Üppigkeit machte mich krank; ist man satt, werden kulinarische Köstlichkeiten zu Folterinstrumenten.
Die Zweifel an unserem hausgemachten Idyll legte ich in die späten Abendstunden, wenn ich wach neben Clemens im Bett lag und im Dunkeln die Zimmerdecke studierte. Fünf Minuten täglich dauerte die Reise ins Grüblerische – zu wenig, um folgenreiche Entscheidungen zu treffen. Doch in den Minuten vor dem Einschlafen auf dem Kopfkissen hatte ich zum ersten Mal die goldenen Gitterstäbe um mich herum gesehen und zum ersten Mal den Gott der Routine nicht um Erlaubnis gefragt, den wahnwitzigen Gedanken denken zu dürfen, der seit Monaten Einlaß forderte: daß mein Käfig in einem Zimmer stand, daß es weitere Räume und Fenster in diesem Haus gab; einen Garten, Gerüche; eine Pforte, Abenteuer; eine grenzenlose, unentdeckte Welt, Sehnsucht; einen Himmel, Leidenschaft.
Die Steinstufen, die vom Klostergang zu den Liebesnestern unterm Dach hinaufführten, waren so steil und eng, daß ich meinen Koffer nur mit Mühe und Schrammen und außer Atem in das zweite Obergeschoß befördern konnte. Ich stellte mein Gepäck vor die Tür mit der Nummer neun, wischte die Haare aus dem Gesicht und zog die beiden Schlüssel, die mir der Pförtner ausgehändigt hatte, aus der Hosentasche. Im Zuge der Ausbesserungsarbeiten in Cloisters Attic hatte man nicht vergessen, die Schlösser zu ölen. Der Bolzen versenkte sich satt schnappend im Türblatt, die Tür öffnete sich lautlos nach innen.
Das Zimmer für mein letztes Jahr in Oxford: eine Dachstube mit dicken, tiefhängenden Eichenbalken. Rechts ein Kamin, in dem mein Koffer mühelos Platz gefunden hätte, wenn die Hausmeister dort nicht schon armdicke Holzscheite für den ersten Winterfrost aufgebaut hätten. Das Fenster mit Bleirahmen und gelben Glasscheiben, die das eindringende Licht trübten und die Bilder der Außenwelt aufweichten. Davor eine hölzerne Sitzbank, eine Art Alkoven. An der dem Kamin gegenüberliegenden Wand stand ein rötlich-brauner, von jahrzehntelanger Benutzung gedunkelter Kleiderschrank, und daneben ein Ledersessel, aus dessen Armlehnen Strohhalme und gelber Schaumstoff hervorquollen. Ein strahlendweißes Waschbecken mit der Aufschrift Made in China zwischen den beiden Wasserhähnen, ein vergrößernder Rasierspiegel aus Chrom. In einer Nische unter zwei Eichenbalken das Bett, dessen Matratze auf der Höhe meiner Hüfte lag. Das Holzparkett ausgetreten von Hunderten von Studentengenerationen, die in diesem Zimmer bereits für ein Jahr gewohnt hatten. Die Dielen hatten sich an einigen Stellen gelöst und klapperten, wenn man auf sie trat. In der Mitte des Zimmers lag ein rot gemusterter Teppich mit Fransen an den Enden und Löchern in der Mitte.
Ich legte meine Taschen auf das Bett, öffnete die Fenster. Die Vormittagssonne warf den Schatten der Streben in das Zimmer. Der Blick ging nach Osten, vorne auf ein flaches, begiebeltes Seitengebäude, die Toiletten des College-Pubs. Unter dem Dachüberstand hingen in regelmäßigem Abstand Steinfiguren, Gesichter, Engelchen und böse Fratzen, die Gargoyles, von denen es allein in Magdalen College einige hundert verschiedene gab, für jeden Studenten einen. Sie sollten böse Geister fernhalten. Was die Tauben nicht davon abhielt, auf ihren Glatzen aus Stein herumzustolzieren und Mutter Natur die Ehre zu erweisen.
Hinter dem Toilettenhaus lag der Park, Addison’s Walk, mit hohen Bäumen und Spazierwegen. Von meinem Bett aus konnte ich die Baumwipfel sehen, die sich im Wind wiegten, und die Stämme knarren hören. Eichhörnchen bevölkerten den Park, rannten über Gras und Fußwege und an den Stämmen herauf und herunter. Hinter dem Cherwell, jenseits der Magdalen-Brücke, begann Cowley, eines der düster-grauen Arbeiterviertel der Stadt, in dem seit einigen Jahren auch Studenten wohnten, angelockt von der Nähe zur Stadt und niedrigen Preisen. Ein leises Echo des Verkehrs auf Iffley Road und St. Clement’s drang herüber in mein Dachzimmer, aber es war zu schwach, um die Ruhe und Abgeschiedenheit des Klostergangs zu stören.
Das Zimmer begann sich mit den wertlosen, aber angenehm-vertrauten Dingen aus meinem Koffer zu füllen. Zwei Stapel Bücher, die ich aus Berlin mitgebracht hatte, verstaute ich auf einem Eichenbalken, Zahnbürste, Rasierklingen und After Shave auf dem chinesischen Handbecken. Hosen, Wollpullover für den Winter, Stiefel und Schlittschuhe in den Schrank. Meine rote Baseballkappe mit dem Morgenmantel an den Kleiderhaken. Alle weiteren Dinge, die sich in meinen ersten beiden Jahren in Oxford angesammelt hatten, waren während der Sommermonate in einer der unzähligen Putzkammern des Colleges untergebracht.
Das Spülgeräusch einer Toilette nebenan. Es gab Nachbarn, und ich begann, die unmittelbare Umgebung zu erkunden. Links von meinem Zimmer befand sich das Studentengemeinschaftsklo der Etage mit angeschlossener Dusche, rechts der Treppenaufgang und gleich darunter der Junior Common Room, kurz J.C.R., der nicht nur als kommunales Fernsehzimmer diente, sondern darüber hinaus – dies war mir aus den ersten zwei Jahren in Magdalen nur allzu bekannt – einmal wöchentlich als Partyraum der örtlichen Housegemeinde, zu deren Mitgliedern ich nicht zählte. Unten, wo die Steintreppe auf den Kreuzgang stieß, war der Tante-Emma-Laden des J.C.R. untergebracht, in dem man die für das Studentenleben notwendigen Dinge kaufen konnte, in erster Linie Instantkaffee und Zigaretten. Emma hieß allerdings Dorothy.
Sie saß hinter der Verkaufstheke, eine brünette Mittdreißigerin und die geduldigste Zuhörerin der Welt, kämmte ihr Haar mit einer Bürste und lächelte breit und gutmütig, als ich unter der klingelnden Türglocke eintrat. Den Sommer über hatte sie sich ausschließlich ihren Kindern sowie dem Alkoholismus ihres Gatten gewidmet und schilderte mir anläßlich unseres Wiedersehens die Symptome einer offenbar unheilbaren Krankheit, unter der ihr Jüngster zu leiden hätte, allerdings ohne sich an den genauen Namen der Heimsuchung erinnern zu können. Und ich solle mich ruhig selbst bedienen, ich wisse ja, wo alles stehe.
Hinter dem Tresen packte ich Teebeutel in einen Einkaufskorb, einen halben Liter Milch, einen Snickers-Schokoladenriegel und ein Glas Nescafé-Goldblend-Instantkaffee. Nein, gesund war das nicht, und es gab Momente, da forderte der Italiener in mir einen anständigen Espresso als Zugeständnis an die Errungenschaften der Zivilisation. Doch erstens waren Kaffeemaschinen (nicht jedoch Wasserkocher) auf Studentenzimmern wegen der Brandgefahr durch Kurzschluß verboten. Zweitens sind sieben von acht in England servierten Tassen Kaffee nach der Instantmethode zubereitet. Und drittens: Man sollte sich als Gast in der Fremde immer den örtlichen Gegebenheiten anpassen.