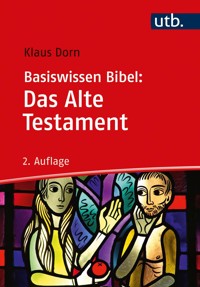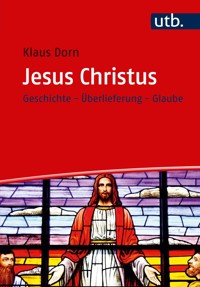
19,99 €
19,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hier geht es nicht darum, eine historische Gestalt genauestens zu rekonstruieren. Vielmehr wird versucht, sich Jesus anzunähern: In welcher Zeit hat er gelebt? Wem ist er begegnet? Welche Botschaft hat er weitergetragen? Was haben die Menschen über ihn gesagt und geschrieben? Es wird zudem danach gefragt, was es heißt, an ihn zu glauben. Denn ein Buch über Jesus ist auch ein Bekenntnis.
Das E-Book können Sie in einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützt:
Veröffentlichungsjahr: 2018
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.