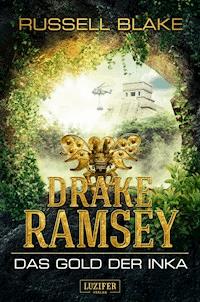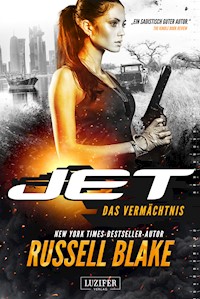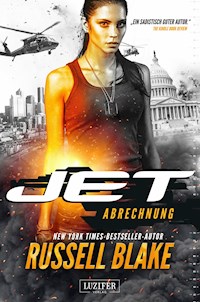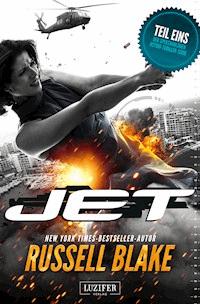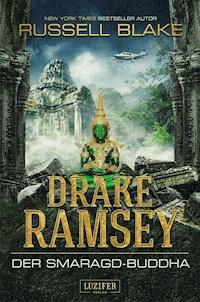Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: JET
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
"Spannung bis zur letzten Seite!" [Lesermeinung] "Das war mal wieder ein Action-Thriller der spannenden Art. Bitte, bitte mehr davon." [Lesermeinung] Inhalt: Die achtundzwanzigjährige Jet, ehemalige Mossad-Agentin aus dem gleichnamigen Roman JET, stellt sich einem beinahe chancenlosen, tödlichen Kampf, um die zu schützen, die sie liebt; einen Kampf von Nebraska bis zu den Zentren der Macht in Washington, von den Straßen Bangkoks bis in den Dschungel von Laos. Fans von Kill Bill, der Bourne-Trilogie und 24 werden ihre helle Freude an dieser wilden Achterbahnfahrt aus Action, Intrige und Spannung haben. Dies ist der zweite Roman der JET-Serie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalte
JET 2 - Verraten
Copyright
Lesermeinungen
Impressum
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Der Autor
Leseprobe
Der LUZIFER Verlag
JET 2 - VERRATEN
Russell Blake
übersetzt von Christian Siege
Copyright © 2012 by Russell Blake
All rights reserved. No part of this book may be used, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the written permission of the publisher, except where permitted by law, or in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews.For information, contact: [email protected].
By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc.350 Fifth Avenue. Suite 5300 New York, NY 10118 USA
Lesermeinungen:
»Krachen muss es, unterhalten muss es und das tut Jet mit Bravour.« [SmilingKatinka, lovelybooks]
»Kurzweilig und spannend - gelungene Fortsetzung! Gut gefallen hat mir der zunehmende Spannungsbogen und das immer höher werdende Tempo. In Verbindung mit jeder Menge Action wird so kurzweiliger Lesespaß geboten. Die Rahmenhandlung ist stimmig, Sprachstil und Erzählstruktur passen.« [Amazon Leser]
»Tolle Protagonistin, spannende Story, zu keiner Sekunde langweilig!!!« [Amazon Leser]
»Action und Spannung ohne Ende. Bitte, bitte mehr davon.« [Amazon Leser]
Impressum
ISBN E-Book: 978-3-95835-076-2
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen und senden Ihnen kostenlos einen korrigierten Titel.
Liebe Leser, der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Vorwort
JET 2 – Verratenist ein Werk reiner Fiktion und geht daher reichlich locker mit zahlreichen Aspekten der Wahrheit um, so auch mit der Beschreibung Thailands und seiner Sexindustrie. Um gegenüber der guten Bevölkerung Thailands fair zu bleiben: Wenn die sogenannten Ping-Pong-Klubs auch zahlreich auf YouTube und per Google zu finden sind, sind sie nahe Nana längst nicht so zahlreich vertreten, wie ich angebe – man muss schon andere Viertel besuchen, um derartige Etablissements ausfindig zu machen. Auch ist Pädophilie nicht so verbreitet – mir wurde versichert, dass sich Vorgänge in diesem Zusammenhang größtenteils in Pattaya abspielen und nicht in Bangkok, außerdem soll die Polizei eine Null-Toleranz-Politik hierbei verfolgen. Wie dem aber auch sei, es gibt dennoch widersprüchliche Angaben, nach denen 40 % der Prostituierten in Thailand minderjährig sein sollen, also bewegt sich die Wahrheit vielleicht irgendwo zwischen den Aufschreien der Art »Ich bin schockiert, welche Zustände hier herrschen« und den sicherlich entsetzlichen und übertriebenen Aussagen auf der anderen Seite. Was auch immer eure Meinung dazu ist, in allen unterprivilegierten Ländern sind Sklaverei und Kinderprostitution ein erhebliches Problem. Während meine Darstellungen wie Sensationsmache scheinen mögen, sind sie nicht dem Bereich der Fantasie zuzuordnen – ich wünschte jedoch, es wären nur meine Erfindungen.
Damit ihr die größtmögliche Freude an dem Buch habt, nehmt keine meiner Darstellungen von irgendetwas wörtlich und vergesst nicht, dass alles nur Fiktion ist, die zu eurer Unterhaltung dient. Stellt also eure Entrüstung draußen vor der Tür ab, dann kommen wir bestens miteinander zurecht. Vor allem aber genießt die Reise – 100 % wahrheitsgetreu oder nicht, es ist alles nur dazu gedacht, euch mit Warpgeschwindigkeit auf den Weg zu schicken und ich hoffe, das wird gelingen.
Kapitel 1
Gordon stupste seinen schlafenden Begleiter an. »Doug. Wach auf.« Dougs Kinnlade hing herunter auf sein schmutziges, militärgrünes T-Shirt, das von der schwülen Hitze der Nacht durchgeschwitzt war. Gordon stieß ihn noch einmal mit dem Ellbogen an. Doug schüttelte sich, hob den Kopf und öffnete ein trübes Auge einen schmalen Spalt weit. »Was?« »Psst. Sei leise«, zischte Gordon. »Wir wollen doch die Wachen nicht auf uns aufmerksam machen.« Er verlagerte seine in Tarnfarben gekleideten Beine im Schlamm und der welken Flora, dann betrachtete er die Wade seines Partners, wo ein schmutziger Verband um eine eitrige Schusswunde unterhalb der am Knie abgeschnittenen Hose gebunden war. Der rostrote Fleck getrockneten Blutes auf der Bandage wimmelte vor Ameisen, welche die einst weiße Mullbinde erkundeten. Doug war blass und sein Körper kämpfte hart gegen Infektion und Fieber. Dass keiner der beiden in den vergangenen zwei Tagen etwas gegessen hatte und sie nur alle vier Stunden Wasser bekamen, kam erschwerend hinzu. Der Dschungel in den südlichen Hügeln von Myanmar war immerzu schonungslos grausam – wenn die Männer nicht von ihren Kidnappern getötet wurden, dann schon bald von der Natur. »Meine Hände sind fast frei«, flüsterte Gordon. »Rutsch herüber, damit ich deine Fesseln lockern kann.« Beide Männer waren mit auf den Rücken gefesselten Händen an einen Pfahl gebunden, der am Rand einer Lichtung in den Boden gerammt war. Eine harsche, aber effektive Art des Festhaltens – außerdem gab es nicht viele Orte, an die man sich hätte davonmachen können. Das Goldene Dreieck war ein gesetzloses Gebiet, das sich von Myanmar bis nach Vietnam erstreckte und einen Teil von Laos und Nordthailand umfasste. Abgesehen von gelegentlichen Dörfern, wo Einheimische in erbärmlicher Armut lebten, war dieses Gebiet ein Flickenteppich aus Dschungel und Schlafmohnfeldern. »Wie?«, fragte Doug schwach, aber immer noch zu laut für Gordons Geschmack. »Sei still. Rück einfach ein Stück näher heran. Und sei ruhig.« Doug gehorchte und rückte zentimeterweise so hinüber, dass Gordon seine Handgelenke erreichen konnte. Die Nacht war dunkel, aber ein Streifen Mondlicht, der oben durch die Bäume schien, spendete genug Licht, um Dougs ausgemergelte Züge zu beleuchten. Mit einem Blick nach rechts konnte Gordon die Zelte des Kernlagers auf der Lichtung und die wenigen grob aufgestellten Hütten nahe des Waldrands ausmachen, gleich bei einem der zahllosen Flüsse in den Hügeln des Shan-Staates, der an Laos und Thailand grenzte. Gordon sägte mit einem scharfen Bambussplitter an dem Seil, den er unten vom Pfahl gelöst hatte. Seine Hände bluteten, wo die scharfe Kante die Haut aufgerissen hatte, was ihm aber egal war. Wenn sie es nicht schafften, zu entkommen, würden sie sterben. So einfach war das. Er vermutete, dass es ungefähr ein Uhr morgens war. Die Sonne war vor mindestens fünf Stunden untergegangen. Obwohl sein Zeitgefühl wegen Dehydrierung, Hunger und der im Freien verbrachten Zeit etwas durcheinandergeraten war, konnte er das einigermaßen schätzen. Sie wurden sogar während der unvermeidlichen, regelmäßigen Regengüsse draußen gelassen, wo die Bergluft mit der Zeit die Feuchtigkeit auf ihrer nassen Haut trocknete, aber auch Moskitos mitbrachte, die um sie schwärmten. Er war so oft gestochen worden, dass jeder Flecken unbedeckter Haut rot geschwollen war, genau wie bei Doug. Er wollte erst gar nicht an die Krankheiten denken, welche die Moskitos in sich trugen und die endemisch in diesem Gebiet auftraten. Denguefieber, Malaria, Gelbfieber, Chikungunyafieber … und dann konnte man sich noch Typhus, Hepatitis, Pest, hämorrhagisches Fieber und eine breite Palette weiterer Freuden holen, wenn man das Wasser in diesem Dschungel trank oder mit seinen Bewohnern in Kontakt kam. Im Moment aber hatten sie größere Probleme. Gordon lauschte angestrengt in Richtung des Lagers. Es war alles ruhig, aber diese Ruhe war trügerisch, denn tagsüber und auch nachts patrouillierten unregelmäßig zwei bis drei Männer mit Sturmgewehren auf den Schultern lautlos im Dschungel um die Buden. Es waren Shan: Stammesleute aus dem Gebiet, welche die Gegend kannten wie ihre Hosentaschen – Söldner, die dafür bezahlt wurden, ein Leben auf der Flucht zu führen und als Sicherheitskräfte für den Mann zu fungieren, der für sie eine Art Gott war. Ein weißer Mann. Ein Rundauge, unglaublich reich und mit einem Verlangen nach extremer Privatsphäre, beherrschte dieses Gebiet wie ein Warlord. Gordon hatte das schwer erreichbare Ziel noch nicht ausgemacht: denFarang, den die Eingeborenen beschützten und in dessen Camp sie jetzt unfreiwillig zu Gast waren. Soweit Gordon den unterdrückten Gesprächen der Wachen entnehmen konnte, war der Mann gar nicht da. Selbst wenn also die Mission nach Plan verlaufen und es ihnen gelungen wäre, in das Lager einzudringen, ohne geschnappt zu werden, wäre alles umsonst gewesen. Er spürte, wie das Seil um Dougs Handgelenke allmählich unter der Kraft des Bambussplitters ausfranste, und sägte daher systematisch weiter. Doug hatte erneut irgendwann das Bewusstsein verloren und das würde wohl die nächste Stunde so bleiben, also ließ ihn Gordon in Ruhe. Er würde schon bald alle Energie benötigen, die er aufbringen konnte. Ein Geräusch durchbrach die Ruhe der Finsternis, und Zweige brachen schnappend, als zwei bewaffnete Männer aus dem Wald auf die Lichtung traten und sich im lokalen Dialekt unterhielten – die Wache für die Nacht war eingetroffen. Das Lager selbst schien am Tage ruhig, also hatten die Männer nicht viel zu tun und schlugen träge die Zeit mit Kochen, Patrouillieren und Glücksspiel untereinander tot. Es gab nichts zu bewachen, während ihr Chef nicht da war. Es gab niemanden, der Interesse daran hatte, eine schwer bewaffnete Gruppe anzugreifen, um ihre Zelte oder Waffen zu konfiszieren. In diesem kleinen Teil der Welt gab es jede Menge Waffen – sie waren in der ländlichen Hügellandschaft verbreiteter als Schuhe. Gordon sah durch halb geschlossene Augen, wie die Neuankömmlinge zu einem kleinen Feuer gingen, wo ein weiterer Mann saß, der eine Kalaschnikow zärtlich im Arm hielt. Sie bedeuteten ihm synchron, seine Flasche weiterzureichen. Er protestierte halbherzig, dann gab er sie ihnen lachend. Danach wurden Zigaretten gezückt, gefolgt von den unvermeidlichen Spielkarten, die in Vorbereitung einer erneuten Umverteilung von Vermögen spät in der Nacht gemischt wurden. Wenn die Zielperson zurückkehrte, wäre es vorbei mit dieser lockeren Art. Sie hatten beide das Dossier über ihn gelesen. Es war reines Glück, dass Gordon seine Fesseln eines Nachts lösen konnte, als die Wache nachlässig gewesen war. Das könnte der seidene Faden sein, an denen ihr Leben hing. Obwohl die Aussichten für Doug eher schlecht standen. Der Schuss in seine Wade hatte den Knochen verfehlt, aber eine Infektion hatte sich ausgebreitet und das würde seine Fähigkeiten einschränken, besonders weit zu kommen. Gordon hatte in Erwägung gezogen, ohne ihn abzuhauen, brachte es aber nicht übers Herz. Er wusste, dass Doug bei ihm geblieben wäre, falls er verwundet worden wäre. Nach allem, was sie gemeinsam durchgemacht hatten, schuldete er Doug zumindest diesen einen Gefallen. Was aber nicht hieß, dass seine Chancen günstig standen. Wenn die Wachen so weiter tranken, hoffte Gordon, könnten sie in einer Stunde aufbrechen und in den Dschungel verschwinden. Wie aber ging es dann weiter? Sie waren mehrere Tage von allem entfernt, was auch nur ansatzweise an Zivilisation erinnerte. Außerdem waren ihre Kidnapper nicht die einzige bewaffnete Truppe in dieser Gegend. Drogenschmuggler, Banditen, Menschenhändler, Wilderer; sie alle blühten auf in diesem Niemandsland, welches das Dreieck war, und jeder von ihnen würde sofort töten, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern. Das waren nicht die besten Aussichten, aber wenn Gordon sich nicht von seinen Fesseln hätte befreien können, hätten sie gar keine Chance gehabt. Zwanzig Minuten später spürte er, wie die letzten zerfransten Schnüre der Fesseln leise schnappend auseinanderrissen. Er stieß Doug wieder an. »Hey. Du bist frei. Schneid den Rest meiner Fesseln durch, wie ich deine zerschnitten habe.« Doug fuhr zusammen und sah ihn mit verständnislosem Blick an. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, überhaupt so lange zu warten. Er war schon total weggetreten. Das Delirium, das mit der Infektion einherging, war zu weit fortgeschritten. »Doug. Nimm das Stück Bambus. Lass deine Hände hinten. Mach keine plötzlichen Bewegungen. Schneide so lange, bis ich frei bin.« Ein klarer Moment flammte auf und Gordon spürte, wie Dougs Finger nach dem Splitter tasteten. Als die Fesseln endlich durchtrennt und seine Handgelenke frei waren, kehrte das Blut heftig spürbar in seine Hände zurück. Er spähte durch fast geschlossene Augen nach den Wachen, die ihre Flasche ausgetrunken hatten und Karten vor sich hin klatschten. Dabei betrogen sie einander mit träger Vertrautheit, ihre Wachsamkeit nur hervorgehoben durch einen gelegentlichen Rülpser oder abgehacktes Husten. Die Männer waren ungefähr siebzig Meter entfernt und Gordon hoffte, dass Doug und er durch das Unterholz davonkriechen konnten und es Stunden dauern würde, bis jemand ihr Verschwinden bemerkte. Seit die Sonne untergegangen war, hatte schließlich noch niemand nach ihnen gesehen, und die Erfahrung der vergangenen zwei Nächte hatte ihn gelehrt, dass frühestens bei Sonnenaufgang jemand kommen würde, um nachzusehen. »Doug, hör zu«, murmelte Gordon. »Wir rutschen hinüber zu den Büscheln Pflanzen dort und dann rennen wir, was das Zeug hält. Schaffst du das?« Doug schien aufmerksamer jetzt, da seine Hände frei waren und eine Aussicht auf Flucht bestand. »Ich glaube schon. Wie machen wir es?« »Ich gehe zuerst. Es ist so finster hier, dass sie uns nicht sehen können, solange wir uns nicht blöd anstellen. Sobald ich außer Sichtweite bin, kommst du zu mir gekrochen, dann laufen wir den Hügel hinunter. Wenn wir bis Tagesanbruch durchhalten, werden wir am Stand der Sonne feststellen, in welche Richtung wir uns bewegen, so gelangen wir dann zur thailändischen Grenze.« Doug nickte. Mit einem letzten flüchtigen Blick zu den Wachen bewegte sich Gordon zentimeterweise hinunter zum Boden und rollte sich auf den Bauch, dann robbte er zu den Bäumen. Niemand bemerkte etwas – es fielen keine Schüsse und kein Alarm wurde ausgelöst. Als er im Gestrüpp angekommen war, drehte er sich um und hielt Ausschau nach Doug. Er hoffte, dass es kein tödlicher Fehler war, ihn mitzunehmen. Zwei Minuten später tauchte Doug neben ihm auf. Sie standen beide auf und Doug belastete zögerlich sein Bein. Die Schwere der Schmerzen, die dabei verursacht wurden, spiegelte sich in seinen Augen wider, aber er schluckte es einfach. Nach einem letzten Blick zum Lager schlüpften sie tiefer ins Gebüsch. Der Klang der Kreaturen der Nacht ringsum begleitete sie, als sie sich wortlos durch die dichte Vegetation arbeiteten und hofften, einen Weg im dürftigen Mondlicht auszumachen. Gordon stützte Doug, als sie vorwärts trotteten und schon eine Stunde auf dem Marsch in die Freiheit waren. Doug wurde bereits müde von dem Schaden, den die Infektion in seinem Körper anrichtete, aber er schleppte sich weiter, ohne zu murren. Gordons Arm brannte von der Entzündung an der Stelle, wo ihm die Wachen den eingepflanzten Peilsender einfach aus der Haut geschnitten und eine üble, klaffende Fleischwunde hinterlassen hatten. Er konnte sich nur vorstellen, was Doug durchmachte. Sie kämpften sich durch Totholz und das Gewirr von Kletterpflanzen, bis sie an einen Fluss kamen, der sich vom Lager her den Hügel hinunter schlängelte. Ein Wildpfad verlief entlang des Ufers, was ihnen ermöglichte, schneller voranzukommen. »Argh. Oh Gott …«, schrie Doug auf, als er mit dem Knöchel in einer Furche umknickte, was an seinem brutal angeschlagenen Wadenmuskel zerrte und ihm die Tränen in die Augen trieb. »Lass uns eine Pause machen und den Verband abwaschen. Das Wasser wird dir gut tun«, sagte Gordon, als Doug zu Boden sank und sich ans Bein griff. Als Gordon die Mullbinde abwickelte, schnappte Doug nach Luft und sein Atem kam in heiseren Stößen. Der Gestank war fürchterlich. Wie verfaulendes Fleisch. Verfärbungen zogen sich an den Venen entlang und ein blutiges Eitergemisch quoll aus der Wunde. Gordon wusch sie vorsichtig ab und nahm Abstand davon, die Insekten zu erwähnen, die sich dort eingenistet hatten. Das Wasser spülte sie fort, aber Gordon machte sich nichts vor. Wenn Doug überlebte, würde er wahrscheinlich das Bein verlieren, außer, sie bekamen irgendein wundersames Antibiotikum in die Finger. »Wie sieht es aus? Es tut weh wie …« Gordon warf seinen Kopf zur Seite und legte einen Finger an die Lippen. »Was?« »Psst«, flüsterte Gordon und lauschte. »Verdammt. Wir müssen weiter. Jetzt. Wir müssen dich schnell verbinden. Wir müssen uns beeilen.« Gordon wrang den Verband aus und wickelte ihn hastig um die klaffende Wunde – die Kugel war sauber durch den Wadenmuskel gegangen, aber die nachfolgende Infektion hat unermesslich großen Schaden angerichtet. Doug sah ihn mit großer Aufmerksamkeit an. »Was hörst du?« »Einen Hund.« Sie standen mit Mühe auf und traten in den Fluss, in der Hoffnung, so ihre Spur zu verwischen – obwohl Gordon glaubte, dass Dougs Wunde einen starken Geruch verströmte. Er hatte keine Ahnung, wie ihre Kidnapper zu einem Hund gekommen waren. Wahrscheinlich stammte er aus einem der Dörfer in der Nähe. Mit ein paar Dollars konnte man sich fast alles kaufen, auch um drei Uhr morgens. Ihr Glück war wohl einfach erschöpft. Über den Himmel schoben sich Wolken und entließen ohne Vorwarnung einen Regenguss, der die beiden Männer durchnässte und ihnen die Sicht nahm. Es gab keinen Ort, an dem man sich vor dem Unwetter hätte unterstellen können, aber nass zu werden, war eine ihrer geringsten Sorgen. Doug geriet ein paar Mal ins Stolpern und schrie auf. Allmählich sah es aus, als sei er nicht in der Lage, noch lange weiterzugehen. »Lass mich einfach hier«, zischte Doug mit zusammengebissenen Zähnen. »Vergiss es. Komm jetzt. Du musst schneller laufen.« »Ich … ich kann nicht. Es ist zu …« Der Feuerstoß eines Gewehrs durchdrang Dougs Oberkörper und Kugeln sirrten Gordon um die Ohren, der sich instinktiv auf den Boden warf. Doug wirbelte herum und brach neben ihm zusammen, wo er gurgelnd seinen letzten Atemzug tat und dann leblos liegen blieb. Der Lärm von Mensch und Tier, der sich ein paar Hundert Meter entfernt durch den Dschungel brach, ließ Gordon wissen, dass seine Zeit abgelaufen war. Er fragte sich, ob sie ihn wohl zurückschleifen würden oder sein Elend gleich mit einer Kugel in den Kopf beendeten. Der Regen stürzte erneut kraftvoll vom Himmel, dicke Tropfen prasselten auf Gordon ein und er nutzte die vorübergehende Deckung, um vorwärts zu hasten, damit er Abstand zwischen sich und seine Verfolger brachte. Seine Stiefel traten schwer auf das felsige Flussbett, aber der strömende Regen um ihn herum erstickte das Geräusch. Seine einzige Hoffnung war nun, dass niemand ein Nachtsichtgerät hatte, oder noch schlimmer, ein Infrarotfernglas. Falls doch, dann war er schon tot. Er folgte dem Bach, bis dieser in einen Flecken aufgewühlten Schaums stürzte. Stromschnellen, die aus dem vom Regen ansteigenden Wasser resultierten. Er trat vorsichtig auf die aufragenden Felsen und hüpfte von einem zum anderen über den Strom in der Hoffnung, auf die andere Seite zu gelangen, während die Regenflut ihm beim Entkommen Deckung verschaffte. Da verlor er den Halt und rutschte mit der Sohle auf dem dritten Felsen aus. Gordon merkte, wie er stürzte, und verlor die Orientierung, als er im Wasser landete. Er schüttelte den Kopf, um klar zu werden und spürte, wie warme Flüssigkeit seinen Hals hinablief. Als er sich hinten ins Genick fasste, war seine Hand voller Blut. Er blickte sich rasch um, brachte sich auf die Füße und rannte am Ufer entlang, während der Strom breiter wurde. Dann lauschte er angestrengt. Der gedämpfte Laut eines bellenden Hundes verriet ihm alles, was er wissen musste. Er musste, so gut es ging, Abstand zu seinen Verfolgern gewinnen. Wenn der Regen aufhörte, stünde er offen da – die Wachen waren Einheimische, die aus den umliegenden Weilern rekrutiert worden waren, und er zweifelte nicht daran, dass ein paar von ihnen als Führer auf den Schmugglerpfaden tätig waren, die sich durch die Hügel schlängelten. Sein einziger Strohhalm war nun ein schwacher Vorsprung und die Dunkelheit der Nacht. Wenn er überhaupt bis zum Morgen durchhielte, wäre er spätestens dann ein toter Mann, außer er schaffte es über die Grenze nach Thailand und damit in relativ zivilisiertes Gebiet. Er verstand die Ironie darin, dass er die Beute war. Es war eine Vernichtungsmission, das Ziel relativ einfach, wenn auch schwer zu fassen. Gordon hatte in Afghanistan, auf dem Balkan und im Nahen Osten ähnliche Missionen frei von Komplikationen ausgeführt. Eigentlich war er das Raubtier. Das hier war nicht geplant. Der Klang von Männern, die durch den Dschungel brachen, drang zu ihm, aber jetzt aus größerer Entfernung. Vielleicht war sein Plan aufgegangen. Aber wenn, dann musste er bald weg von dem Fluss. Er hatte seinen Zweck erfüllt, aber man konnte ihm leicht folgen. Ein kaum wahrnehmbarer Pfad zweigte zu seiner Rechten vom Wasser ab. Nach kurzem Zögern stürzte er sich auf diesen Weg und zwang seine Beine zu sehr hohem Tempo, denn ihm war schwindlig vom Blutverlust. Er würde schon bald anhalten und die Wunde verschließen müssen, oder sie übernahm den Job der Gewehrschützen. Rufe hallten durch den Dschungel hinter ihm, aber immer noch weit genug entfernt, um ihm einen vorübergehenden Hoffnungsschimmer zu bieten. Wenn der Hund die Fährte am Fluss verloren hatte, dann waren sie genauso blind wie er selbst in diesem riesigen Gebiet. Schlingpflanzen zerkratzten ihm die Haut, als der Pfad enger wurde. In diesem Augenblick hätte er alles für eine Machete und ein M4-Gewehr gegeben. Er würde kurzen Prozess mit den Amateuren machen, die ihn hetzten, sogar, wenn er nur die Machete hätte. Schüsse erklangen weit entfernt, aber es gab keine Anzeichen in der Nähe, dass sie einschlugen. Die bewaffneten Männer feuerten also auf Schatten. Eine Regung in einem der Bäume ließ Gordon abrupt anhalten – ein Paar glühender Augen starrte ihn brennend an. Er blinzelte in dem schwachen Licht und erstarrte vor Schreck. Dort auf einem Ast saß ein gefleckter Leopard, der in der Lage wäre, einen Hirsch zu reißen. Die Großkatze fauchte, als sie ihn beobachtete, während er vorsichtig davonschlich und dabei Augenkontakt hielt, damit sie nicht dachte, er hätte Angst. Tiere konnten Angst spüren, das wusste Gordon. Er hatte keinen Streit mit dem hungrigen Leoparden, und wollte ihn auch auf keinen Fall provozieren. Mit über dreißig Kilo Lebendgewicht vermochte das Raubtier durchaus beachtlichen Schaden anzurichten, besonders, da Gordon sehr geschwächt war. Er ging rückwärts weg, aber der Leopard schien darauf aus zu sein, ihn herauszufordern. Ganz offenbar konnte er das Blut riechen. Die beiden befanden sich etwa sechs bis sieben Meter voneinander entfernt und starrten einander tief in die Augen, bis die Katze der Auffassung war, dass der Dschungel leichtere Beute bereithielt und grazil auf einen anderen Ast sprang, dann auf den Boden hinunterkletterte und sich rasch durch die Büsche davonmachte. Gordon seufzte erleichtert und setzte seinen Weg den Pfad entlang fort, wobei ihm mehr als bewusst war, dass die Schützen ihm immer noch dicht auf den Fersen waren. Er konnte am Lärm der letzten Schüsse erkennen, dass sie ungefähr vierhundert Meter entfernt mussten, aber er wollte bis zum Morgengrauen einige Kilometer daraus machen, falls möglich. Solange der Hund seinen Geruch nicht wieder aufspürte, war es machbar, vorausgesetzt, dass er nicht verblutete oder gefressen wurde. Als er vorsichtig den Hügel hinabstieg, trat er in dichten Bodennebel, der wie ein Mantel über dem darunterliegenden Tal ausgebreitet lag. Gordon hatte eine vage Vorstellung davon, wo er sich befand, aber er wusste es nur ungefähr, da er und Doug weit vom Ort ihrer Gefangennahme weggebracht worden waren. Ein tragbares GPS-Gerät wäre ihm jetzt recht gekommen. Rufe vom Kamm des Hügels, gefolgt von einem Bellen, ließen ihn wissen, was er wissen musste. Der Hund hatte den Geruch des Blutes im Wind gewittert und führte die Männer erneut direkt zu ihm. Das Bellen des Hundes nach seiner Beute schien jede Minute, die verstrich, lauter zu werden. Gordon biss die Zähne zusammen und hetzte weiter, immer schneller, bis er schließlich einfach rannte wie der Teufel. Er blieb an einer Ranke auf dem Boden hängen, stolperte, stürzte den Hang hinunter und wurde immer schneller, als er den schlammigen Hügel hinunterglitt. Er streckte beide Hände aus, um seinen Fall zu bremsen, aber es half nichts. Die Schwerkraft behielt Oberhand und der Regen hatte den Grund zu einer eisglatten Rutschbahn gemacht. Gordon knallte gegen einen Baumstamm, wodurch seine Abfahrt jäh gebremst wurde, und spürte etwas in seiner Brust knacken. Er nahm an, dass er sich mindestens ein bis zwei Rippen gebrochen hatte. Der einfache Auftrag war zu einer Tortur geworden, aus der er fürchtete, nicht lebend herauszukommen. Blut sickerte weiter von seinem Kopf und seine Hände waren bis auf das Fleisch aufgerissen. Die einzig gute Nachricht war, dass ihn seine Abfahrt mindestens hundert Meter weiter einen steilen Hang des Hügels hinuntergebracht hatte, wohin ihm niemand, der bei Verstand war, folgen würde. Wenn er einen Pfad aufspürte und sich zügig fortbewegte, könnte er eine Chance haben. Gordon fühlte sich, als habe er zehn Runden mit einem Bären gerungen, zwang sich aber auf die Füße. Er atmete keuchend, und jedes Mal, wenn er Luft holte, durchdrang ein stechender Schmerz seine Brust, aber soweit er beurteilen konnte, war er immer noch einsatzfähig. Er bahnte sich einen Weg durch das Gebüsch und achtete sorgfältig darauf, wohin er seinen Fuß setzte, denn er wusste, dass außer den bewaffneten Männern noch andere Gefahren hier lauerten. Leoparden, ein gelegentlicher Tiger, Tigerpythons … sie alle gingen im Schutz der Dunkelheit auf die Jagd. Gordon war verwundet, blutete, hatte keine Waffe, war halb verhungert und erschöpft. All das machte ihn hilflos gegenüber allem, das es auf ihn abgesehen haben könnte. Das Schlimmste aber war, dass er zum ersten Mal in seiner Karriere versagt hatte. Er hatte seinen Partner verloren, war gefangen genommen worden und hatte nichts herausgefunden, was er nicht auch schon vor dem katastrophalen Einsatz gewusst hätte. Der Sprühregen hörte auf und die Bäume um Gordon sahen ihn an wie stumme Wächter, als er ziellos vorbeistolperte und nach irgendeiner Art Weg suchte, der Abstand zwischen ihn und seine Verfolger bringen würde. Insekten summten überall im Gras; ein gelegentliches Rascheln empfing seine Schritte, wenn ein verborgenes Tier davonhuschte. Die Sohlen seiner Stiefel saugten sich im Schlamm fest und seine Beine waren bei jedem Schritt schwer wie Blei. Die Auswirkungen des Schlafentzugs und des Hungers forderten ihren Tribut. Es saugte ihm die Energie aus, als er nur noch mehr von seinem geschundenen Körper verlangte. Als Gordon auf eine kleine Lichtung trat, teilten sich die Wolken gerade weit genug, um das Mondlicht hindurchscheinen zu lassen, dessen geisterhaftes Glühen ihm erlaubte, eine Lücke im Unterholz auf der gegenüberliegenden Seite zu erkennen. Nebel waberte über die offene Fläche und kreiste das scheinbare Trugbild ein. Gordon taumelte auf die Bäume zu, überzeugt, dass er sich das nicht nur eingebildet hatte. Hinter ihm ertönte ein weiteres Bellen in der Ferne und trieb ihn vorwärts. Dort. Nur noch ein paar Meter. Für einen Augenblick dachte er, er sei danebengeraten, dann begleitete das Knacksen trockener Zweige den Sturz seines Körpers in die Dunkelheit. Ein bewusstseinsraubender Schmerz durchfuhr ihn. Heftige, brennende Agonie in seinem Bauch, seiner Brust und seinen Beinen.
Kapitel 2
Gegenwart, Omaha, Nebraska
Im Flughafen herrschte reges Treiben. Alles prangte in kühlem Chrom und bekannte Restaurantketten boten überteuerte Snacks sowie Kaffee für sechs Dollar an. Rindfleisch war hier prominent im Alltag vertreten und überall an den Wänden hingen Plakate mit Kühen, die in rindlichem Staunen die vorbeigehenden Passagiere angafften, sofern keine Burger-Sonderaktionen oder überdimensionale Getränke und Desserts darauf abgebildet waren. Die Luft war frisch, als Jet zu ihrem Mietwagen ging. Auf dem Weg über den Parkplatz zog sie ihren Koffer hinter sich her und wich Pfützen geschmolzenen Schnees aus. Bei ihrer Ankunft hatte sie einen ersten Blick auf den großen Staat Nebraska erhalten und ihr erster Eindruck, auch von Omaha, konnte in einem Wort zusammengefasst werden: flach. Das Auf und Ab der wenigen Hügel war allerorts kaum höher als fünfzig, sechzig Meter und mit landwirtschaftlichen Nutzflächen übersät. Wenn auch groß, so hatte die Stadt doch einen familiären Touch, jedoch mit einem deutlichen Ansatz des typisch amerikanischen Vororts. Aus der Luft sah sie wie ein einziges großes, genau geplantes Wohnviertel aus. Jet fand ihren Chevrolet und warf den Koffer auf den Rücksitz, bevor sie sich ans Steuer setzte und den Motor startete. Der kleine Vierzylindermotor drehte hoch, während er warmlief, dann beruhigte er sich zu einem monotonen Brummen, als Jet zur Ausfahrt lenkte und dem Pförtner ihre Papiere zeigte. Der Flug von Paris hatte lange gedauert und der Zwischenhalt in Chicago war nervtötend gewesen, aber jetzt war sie endlich hier. Die einzige Frage war, was als Nächstes zu tun war. Sie kannte eine Adresse und einen Namen. Das war alles. Kein Plan. Keine Strategie. Sie hatte versucht, im Flugzeug einen Plan auszuarbeiten, aber sie wusste nicht genug über die Sachlage, um sich etwas Nützliches einfallen zu lassen. Die einzige Information, die Jet hatte, war die Identität der Person, der man ihre Tochter überlassen hatte, nachdem sie bei der Geburt entführt worden war. Sie hatte keine Ahnung, was die Person oder die Menschen wussten oder nicht wussten, oder welche Geschichte David ihnen aufgetischt hatte. Sie bezweifelte stark, dass er ihnen die Wahrheit erzählt hatte. Das war nie sein Stil gewesen. Soweit sie wussten, hätte das Baby eine Waise sein können oder war vielleicht aus einer Missbrauchssituation gerettet worden. Jet hatte ihre Tochter Hannah noch niemals gesehen. Sie war überzeugt davon, das zweijährige Mädchen erkennen zu können, aber in Wahrheit war das wohl nicht der Fall. Jet wusste nicht das Geringste über das Leben des kleinen Mädchens, seit es nach einer komplikationsreichen Geburt aus dem Krankenhaus verschwunden war – der Arzt hatte gelogen und Jet weisgemacht, dass ihr Kind bei der Geburt verstorben sei. Sie kannte nicht einmal den Namen ihrer Tochter. Ihren neuen Namen. Den Namen, den ihr die Menschen gegeben hatten, die ihre einzigen bekannten Eltern waren. Jets Augen wurden feucht, aber sie widerstand dem Drang, zu weinen. Sie war von den Strapazen der vergangenen Tage erschöpft. Der Tod ihres Liebsten durch die Hand Gridschenkos, des mörderischen russischen Oligarchen, der ein Killerkommando beauftragt hatte, das auch sie umbringen sollte. Die Schießerei auf seiner Jacht. Die grauenhafte Flucht aus Frankreich. Die neue Erkenntnis, dass ihre Tochter, die sie tot geglaubt hatte, doch am Leben war. Sie wusste, dass sie am Ende ihrer Kräfte angelangt war, aber sie konnte nicht ruhen, bis sie ihre Tochter zurückhatte. Und was dann? Und wie? Sie betrachtete sich selbst kurz im Rückspiegel, überprüfte ihr neu gestyltes, schwarz gefärbtes Haar und sah sich dann ihre Augen an. Sie waren müde. Die letzte Woche hatte ihren Tribut gefordert und der Stress zeigte sich inzwischen deutlich, wenn es auch niemand außer ihr sehen konnte. Sie brauchte Ruhe. Aber zuerst musste sie ihre Tochter finden. Jet fischte in ihrer Handtasche nach einem tragbaren GPS-Gerät. Sie schaltete es ein und der kleine Bildschirm flackerte auf. Sie tippte auf der winzigen Tastatur die Adresse ein, die sie sich so lange gemerkt hatte und blickte auf das Display. Dem Apparat nach war sie zwölf Kilometer von dem Haus entfernt. Ein schneller Blick auf die virtuelle Karte zeigte ihr, dass sie innerhalb von fünfzehn Minuten dort sein konnte. Sie bog auf die Hauptverkehrsader ein, die zu den Randbezirken von Omaha führte, und spielte hektisch im Kopf die möglichen Szenarien durch, die sie vorfinden könnte, sobald sie an dem Haus ankam, in dem ihre Tochter seit zwei Jahren lebte. Jet wusste nicht, was sie erwarten sollte; die steigende Spannung schnürte ihr die Kehle zu. Sie zwang sich, ruhig zu werden. Aufregung war gefährlich und würde keinen nützlichen Zweck erfüllen. Als sie in der Trabantenstadt ankam, wirkte sie genauso anonym wie jede andere, die sie gesehen hatte; voller identischer Behausungen, die nach einem von drei verschiedenen Mustern gebaut waren – bescheidene Dinger für die Arbeiterklasse der Mittelschicht, die offenbar einen Großteil der Bevölkerung Omahas stellten. Viele Autos hier waren US-Fabrikate der mittleren Preisklasse, und da es ein Nachmittag mitten unter der Woche war, fand sie die Straßen leer vor, da jeder entweder in der Arbeit war oder seine Kinder von der Schule abholte. Jet war noch nie zuvor in den Vereinigten Staaten gewesen, daher war ihr das Norman-Rockwell-Viertel grundsätzlich fremd, genauso wie die schiere Größe von allem. Die Einkaufszentren, die Autos, die Menschen, die Straßen – es war alles so groß. Als habe jemand das ganze Land aufgeblasen. Sie hatte noch niemals etwas Vergleichbares gesehen, aber sie beschloss, sich anzupassen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ihr größter Vorteil zu diesem Zeitpunkt war, dass sie komplett vom Radar verschwunden war – unsichtbar, unterwegs mit einem ihrer alternativen Reisepässe als freie Journalistin aus Belgien. Sie fuhr langsamer, als sie an der Adresse vorbeikam, und musterte das unscheinbare eingeschossige Haus mit geschultem Auge. Ein Zaun, mit Sicherheit auch ein großer Garten hinten, eine Doppelgarage und wahrscheinlich drei Schlafzimmer, gemessen an der Größe. Es unterschied sich in absolut nichts von den Hunderten anderer Planhäuser an der langen, ruhigen Straße. Jet parkte und notierte schnell die Telefonnummer eines Immobilienmaklers, dessen Reklameschild vor einem der Nachbarhäuser im Vorgarten stand. Es wäre großes Glück, wenn sie in dieses Haus kommen könnte. Sie würde dadurch alles Notwendige über Grundrisse, die Qualität möglicher Alarmanlagen, Nachbarschaftshilfen, die das Viertel bewachen, sowie Tür- und Fensterschlösser erfahren. Der Nachteil dieses Viertels war, dass es hier nur wenige Orte gab, an denen man sich verstecken konnte, außerdem sah es aus, als würde hier jeder jeden kennen, was bedeutete, dass sie das Haus nicht einfach so beobachten konnte. Sie musste kreativ vorgehen – es würde nur einen Versuch geben, ihre Tochter zu holen, und das durfte sie nicht vermasseln. Sie schlenderte die Straße entlang und notierte noch ein paar Telefonnummern – offenbar gab es eine große Zahl an verkaufswilligen Opfern der anhaltenden Finanzkrise, die sich über fast fünf Jahre hinzog. Jedes zweite Schild kündete von Zwangsvollstreckung oder davon, dass das Haus der Bank gehörte – einschließlich des Schildes vor dem Haus neben ihrem Ziel. Sonst gab es nicht mehr viel herauszufinden. Als Nächstes musste sie ein Einweg-Handy besorgen und ein Motel in der Nähe finden. Sie drehte das Lenkrad herum und fuhr den Weg zurück, den sie gekommen war, den Blick noch einmal auf das Haus gehaftet, als sie erneut daran vorbeifuhr. Es gab keine offensichtlichen Anzeichen auf Leben, aber die Jalousien an den vorderen Fenstern waren heruntergelassen, daher war es schwer, einzuschätzen, ob jemand zu Hause war oder nicht. Ein paar Blocks die Straße runter fuhr Jet auf den Parkplatz eines Target-Einkaufsmarkts. Sie stellte den Motor ab und öffnete den Kofferraum, dann verstaute sie ihren Koffer so, dass man ihn nicht sehen konnte. Sie musste ja nicht unbedingt Diebe anlocken, auch wenn Omaha bisher wie der Inbegriff von Vorstadtsicherheit wirkte. Zehn Minuten später kehrte sie zum Wagen zurück und tätigte mit ihrem neuen, temporären Prepaidhandy einen Anruf. »Realty World Immobilien. Sie sprechen mit Joanie!«, zwitscherte eine übertrieben fröhliche Stimme. »Ja, hallo. Ich heiße Susan«, log Jet. »Ich sehe mich momentan nach Häusern um und habe Ihre Nummer von einem Schild vor einem Haus, das mir gefallen hat …« »Ach, ja! Ein Haus! Nun, da sind Sie bei mir richtig! Welches war es denn?« Jet nannte ihr die Adresse. »Hm, ja. Ich kenne es. Das ist eine gute Partie. Es gehört der Bank. Die möchten es so bald wie möglich loswerden. Sie könnten es wahrscheinlich stehlen und von denen noch das Geld dafür leihen, dass sie das tun!« »Oh, das hört sich ja gut an. Ich suche schon überall, aber das scheint mir ein nettes, ruhiges Viertel zu sein. Könnten wir einen Termin für eine Besichtigung des Hauses vereinbaren?« »Aber natürlich. Wie sieht es in einer Stunde aus? Schaffen Sie das?« »Das wäre perfekt.« »Susan, richtig? Wie lautet Ihr Nachname?« »Jacobs.« »Kommt denn auch Ihr Ehemann mit?« »Nein. Das Haus ist nur für mich.« »Wunderbar. Haben Sie denn auch einen Finanzierungsplan vorliegen, damit Sie ein Angebot abgeben können?« Jet war rasch genervt von dem ganzen Vorqualifizierungsgespräch. »Lassen Sie uns so etwas jetzt nicht vorgreifen. Es gibt eine Menge Häuser da draußen. Ich habe vor, bar zu bezahlen, sobald ich kaufe, anschließend nehme ich eine Hypothek auf.« »Oh, gut. Das gefällt mir. Sie wissen, was Sie wollen und Sie möchten keine Zeit verlieren.« Jet seufzte. »Also, in einer Stunde beim Haus?« »Definitiv!« Jet fragte sich, welchen Kurs in Überredungskunst die auto-suggestive Maklerin besucht hatte und legte kopfschüttelnd auf. Sie sah auf die Uhr und fand, dass sie noch Zeit hatte, eine Unterkunft für die Nacht zu suchen. Irgendetwas Ruhiges. Zwanzig Minuten später hatte sie in einem typischen Motel eingecheckt. Es besaß zwei Stockwerke mit außen liegenden Zimmertüren und niemand scherte sich um das Kommen und Gehen der Gäste. Sie hatte nach dem ruhigsten vorhandenen Zimmer gefragt und die Rezeptionistin hat ihr ein Zimmer im Erdgeschoss am hintersten Ende des Komplexes zugewiesen. Es erwies sich als einfach, sauber und angemessen, ausgestattet mit einem elektronisch verschließbaren Safe und WLAN. Jet packte schnellstens ihr weniges Hab und Gut aus und sperrte ihre Ausweise zusammen mit dem meisten Bargeld, das sie bei sich hatte, in den Safe. Sie würde nach dem Ausspähen des Nachbarhauses schon noch darüber nachdenken, was sie so alles braucht. Joanie erwies sich als Frau Mitte vierzig, und ihre Erscheinung entsprach exakt ihrer Stimme. Sie hatte eine aufgebauschte Frisur, ein aufgesetztes Lächeln, trug einen Hosenanzug mit zweckmäßigen Schuhen dazu und hatte einen Händedruck wie ein Mann. Bald ließ sie ein ununterbrochenes Sperrfeuer von Informationen und Fragen auf Jet los. Als sie das Haus besichtigten, tat Jet so, als interessiere sie sich für das Platzangebot in der Küche, die Arbeitsplatte in Granitoptik und die neuen Geräte. Es gab keine Möbel und die Teppiche waren vor Kurzem ausgewechselt worden. Die Wände waren neu gestrichen, sodass es nach Chemie und verbrauchter Luft roch. »Wie ich schon sagte, die Bank ist motiviert. Sie wissen ja, wie das ist«, pries Joanie voller Enthusiasmus. »Nun, es ist in einem anständigen Zustand. Was können Sie mir über dieses Viertel sagen? Ist es sicher?« »Oh, extrem sicher sogar. Wir haben hier die niedrigste Verbrechensrate von ganz Omaha!« »Gut zu wissen. Gibt es eine Nachbarschaftsgruppe, um das Viertel zu bewachen?« »Wissen Sie, ich glaube nicht, dass sie hier so etwas haben. Hier wurde seit Jahren nicht eingebrochen. Damit meine ich sehr viele Jahre. So etwas passiert hier einfach nicht. Sie finden nirgends einen Ort, der sicherer ist.« »Haben sich schon viele das Haus angesehen? Wie lange ist es bereits auf dem Markt?« Joanie ging ihre Unterlagen durch. »Seit fünf Monaten, wie es aussieht. Und nein, es waren noch nicht viele hier. Nur wenige Menschen möchten in den Wintermonaten umziehen, wo es ständig schneit und stürmt und so. Ich denke, Sie bekommen es zu einem Spottpreis.« Jet verbrachte eine halbe Stunde mit der penetranten Maklerin, die eine erdrückende Verkaufsmasche an den Tag legte, dann beschloss sie, dass sie genug gesehen hatte. Joanie bestand darauf, ihr den Garten zu zeigen, der reichlich ungepflegt war, da er den ganzen Winter über nicht beachtet worden war, dann gingen sie zur Veranda. Joanie versuchte, so viel wie möglich über Jet zu erfahren, die ihre Identität nur erfunden hatte: Sie sei aus Seattle hierher versetzt worden, um in der Stadt ein neues Versicherungsbüro zu eröffnen, möchte innerhalb einer Woche eine Entscheidung treffen und ist definitiv kaufwillig … Joanies Augen gingen über, als sie hörte, dass Jet schon bald kaufen wollte und sie versicherte noch einmal mit Nachdruck, dass dies das perfekte Haus für Jet war. »Ich denke, Sie sollten ein Angebot schreiben. Vorerst nur einen kleinen Betrag, das kann ja nicht schaden, und wenn Sie es für den Preis bekommen … nun, Sie wissen ja, dass im Prinzip alles verhandelbar ist.« »Joanie. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich habe Ihre Kontaktinformationen. Ich werde mich wieder bei Ihnen melden, falls ich das Haus noch einmal sehen muss und ein Angebot …« Sie unterbrach mitten im Satz, als ein Auto die Einfahrt zum Nachbarhaus hochfuhr und eine Frau ausstieg, um die hintere Beifahrertür zu öffnen und ein Kleinkind aus dem Kindersitz loszuschnallen. Jet blieb die Luft weg. Die Frau war von mittlerer Größe, aschblond, trug Bürokleidung und hantierte mit einer überfüllten Plastiktüte herum, als sie die Gurtschnalle des Sicherheitssitzes öffnete. Joanies unaufhörliches Gequassel verblasste zu einem fernen Summen, als Jet das Blut in den Ohren rauschte und ihr Herzschlag rasant anstieg. Sie hörte sich selbst ein vages Zugeständnis an die nervige Frau richten, um auf einen weiteren Vorschlag zu antworten, sie möge doch etwas zu dem Haus aufschreiben, dann setzte sich die Zeit zögerlich wieder in Bewegung und die Zeitlupe, in der sie für ein paar Sekunden festgesteckt hatte, wich allmählich wieder der Realität. Die Blondine hob das Kleinkind aus dem Sitz und stellte es sanft in der Einfahrt ab, wo es unsicher stehen blieb und dann die Einfahrt zur Haustür auf den pummeligen, leicht wackeligen Beinen einer gesunden Zweijährigen hinauf trottete. Sie war so wunderschön. Der hinreißendste Anblick, den Jet je erblickt hatte. Es bestand kein Zweifel. Sogar aus zehn Metern Entfernung konnte sie sich selbst in dem kleinen Gesichtchen, in der Augenpartie und der Nase wiedererkennen. Es war ihre Tochter. Ihre Hannah. In Jets Bauch wallte eine kurze Erinnerung an das Leben auf, das sie einst ausgetragen und das kleine Herz des Kindes mit dem ihren im Einklang geschlagen hatte. Obwohl sie wie versteinert stand, zwang sich Jet, wegzusehen. Sie wollte gegenüber Joanie nicht den geringsten Verdacht wecken oder etwas Auffälliges tun – was relativ einfach war, da die Maklerin nichts sehen oder hören konnte außer der Aussicht, etwas zu verkaufen und das am besten noch heute. »Joanie, ich habe die Führung wirklich sehr genossen, aber nun muss ich langsam weiter. Ich muss noch zu einem Meeting. Ich werde Sie morgen oder übermorgen anrufen, nachdem ich mich fertig umgesehen habe. Dieses Haus ist auf jeden Fall in der engeren Auswahl. Es bietet alles, was ich brauche.« Joanie ließ sichtbar den Mut sinken, als die Worte bei ihr ankamen. Ihre Hoffnung auf ein schnelles Angebot war sofort dahin, sie versuchte es zwar noch einmal, aber sie hatte kaum noch den Enthusiasmus dazu. »Nun, ich werde das Haus häufiger vorstellen, sobald das Wetter besser wird, wenn ich also Sie wäre, würde ich rasch handeln. Es ist ein echtes Schmuckstück und so gemütlich. Und sicher. Und die Bank …« »Ja. Ich weiß. Die Bank ist motiviert – das habe ich klar und deutlich vernommen. Wirklich, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, es mir zu zeigen, Joanie. Das weiß ich zu schätzen und ich werde in Kürze eine Entscheidung treffen.« Jet riskierte noch einen letzten Seitenblick zu ihrer Tochter, dann wandte sie sich ab, blieb noch kurz stehen, um Joanie die Hand zu schütteln, und ging zurück zu ihrem Wagen, während ihre Welt drohte, jeden Augenblick aus den Angeln zu geraten. Sie ließ den Schlüssel in die Zündung gleiten und startete den Motor, bemüht, wieder ruhig zu atmen – während sie nach außen hin gelassen wirkte, drängte sie in ihrem Inneren etwas dazu, in das Haus zu rennen und Hannah gleich hier und jetzt mitzunehmen. Aber das wäre keine dauerhafte Lösung. Sie musste sie bekommen – das war Fakt. Aber sie musste auch klug dabei vorgehen und ihre Spuren verwischen, damit sie das Mädchen für immer behalten konnte, sobald sie es bei sich hatte.
Kapitel 3
Jet parkte den gestohlenen Toyota Camry zwanzig Meter vom Haus entfernt am Gehsteig. Die letzten Meter rollte sie mit ausgeschalteten Scheinwerfern. Alle Häuser in der Umgebung waren dunkel, abgesehen von ein paar Verandalampen, die in den mitternächtlichen Schatten schienen. Jet stieg aus dem Wagen, schnallte sich einen schwarzen Nylonrucksack um, den sie sich ein paar Stunden vorher gekauft hatte, und begab sich zu dem leer stehenden Haus, das sie drei Tage zuvor mit Joanie besichtigt hatte. Sie schlich zur Veranda und bückte sich. Kurz darauf hatte sie den Schlüsselkasten der Maklerin gefunden und stellte auf dem Zahlenschloss die Kombination ein, die sie bei Joanie abgeguckt hatte. Ihre Latexhandschuhe quietschten auf der glatten Oberfläche, als sie den Schlüssel herausfischte. Nachdem sie die Haustür aufgesperrt hatte, hängte sie ihn wieder zurück in seinen verborgenen Kasten und ließ das Kombinationsrädchen rotieren, sodass es bei einer zufälligen Position stehen blieb. Sobald sie in dem leeren Haus war, setzte sie rasch eine Nachtsichtbrille auf – die hatte sie sich im Internet bestellt und per Express liefern lassen. Sie wusste, dass es unklug gewesen wäre, solche besonderen Gegenstände in Omaha zu erwerben. Vorsicht war ein unerlässlicher Bestandteil ihrer Vorbereitung auf jegliche Art von Einsatz, die Rettung ihrer Tochter bildete da keine Ausnahme. Das Innere des Hauses wurde vom grünen Glühen der Nachtsichtbrille erleuchtet – es war nur ein gewöhnliches Gerät für Normalbürger, das aber für diese nächtliche Mission ausreichend war. Jet holte den Rest ihrer Ausrüstung hervor. Sie setzte sich im Schneidersitz auf den Boden und beobachtete fünfundvierzig Minuten lang die Straße vor dem Haus. Dabei hielt sie sorgfältig nach jeglichem Anzeichen von Leben Ausschau. Nichts. Keine Autos, keine Hunde, die ausgeführt wurden. Das Viertel war komplett ruhig. Sie kroch zur Hintertür und öffnete sie, dann ging sie mit vorsichtigen Schritten zu dem Zaun, der die Grundstücke trennte. Nachdem sie nichts Verdächtiges sehen konnte, stieg sie über den Holzlattenzaun und begab sich zum Hintereingang von Hannahs Haus, wobei sie angestrengt lauschte, ob drinnen Bewegung zu hören war. Sie brauchte fünfzehn Sekunden für das Schloss. Langsam drehte sie den Türknauf, darauf bedacht, keinerlei Geräusche zu machen. Als der Knauf schließlich vollständig zurückgedreht war, drückte sie die Tür auf. Dank des Tropfen Öls, den sie auf jedes Türscharnier gegeben hatte, bevor sie das Schloss knackte, quietschte die Tür nicht. Das Haus sah exakt so aus wie das leer stehende Gebäude von nebenan, also wusste Jet ganz genau, wo sich das Elternschlafzimmer befand und wo die Gästezimmer zu finden sein würden. Die Chancen standen recht gut, dass Hannah ihr eigenes Zimmer hatte. Die Laufschuhe gaben kein Geräusch von sich, als Jet durch den Flur zu den Schlafzimmern schlich. Wenn sie auch nur ein bisschen Glück hatte, würden Hannahs vermeintliche Eltern bei geschlossenen Türen schlafen. Falls sie das nicht taten und am Ende sogar noch aufwachten, wusste Jet, wie sie mit ihnen umzugehen hatte, jedoch hoffte sie, ihnen nicht wehtun zu müssen. Wahrscheinlich waren sie in der ganzen Sache unschuldig, wenn man berücksichtigte, wie David vorzugehen pflegte. Alle, die involviert waren, würden nichts voneinander wissen. Und niemand würde mehr wissen, als er unbedingt wissen musste. Sie hatte darüber nachgesonnen, wie er diese Menschen gefunden hatte, kam jedoch zu dem Schluss, dass es eigentlich egal war. Da der Mossad sein Arbeitgeber war, hatte David zu weit größeren Ressourcen Zugang gehabt, als Jet sich auch nur hätte vorstellen können. Das wahrscheinlichste Szenario war, dass er arrangiert hatte, Hannah einem Paar zu übergeben, das auf eine Adoption wartete. Es gab Myriaden Arten, etwas zu erreichen, wenn man ein Problem nur unter genug Geld begrub, das wusste sie, und David hatte sie wissen lassen, dass das Budget für seine Einsätze immens und nicht verfolgbar war. Die Tür zum Schlafzimmer der Eltern war geschlossen, also ging sie zum ersten Gästezimmer – dem einen von beiden, das sie am ehesten als Kinderzimmer genutzt hätte, ausgehend von ihrer Tour durch das baugleiche Nachbarhaus. Der Türgriff bewegte sich mit einem Klicken. Jet erkannte das erste Problem im Zimmer – ein Babyphone, das jedes Geräusch aus Hannahs Zimmer an das Gegenstück im Elternschlafzimmer übertragen würde. Ihre Finger tasteten nach einem Taschenmesser. Zielsicher hob sie das Kabel hoch und durchtrennte es mit einem Schnitt. Hannah wälzte sich in ihrem Kinderbettchen, gab aber keinen Ton von sich und schlief weiter, ohne zu wissen, dass sich ihre Mutter gut einen Meter von ihr entfernt befand. Der Moment der Wahrheit war gekommen.