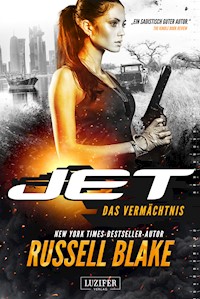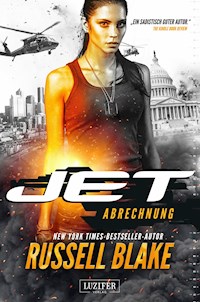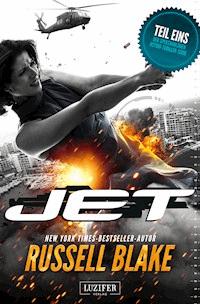
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: JET
- Sprache: Deutsch
Thriller-Bestseller von einem der populärsten US-Autoren. USA Today and New York Times Bestseller Autor Russell Blake. "Rasant, actionreich und super spannend!" [Lesermeinung] "Empfehlung für Actionliebhaber! Rasante sympathische Protagonistin. Filmreif! Hatte viel Spass damit" [Lesermeinung] Inhalt: Codename: Jet. Alter: 28 Jahre. Jet war einst des Mossads tödlichste menschliche Waffe, bis sie ihren eigenen Tod vortäuschte, um diese Identität für immer zu begraben. Aber die Geheimnisse der Vergangenheit lassen sich nicht einfach abschütteln. Als ihr neues Leben auf einer ruhigen Insel von einem brutalen Angriff bedroht wird, muss Jet zu ihrer geheimen Existenz zurückkehren, um die zu retten, die sie liebt. Eine wilde Achterbahnfahrt voller schockierender Wendungen beginnt … Fans von Lizbeth Salander, SALT und der Bourne-Trilogie werden ihre helle Freude an diesem unkonventionellen Thriller haben, der mit Höchstgeschwindigkeit auf ein erschütterndes Finale zusteuert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JET
Russell Blake
Copyright © 2012 by Russell Blake
All rights reserved. No part of this book may be used, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the written permission of the publisher, except where permitted by law, or in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews.
By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc. 350 Fifth Avenue. Suite 5300
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: JET Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Christian Siege
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-943408-38-6
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Für weitere spannende Bücher besuchen Sie bitte unsere Verlagsseite unter luzifer-verlag.de
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche dir keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
Ein paar Worte des Autoren
JET ist ein rein fiktionales Werk und jegliche Ähnlichkeit der handelnden Personen mit real existierenden Menschen oder Organisationen ist rein zufällig oder dient einem literarischen Zweck. Auf diese Weise möchte ich erklären, dass ich keine Ahnung habe, ob der Mossad oder die CIA im realen Leben Teams verpflichten, die Mordanschläge begehen. Ich hoffe für mich, dass sie es nicht tun. Es ist viel wahrscheinlicher, dass der Mossad, die CIA und der KGB zuverlässige Organisationen sind, in denen jeder Angestellte ehrbar ist und hart arbeitet. Ich habe keinen Anlass, anderes anzunehmen, aber die Geschichte ist einfach spannender, wenn jeder überall verdächtig und betrügerisch handelt und grundsätzlich nur Böses im Schilde führt. Das ist eben der literarische Sprung, den ich mir erlaube. Wahrscheinlich tauchen auf den folgenden Seiten zahlreiche Dinge auf, die nicht zu hundert Prozent korrekt wiedergegeben werden oder sich nicht so in der richtigen Welt abspielen. Das ist in Ordnung. Es soll ja kein tiefergehendes, zu hundert Prozent richtiges Nachschlagewerk sein. Ich hoffe, man verzeiht mir jegliche schriftstellerische Freiheit.
Auch verwende ich als Währung meist Dollars statt des jeweils landesüblichen Geldes, und zwar aus zwei Gründen: Zum einen erspart es den Leuten, sich mit Umrechnungstabellen herumschlagen zu müssen, zum anderen – ob Ihnen das nun Recht ist, oder nicht – ist der Dollar nun einmal die weltweite Leitwährung; es liegt also nahe, dass größere Summen oder verachtenswerte Transaktionen in den bekannten grünen Scheinen verhandelt werden.
In den ersten Kapiteln von JET verwende ich häufig Rückblicke, um Informationen zu vermitteln, die für später von Bedeutung sind. Nicht erschrecken, wenn dabei wild umhergesprungen wird – wenn man tiefer in das Buch vordringt, wird alles einen Sinn ergeben. Versprochen.
JET ist das erste Werk aus einer ganzen Reihe, zu der ich während meiner Arbeit an Silver Justice inspiriert worden bin. Ich stelle mir so vier bis fünf Bücher in der Reihe vor, wahrscheinlich mindestens drei beziehungsweise höchstens sechs – das hängt vom Umfang der zu erzählenden Geschichte ab. Ich hoffe, dieses erste Werk bringt dem Leser die gleiche Freude, die ich beim Schreiben hatte.
JET ist bisher mein Lieblingscharakter – ein Rätsel, gehüllt in ein Geheimnis und das Ganze versehen mit einer Attitüde, die einem ordentlichen Tritt in den Hintern gleichkommt. Wie sagte noch ein befreundeter Autor, als ich ihm von dem angestrebten Konzept erzählte: »Sie trägt doch schwarzes Leder? Ich hoffe, dass sie schwarzes Leder trägt.« Sie werden sehen, wozu mich diese Idee geführt hat.
Prolog
Widerwillig machte das verregnete Grau des Morgens ein paar Flecken blauen Himmels Platz, die durch die Wolken lugten. Die Feuchtigkeit fiel in Tropfen von der dichten Vegetation auf den Asphalt, von dem sie unterbrochen wurde, und verdunstete nach dem Kontakt damit innerhalb von Sekunden. So weit landeinwärts war die Luftfeuchtigkeit stets hoch – der Sitz der Regierung war an diesen relativ sicheren Ort verlegt worden, nachdem ein Hurrikan die Hauptstadt an der Küste vor über vierzig Jahren verwüstet hatte.
Die Bushaltestelle an der Hauptkreuzung bot einen tristen Anblick, wie die meisten umstehenden Gebäude, die von Entropie heimgesucht wurden, noch bevor die Farbe an ihren heruntergekommenen Wänden trocken war. Um den Busbahnhof erstreckten sich marode Buden, die aus Planen und Holzabfällen zusammengezimmert waren und den Eindruck einer verwahrlosten Zeltstadt erweckten, in der Händler eifrig bemüht waren, Käufer für kitschige Artefakte und Second-Hand-Kleidung zu gewinnen.
Ein altersschwacher Greyhound-Bus schob sich scheppernd in den schlammigen Halteplatz. Darin saßen eine Handvoll unerschrockener Touristen und Pendler aus den kleineren Orten an der Küste. Die ermüdeten Luftdruckbremsen zischten protestierend, als der Bus zum Halten kam und seine Ladung ausspie; dabei ratterten die rostigen, mit Graffiti übersäten Seiten im Takt des laufenden Motors.
In der Nähe türmten sich wuchtige Betonbunker auf, die hässlich und gleichgültig wirkten, um die Lebewesen des Dschungels zurückzuhalten. Träge, hemdsärmelige Bürokraten schlenderten unbeirrt über den ausgedehnten, weiten Platz und wischten sich mit Handtüchern den Schweiß von den Brauen, während sie sich zu ihren Büros begaben, um einen weiteren langen Tag nichts zu tun.
Drei Männer kamen aus dem größten der Gebäude und blieben auf den Stufen bei der schweren gläsernen Eingangstür stehen und hielten sich die Hände über die Augen, um sich vor den Sonnenstrahlen zu schützen, die durch die Wolkendecke drangen. Nach einer kurzen Verabschiedung schüttelten sie sich die Hände und zwei von ihnen gingen zum Parkplatz. Der dritte Mann sah ihnen hinterher. Schweiß glitzerte auf seiner kohlschwarzen Haut und drohte, seinen leichten navyblauen Anzug zu ruinieren. Er blickte kurz auf die Uhr, dann marschierte er auf ein mehrstöckiges Gebäude auf der anderen Seite des Platzes zu. Der Springbrunnen in der Mitte des Areals, das Becken mit einer dicken Kruste aus Kalk überzogen, war mit zeternden Spatzen bevölkert, die in der Regenwasserlache darin baden wollten. Von dem lauten Gezwitscher angezogen, ging der Mann langsamer, um sie dabei zu beobachten, wie sie die kurze Befreiung von der drückenden Hitze genossen.
Die Vögel wurden von einem peitschenden Knall erschreckt und flogen unter großem Lärm davon, als der Schädel des Mannes explosionsartig in blutige Stücke gerissen wurde. Sein Körper schlug leblos auf den Betonboden, bevor die Überreste seines Kopfes wie Melonenstücke auf den Boden platschten. Die wenigen umstehenden Augenzeugen blieben erstarrt stehen und blickten voller Angst um sich.
Im obersten Stockwerk eines zweihundertfünfzig Meter entfernten Motels erhob sich der Schütze von seiner Position, hielt sein Gewehr fest an sich gedrückt und trottete die lange Zeit unbenutzte Treppe hinunter zu einem wartenden Ford Expedition.
Als sich die hintere Tür öffnete, legte der Fahrer den Gang ein und warf durch den Rückspiegel einen prüfenden Blick auf das Chaos bei den Regierungsgebäuden. Der Schütze ließ das Gewehr in einem Fach unter dem Boden des Kofferraums verschwinden und überblickte rasch den leeren Parkplatz, bevor er auf den Beifahrersitz schlüpfte. Er legte den Sicherheitsgurt an, tastete im Handschuhfach nach einer Schachtel Zigaretten, zündete sich eine an und richtete die kühle Lüftung auf sein schweißnasses Gesicht, als der Fahrer auf die Straße bog, die aus der Stadt führte. Zufrieden atmete er den Rauch aus, dann öffnete er das Fenster einen Spalt und führte hastig ein kurzes Gespräch am Handy. Er sprach dabei scharf und stark betont.
Routiniert öffnete er die Rückseite des Telefons und warf die Prepaid-SIM-Karte zusammen mit dem Akku aus dem offenen Fenster in ein dichtes Gestrüpp. Der Fahrer widmete ihm einen wortlosen Blick, dann konzentrierte er sich wieder auf die Straße.
Der Schütze zog an seiner Zigarette und sagte mit einem tödlichen Lächeln: »Einer weniger.«
Kapitel 1
Türkisfarbenes Wasser brandete in den feinen Sand der leewärtigen Seite von Trinidad und kitzelte den Strand mit sanften Wellen. Schrottreife Fischerboote mit einfachen Außenbordmotoren trieben zehn Meter vom Strand entfernt auf dem Wasser und zogen leicht an den Anlegeleinen, während die Kapitäne im Schatten faulenzten, Rum kreisen ließen und altbekannte Geschichten zum Besten gaben.
Die Abendluft war erfüllt von Musik und dem berauschenden Aroma exotischen Essens, als das jährliche Karnevalsfest langsam in lautes Getöse überging. Aufgeregte Gruppen von Kindern liefen die Küste auf und nieder und kämpften mit ihrem fröhlichen Lachen gegen den Lärm feiernder Erwachsener an. Feierlustige von nah und fern drängten sich in den Straßen und prosteten mit ihren Bierflaschen in froher Erwartung der wilden Nacht, die bald beginnen sollte, und dem Sonnenuntergang zu. Kaffeebraune Haut, blitzende weiße Zähne und lange, geschmeidige Beine kündeten von den Genüssen des Wochenendes, als ein Beben schwelender Verheißung sich anbahnender Möglichkeiten und alkoholseliger Hoffnung die Atmosphäre durchdrang. Hypnotische Trommelrhythmen hämmerten, als die Parade mit extravaganten Kostümen und Masken vorüberging und Einheimische wie Touristen sich gleichermaßen in leichtfertiger Hingabe verloren.
Die Glocke am Eingang des kleinen Internet-Cafés erklang und lenkte Mayas Aufmerksamkeit ruckartig von ihrem PC-Bildschirm auf dem Schreibtisch hinten im Büro weg. Träge wischte sie sich das lange schwarze Haar aus dem Gesicht, klickte seufzend mit der Maus und nahm die auf dem Monitor angezeigte Uhrzeit zur Kenntnis. Seit über einer Stunde war kein Besucher gekommen und sie wollte den Laden eigentlich gleich schließen. Ihr Mitarbeiter war schon um fünf gegangen, damit er die Party auf keinen Fall verpasste, und hatte es ihr überlassen, zum Feierabend sauberzumachen. Inzwischen, vier Stunden später, gab es nur noch wenig Hoffnung auf weiteren Umsatz, da die ganze Stadt schon im Party-Modus war. Jeder, der unterwegs war, hatte jetzt handfestere Arten der Unterhaltung im Kopf, als solche, die man im Cyberspace finden konnte.
Als sie sich durch den Perlenvorhang schob, der die hinteren Räume vom Kundenbereich trennte, baumelte eine Schlinge über ihrem Kopf. Sie konnte gerade noch rechtzeitig die linke Hand heben, um zu verhindern, dass sich die Schlaufe um ihren Hals zuzog. Sie konnte die Kraft ihres Angreifers spüren, als der Draht in ihre Hand schnitt, worauf sie ihm instinktiv mit voller Wucht auf den Fuß trat, um ihn so zu schwächen. Hätte Maya ihre Stiefel angehabt, hätte sie ihm den Mittelfußknochen gebrochen, mit ihren Tennisschuhen aber entlockte ihm ihr Versuch nur ein Ächzen und sorgte lediglich für eine vorübergehende Lockerung des tödlichen Drucks.
Blut rann ihr über das Handgelenk, als sie zurücksprang und ihren Angreifer gegen den Tresen aus Granit stieß, auf dem eine Reihe Monitore standen. Einer der Bildschirme fiel nach kurzem Taumeln auf den Boden und zerbrach, als sie bei den Computern nach etwas tastete, das sie als Waffe gebrauchen konnte.
Sie bekam den Hals einer Flasche Fanta zu fassen, welche sie nach hinten schwang, wo sie seinen Kopf vermutete. Die Flasche traf ihr Ziel mit einem zufriedenstellenden klonk, worauf sie sie erneut schwang, diesmal mit dem Ergebnis, dass die Flasche an seinem Kopf zerbarst. Sie blendete den Schmerz aus, den die Schlinge verursachte, und stach hinter ihrem Kopf mit dem scharfkantigen Ende der zerbrochenen Flasche immer wieder um sich, bis sie einen unterdrückten Schrei hörte und sich ein warmer Schauer über ihr Genick ergoss. Der Griff um ihren Hals lockerte sich, sie wirbelte herum und hob gleichzeitig geschickt ihr Knie an, während sie die Schlinge wegschleuderte. Ihr Bein traf auf das weiche Gewebe seiner Leiste und sie erhaschte einen Blick auf das kalte Gesicht eines Mannes mittleren Alters, aus dessen aufgeschnittener Wange und rechtem Auge das Blut in Strömen floss. Er boxte mit der Faust nach ihr, aber sie duckte sich nach rechts weg und er schlug weit ins Leere. Erneut hackte sie mit der Flasche nach ihm, täuschte den Angriff aber nur vor und trat ihm stattdessen mit aller Kraft in den Bauch.
Die Beine des Angreifers knickten ein, er fiel hin, schlug sich seinen bereits übel zugerichteten Kopf am Tresen an und fiel auf eines seiner Knie. Benommen griff er in die Hosentasche und zog ein Springmesser hervor. Die Klinge schnappte auf. Er holte aus. Sie wich dem Messer aus und trat ihn erneut. Diesmal war er darauf gefasst; sie merkte, wie er seine gestählten Bauchmuskeln anspannte, um dem Tritt standzuhalten. Als er wieder gegen den Tresen geschmettert wurde, schleuderte sie ihm die Flasche entgegen, dann schnappte sie sich einen der Flachbildschirme und schlug ihn mit Schwung gegen seinen Kopf, wobei sie seinen Wangenknochen traf. Der Bildschirm zersplitterte, als sie unaufhörlich damit zuschlug und brutal bearbeitete, was von seinem Gesicht noch übrig war.
Trotzdem hielt er das Messer weiter fest in der Hand.
Er warf sich gegen sie, und sie fühlte einen stechenden Schmerz, als sich die Klinge in ihr Kreuz bohrte, obwohl sie mit einer Drehung auszuweichen versuchte. Sie trat ihn noch einmal mit dem Knie, zerrte eine Maus aus dem Haufen Computerschrott und nahm den Mann mit dem Kabel in den Würgegriff.
Die Muskeln in ihren Armen traten hervor, als sie an beiden Enden des Kabels zog, bis die Messerangriffe, die anhielten, obwohl sie außer Reichweite war, langsam schwächer wurden. Maya kümmerte sich nicht um das Blut, das aus dem Schnitt in ihrer linken Hand strömte, als sie sich anstrengte, ihren Würgegriff aufrechtzuerhalten, bis der Killer sichtlich kurz davor war, das Bewusstsein zu verlieren.
Als ihm klar wurde, dass er den Kampf verlieren würde, befreite er sich und riss ihr das Mauskabel aus der Hand. Sie rannte zur Registrierkasse und hoffte, eine der schweren Metallkannen zu fassen zu kriegen, in denen sie sonst Wasser und Saft servierte, aber er stellte ihr rasch ein Bein, wodurch sie stürzte und gegen die Kasse knallte. Darauf wirbelte er herum und stieß sich kraftvoll von der Kasse ab, um mit dem Messer auf sie loszustürmen. Sie wusste, dass er vor lauter Blut im Gesicht nicht mehr gut sehen konnte, aber das half ihr nun auch nichts mehr, da sie ihren Schwung verloren hatte und er am Zug war.
Er schwang wieder mit dem Messer nach ihr, erwischte ihr flatterndes Shirt aber verfehlte die Rippen. Sie drehte sich herum und tastete nach der Schere, die immer bei der Kasse lag, aber ihre Finger fanden einen anderen, vertrauten Gegenstand. Ihre Brust bebte vor Anstrengung, aber sie bekam das Objekt zu fassen und schlug es mit aller Gewalt gegen seinen Kopf.
So überrascht wie verdutzt riss er die Augen auf, bevor er zu Boden fiel und krampfartig zuckte.
Sie beobachtete seinen Todeskampf, den Blick auf den Sockel des Kassenzettelhalters gerichtet, dessen fünfzehn Zentimeter langer Stachel sich durch das Ohr des Mannes in sein Gehirn gebohrt hatte. Als er aufhörte zu zucken, ließ sie sich zitternd in einen Drehstuhl fallen und verschaffte sich einen raschen Überblick über ihre Wunden. Ihre Hand war arg mitgenommen, aber wenn sie ihre Finger ausstreckte, bewegten sie sich noch, also war es keine schlimme Verletzung. Sie war sich sicher, dass auch die Wunde am Rücken nur oberflächlich war, obwohl sie ein leichtes Stechen spürte. Das meiste Blut an ihr aber stammte von dem Toten.
Einen Moment lang blieb sie keuchend sitzen, dann sah sie sich rasch um, nahm eines der T-Shirts, das sie in ihrem Shop an Touristen verkaufte und wickelte es sich um ihre Hand. Dann ging sie zurück zur Leiche ihres Angreifers, beugte sich hinunter und untersuchte seine Kleidung nach Waffen, aber außer der Schlinge und dem Messer hatte er nichts bei sich, nur eine Geldbörse mit einer Kreditkarte einer unbekannten Bank und ein paar hundert Dollar.
Ein Geräusch hinten im Laden brachte ihre Aufmerksamkeit blitzartig zurück. Jemand versuchte durch die verschlossene Hintertür einzudringen.
Sie wusste, wenn es Profis waren, würde die Tür sie nicht lange aufhalten können.
***
Jemand mit Handschuhen stieß die Tür auf, nachdem das Schloss sich nur als geringfügiges Hindernis für einen strategisch gut platzierten Schuss aus einer Pistole mit Schalldämpfer erwiesen hatte, der den Türpfosten mit einem gedämpften Splittern in Stücke riss. Der enge Flur war dunkel, weshalb sich der Eindringling vorsichtig durchtastete, bis er in dem kleinen Büro ankam. Er richtete die Waffe nach vorn, als er nach dem Lichtschalter an der Wand tastete. Er drückte ihn – nichts passierte.
Die Tür gegenüber von ihm flog krachend auf, als Maya so schnell, dass sie kaum zu sehen war, aus einem kleinen Lagerraum gestürmt kam. Er bekam ihre Ankunft gar nicht mit, als er seine Waffe fallen ließ und ihm Blut über den Rücken lief, nachdem sie ihm die Schere zwischen die Schulterblätter hindurch ins Herz gerammt hatte.
Nach ein paar Sekunden war alles vorbei. Der Leichnam des Eindringlings rutschte zu Boden und hinterließ eine wachsende dunkelrote Pfütze. Maya stieg über ihn hinweg, hob seine Pistole auf und sah sie sich an. Eine Beretta 92 mit vollem Magazin; ungefähr vierzehn Schuss waren übrig, wenn man den einen von der Türöffnung wegrechnete. Maßgefertigter Compact-Schalldämpfer. Die Waffe war extra umgebaut worden, damit der Schalldämpfer passte; es waren also weder Kosten noch Mühen gescheut worden – das war gar nicht gut.
Sie kroch zu dem Toten und durchsuchte ihn kurz, fand aber nichts, außer noch einer leeren Geldbörse mit ein paar hundert Dollar.
An der Hintertür erklang ein extrem schwaches Kratzen.
Maya warf sich auf den Boden im Flur und feuerte aus nächster Nähe auf die Silhouette im Türrahmen. Der Fremde ächzte, dann schlug ein schallgedämpfter Schuss in die Wand nahe ihres Kopfes. Sie schoss noch zweimal, dann fiel der Angreifer rückwärts nach draußen auf die Erde.
Sie wartete einen Herzschlag und einen zweiten lang. Es könnten nur diese drei gewesen sein, es könnte aber noch ein vierter kommen. Oder noch mehr.
Nichts.
Wenn noch jemand zu denen gehörte, wäre er sicher schlau genug, zu warten, bis sie hinausging, um sich den Toten anzusehen.
Sie sprang auf die Füße und rannte vor in den Laden. Sie hatte die Sicherungen ausgeschaltet, bevor sie sich in dem Lagerkämmerchen versteckt hatte, daher war das Ladenlokal jetzt stockdunkel; die Sonne hatte längst ihre himmlische Reise hinter dem Horizont des Ozeans vollendet. Maya ging zum Tresen und nahm noch ein T-Shirt vom Stapel. Sie entledigte sich des blutverschmierten Tops und zog ein sauberes, dunkelblaues Shirt an, dann holte sie hinter der Kasse eine Rolle Küchenpapier hervor und verband sich damit notdürftig die Hand, den Rest stopfte sie in ihre Tasche. Die Wunde war bereits verkrustet. Sie fühlte sich zwar schrecklich, war aber am Leben.
Sie hielt inne und spitzte die Ohren. Alles, was sie hörte, war Musik von der Straße und das gelegentliche Gejohle von feiernden Menschen, die vorbeigingen.
Hinten im Laden war es still.
Maya hängte sich ihre Handtasche über die Schulter und versteckte die Waffe darin, damit draußen niemand deswegen in Panik geriet. Sie spähte durch die Fenster und schätzte die Menge auf der Straße auf locker ein paar hundert Menschen, zwischen denen man recht einfach untertauchen konnte; gleichzeitig würde es so aber auch schwieriger, mögliche Angreifer zu entdecken. Sie betrachtete noch einmal das Blutbad in ihrem kleinen Internet-Café, das die letzten zwei Jahre ihre Lebensgrundlage gewesen war und atmete tief durch. Es würde nichts bringen, das Unausweichliche hinauszuzögern, und mit ein bisschen Glück würde sie das Überraschungsmoment auf ihrer Seite haben.
Sie schwang die Vordertür auf und tauchte ins Getümmel, dabei hielt sie vorsichtig Ausschau nach allem Verdächtigen. Horden angetrunkener Einheimischer strömten benommen durch die Gassen und über jene Straßen, die für die Dauer des Festivals für Autos gesperrt waren. Zwei Jongleure auf hohen Stelzen warfen Bälle hin und her und grinsten anzüglich und voller Heiterkeit mit ihren bemalten Gesichtern auf die Menschenmenge unter ihnen.
Als eine markerschütternde Explosion die Luft zerriss, ging Maya reflexartig in Deckung. Es folgte noch eine Explosion, dann nahm sie die hocherfreuten Gesichter um sich wahr – die Detonationen kamen von einem Feuerwerk, das seine leuchtenden Strahlen über die leidenschaftlichen Feierlichkeiten ausbreitete.
Innerlich schüttelte sie sich und zwang ihren Puls, wieder in normalem Maß zu schlagen. Ihre früheren Instinkte waren eingerostet, aber sie waren dabei, sehr schnell wieder zu erwachen. Ein dritter Donnerschlag hallte von der Küstenstraße wider, gefolgt vom Stakkato kleinerer Feuerwerkskörper, die den Nachthimmel mit grellen roten und blauen Strahlen erleuchteten, die sich wie Blüten ausbreiteten.
Sie ging hinunter zur Straßenecke und überquerte zügig die Straße in Richtung einer Gruppe von Gebäuden, die das Zentrum des Strandviertels umgaben, in dem ihr Café stand. Sie überwachte ihre Umgebung, indem sie die Spiegelungen in den Schaufenstern betrachtete. Alle dreißig Meter blieb sie stehen und hielt so nach Bedrohungen Ausschau.
Wer auch immer hinter ihr her war, meinte es verdammt ernst. Sie hatten die Waffen und die Herangehensweise von absoluten Profis. Ihr sorgfältig aufgebautes, friedliches Leben war erschüttert. Aber warum das alles – warum gerade jetzt? Und wer? Es ergab keinen Sinn.
Besonders, da sie seit drei Jahren tot war.
Maya bewegte sich unerkannt zwischen den Frauen, die am Wasser entlang gingen – ein Meer aus schwarzen Haaren und gebräunter Haut – und sie begrüßte den Umstand, dass es Nacht war, denn nachts standen ihre Chancen besser. Selbst, wenn ihre Gegner Fotos von ihr hatten – wovon sie ausging, wenn sie ihre Hausaufgaben gemacht hatten –, wäre es schwierig, sie im Dunkeln zu erkennen. Dazu kam noch, dass der Karneval inzwischen sein volles Ausmaß erreicht hatte und viele Menschen Masken und Kostüme trugen, was die Möglichkeiten, jemanden zu identifizieren, noch weiter einschränkte.
Ihre Hand pochte vor dumpfem Schmerz, während sie ihre Optionen abwog. Es würde höchstens ein paar Stunden dauern, bis man die Leiche an der Hintertür finden und damit die Polizei in Alarmbereitschaft versetzen würde, die sofort eine Fahndung nach ihr herausgeben würde, um sie verhören zu können. Selbst in ärmeren Ländern wie Trinidad und Tobago würden drei Leichen nach einer Erklärung verlangen – einer Erklärung, die sie so schnell nicht unbedingt geben wollte.
Sie versteckte sich in einem Souvenirladen und kaufte eine schwarze Baseballkappe, auf der das Logo der Insel prangte, sowie ein langärmeliges Shirt mit der schlecht gezeichneten Darstellung eines Segelboots darauf. Sie sah sich um und nahm spontan eine mit Federn geschmückte Karnevalsmaske, die sie in ihre Handtasche stopfte, bevor sie bezahlte. Als sie hinausging, sah sie mit der falsch herum aufgesetzten Mütze eher aus wie ein punkiger Teenager als eine Achtundzwanzigjährige. Hoffentlich reichte das, um mögliche Verfolger zu verwirren.
Als sie gerade einer ausgelassenen Gruppe junger Männer auswich, nahm sie auf dem Bürgersteig gegenüber eine verdächtige Bewegung wahr. Maya nahm ihr Telefon aus der Handtasche und benutzte den Bildschirm als Spiegel, bevor sie es sich ans Ohr hielt und so tat, als telefoniere sie. Sie konnte nicht viel sehen. Ein Mann mit rasiertem Kopf, offenbar kein Einheimischer, der trotz der Temperaturen eine Windjacke trug, war ihr auf den Fersen. Er war ganz offensichtlich nicht wegen des Straßenfests hier.
Maya tat weiter so, als telefoniere sie mit einem erfundenen Freund und ging dabei im Kopf mögliche Maßnahmen durch. Als Erstes musste sie das Telefon loswerden. Es war zwar ein Wegwerfhandy mit einer Prepaidkarte, trotzdem konnte es sich als Gefahr erweisen – die meisten Regierungen, Geheimorganisationen und Hi-Tech-Überwachungsfirmen konnten Mobiltelefone aufspüren oder sogar das Mikrofon anzapfen, um Gespräche mitzuhören, selbst wenn es ausgeschaltet war. Sie war zwar überzeugt, dass das kein Problem darstellte für jemanden wie sie, da sie aus Sicherheitsgründen das Telefon ohnehin regelmäßig austauschte, aber unter den gegenwärtigen Umständen musste sie davon ausgehen, dass ihren Verfolgern unbegrenzte technische Möglichkeiten zur Verfügung standen.
Ein komplett mit goldener Farbe überzogener Feuerspucker tauchte neben ihr auf und blies einen gelben Feuerstrahl in den Nachthimmel. Feiernde schickten sich an, Bilder zu machen, bis eine betrunkene Frau schrill lachend zwei schlagende Argumente entblößte, welche die Aufmerksamkeit der Fotografen auf sich zogen. Gleichzeitig sorgte das für eine kurze Ablenkung, die Maya nutzte, um in eine Ecke zu schlüpfen und das Telefon in einen Mülleimer zu werfen, bevor sie ihre Flucht fortsetzte. Nicht weit entfernt sah sie eine Bar, die sie kannte und die neben dem Gästebereich innen auch noch einen Außenbereich im Hinterhof hatte. Damit bot sich eine Möglichkeit, die Verfolger abzuschütteln, falls sie richtig folgerte, dass diese, wer auch immer sie waren, nicht einfach in aller Öffentlichkeit anfangen würden, jeden umzulegen, der sich bewegte. Aus dem Angriff vorhin schloss sie, dass sie sie mit einem Mindestmaß an Aufsehen erledigen wollten, was aber schnell nach hinten losgegangen war.
Der Eingang zur Bar ›El Pescador‹ befand sich nur noch wenige Meter entfernt zu ihrer Rechten. Musik und frohes Lachen drangen auf die Straße, und es klang ganz so, als sei die Kneipe zum Bersten voll, was für sie von Vorteil sein konnte.
Sie drängte sich an ein paar angetrunkenen Menschen draußen vorbei und kämpfte sich durch die Massen, mit dem Ziel, zum Außenbereich zu gelangen. Ein paar der Leute, die sie angerempelt hatte, warfen ihr schmutzige Blicke zu, als sie das neue Langarmshirt über ihre Kleidung zog. Ihre Verfolger hatten es absolut nicht leicht, ihr auf den Fersen zu bleiben. Sie warf die Baseballkappe auf einen Tisch und band ihre Haare geschickt zu einem Pferdeschwanz. Als sie einen Haargummi aus der Handtasche angelte, strichen ihre Knöchel über den Sicherheit versprechenden Griff der schallgedämpften Pistole. Innerhalb von Sekunden hatte sie sich in eine andere Frau verwandelt – dieses Mal in eine seriöse College-Studentin im Urlaub.
Maya widerstand der Versuchung, einen Blick zurückzuwerfen, um zu sehen, ob der Stalker ihr in die Bar gefolgt war, und drückte sich stattdessen die letzten Meter weiter durch die Menge nach hinten in den Hof. Dort standen weniger Leute herum, aber sie wusste, dass das gesamte Etablissement in ein paar Stunden nur noch Stehplätze übrig haben würde.
Sie sah sich um und musterte die Mauer um den Außenbereich, die ihr den Weg zu der Bar gezeigt hatte – sie erinnerte sich, dass daran zwei gemauerte Toilettenhäuschen ohne Überdachung eingelassen waren. Maya ging schnurstracks zur Damentoilette und schloss die Tür ab, dann stellte sie sich sofort auf den Toilettensitz, um den Rand der Mauer zu fassen zu kriegen.
Ihre verletzte Hand protestierte energisch, als sie sich hochzog. Auf der anderen Seite ließ sie sich leise auf das Pflaster fallen. Wer auch immer hinter ihr her war, musste nun improvisieren – der Plan war eindeutig, sie um jeden Preis auszulöschen, und seit drei von ihnen in dem Shop ausgeschaltet worden waren, waren sie wahrscheinlich unterbesetzt.
Ein heftiger Schlag riss ein Stück aus der Fassade neben ihr und sie hörte den unverwechselbaren Klang eines Querschlägers, also beschloss sie, rasch loszurennen, um Abstand zwischen sich und den Schützen zu bringen. Ein weiterer Schuss aus größerer Entfernung ging auch daneben – sie riskierte einen Blick über die Schulter. Der Angreifer schoss durch das hintere Toilettenfenster; wahrscheinlich stand er auf der Kloschüssel, um an die Öffnung heranzukommen, die mit einem Eisengitter gegen Einbrüche geschützt war. Sie wollte keine ihrer wertvollen Patronen verschwenden, also sprintete sie zum Ende der langen Gebäudezeile, statt zurückzufeuern. Mit jedem Meter, den sie zwischen sich und die Waffe bringen konnte, würde die Treffsicherheit der schallgedämpften Neunmillimetergeschosse weiter nachlassen. Angesichts der Entfernung hatte sie einen Vorteil – der sofort weg war, als sie um eine Ecke in eine noch schmalere Straße bog und auf eine Person zulief, die zwanzig Meter weiter mit gezogener Waffe angerannt kam.
Sie mussten sich abgesprochen haben, wahrscheinlich per Funk oder auf einem anderen ausgeklügelten Kommunikationsweg.
Der Kerl mit der Waffe zögerte für den Bruchteil einer Sekunde, da schoss Maya durch ihre Handtasche hindurch. Zwei Kugeln gingen ins Nirgendwo, die dritte aber traf und er fiel um, wobei er noch einen Schuss abgeben konnte. Sie spürte einen Schlag unten an ihrem neuen Shirt und sah ein qualmendes Loch im flatternden Stoff an ihrer Hüfte klaffen. Die Kugel hatte sie nur um einen Zentimeter verfehlt, was ausreichend entfernt, ihr aber immer noch zu nah war.
Ein weiteres Geschoss sauste in großem Abstand vorbei, als der Killer sie zu treffen versuchte. Sie trat ein paar Schritte auf ihn zu, holte die Beretta aus der Handtasche, zielte sorgfältig und drückte ab. Der Mann zuckte kurz, seine Waffe schepperte auf das Kopfsteinpflaster, dann blieb er reglos liegen.
Maya trat vorsichtig näher, die Waffe auf seinen erstarrten Körper gerichtet, und kickte mit dem Fuß die Pistole aus seiner Reichweite. Ihr fiel auf, dass er die gleiche Beretta hatte wie sie – dann zog es ihr die Beine weg und sie fiel hintenüber. Der Schütze hatte sie mit dem Fuß umgerissen, worauf sie nicht rechtzeitig reagiert hatte. Noch im Fallen erkannte sie ihren Fehler und es gelang ihr, sich abzurollen.
Der Schmerz vom Sturz auf die harte Straße schoss ihr in die Seite, aber sie ignorierte ihn und konzentrierte sich darauf, ihre Waffe nicht loszulassen, als sie versuchte, weit genug von dem am Boden liegenden Mann wegzukommen, um weiteren Schaden durch ihn abzuwenden. Ihr Handgelenk schleifte über den Boden und wurde für einen Augenblick taub, weshalb sie zuckte und die Pistole unfreiwillig fallen ließ.
Er trat erneut nach ihr, aber sie überraschte ihn, indem sie sich blitzartig aufrichtete und ihm dabei ihren Ellbogen ins Gesicht rammte. Zu ihrer Zufriedenheit traf sie seinen Unterkiefer, und sein Kopf schlug daraufhin hörbar auf das raue Straßenpflaster. Sie setzte noch einen brutalen Schlag von oben mit dem Ellbogen nach und hörte, wie sein Nasenbein zersplitterte.
Ihr Kopf wurde nach hinten gerissen und ihr wurde schwarz vor Augen von den Schmerzen in ihrem Kiefer, als dieser von der Faust des Mannes getroffen wurde. Dann spürte sie, wie unglaublich starke Arme ihren Oberkörper umschlangen und nach festem Griff suchten. Sie drehte sich mit seiner Bewegung und rammte ihm den Ballen ihrer geschundenen Hand in die kaputte Nase, aber er drehte sich im letzten Moment weg und wich so dem Schlag aus, der ihn das Leben gekostet hätte. Maya setzte sogleich nach, indem sie ihm trotz des Protests ihrer Hand mit dem Finger ins Auge stach und ihre Nägel in seine Hornhaut bohrte. Dieses Mal war er etwas langsamer und heulte auf vor Schmerzen – der erste Laut, den einer von ihnen seit Beginn des tödlichen Zweikampfs von sich gegeben hatte.
Ihr nächster Schlag erstickte den Schrei: Sie schlug mit beiden Handflächen auf seine Ohren und zerriss ihm damit auf der Stelle die Trommelfelle – sie wusste, dass solch eine Verletzung unsagbare Qualen verursachte. Seine Arme fielen von ihr ab und er griff sich an den Kopf. Sie nutzte die Kraft ihres Schwungs und schmetterte seinen Schädel auf das Pflaster. Ein abscheuliches Knacken bestätigte das Ende des Kampfes. Er lag reglos da, unter ihm sickerte Blut hervor und lief in den Rinnstein.
Sie rollte sich weg, kam auf die Knie, stand schließlich auf und ging zu seiner Waffe, die auf dem Boden lag. Als sie sich vergewissert hatte, dass sie mit ihrer identisch war, ließ sie das Magazin herausgleiten und steckte es in ihre Handtasche. Sie würde ihre Pistole später in einer Verschnaufpause nachladen.
Ein weiterer Mann lugte um die Ecke des Gebäudes am Ende der Häuserzeile und richtete den Lauf seiner schallgedämpften Pistole in ihre Richtung – sie reagierte instinktiv, riss die Pistole ohne Magazin hoch und drückte ab.
Die Kugel, die noch in der Kammer war, trat aus, und Maya sah, wie die Hälfte seines Gesichts weggerissen wurde und sein Körper hinter dem Gebäude zusammenklappte.
Sie warf die leere Kanone weg, hob flink ihre eigene auf, näherte sich dem bewegungslosen Körper ihres neuesten Gegners und ging ihre Optionen durch. Sie konnte entweder davonlaufen oder hierbleiben und sich darauf konzentrieren, jeden auszuschalten, der noch hinter ihr her war. Der kurze Blick, den sie auf den letzten Angreifer erhaschen konnte, verriet, dass es nicht der Mann war, der sie vorhin die ganze Zeit verfolgt hatte, folglich lief noch mindestens ein weiterer herum. Vielleicht noch mehrere.
Vorsichtig spähte sie in die Richtung, aus der sie kam, aber die Gasse war menschenleer. Der Schütze aus dem Klo der Bar war wahrscheinlich zur Vordertür raus und schlich um die Gebäude herum. Das war eine wertvolle Information, und sie somit in der Lage, ihm vorbereitet gegenüberzutreten.
Sie beobachtete weiter die Gasse, griff mit ihrer schmerzenden Hand hinunter und ging rasch die Taschen des besiegten Gegners durch, wobei ihr das verräterische, zerbrochene Headset auffiel, das der Mann im Ohr trug. Hochmoderne, abhörsichere Funkausrüstung – ganz wie sie erwartet hatte.
Seine Waffe war auch eine Beretta, also tauschte sie das Magazin ihrer Pistole gegen seines aus und verschwand im Dunkel eines nahen Torbogens, bereit, den nächsten Angriff zu erwarten.
Der nicht stattfand.
Sie wartete lange, aber niemand tauchte auf. Eine Minute, zwei, aber nichts tat sich.
Aus der anderen Richtung hörte sie schlurfende Schritte von Leuten, die sich auf Spanisch unterhielten. Es klang nach drei jungen Männern, die sich nicht einig waren, wo sie als Nächstes hingehen sollten. Ihr Abend wäre ruiniert, sobald sie die Leichen entdecken würden, aber das war nicht ihr Problem.
Sie musste weg von hier, ihre vorbereitete Fluchtausrüstung holen und für alle Zeit untertauchen.
Leise wie ein Gespenst trat Maya aus der Dunkelheit, verschwand in der Nacht und wurde eins mit den Schatten. Nur das Echo der Stimmen der jungen Männer folgte ihr die Straße entlang.
Kapitel 2
In der Ferne heulten schon die Sirenen, als sie in unauffälligem Tempo ihres Weges ging – wie eine ganz normale Einheimische auf dem Heimweg nach einem langen Tag.
Es war völlig klar, dass sie letzten Endes von der Polizei gejagt würde – die Frage war nur, wie schnell sie sein würden. Wenn sie Hilfe hatten, zum Beispiel in Form eines anonymen Anrufs, der Maya verriet, könnten sie sofort hinter ihr her sein. Wenn sie aber erst die Puzzleteile nach dem Auffinden der Leichen im Café zusammenfügen mussten, blieben ihr wohl noch ein paar Stunden.
Sie konnte sich aber weiterhin keine Verschnaufpausen leisten. Es war das Sicherste, davon auszugehen, dass die Behörden die Jagd auf sie schon in Kürze eröffnen würden, weshalb es für Maya oberste Priorität hatte, ihr Fluchthilfe-Set in die Finger zu bekommen.
Vier Blocks weiter bog sie ab und ging in den Park – ihr Ziel war ein englischer Pub, der einer Frau gehörte, mit der sie sich kurz nach ihrer Ankunft auf der Insel angefreundet und die ihr geholfen hatte, eine Wohnung zu finden und ihr auch Kontakte zu Arbeitern vermittelt hatte, die sie brauchte, um das Internetcafé aufzubauen. Chloé war eine ausgewanderte Französin, Anfang vierzig, das dritte Mal verheiratet, und eher zufällig in Trinidad gelandet, wie viele andere auch. Sie war als Urlauberin hergekommen und verliebte sich in den Eigentümer der Bar – Vincente, ihr dritter Ehemann. Sie hatten sich erfolgreich einen Gastronomiebetrieb aufgebaut, der auf die Inselbewohner abzielte, die auf der Suche nach etwas Besonderem waren. Vier Monate, nachdem sie sich kennengelernt hatten, bat Maya Chloé, ein paar Sachen für sie im Keller aufzubewahren.
Im King’s Arms war an diesem Freitagabend nicht viel los. Wegen des Karnevals spielte sich die meiste Action an der Küste ab, daher waren nur ein paar unerschütterliche Säufer in der Bar, sowie drei dicke Deutsche, die lautstark in ihrer Muttersprache diskutierten, warum niemand außerhalb Deutschlands in der Lage war, anständiges Bier zu brauen. Maya sprach sieben Sprachen, aber als sie die Bar betrat, verheimlichte sie, dass sie alles verstehen konnte, selbst, als sie anzügliche Bemerkungen austauschten, was sie gern alles mit ihr machen würden.
Chloé war gerade dabei, die Flaschen mit einem Lappen abzuwischen.
Maya ging lächelnd auf sie zu.
Chloé hingegen runzelte die Stirn. »Liebes! Was ist mit dir passiert? Was ist mit deiner Hand?«
Maya war klar, dass sie ziemlich mitgenommen aussah. Sie betrachtete die blutverschmierten Papiertücher, die sie hastig um ihre Wunde gewickelt hatte und wusste, dass die Kratzer in ihrem Gesicht deutlich sichtbar sein mussten.
»Ich bin so ein Trampel. Wollte ein paar neue Bilder aufhängen, und das ging gründlich schief. Ich wollte sie mit Draht befestigen und habe mich daran geschnitten, als ich vom Stuhl fiel. Ich werde es nähen lassen, wenn ich hier fertig bin.«
»Was? Nähen? Guter Gott! Hast du dir den Kopf schlimm gestoßen?«, rief Chloé, deren Mutterinstinkt zum Vorschein kam.
»Schlimm genug, aber das meiste hat meine Hand abbekommen. Sieht schlimmer aus, als es ist. Es war dumm von mir, mich auf einen Drehstuhl zu stellen. Hör zu, Chloé, ich muss an die Kiste, die ich bei dir gelassen habe. Sorry, dass ich so spät abends auftauche, aber wäre das möglich? Es dauert auch nur ein paar Minuten.«
»Bist du verrückt? Lass erst einmal deine Hand verarzten. Die Kiste kann warten.«
»Ich weiß, ich weiß, aber nun bin ich schon hier und dort befinden sich eben ein paar Sachen, die ich unbedingt jetzt brauche.«
Chloé seufzte resigniert. »Wenn du das sagst. Ich kann dir den Keller aufsperren, aber ich bin heute allein hier, also musst du selbst zurechtkommen. Vincente ist mit ein paar Freunden zum Karneval. Wir dachten, es würde heute nichts los sein. Alle sind draußen auf der Straße.«
»Ich brauche nur fünf Minuten. Ich weiß, wonach ich suchen muss.«
»Cheri, du machst mir Sorgen. Im Krankenhaus wirst du ein paar Stunden warten müssen, bis du dran kommst. Ich werde einen Freund von mir – einen Arzt – anrufen. Er ist Allgemeinmediziner, aber sicher in der Lage, deine Wunde zu nähen. Er wohnt über seiner Praxis. Es ist nur ein paar Straßen weiter.«
Maya dachte über das Angebot nach, unter Berücksichtigung der Dringlichkeit ihrer allgemeinen Lage. Irgendwann musste sie die Hand versorgen lassen, wenn sie nicht riskieren wollte, dass sie dadurch später in eine Situation geriet, wo sie deswegen handlungsunfähig sein könnte.
»Oh, vielen, vielen Dank, Chloé. Du bist meine allerbeste Freundin. Wirklich. Tut mir leid, dass ich dir so viele Umstände bereite …«
»Unsinn. Ich sperre dir auf, dann rufe ich an. Hoffentlich ist er noch nicht betrunken.«
Sie gingen zusammen nach hinten und Chloé sperrte die Tür zum Keller auf. Sie machte Licht und deutete die baufällige Holztreppe hinunter.
»Es ist genau dort, wo du es gelassen hast, hinten bei den zwei Tauchflaschen.«
»Ich weiß. Kümmere dich ruhig um deine Gäste. Ich bin sofort zurück.« Maya ging an ihr vorbei in den feuchten Raum.
Chloé nickte und machte leise die Tür hinter ihr zu.
Maya schob den Riegel vor, damit sie ungestört war, und ging schnurstracks zu der Kiste, die sie vor fast zwei Jahren hier deponiert hatte. Sie war noch immer mit dem Paketband von damals zugeklebt. Sie zog die Kiste heran und schlitzte das Klebeband mit ihrem Schlüssel auf, dann holte sie einen mittelgroßen Aluminiumkoffer heraus, der für Handgepäck auf Reisen gedacht war. Nachdem sie die Kombination am Zahlenschloss eingestellt hatte, legte sie die Verschlüsse um, die sofort aufschnappten.
Maya schielte zur Tür hoch, dann widmete sie sich dem Inhalt des Koffers.
Als Erstes kam eine Heckler-&-Koch-MP7A1-Maschinenpistole mit Schalldämpfer zum Vorschein, eingewickelt in ein Wachstuch. Dann fand sie die vier Kaliber-Dreißig-Magazine und drei Schachteln mit Munition. Danach holte sie ein Butterflymesser mit rasiermesserscharfer Klinge hervor, sowie zwei Handgranaten. Schließlich noch eine Ruger-P95-Pistole, Kaliber neun Millimeter, und ein ›Super Tool‹, ein Multifunktionswerkzeug, aus rostfreiem Stahl.
Die Waffen lagen ausgebreitet auf dem Boden. Sie holte noch eine schwere, wasserdichte Plastiktüte hervor. Darin befanden sich zwanzigtausend Dollar in Hundertern, ein belgischer und ein nicaraguanischer Ausweis mit unterschiedlichen Namen, dazu passende Führerscheine sowie eine Kreditkarte von der Firma Techno Globus SA, die noch drei Jahre gültig war und mit der sie von jedem Geldautomaten der Welt Zugriff auf ein Konto mit hundertfünfzigtausend Dollar hatte. Die letzten Gegenstände waren ein Verbandskasten, Haarfärbemittel und ein tragbares GPS-Gerät, das auf einem flachen Schweizer Nylonrucksack lag – der Rucksack war praktisch unzerstörbar und hatte zwei Fächer, die bis zu einer Tiefe von fünf Metern wasserdicht waren. Nachdem sie die Magazine geladen hatte, packte sie den Koffer wieder in die Kiste und stellte sie zurück neben die Tauchflaschen. Sie sah auf die Uhr, dann packte sie die Waffen und Dokumente in den Rucksack und war erstaunt, wie wenig Platz die Sachen einnahmen. Maya fühlte sich nun viel besser, da sie ihre eigenen Waffen und zwei neue Identitäten zur Hand hatte.
Sie war schon nach kurzer Zeit wieder in der Bar und dankte Chloé noch einmal.
»Siehst du? Ich sagte doch, es würde nicht lange dauern.«
»Ich habe meinen Freund erreicht. Er kann dich in zehn Minuten in seiner Praxis empfangen. Sie ist neben dem kleinen Café, wo es diese großartigen Croissants gibt. Weißt du noch?«
»Wie könnte ich das vergessen? Danke noch einmal, Chloé. Ich habe deinen aufregenden Abend mit den Jungs hier nur äußerst ungern gestört«, scherzte Maya mit Blick auf die besoffenen Deutschen.
»Solange sie bezahlen, bin ich zufrieden. Brauchst du seine Adresse? Er heißt Roberto. Er sieht auch gut aus.«
»Nein, ich weiß, wo ich hin muss.«
Maya streckte ihren gesunden Arm aus, umarmte Chloé und gab ihr ein Küsschen auf die Wange.
»Ciao, Süße. Viel Glück mit deinen Wunden und ruf mich an, wenn du irgendetwas brauchst. Ich werde bis zwei Uhr hier sein«, sagte Chloé, die immer noch besorgt war.
»Das werde ich. Bleib brav.«
***
Die Straßen füllten sich weiter mit Menschen, als sie sich auf den Weg zurück zur Küste machte. Die Arztpraxis war fünf Blocks vom Strand entfernt – weit genug, um weniger Miete zahlen zu müssen, aber auch nahe genug, um kranke oder verletzte Touristen empfangen zu können. Sie fand sie auf Anhieb, öffnete die Tür und wartete.
»Doktor Roberto?«
»Ich bin hier. Sie müssen Carla sein …« Carla war der Name, den Maya in Trinidad benutzte – ihre dritte Identität, die sie jetzt aufgeben musste.
Sie nickte.
»Kommen Sie herein. Ich sehe mir das mal an.« Er führte sie zu einem kleinen Sprechzimmer, in dem schon Licht brannte.
Maya wiederholte ihre Geschichte, als er die Verletzungen untersuchte. Sie zuckte, als er sie gründlich überprüfte und desinfizierte.
»Sie haben großes Glück. Die Arterie wurde nur um ein paar Millimeter verfehlt. Es wurden keine Sehnen durchtrennt, sollte also problemlos verheilen. Sie werden diese Woche nicht mehr Klavier spielen können, aber abgesehen von den Schmerzen bedeutet es auch nicht den Weltuntergang.«
»Ich bin erleichtert.«
»Ich gebe Ihnen etwas gegen die Beschwerden – und werde auch ein bisschen nähen müssen.«
»Nein, ist schon in Ordnung. Ich halte auch größere Schmerzen gut aus. Bringen wir lieber den schlimmeren Teil hinter uns.«
Er sah sie lange an. »Sind Sie sicher?«
»Kein Problem. Nähen Sie mich einfach zu, dann ist alles bestens.«
Fünf Minuten später war er fertig und hatte sie mit einem richtigen Mullverband versorgt. Sie hielt ihre Hand hoch und betrachtete den Verband mit zustimmendem Nicken.
»Haben Sie vielen Dank für alles. Es tut mir wirklich sehr leid, Sie um diese Zeit gestört zu haben. Ehrlich.«
»Die Freunde von Chloé sind auch meine Freunde. Außerdem hatten Sie Glück, mich noch anzutreffen, bevor ich ausgehe. Was ich jetzt auch tun werde.« Er sah sie noch einmal an und lächelte. »Kann ich Sie auf einen Cocktail am Strand einladen?«
Nach einigem Geplänkel schaffte sie es, höflich aber bestimmt abzulehnen, unter dem Vorwand, Kopfschmerzen zu haben – Roberto lehnte es ab, Geld zu nehmen, bestand aber stattdessen darauf, ihr seine Telefonnummer zu geben. Hätte sie momentan nicht um ihr Leben rennen müssen, wäre sie vielleicht sogar geneigt gewesen, mit ihm ein oder zwei Bier zu trinken, heute Abend jedoch ging das absolut nicht. Sie musste sich überlegen, wie sie von der Insel wegkam, solange es noch möglich war. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Polizei alles abriegeln würde.
***
Maya hielt ein paar hundert Meter von ihrer Wohnung entfernt inne und sah sich nach Beobachtern um. Weiter die Straße runter bellte ein Hund – ein Pitbull, von dem sie aus Erfahrung wusste, dass man ihm besser nicht zu nahe kommen sollte. Das laute und aggressive Bellen ließ sie verharren – es klang ungewöhnlich alarmiert.
Die paar Autos im Viertel waren recht heruntergekommen und fielen dem Zahn der Zeit zum Opfer; die Karosserien waren rostig, wegen der salzigen Luft und jahrzehntelanger Vernachlässigung. Sie konnte keine unbekannten Fahrzeuge entdecken. Wenn ihre Verfolger also wussten, wo sie wohnte, beobachteten sie sie wohl nicht von der Straße aus.
Einige Verandalampen sorgten für ein bisschen Licht, denn die Straßenlaternen waren schon vor langer Zeit ausgefallen. Die Versprechungen der Stadtverwaltung, sie zu reparieren, waren genauso leer wie alle anderen Zusicherungen, dass sich etwas ändern würde. Maya bewegte sich vorsichtig in den Schatten. Ihre Sinne waren in höchster Alarmbereitschaft. Da draußen waren noch der Typ aus der Bar und vielleicht sogar andere unterwegs, obwohl man normalerweise nur eine kleine Handvoll Killer schickte, um ein einziges Ziel zu eliminieren. Außerdem gab es die Chance, dass ihre Gegner sie weiterhin unterschätzten.
Sie kreiste um den Wohnblock, konnte aber nichts Verdächtiges erkennen. Maya bezahlte ihre Miete immer jeden Monat bar – ohne Mietvertrag. Also konnte man sie hier nur aufspüren, wenn man ihr direkt folgte. Und das hätte sie längst bemerkt. Obwohl sie ein bisschen aus der Übung war, hatte sie immer noch diesen perfekt ausgeprägten sechsten Sinn für Verfolger. Viele der besseren Geheimagenten entwickelten diesen Instinkt mit der Zeit, und sie war die beste von allen.
Sie näherte sich ihrer Wohnung diesmal von der Rückseite des Gebäudes, indem sie über eine Mauer kletterte, welche die Stellplätze der Mülltonnen von denen der Nachbarn trennte. Ihr Appartement im ersten Stock war dunkel und es gab keine Anzeichen dafür, dass jemand hier gewesen war. Keine Beobachter in den Bäumen, keine verdächtig herumlungernden Gestalten.
Eine schwarzweiße Katze lief ihr fauchend vor die Füße. Erschrocken zückte sie die Pistole, bevor sie erkannte, dass es nur ein Tier war. Als das pelzige Wesen davonhuschte, atmete Maya erst einmal tief durch, um ihren Puls wieder zu beruhigen, der in ihren Ohren hämmerte.
Vielleicht war sie nicht nur ein bisschen aus der Übung.
Früher hätte das alles ihren Puls nicht einmal auf über achtzig beschleunigt.
Als sie ein paar leise Schritte weiter ging, bemerkte sie am Rande ihres Sehfeldes eine Bewegung. Beim Parkplatz funkelte etwas. Vielleicht eine Armbanduhr. Sie spähte in die Finsternis und ließ ihren Blick schweifen, konnte aber nicht mehr erkennen.
Egal.
Das reichte.
Da war jemand.
Der erste Schuss kam ohne Vorwarnung. Sie duckte sich hinter eine niedrige Betonziegelmauer und lauschte dem Sperrfeuer der schallgedämpften Pistole in gut dreißig Metern Entfernung.
Die Kugeln prallten wirkungslos gegen den Beton. Die Dunkelheit hatte sie gerettet. Gerade noch. Sie konnte sich endlich kurz ausruhen. Nun stellte sich die Frage: Kämpfen oder weglaufen?
Ihr Instinkt gebot ihr, zu kämpfen, aber sie wusste nichts über ihre Angreifer, wodurch sie klar im Nachteil war.
Sie feuerte siebenmal in die Richtung, in der sie den Schützen wähnte und sprintete dann Haken schlagend zur anderen Seite des Gebäudes. Dort war es dunkel und einigermaßen geschützt, sodass sie sich sicher fühlte. Der Schütze hatte wahrscheinlich die ganze Zeit gewartet, dass sie in ihre Wohnung ging, um sie dort auszuschalten – wenn er sie nicht sogar schon mit Sprengstoff präpariert hatte. Oder es wartete geduldig jemand darin, bis sie den letzten Fehler ihres Lebens machte.
Einen Augenblick später setzte Maya über die Mauer und schlängelte sich über das Grundstück. Sie hörte keine Schüsse mehr, was wohl bedeutete, dass ihre Feinde gerade wertvolle Zeit mit der Diskussion verschwendeten, was als Nächstes zu tun sei – Zeit, die den Unterschied zwischen Flucht und Tod ausmachte.
Sie rannte kraftsparend und ausbalanciert, um ihre Ausdauer gut einzuteilen. Falls nötig, konnte sie eine Stunde lang in diesem Tempo weiterlaufen. Das tat sie jeden Morgen, um fit zu bleiben.
Eine Kugel streifte ihre Schulter und schnitt durch ihren Deltamuskel, der sofort höllisch brannte – abrupt stoppte sie zwischen zwei kleinen Häusern. Als sie nicht mehr so außer Atem war, hörte sie Motorengeräusche näherkommen und das Quietschen abgenutzter Bremsen, gefolgt vom unverwechselbaren Klang zweier schlagender Türen. Ein zweites Auto kam mit quietschenden Reifen angefahren.