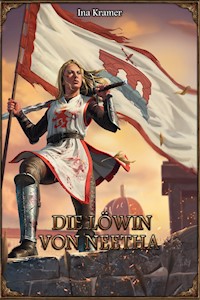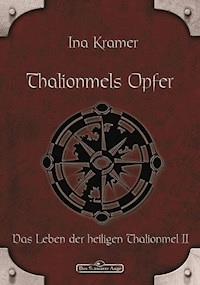Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Nach allerlei überwiegend unerfreulichen Erfahrungen und Irrwegen landet Jenny in der Wohngruppe einer städtischen Jugendhilfeeinrichtung. Dort schreibt sie auf Anregung der Heimpsychologin zwischen Oktober 2012 und Mai 2013 ihre Autobiographie nieder, unterbrochen von Berichten und Schwänken aus dem WG-Alltag. In dieser Zeit feiert sie ihren sechzehnten Geburtstag. Wer "Umbra heißt Schatten" gelesen hat, wird feststellen, dass es sich bei Jenny um Ambers alte Schulfreundin handelt. "Jetzt erzähle ich" ist zwar ein Jugendroman, aber er richtet sich auch an Erwachsene, die ein Interesse an jungen Menschen haben - Eltern, Lehrer, Erzieher ... - und gern ein spannendes Buch lesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ina Kramer wurde in Mülheim an der Ruhr geboren, machte Abitur in Essen, studierte Freie Kunst und Künstlerisches Lehramt an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf, unterrichtete vier Jahre lang Kunst an einem Duisburger Gymnasium, malte und nahm an einigen Gruppenausstellungen teil, assistierte Ulrich Kiesow beim Erstellen des Regelwerks für das Fantasy-Rollenspiel Das Schwarze Auge, trug durch Texte, darunter vier Romane, und zahlreiche Illustrationen zur Ausgestaltung der Spielwelt Aventurien bei, betreute als freie Lektorin diverse Romanprojekte, schrieb und schreibt Prosa und Gedichte. Sie lebt und arbeitet in Düsseldorf.
Bisher erschienen:
110 Gerdichte
Die Albtraumgruppe und andere Erzählungen
Frau Plaschkes Abenteuer – Roman in drei Teilen
Vorletzte Betrachtungen – Gedichte Band 2
Umbra heißt Schatten
INHALT
Kapitel – Ich, Jenny
Kapitel – Die Wohngruppe
Kapitel – Andrea
Kapitel – Meine Mutter
Kapitel – Kevin
Kapitel – Amber
Kapitel – Amber Fortsetzung
Kapitel – Tina
Kapitel – Das Vibraphom
Kapitel – Paul
Kapitel – Die Flucht
Kapitel – Boris
Kapitel – Marcel
Kapitel – Boris Fortsetzung
Kapitel – Boris zum Dritten
Kapitel – Die Glücksfee
Kapitel – Und nochmal Boris
Kapitel – Weihnachten in der WG
Kapitel – Erwischt
Kapitel – Tante Dorothee
Kapitel – Der Aufsatz
Kapitel – Die Konfirmation
Kapitel – Der Ausflug
Kapitel – Solveig
Kapitel – Rausgeflogen
Kapitel – Der Mai ist gekommen
1. Kapitel – Ich, Jenny
Also erstens: Ich heiße Jenny mit J vorne und nicht Dschenny!
Und zweitens: Meine Idee war das nicht, dieses Buch hier. Es war Andreas Idee. Sie hat gesagt, ich soll mal mein Leben aufschreiben. Ein bescheuerter Vorschlag, wenn ihr meine Meinung wissen wollt. Wer schreibt denn mit fünfzehn dreiviertel seine Autobiographie? So heißt das. Okay, Justin Bieber hat seine mit sechzehn geschrieben, aber der ist ja auch ein Popstar, da ist das was anderes. Ich bin nur Jenny Müller, war noch nie berühmt und werde es auch nie sein. Wen sollte da mein Leben interessieren? Müller ist übrigens nicht mein richtiger Nachname, aber ich habe keine Lust, den echten zu verraten. Andrea findet das irgendwie unlogisch. Denn erstens, sagt sie, soll ich mein Leben ja nicht für andere aufschreiben, sondern für mich (was wiederum ich ein bisschen unlogisch finde; ich kenne mein Leben ja schon). Und zweitens würde mich eh jeder wiedererkennen, der mich von früher kennt, ob da nun Müller, Meier oder Merkel steht. Merkel heißt unsere derzeitige Bundeskanzlerin.
Das war mal wieder so ein Scherz von Andrea, den Namen der Kanzlerin mit aufzuzählen. Ich fand es, ehrlich gesagt, auch nicht völlig unwitzig, weil Merkel mit M anfängt, also passt, und weil Frau Merkels Leben wahrscheinlich so ziemlich das Gegenteil von meinem war (ihr Vater war Pfarrer, sagt Andrea). Wahrscheinlich sind Andrea und ich die einzigen, die über so was lachen können. Ich habe dann Andrea auf den Widerspruch hingewiesen, nämlich, dass mich ja wohl kaum einer wiedererkennen könne, wenn ich für mich schreibe, also ich meine einzige Leserin bin. Da hat sie gesagt, ich solle mir einen fiktiven Leser vorstellen. Das ist ein ausgedachter Leser, einer, den es gar nicht gibt, aber geben könnte. Sich selbst hat sie ausdrücklich nicht damit gemeint, denn sie ist ja real, und für sie soll ich auch nicht schreiben (obwohl ich glaube, dass sie meinen Erguss ganz gern lesen würde; irgendwann werde ich es ihr vielleicht erlauben).
Andrea findet es übrigens lächerlich beziehungsweise peinlich, dass dieser Justin Bieber mit sechzehn seine Autobiographie geschrieben hat. Falls er sie überhaupt selbst geschrieben hat, wie sie sagt, und nicht ein Ghostwriter. Ghostwriter sind Leute, die für Leute schreiben, die nicht schreiben können. Alles klar? Ihr merkt schon, bei Andrea kann man ziemlich viele schlaue Wörter lernen. Andreas Begründung, warum sie Justin Biebers Autobiographie peinlich findet, erspare ich euch jetzt. Ich weiß gar nicht, ob sie die überhaupt gelesen hat. Nur das eine sollt ihr wissen: Sie glaubt, dass mein Leben viel spannender oder ereignisreicher war als seins. Dabei kennt sie bisher nur sehr wenig davon.
Wo ich denn anfangen soll, habe ich Andrea gefragt. Im Kindergarten? Bei meinen frühesten Erinnerungen? Aber sie findet, das sei egal, ich könne irgendwo anfangen. Da kam mir komischerweise als erstes Amber in den Sinn, die Zeit mit ihr und alles, was damals so passiert ist. Aber wenn ich das als erstes erzähle, versteht der fiktive Leser ja nichts. Da ist es wohl doch besser, ich fange mit meiner Kindheit an. Obwohl, die ist für meinen fiktiven Leser möglicherweise noch uninteressanter als der Rest. Ich stelle ihn mir nämlich ungefähr in meinem Alter vor und auch so ähnlich drauf wie ich, und ich interessiere mich nur sehr in Maßen für die Kindheitserinnerungen meiner Altersgenossen. Ich werde das Thema also kurz abhandeln, auch wenn Andrea meint, ich solle mir ruhig Zeit lassen. Aber Andreas Vorschlag, den Text in Kapitel aufzuteilen, werde ich übernehmen. Das würde ihn strukturieren, also irgendwie übersichtlicher machen, findet sie, und mir die Arbeit erleichtern.
Gerade kommt mir ein komischer Gedanke: Wenn ich mein ganzes Leben aufschreibe, werde ich nie fertig; ich kann mich einfach nicht einholen. Weil, mein Leben geht ja immer weiter, während ich schreibe. Und wenn ich den heutigen Tag erreicht habe, sind wieder ein paar Wochen oder Monate vergangen, je nachdem wie schnell ich das schaffe. Und wenn ich von diesen Wochen oder Monaten berichte, ist mein Leben in der Zwischenzeit wieder weitergegangen, und das schreibe ich auf, und das dauert, und darüber vergeht die Zeit, und so weiter und so fort...
Das muss ich unbedingt Andrea erzählen, aber vielleicht sind das auch nur ganz bescheuerte Überlegungen.
Andrea ist Psychologin. Sie arbeitet in der Einrichtung, in der ich wohne, im Haupthaus. Da hat sie ihr Büro oder ihre Praxis, und ich besuche sie ein- bis zweimal die Woche, um mich mit ihr zu unterhalten.
Nein, nicht was ihr denkt! Ich bin nicht gaga, und unsere Einrichtung ist keine Klapse. Sie heißt Städtisches Jugendhilfezentrum und besteht aus zwei Häusern mit mehreren Wohngruppen. Ich wohne im „Haus Lotte“, das heißt so nach einer Romanfigur von Erich Kästner. Das andere heißt „Haus Emil“, auch nach einem Jugendbuch von Erich Kästner, nämlich „Emil und die Detektive“. Ich habe es nicht gelesen, soll aber ziemlich gut sein.
2. Kapitel – Die Wohngruppe
Meine Mutter lebt in einer anderen Stadt und hat eine Macke, oder ein Problem, wie Andrea sagt. Ich habe auch einen Vater, klaro, wie jeder Mensch. Aber den kenne ich nicht. Der ist abgehauen, als meine Mutter mit mir schwanger war. Vielleicht ist er ja inzwischen gestorben, dann müsste es heißen, dass ich einen Vater hatte. Ich fänd es okay, wenn er tot wäre. Dann könnte er nämlich nicht eines Tages hier aufkreuzen und so tun, als ob er mich fünfzehn Jahre lang vermisst hätte, der Arsch. Und ich müsste ihn nicht mit den übelsten Schimpfworten begrüßen, die ich kenne und von denen Sackgesicht und Wichser noch die harmlosesten sind.
Meine Mutter glaubt nicht, dass er tot ist. So einer stirbt nicht so leicht, sagt sie. Sie vermutet ihn eher im Knast, oder gerade wieder draußen, oder mit einem Bein schon wieder drin. Ist auch egal. Er sucht mich nicht, ich suche ihn nicht, keiner braucht ihn. Glaube ich zumindest. Aber er sah ziemlich gut aus, das muss ich leider zugeben. Meine Mutter hat mir mal ein Foto gezeigt aus der Zeit, als sie und der Arsch noch zusammen waren und sie schwer in ihn verknallt. Sie behauptet auch, dass ich ihm ähnlich sehe. Ob sie das als Kompliment gemeint oder gesagt hat, um mich zu ärgern, weiß ich nicht. So was ist bei ihr manchmal schwer zu unterscheiden.
Ich finde übrigens, dass ich ihm nicht sehr ähnlich sehe, und seit ich die Haare schwarz gefärbt habe, noch weniger – schwarz, so wie Amber sie damals hatte.
Aber genug jetzt von meinem Alten! Ich hab schon viel zu viel über den geschrieben!
Wo ich gerade beim Schreiben bin, fällt mir ein: Ihr wundert euch sicher, dass ich so wenig Fehler mache, stimmt’s? Das liegt aber nicht daran, dass ich eine Superleuchte in Rechtschreibung und Grammatik bin (obwohl, in meiner jetzigen Klasse gehöre ich in Deutsch schon so ziemlich zu den Besten), sondern am Schreibprogramm. Das korrigiert Rechtschreibfehler automatisch und markiert Grammatikfehler mit einer grünen Zickzacklinie. Ich schreibe nämlich am Computer, an Andreas altem Laptop. Den hat sie mir als Dauerleihgabe für dieses Projekt, wie sie das, was ich hier mache, nennt, zur Verfügung gestellt. In unserer Wohngruppe gibt es zwar auch einen Computer, aber der ist meistens besetzt. Irgendeiner muss immer chatten oder bekloppte Videos auf YouTube gucken oder spielen oder sonstwas.
Naja, ich will nicht ungerecht sein. Vanessa sagt manchmal, dass sie ganz dringend was für die Schule nachgucken muss. In diesem nervigen nöligen Ton, den sie immer anschlägt, wenn sie was erreichen oder sich vor was drücken will. Das Argument Schule/Hausaufgaben zieht bei unseren Erziehern immer, aber hallo. Und dann werden Motz oder Denise, oder wer sonst gerade am Computer sitzt, von dort verscheucht und Vanessa hockt die nächste halbe Stunde vor dem Bildschirm und schreibt Wort für Wort ab, was da steht. Wir haben nämlich keinen Drucker.
Ob auf unserem Computer ein Schreibprogramm installiert ist, weiß ich gar nicht. Darum habe ich mich noch nie gekümmert, weil, ich würde sowieso niemals auf dem Wohngruppenrechner was schreiben. Keinen Schulaufsatz und erst recht nicht meine Autobiographie. Auf keinen Fall! Warum? Blöde Frage. Wenn ich zu den anderen sage: Das ist privat, das geht keinen was an, lasst bloß die Finger davon, dann macht das die doch gerade scharf. Ich wäre noch nicht ganz zur Tür raus, da wüssten sie schon, was ich geschrieben habe, und am nächsten Tag wüsste es meine halbe Schule.
Andreas ausgemusterter Laptop wäre normalerweise auch nicht wirklich sicher vor denen; ich schleppe ihn schließlich nicht ständig mir rum. Motz zum Beispiel habe ich schon zweimal dabei erwischt, wie er an dem Ding rumgefummelt hat. Aber da kann er noch so viel tippen und hacken, der kommt in kein Programm rein. Mein Rechner ist nämlich mit einem Passwort gesichert. Andrea hat mir gezeigt, wie das geht. Tja, und mein Passwort, das wird so leicht keiner rauskriegen. Das ist nicht Jenny rückwärts oder sonst was Kindisches leicht zu Knackendes. Das ist was aus meinem früheren Leben, da kommt keiner drauf.
Vanessa und Motz habe ich schon erwähnt. Da passt es ja, wenn ich jetzt ein bisschen von unserer Wohngruppe und ihren übrigen Mitgliedern erzähle. Ich lebe seit fast vier Monaten hier und habe den Platz einer gewissen Jamila eingenommen, die rausgeflogen ist, weil sie achtzehn geworden ist. Ja, so geht das bei uns: Mit achtzehn fliegt man raus. Ich bin übrigens auch rausgeflogen, nämlich bei meiner Tante, bei der ich vorher gewohnt habe. Rausgeflogen in beiderseitigem Einvernehmen. Find ich gut, die Formulierung: beiderseitiges Einvernehmen. Aber meine Tante ist noch nicht dran, zu der komme ich später.
Wir haben drei Erzieherinnen und einen Erzieher, die sich in unserer Betreuung abwechseln. Mindesten eine oder einer muss immer anwesend sein, auch nachts. Gerade nachts.
Steffi ist die Chefin der Truppe. Sie ist keine Erzieherin, sondern was Besseres, eine Studierte, Sozialpädagogin oder so. Und witzigerweise erzieht sie nicht nur uns (das heißt, sie versucht es), sondern manchmal auch unsere Erzieher. Nicht offensichtlich, aber doch so, dass man es merkt, wenn man Augen und Ohren und Antennen für so was hat. Steffi sieht für ihre schätzungsweise vierzig Jahre nicht schlecht aus, und sie ist mir auch nicht von Herzen unsympathisch, aber, sagen wir mal so, es gibt angenehmere Menschen.
Florian ist lang und dünn, hat einen flusigen Ziegenbart und lässt einem ziemlich viel durchgehen. Abends holt er manchmal seine Gitarre raus und unterhält die Runde mit dämlichen Liedern aus seinem früheren Leben als Pfadfinder. Grauenhaft! Ich verzieh mich immer, wenn er loslegt. Aber er kann ziemlich gut kochen. Alles in allem ist er okay.
Bea ist auch dünn, kann aber nicht Gitarre spielen und kocht immer dasselbe: Spaghetti mit Tomatensauce oder Reis mit Scheiß. Der Ausdruck stammt nicht von mir; so hieß das Essen schon vor meinem WG-Beitritt. Schmeckt aber gar nicht so übel. Bea kennt ungefähr zweitausend Gesellschaftsspiele, und, das muss ich zugeben: Nicht alle sind bescheuert.
Elke ist dick und doof, hat eine piepsige Stimme, die aber total schrill und laut werden kann, wenn sie sich aufregt. Und sie regt sich oft auf, manchmal sogar zu recht. Seltsamerweise sind die beiden Kleinen ganz vernarrt in sie. Sie muss also wohl doch irgendwas Nettes an sich haben, das mir bisher nur noch nicht aufgefallen ist.
Soviel zu den Erziehern. Jetzt zu meinen Mitbewohnern. Wir sind sechs insgesamt. Ich habe, wie gesagt, den Platz von Jamila eingenommen und demzufolge auch ihr Bett und ihre Zimmergenossin geerbt. Die heißt Denise und ist die älteste in unserer Wohngruppe; nächste Woche wird sie siebzehn. Sie besucht die zehnte Klasse einer Förderschule. Auf einer Förderschule war ich auch mal, aber auf einer anderen, also können wir uns nicht über gemeinsame Lehrer oder Mitschüler unterhalten. Wir haben überhaupt nicht sehr viel gemeinsam, zum Beispiel einen total unterschiedlichen Musikgeschmack. Denise hat einen ganz gruseligen: Schlager und Discoscheiß. Ich habe im Gegensatz zu ihr einen sehr guten Musikgeschmack. Den verdanke ich einem früheren Lehrer, Herrn Mewes. Der war klasse, und über den werde ich euch einiges erzählen, wenn es soweit ist. Ich komme mit Denise ganz gut klar, sie nervt kaum, außer, wenn sie mir die letzte Folge von GZSZ erzählt. Das ist eine Daily Soap, und wenn ich die gucken wollte, würde ich das auch tun. Das habe ich Denise schon mehrfach erklärt. Aber sie scheint das irgendwie nicht zu begreifen, denn mindesten dreimal pro Woche muss ich mir anhören, wer gerade in wen verknallt ist, wer mit wem Schluss gemacht hat, wer gegen wen intrigiert und so weiter. Intrigiert sagt Denise natürlich nicht, das ist ein Andrea-Wort und bedeutet: Ränke schmieden. Ja, so hat Andrea es mir erklärt, und da war ich natürlich genau so schlau wie vorher: Ränke schmieden? Also, intrigieren oder Ränke schmieden bedeutet: einen gegen den anderen ausspielen.
Hier kommt eine Zwischenbemerkung: Euch ist sicher schon (unangenehm?) aufgefallen, dass ich Fremdwörter erkläre. Das liegt aber nicht daran, dass ich euch für blöd halte. Vielleicht kennt ihr die Wörter ja alle schon. Ich hatte nur am Anfang gesagt, dass ich mir die fiktiven Leser, also euch, ungefähr so vorstelle wie mich, und zwar so, wie ich war, bevor ich Andrea kennengelernt habe. Damals kannte ich nur ein einziges Fremdwort, nämlich provozieren. Ich wusste zwar nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber doch in etwa, was es bedeutet, weil die folgenden beiden Sätze die häufigsten waren, die ich in meiner Kindheit zu hören bekommen habe: "Musst du eigentlich immer provozieren?" und "Lass dich doch nicht immer provozieren!"
Also, ich halte euch nicht für blöd, und ihr haltet mich hoffentlich nicht für arrogant oder so, weil ich GZSZ blöd finde. Ich finde es nicht blöd. Ich finde es auch nicht toll. Ich weiß nicht, wie ich es finde, weil ich es nicht gucke. Und ich gucke es nicht, weil man bei einer Daily Soap nicht bei Folge 4236 (keine Ahnung, ob das stimmt, vielleicht sind sie auch schon bei Folge 5813) einsteigen kann. Dann kapiert man nämlich nichts. Und den Nerv, mir von Denise die vorangegangenen 4235 Folgen erzählen zu lassen, habe ich nicht. Selbst wenn sie besser erzählen könnte, wäre mir meine Lebenszeit dafür zu schade.
Denise hat rot gefärbte Haare und neigt zum Dickwerden. Noch geht es, aber sie muss aufpassen. Seit ich sie kenne, hat sie schon vier Kilo zugenommen.
Weiter mit meinen Mitbewohnern. Der jüngste ist Motz. Richtig heißt er Moritz und ist zehn. Motz wird er wahrscheinlich genannt, weil das so schön kurz ist, und nicht, weil er besonders viel motzt. Ich meine, er motzt schon ziemlich viel, aber das tun wir anderen auch. Motz ist ein großer Elke- und Nutella-Fan, daher ziemlich dick, richtig fett, teigig und ungelenk. Und er platzt immer zu den unmöglichsten Zeiten in unser Zimmer. Natürlich ohne anzuklopfen. Er ist wahnsinnig neugierig und schon mehr als einmal beim Rumschnüffeln erwischt worden. Wenn man ihn dann zur Rede stellt, fängt er regelmäßig an zu flennen. Er heult auch, wenn er bei Mensch ärgere dich nicht verliert. Alles in allem also kein Kind, das man brüllend gern adoptieren würde. Kann man auch nicht, weil er schon Eltern hat.
Motz teilt sich das Zimmer mit Patrick, dem zweiten Jungen in unserer WG. Zu Patrick kann ich nicht viel sagen; er ist irgendwie unauffällig. Na ja, eine Macke hat er auch, wie jeder von uns. Manchmal lacht er unvermittelt, wenn es gar nichts zu lachen gibt. Oder er haut sich auf die Schenkel und sagt irgendein Wort, das überhaupt nicht zu der Unterhaltung passt, zum Beispiel kriminell. Patrick ist vierzehn, knapp einsachtzig, hat ziemlich lange braune Haare und kriegt auf der Oberlippe einen kleinen Bart. Vanessa ist, glaube ich, in ihn verknallt.
Womit wir bei Vanessa und Jessica wären. Dass Vanessa eine Streberin ist, habe ich ja schon angedeutet. Und wie die meisten Streberinnen ist sie spindeldürr. Und klein. Sie kaut auch ihre Nägel ab und trägt einen rosa Haarreifen, damit ihr die straßenköterblonden Fetthaare nicht ins Gesicht fallen. Was die Schule betrifft, ist sie unheimlich fleißig, kritzelt stundenlang ihre Hefte voll. Ich glaube ja, dass sie manchmal nur so tut, als ob sie Hausaufgaben machen würde, um nicht staubsaugen oder den Tisch decken zu müssen. Vielleicht irre ich mich auch. Aber dass sie ständig krakeelt „Bin noch nicht mit Hausaufgaben fertig“, wenn es in der WG was zu tun gibt, ist schon irgendwie verdächtig. Vanessa ist zwölf, besucht die Realschule und will später Abitur machen und was ganz Tolles studieren.
Jessica ist vierzehn und eindeutig die schönste in unserer Wohngruppe: lange blonde Haare (natur!), blaue Augen, Titten und Arsch, aber schlank und für ihr Alter recht groß. Sie will mal Germany’s next Topmodel werden und übt jetzt schon für das Casting in zwei Jahren, wenn sie sechzehn ist. Bei DSDS will sie auch mitmachen (obwohl ja niemand weiß, ob es die Sendungen in zwei Jahren überhaupt noch gibt). Dafür übt sie leider auch. Leider, denn erstens hat sie keine schöne Stimme, zweitens sucht sie sich für ihre zukünftige „Performance“ immer den letzten Pop-Schrott aus, und drittens trifft sie nie, aber auch wirklich nie den richtigen Ton.
Und ich? Wie sehe ich aus? Was ist meine Macke? Ich sehe irgendwie durchschnittlich aus: weder groß noch klein, weder dick noch dünn, weder schön noch hässlich.
Meine Macke ist, sagt Andrea, dass ich keinen leiden kann. Aber das stimmt nicht. Amber konnte ich leiden. Nicht sofort, aber zum Schluss, und am meisten, als ich schon weg war.
Und Herrn Mewes konnte ich auch leiden.
3. Kapitel – Andrea
Gerade ist Motz reingeplatzt, sieht mich schreiben und quiekt: „Was schreibst du denn da? Lass mal sehen!“ Da hab ich vor Schreck den Laptop ausgeschaltet statt ihn einfach zuzuklappen. Ohne vorher zu speichern! Und jetzt ist alles weg, was ich in den letzten beiden Stunden geschrieben habe. So eine Scheiße! Dieser eklige, neugierige kleine Pisser! Ich könnte ihn erwürgen, hätte ihm zumindest gern eine gescheuert, aber er war zu weit weg. Da habe ich ihn nur angebrüllt: „Raus, du Fettarsch! Blöder Mistpickel!“ Und jetzt heult er sich an Elkes dickem Busen aus.
Ich hatte angefangen, von meiner Mutter zu erzählen, aber jetzt habe ich keine Lust, alles noch mal zu schreiben. Also schreibe ich was anderes, und zwar was über Andrea, das ich bisher vergessen hatte. Man könnte nämlich meinen – das ist mir beim Durchlesen aufgefallen –, dass ich „Andrea“ und „du“ zu ihr sage und dass sie so eine Art Freundin ist. Stimmt aber nicht. Andrea nenne ich sie nur in Gedanken. Mit vollem Namen heißt sie Andrea Stockamp, und ich sage „Frau Stockamp“ und „Sie“ zu ihr. Sie ist auch keine Freundin oder mütterliche Freundin. Das würde vom Alter her zwar ungefähr passen, sie ist nur sechs Jahre jünger als meine Mutter, geht aber nicht, weil: Es ist nicht erlaubt.
Das ist auch so etwas, das ich nicht verstehe und das mich manchmal richtig wütend macht. Wenn ich vor oder nach unseren Sitzungen, so heißen die Gespräche, oder abends vor dem Einschlafen über sie und mich nachdenke, dann kriege ich oft fast einen Hass auf sie. Oder wie würdet ihr das finden, wenn jemand, von dem ihr glaubt, dass er sich für euch und eure Probleme interessiert und euch leiden kann und mit dem ihr euch eine Stunde lang ganz toll unterhalten habt wie mit einer guten Freundin, plötzlich auf die Uhr guckt und sag: „So Jenny, die Stunde ist vorbei. Wir sehen uns nächsten Donnerstag.“? Da würdet ihr doch sicher auch glauben, dass diese ganze Freundlichkeit und Anteilnahme nur geheuchelt sind, oder?
Andrea hat versucht, es mir zu erklären. Therapeut und Patient dürften keine private Beziehung eingehen, sagt sie; eine professionelle Distanz sei wichtig bei ihrer Arbeit. Außerdem verstoße eine solche Beziehung gegen das Berufsethos. Das sind die moralischen Richtlinien ihres Berufes. Aber erstens bin ich nicht krank, also keine Patientin, und zweitens: Was ist das denn für eine Moral, die Freundschaft verbietet?
Ich würde mich wahrscheinlich nicht so aufregen, wenn ich Andrea nicht irgendwie klasse fände. (Diesen Satz werde ich auf jeden Fall löschen, bevor ich ihr meine Autobiographie zu lesen gebe – falls ich sie ihr zu lesen gebe.)
Am Anfang, als man mich zu den Stunden bei ihr verdonnert hatte, fand ich sie natürlich ätzend, wie alle Psycho- und Sozialtanten, mit denen ich bisher zu tun hatte. Und genau so habe ich mich auch ihr gegenüber verhalten.
Bei der ersten Sitzung habe ich mich, ohne zu grüßen und ihren Gruß zu erwidern, auf meinen Stuhl gesetzt, die Arme verschränkt, die Beine übereinandergeschlagen, sie angestarrt und geschwiegen. Sie hat gelächelt, hat mir eine Apfelschorle eingeschenkt und dann irgendwas in ihre Unterlagen gekritzelt. Ich hätte schon gern gewusst, was. Aber dazu hätte ich ja sprechen müssen, und das wollte ich nun mal nicht. Ich hätte auch gern die Schorle getrunken, ich hatte nämlich Durst, aber dazu hätte ich mich bewegen müssen, und das wollte ich auch nicht. Andrea schien aber weder überrascht noch sauer zu sein.
„Du musst nicht sprechen, wenn du keine Lust hast“, hat sie gesagt. „Für mich ist das auch einfacher. Ich muss nämlich einen Bericht schreiben, und da schreibe ich nun rein: ‚Hat die Sitzung über geschwiegen.’ Leicht verdientes Geld.“
Das mit dem Schweigen habe ich nur die erste Stunde durchgehalten. Beim zweiten Mal habe ich auf ein paar ihrer Fragen geantwortet, aber patzig und einsilbig. Seltsamerweise schien sie sich darüber zu freuen, und am Ende der Sitzung hat sie sich tatsächlich für das Gespräch bedankt. Ich dachte zuerst, sie meint das ironisch. War aber nicht so, war aufrichtig, das konnte man ihr ansehen.
In der dritten Stunde hat sie mich gefragt, ob sie mir eine Geschichte vorlesen darf, die eine frühere Patientin geschrieben hat. Ich hab nur mit den Schultern gezuckt, okay, weil, dösen, während sie irgendwas Langweiliges vorliest, ist immer noch besser als dämliche Fragen zu beantworten, hab ich mir gesagt.
Die Geschichte war aber gar nicht langweilig. Sie war spannend und, wie soll ich sagen, aufwühlend, schmerzliche Erinnerungen weckend? Es war nämlich fast meine Geschichte, die von Kevin und mir. Die hatte ich noch nie jemandem erzählt, außer Amber und meiner Mutter (und Boris, gezwungenermaßen).
Da hat es plötzlich klick gemacht und ich habe Andrea mit anderen Augen gesehen. Kann die in mich reingucken?, habe ich mich gefragt. Jedenfalls wurde es danach immer besser mit uns.
Sie sieht auch ziemlich gut aus.
Und statt ein Kapitel über meine Mutter zu schreiben, ist das jetzt ein Andrea-Kapitel geworden. Seltsam.
4. Kapitel – Meine Mutter
Ich bin gestern mitten bei Wer wird Millionär? ins Bett gegangen. Ich war müde und überhaupt nicht in Stimmung, von meiner Mutter zu erzählen. Heute ist ein trüber Tag. Der Regen prasselt gegen die Scheiben, das Herbstlaub sieht gar nicht schön bunt aus, sondern braun. Und ich habe in Mathe eine Fünf geschrieben. Da passt es irgendwie.
Also, meine Mutter ist zweiundvierzig Jahre alt und Alkoholikerin. Alkoholismus ist eine Krankheit, eine unheilbare. Es gibt zwar Alkis, die mit dem Saufen aufhören – trocken, heißt das –, aber im Grunde ihres Herzens bleiben sie Alkis, und wenn sie nur ein einziges Bier trinken, sind sie gleich wieder voll drauf. Meine Mutter war auch öfters trocken, aber nie sehr lange, höchstens für ein paar Wochen. Sie hat zwar immer wieder versprochen, nicht mehr zu trinken, aber, wie gesagt, durchgehalten hat sie das nicht.
Das mit der Krankheit muss man übrigens wissen, damit man Alkoholiker nicht zu Scheiße findet. Sie benehmen sich nämlich manchmal echt beschissen. Meine Mutter zum Beispiel ist oft bis mittags im Bett geblieben, und als ich klein war, hat sie mehr als einmal vergessen, mich vom Kindergarten abzuholen. Da kommt man sich ganz schön verloren vor, wenn überall Mütter und Väter rumwuseln, und es gibt ein großes Hallo und Küsschen hier und da, und Fragen: „War es schön heute? Hast du schön gespielt? Und auch nicht gezankt?“
Und dann sind alle weg, und die Erzieherinnen telefonieren rum und werden immer nervöser und vor allem sauer, weil eine von ihnen dableiben und Überstunden machen muss, um auf mich aufzupassen, bis jemand vom Jugendamt kommt. Das ist aber nur zwei- oder dreimal passiert, danach hatte Kevin den Job, mich abzuholen. Kevin war mein Bruder. Er ist tot.
Natürlich war nicht immer alles Scheiße mit meiner Mutter. Einmal ist sie mit uns in den Zoo gefahren und hat uns Eis spendiert, das war richtig toll. Und wenn sie mir die Haare gemacht, mich schön angezogen und geschminkt hat und sich selbst auch, und wenn wir dann zusammen vor dem Spiegel standen, dann habe ich gedacht: Ich bin eine Prinzessin und sie ist eine Königin.
Frisieren, Haare schneiden und färben, das konnte sie; sie hat nämlich Friseurin gelernt. Warum sie nicht in ihrem Beruf gearbeitet hat, jedenfalls nicht, so lange ich mich erinnern kann? Keine Ahnung. Vielleicht wegen dem Tatterich. Weil, wenn sie zu viel gesoffen hatte, hat das mit dem Schneiden und Kämmen nicht mehr so gut geklappt. Und wenn sie auf Entzug war, haben ihre Hände oft sogar noch mehr gezittert. Später, als ich größer war, habe ich sie nur noch an meine Haare rangelassen, wenn ich ziemlich sicher sein konnte, dass nichts schiefgeht.
Richtig gekocht hat sie eigentlich nie. Wir haben meistens Tiefkühl-Pizza oder Dosen-Ravioli oder Fischstäbchen, Würstchen, Chicken Wings und so Sachen gegessen. Und Butterbrote natürlich. Auch Chips, Kekse, Schokoriegel. Ich fand das aber okay, hat mir gut geschmeckt. Bis ich in die Schule kam, habe ich sogar geglaubt, alle Leute ernähren sich so.
In der Schule haben wir dann was über gesunde Ernährung gelernt. Ich hatte mich vorher schon oft über das Gemüse im Supermarkt gewundert und konnte mir nicht vorstellen, dass man das essen kann. Nach dem Unterricht habe ich dann zu meiner Mutter gesagt, sie solle mal einen Blumenkohl kochen. Hat sie auch gemacht. Das Ergebnis hat weder Kevin noch mich davon überzeugt, dass Blumenkohl essbar ist. Sogar mit literweise Ketchup drauf hat er noch richtig gruselig geschmeckt.
Zu weiteren Gemüse-Experimenten haben wir unsere Mutter nicht mehr ermuntert.
Gerade ist Motz wieder reingeplatzt und hat gebrüllt: „Du darfst mich nicht anbrüllen. Das hat Elke gestern gesagt. Du darfst mich auch nicht hauen. Was schreibst du denn da schon wieder?“
Ich bin ganz ruhig geblieben. „Einen Aufsatz über Gemüse.“
„Iii, wie langweilig!“
„Genau, stinklangweilig. Und jetzt verpiss dich!“
Motz wollte was richtig Freches erwidern, das hat man ihm angesehen, aber außer „Blöde Kuh“ ist ihm nichts eingefallen.
Wie gesagt, dass unsere Mutter nicht kochen konnte, hat mich nicht gestört. Regelmäßig ein selbstgekochtes warmes Mittagessn, das habe ich erst bei meiner Tante kennengelernt. Ich habe euch doch schon erzählt, dass ich mal bei ihr gewohnt habe, oder? Na, jedenfalls hat es mir bei der zuerst überhaupt nicht geschmeckt, dabei kann sie kochen. Aber ich kannte das ja nicht: Rosenkohl mit Kartoffelbrei und Frikadellen oder Nudelauflauf oder Schweinebraten mit Rotkohl und Klößen. Jetzt mag ich das richtig gern.
Wie gesagt, dass meine Mutter nicht kochen konnte, hat mich nicht gestört. Aber dass sie, je schlimmer es wurde mit der Sauferei, manchmal neben das Klo gekotzt hat statt rein und ich dann die Kotze wegwischen durfte, hat mich nicht nur gestört, es hat mich richtig wütend gemacht. Aber ich konnte es ihr irgendwann verzeihen. Sie war ja hinterher immer sehr lieb und dankbar und hat sich entschuldigt. Und immerhin ist sie meine Mutter.
Manchmal hat sie irgendwelche wildfremden Kerle angeschleppt. Woher sie die hatte, weiß ich nicht. Und was die an ihr fanden, ebenso wenig. Vom Saufen wird man ja nicht gerade schöner. Die Typen sind dann über Nacht geblieben, manchmal auch ein paar Tage, aber so lange sie mich in Ruhe gelassen und nicht verlangt haben, dass ich Onkel oder sonst was Beknacktes zu ihnen sage, haben die mich nicht sonderlich gestört. Zu verzeihen gibt es da eigentlich nichts. Andrea sieht das, glaube ich, ein bisschen anders.
Dass meine Mutter meinen dreizehnten Geburtstag vergessen hat, finde ich viel schwerer zu verzeihen. Dreizehn ist schließlich was Besonderes; mit dreizehn ist man kein Kind mehr, sondern ein Teenager. Außerdem ist mein Geburtstag leicht zu merken. Für sie jedenfalls. Ich habe nämlich exakt einen Monat nach ihr Geburtstag. Ihrer ist am sechsten Dezember, also in zwei Monaten. „Ich bin eine Nikoläusin“, hat sie immer gesagt. Und meiner ist, logo, am sechsten Januar. Seit ich weg bin, hat sie meinen Geburtstag übrigens nicht mehr vergessen. Sie wusste ja, wo ich wohne, und hat die beiden Päckchen plus Glückwunschkarten an die Adresse meiner Tante geschickt. Ich habe auch, zusätzlich, zwei Briefe von ihr bekommen, aber ich habe mich weder für die Geschenke bedankt noch auf die Briefe geantwortet.
Seit ich weg bin, habe ich meine Mutter weder gesehen noch gesprochen, obwohl ich sie besuchen dürfte und sie sich ein Treffen und eine Aussprache sehr wünscht, wie sie in allen vier Schreiben beteuert. Andrea meint, es sei ihr ernst damit. Kann sein. Kann aber auch sein, dass sie nur die liebende Mutter raushängen lässt, um das Sorgerecht wiederzukriegen. Das ist ihr nämlich nach ihrer letzten Schote entzogen worden.
Andrea versucht nicht, mich zu überreden. Sie lächelt nur, wenn wir über meine Mutter reden, und letztens sagte sie: „Ich glaube, du bist bald so weit.“
Was ich meiner Mutter auch nur schwer verzeihen kann, ist, dass sie Kevin, seit er tot ist, einen Heiligenschein verpasst hat. Dabei standen noch am Abend vor meinem Geburtstag die Bullen bei uns auf der Matte, weil er wieder irgend einen Scheiß gebaut hatte. Wie so oft. Aber für Kevins Eskapaden (ein viel zu harmloses Andrea-Wort, es bedeutet nämlich „Streich“, und Streiche waren das echt nicht!), hatte sie immer eine Erklärung parat, hatte Verständnis. Sie hat ihm auch, im Gegensatz zu mir, nie eine gescheuert. Vielleicht hat sie sich das auch nicht getraut, später zumindest; er war ja größer und stärker als sie.
Bei dem allergrößten Scheiß, den Kevin gebaut hat, hat sie die Augen fest zugekniffen und angeblich nichts mitgekriegt. Sie hat mir auch nicht geglaubt, was ich ihr von ihrem heiligen Sohn erzählt habe, hat geheult und gebrüllt, dass ich lüge, und mich eingesperrt. Das war kurz nach Kevins Tod, aber das ist keine Entschuldigung. Nein, das werde ich ihr nicht verzeihen! Nie! Außerdem: Weiß ich, ob sie mir inzwischen glaubt?
Andrea sagt: „Sie glaubt dir.“ Sie sagt auch: „Sie war verzweifelt.“
Jetzt würde es gut passen, über Kevin zu reden. Aber der bekommt sein eigenes Kapitel.
Zum Schluss muss ich noch erzählen, wodurch meine Mutter das Sorgerecht verloren hat. Er hängt natürlich mit der Sauferei zusammen, weil sie uns deswegen vernachlässigt hat. Die Typen vom Jugendamt, die bei uns auch mehr als einmal auf der Matte standen, hatten es ihr schon ein paarmal angedroht. Aber sie hat dann Besserung gelobt und eine Entgiftung gemacht, Kevin und ich haben auch Besserung gelobt, und dann war wieder für eine Weile Ruhe. Kevin und ich wollten ja auch nicht ins Heim. Auf keinen Fall! Lieber eine Alkoholikerin zur Mutter als Heim! Heim, das war für uns Horror, die Hölle, echt. Wahrscheinlich hatten wir durchs Fernsehen falsche Vorstellungen von Kinderheimen: riesige Schlafsäle mit Stockbetten, vergitterte Fenster, bösartige Erzieher, der Heimleiter ein echter Sadist und so weiter. Wir hatten auch keinen Kontakt zu Heimkindern. Wahrscheinlich hatten wir den doch, Kevin zumindest. Aber diejenigen von seinen Kumpels, die im Heim waren, haben das sicher verschwiegen. Denn peinlich ist es auf jeden Fall.
Zurück zu meiner Mutter. Manchmal, wenn es ihr schlecht ging, und es ging ihr ja ziemlich oft schlecht, hat sie Sachen gesagt wie: „Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bring mich um.“
Wie findet ihr das? Ich finde das Scheiße, total daneben! Aber so was von daneben! Den eigenen Kindern eine solche Angst einzujagen! Wir haben ja geglaubt, dass sie es ernst meint. Ich jedenfalls. Und beim letzten Mal hat sie es wohl tatsächlich ziemlich ernst gemeint. Wir hatten uns gestritten, sie und ich. Sie war mal wieder blau, und da hab ich ihr so richtig die Meinung gesagt: dass sie eine Schlampe ist, dass sie eine Scheiß-Mutter ist und dass ich lieber ins Heim gehe, als sie länger zu ertragen und ihre Kotze aufzuwischen.
Da hat sie ein Küchenmesser genommen; ich dachte, sie will mich abstechen. Aber sie hat nur mit dem Messer rumgefuchtelt und geschrieen: „Rühr dich nicht vom Fleck!“ Dann hat sie die Schublade mit den Tabletten aufgerissen, wahllos irgendwelche Schachteln gegriffen, die Folienstreifen rausgeschüttelt und mindestens dreißig Tabletten aus den Streifen gedrückt, was mit einer Hand ziemlich schwer ist.
„Mach keinen Scheiß!“ hab ich sie angefleht. Aber sie hat stur weitergemacht und schließlich alle Tabletten geschluckt, zwischendurch immer wieder mit Schnaps nachgespült. Danach hat sie mit dem Messer an ihrem Handgelenk rumgesäbelt, ziemlich fahrig, es sah wohl schlimmer aus als es tatsächlich war. Aber sie hat geblutet.
„Jetzt spring ich aus dem Fenster.“ Das waren die letzten Worte, die ich von meiner Mutter gehört habe. Wir wohnten im fünften Stock. Ich war wie gelähmt. Aber zum Glück hat sie es nicht mehr bis zum Fenster geschafft, ist vorher zusammengebrochen.
Ich wusste nicht, ob sie noch lebte. Irgendwie konnte ich mich nicht überwinden, sie anzufassen, um den Puls zu fühlen oder was man so macht. Schließlich ist mir eingefallen, den Notarzt anzurufen. Das hat geklappt, obwohl kein Guthaben mehr auf meinem Handy war. Amber hatte mir gesagt, dass man die 110 und die 112 immer anrufen kann, und das ist mir in dem Moment wieder eingefallen.
Dann ging alles sehr schnell. Und während die Ärztin und die Sanitäter sich um meine Mutter gekümmert haben, hab ich mich heimlich vom Acker gemacht.
Gerade ist Motz wieder in unser Zimmer gestürmt. Wieder ohne anzuklopfen. Er lernt es nicht. Zum Glück hatte ich gespeichert und wollte den Rechner gerade ausmachen.
„Schreibst du immer noch über Gemüse?“, fragte er, ganz unschuldig. Er scheint nicht zu befürchten, dass ich ihm tatsächlich mal eine scheuer. Dabei könnte das leicht passieren.
„Jau. Das heißt, nein. Bin gerade mit dem Aufsatz fertig. Und jetzt verpiss dich!“
„Lass mal lesen!“
„Auf keinen Fall. Raus jetzt!“
„Bitte.“
„Okay, ich les ihn dir vor.“
Motz konnte sein Glück nicht fassen. „Ehrlich?“
„Also, pass auf! Gemüse, ein Aufsatz von Jenny Müller. Gemüse ist sehr gesund und hat viele Vitamine. Es wird in vier Gruppen eingeteilt. Erstens: Gemüse, das total scheiße schmeckt, zweitens: Gemüse, das nur normal scheiße schmeckt, drittens: Gemüse, das einigermaßen essbar ist, und viertens: leckeres Gemüse. Zur ersten Gruppe gehören Blumenkohl, Rosenkohl und Brokkoli. Zur zweiten Gruppe gehören Möhren, Erbsen und Bohnen, zur dritten Gruppe gehören Gurken und Tomaten. Ein Gemüse, das zur vierten Gruppe gehört, ist bisher leider noch nicht entdeckt worden. Ende.“
„Stimmt das auch?“
„Aber klar doch. Du weißt, dass ich immer ziemlich gute Noten im Aufsatz kriege. Du kannst also, wenn ihr das nächste Mal Gemüse durchnehmt, getrost nacherzählen, was du gerade gelernt hast. Dann kriegst du auch eine gute Note. Und jetzt raus mit dir! Und vergiss nicht, die Tür hinter dir zuzumachen.“
5. Kapitel - Kevin
Nun also Kevin. Ich habe die Arbeit drei Tage lang vor mir hergeschoben. Andrea, bei der ich gestern wieder „Sitzung“ hatte, meinte, wenn es mir so schwer falle, über Kevin zu schreiben, solle ich doch ein anderes Kapitel vorziehen. Aber ich will es hinter mich bringen. Ich hatte gehofft, die Sonne würde sich mal zeigen, doch nein: Regen, Regen, Regen. Tag und Nacht, ohne Pause.
Und dann hat mir Elke eben schwere Vorwürfe gemacht, weil ich Motz immer Fettarsch, Mistpickel oder Pisser nenne. Wie, bitteschön, soll ich den mistpickeligen kleinen Fettarsch denn sonst nennen? Fettarschige Petze vielleicht? Oder Heulsuse? Mir fallen auf Anhieb noch mehr nette Namen ein, er hingegen bleibt stumpfsinnig bei blöde Kuh. Ich werde es beim nächsten Mal, wenn er wieder ohne anzuklopfen in unser Zimmer platzt oder rumschnüffelt, mit kleine Pest oder Strafe Gottes versuchen. Mal sehen, was er dazu sagt.
Ich soll ihm auch nicht einen solchen Mist über Gemüse erzählen, hat Elke weiter genölt. Ja wie beschränkt ist dieses Kind eigentlich? Hat er den Scheiß etwa geglaubt? Er sieht doch, wie gern ich Bohnen, Brokkoli und Tomaten esse! Klar, er selbst mag keine Gemüse, so ist das bei diesen Nutella-Fressern, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber man kann ja auch mal dazulernen, oder? Der Ausdruck „Reis mit Scheiß“ für Beas leckeren Gemüsereis stammt übrigens von ihm. Hat er aus der Kita mitgebracht. Klasse, was man heutzutage in den Kitas so lernt!
Und nun ist unser kleines Häschen auch noch verwaist, der Arme. Nee, seine Eltern sind nicht gestorben; Patrick ist gestern ausgezogen. Für mich kam das ziemlich überraschend, aber wahrscheinlich hatte ich nur wieder mal nicht zugehört, als darüber gesprochen wurde. Er war sowieso nur übergangsweise hier, wie ich bei der Gelegenheit erfahren habe. Bis seine Mutter eine passende Wohnung gefunden hat. Das ist jetzt geschehen, und nun lebt er wieder bei ihr. Ich kann nicht behaupten, dass ich ihn vermissen werde; ich habe ihn eigentlich nie richtig kennengelernt. Aber für Vanessa ist es natürlich ein herber Verlust. Sie hat beim Abschied geflennt. Motz hat auch geflennt, aber das tut er ja ohnehin gern.
Was mich am meisten interessiert: Wer wird an Patricks Stelle bei uns einziehen? Ein Junge, das ist klar. Aber was für einer? Ein Baby? Ein Macho? Eine Nervensäge? Oder einer, mit dem man was anfangen kann? Und wann wird er einziehen?
Vom Wetter gibt es nichts Neues zu berichten, Elke konnte meine Fragen zu unserem zukünftigen WG-Genossen nicht beantworten, also lässt sich Kevin nicht länger hinausschieben.
Ich muss aber zunächst noch erzählen, wo und wie wir gewohnt haben. Den Namen der Stadt werde ich ebenso wenig verraten wie meinen, aber es ist eine Großstadt, eine große Großstadt. Ich nenne sie A-Burg. Jetzt lebe ich zwar auch in einer Großstadt, aber einer kleinen, ungefähr sechzig Kilometer von der anderen entfernt. Die nenne ich B-Heim. Hier wohnt auch meine Tante.