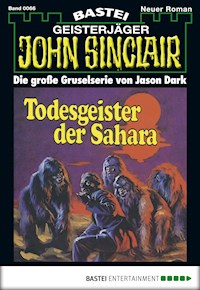
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Sinclair
- Sprache: Deutsch
Endlich als E-Book: Die Folgen der Kult-Serie John Sinclair aus den Jahren 1978 - 1979!
Todesgeister der Sahara.
Bizarre Körper mit schwarzen Flügeln erhoben sich von den nackten Felsen.
Lautlos schwangen sie sich in den nächtlichen Himmel, dem blutroten Mond entgegen.
Sie waren wieder unterwegs, die Todesgeister der Sahara, auf der Suche nach Opfern.
In dieser Einöde waren nur die wenigen Beduinen gefährdet, aber die Todesgeister sollten sich bald auf übervölkerte Städte stürzen und sie in riesige Leichenhallen verwandeln ...
John Sinclair - der Serien-Klassiker von Jason Dark. Mit über 300 Millionen verkauften Heftromanen und Taschenbüchern, sowie 1,5 Millionen Hörspielfolgen ist John Sinclair die erfolgreichste Horrorserie der Welt. Für alle Gruselfans und Freunde atemloser Spannung.
Tauche ein in die fremde, abenteuerliche Welt von John Sinclair und begleite den Oberinspektor des Scotland Yard im Kampf gegen die Mächte der Dunkelheit!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
John Sinclair – Die Serie
John Sinclair ist der Serien-Klassiker von Jason Dark. Mit über 300 Millionen verkauften Heftromanen und Taschenbüchern, sowie 1,5 Millionen Hörspielfolgen ist John Sinclair die erfolgreichste Horrorserie der Welt. Für alle Gruselfans und Freunde atemloser Spannung.
Tauche ein in die fremde, abenteuerliche Welt von John Sinclair und begleite den Oberinspektor des Scotland Yard im Kampf gegen die Mächte der Dunkelheit.
Über dieses Buch
Todesgeister der Sahara
Bizarre Körper mit schwarzen Flügeln erhoben sich von den nackten Felsen.Lautlos schwangen sie sich in den nächtlichen Himmel, dem blutroten Mond entgegen.Sie waren wieder unterwegs, die Todesgeister der Sahara, auf der Suche nach Opfern.In dieser Einöde waren nur die wenigen Beduinen gefährdet, aber die Todesgeister sollten sich bald auf übervölkerte Städte stürzen und sie in riesige Leichenhallen verwandeln …
Über den Autor
Jason Dark wurde unter seinem bürgerlichen Namen Helmut Rellergerd am 25. Januar 1945 in Dahle im Sauerland geboren. Seinen ersten Roman schrieb er 1966, einen Cliff-Corner-Krimi für den Bastei Verlag. Sieben Jahre später trat er als Redakteur in die Romanredaktion des Bastei Verlages ein und schrieb verschiedene Krimiserien, darunter JERRY COTTON, KOMMISSAR X oder JOHN CAMERON.
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabeder beim Bastei Verlag erschienenen RomanheftausgabeBastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG© 2015 by Bastei Lübbe AG, KölnVerlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian MarzinVerantwortlich für den InhaltE-Book-Produktion:Jouve
ISBN 978-3-8387-2820-9
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.dewww.bastei.de
Todesgeister der Sahara
Sie erhoben sich von den nackten Felsen. Bizarre Körper mit schwarzen Flügeln.
Lautlos schwangen sie sich in den nächtlichen Himmel, dem blutroten Mond entgegen, derauf die Sahara herunterleuchtete. In dieser Nacht waren sie wieder unterwegs, die Todesgeister der Sahara, auf der rastlosen Suche nach Opfern.
In dieser Einöde waren nur die wenigen Beduinen gefährdet, aber die Todesgeister sollten sich schon bald auf übervölkerte Städte stürzen und sie in riesige Leichenhallen verwandeln. Das plante die Inkarnation des Bösen.
Nach einem freien Wochenende ist der Arbeitsbeginn am Montag immer ziemlich hart. Besonders hart fand ich ihn, weil es ein nebliger Tag war, kalt, grau und regnerisch. Und das in London, wo jeder Regen irgendwie doppelt zählt. Manchmal habe ich das Gefühl, in England wären die Regentropfen feuchter als anderswo. Das ist sicher nur eine Täuschung, passte aber zu meiner Stimmung an diesem Morgen.
Daher begann blanker Neid in mir zu nagen, als mir Glenda Perkins meine Post brachte. Glenda, schwarzhaarige und bildhübsche Sekretärin in meinem Vorzimmer im Yard, tat das nicht ohne einen feurigen Blick. Reinste Verschwendung bei mir! Ich hatte mir zum obersten Prinzip gemacht, im Büro keinen Flirt anzufangen. Glenda vergeudete ihre Kräfte.
Sie merkte es und zog wortlos wieder ab, während ich auf eine Ansichtskarte aus Tunis starrte. Sie zeigte weißen Strand, grüne Palmen, blaues Meer und blauen Himmel. Ich warf einen missmutigen Blick aus dem Fenster in den strömenden Regen.
Während ich für Scotland Yard in London arbeitete, sonnte sich mein Freund Bill Conolly in Tunesien. Das schrieb er zumindest auf der Karte, auch wenn es nicht so ganz stimmte.
Früher war ich oft mit Bill Conolly zusammen auf Geisterjagd gegangen. Das hatte sich seit seiner Hochzeit mit Sheila geändert. Und erst recht seit der Geburt seines Sohnes John. Sheila war von Anfang an dagegen gewesen, dass Bill sich immer wieder solchen Gefahren aussetzte, wie sie ein Kampf gegen Geister und Dämonen mit sich brachte. Bill hatte kürzer getreten. Und seit es John jr. gab, hielt er sich noch mehr zurück.
Dass er diesmal verreist war – noch dazu ohne Sheila –, hatte einen beruflichen Grund. Bill war Reporter, aber die Conollys konnten es sich leisten, nur zu tun, was sie wirklich wollten. Sie waren finanziell abgesichert. Diesmal hatte Bill das Angebot erhalten, eine ausführliche Reportage über Tunesien zu machen. Zusammen mit Tom Turner, einem bekannten Fotografen, war er schon vor einer Woche nach Tunesien geflogen.
So ganz stimmte das mit dem Faulenzen in der Sonne also nicht. Außerdem gab es auch in Tunesien nicht nur Sonne. Trotzdem nagte der Neid in mir, wenn ich mir die Postkarte ansah.
Nicht, dass ich meinem Freund das schöne Wetter nicht gegönnt hätte. Durch Bills begeisterte Schilderung der afrikanischen Sonne ging mir das Londoner Wetter nur doppelt auf die Nerven.
Ich überlegte krampfhaft, ob ich nicht auch irgendeine Aufgabe in einem Sonnenland übernehmen konnte. Als Geisterjäger kam ich schließlich um die ganze Welt.
Eine halbe Stunde später trat Glenda wieder in mein Büro, diesmal mit einem Telegramm.
»Ist soeben gekommen«, sagte sie. Dabei war es selbstverständlich, dass sie Telegramme sofort an mich weitergab. Glenda war die Zuverlässigkeit in Person. In einer sehr hübschen Person.
Ich betrachtete das Blatt in meiner Hand mit einer Mischung aus Spannung und Vorahnung. Telegramme bedeuten selten etwas Gutes. Als ich dann gar sah, woher es kam, fühlte ich einen Kloß im Hals.
Tunesien!
Warum sollte mir Bill ein Telegramm schicken? Der kleine John, Bills und Sheilas Sohn und mein besonderer Liebling, war bei seiner Mutter gut aufgehoben. Hätte es etwas mit dem Kleinen zu tun gehabt, hätte sich Bill an seine Frau gewandt. Und hätte er eine gute Nachricht gehabt, hätte er auch direkt an Sheila telegrafiert. Warum also an mich?
Ich gab mir einen Ruck und riss das Telegramm auf. Und dann las ich ziemlich verwirrt den Text, las ihn noch einmal und ein drittes Mal. Anschließend war ich genauso schlau wie am Anfang.
*
Glühend heiß brannte die Sonne auf das kahle Felsmassiv herunter. Das Wetter schien sich überhaupt nicht mehr um die Jahreszeit zu kümmern. Es war heiß, obwohl auch in der Wüste eine kühlere Periode hätte einsetzen müssen.
Normalerweise kreisten über den vegetationslosen Bergen die Geier und warteten auf Aas. Jetzt ließ sich kein einziges Lebewesen in weitem Umkreis blicken.
Von Süden näherte sich eine Karawane dem Felsmassiv. Traditionsgemäß benutzten die langen Reihen von Kamelen und Menschen eine breite Schlucht, die die Berge in der Mitte teilte. Diesmal jedoch wich der Karawanenführer nach Osten aus, um das Gebirge zu umreiten. Er wusste selbst nicht genau, warum er es tat, aber er hatte nicht den Mut, sich den Felswänden noch mehr zu nähern.
Die Kamele waren während der letzten halben Stunde unruhig geworden. Kaum wechselte die Karawane die Richtung, als sich die Tiere wieder beruhigten.
Als sich niemand in Sichtweite der höchsten Bergspitze befand, erhob sich dort oben im gleißenden Sonnenlicht ein Wesen, das man nur aus Sagen und Märchen kannte.
Ein Drache!
Der Schädel saß auf einem langen, dünnen Hals. Die riesigen Augen blickten hasserfüllt in die Ebene hinunter. Dampf quoll aus den Nüstern, und als sich der Drache aufrichtete und ein markerschütterndes Brüllen ausstieß, schossen Feuerlanzen aus dem Maul der Bestie.
Noch war nicht die große Zeit der Drachen gekommen, aber sie näherte sich. Mit jeder Stunde wurde er mächtiger.
Wehe den Menschen, wenn dieses Ungeheuer losgelassen wurde!
Der Drache allein war schon tödlich wie die Pest. Zusammen mit den Todesgeistern der Sahara war er unschlagbar!
*
»Etwas Unangenehmes?«, fragte Glenda Perkins.
Erst jetzt merkte ich, dass sie abwartend in der Tür stand. Ich zuckte die Schultern.
»Weiß ich nicht«, murmelte ich und vertiefte mich noch einmal in den Text des Telegramms. Er war schon recht mysteriös.
SONNE BRENNT HEISS AUF SAHARA STOP NACHTS SCHEINT DER MOND STOP FLEDERMÄUSE STOP HABE KEIN JAGDGLÜCK STOP TRETE LÄNGEREN URLAUB AN STOP BILL
Auf den ersten Blick ergab das keinen Sinn und wirkte harmlos. Aber gerade das beunruhigte mich. Obwohl Bill seit seiner Heirat kurztrat, was Dämonen anging, hatten diese ihn und Sheila nicht in Ruhe gelassen. Immer wieder waren die beiden von den abscheulichen Wesen aus dem Schattenreich verfolgt worden. Mehr als einmal waren sie nur mit knapper Mühe – und meiner Hilfe – dem Tod oder einem noch schlimmeren Schicksal entgangen.
Daher dachte ich sofort an eine Gefahr aus dieser Richtung, als ich nun Bills Telegramm zum weiß wievielten Mal las. Er wies mich auf die Sahara hin und auf die Nächte in der Wüste. So viel glaubte ich zu erkennen.
Das Wort ›Fledermäuse‹ alarmierte mich. Ich dachte an Vampire. Wollte Bill mir mitteilen, dass er diesen Blutsaugern auf die Spur gekommen war? Aber weshalb schrieb er das nicht offen? Fürchtete er, dass das Telegramm sonst abgefangen worden wäre? Das passte nicht zu Vampiren. Sie lasen und unterschlugen keine Telegramme.
Und was sollte heißen, dass er kein Jagdglück hatte? Das bezog sich wohl kaum auf den Job, den er als Reporter übernommen hatte. War er bei seinen Recherchen über Tunesien auf einen Fall von Schwarzer Magie oder auf einen gefährlichen Dämon gestoßen und hatte ohne Erfolg versucht, dieses Problem selbst zu lösen?
Zuletzt war da noch der Hinweis auf den längeren Urlaub, den er antreten sollte. Oder musste …? Ich dachte sofort an Gefangenschaft.
Ich musste mir auf der Stelle Klarheit verschaffen, sonst hatte ich keine ruhige Minute mehr. Dieses Telegramm hatte nichts mit Bills Arbeit zu tun und war auch kein scherzhaft gemeinter Gruß. Viel eher klang das nach letzten Grüßen!
Das Telegramm war genau wie die Postkarte in Tunis aufgegeben worden. Das war mein einziger Anhaltspunkt.
Ich nahm die Karte und drehte sie nach allen Seiten. Plötzlich kniff ich die Augen zusammen, um einen kleinen Stempel lesen zu können. Er war neben dem Poststempel aufgedruckt.
Glenda brachte mir ein Vergrößerungsglas und blieb neben dem Schreibtisch stehen.
»Hotel Mirage«, entzifferte ich. »Tunis! Manche Hotels drucken solche Stempel auf Ansichtskarten, die sie an der Rezeption verkaufen. Glenda, Blitzverbindung nach Tunis.«
»Hotel Mirage«, sagte sie, nickte und verschwand in ihrem Zimmer.
Die Blitzverbindung ließ auf sich warten. Ich hätte gern Suko oder Jane Collins angerufen, die ebenfalls mit den Conollys befreundet waren, aber ich wollte die Leitung nicht blockieren. Und mit Sheila konnte ich jetzt nicht sprechen!
Nach einer halben Stunde endlich schaltete Glenda die Verbindung zu mir herein. Ich hatte Glück, die Verständigung war gut, und ich hatte in Tunis einen Hotelangestellten am Apparat, der fließend Englisch sprach.
Ich erkundigte mich nach Mr. Conolly und Mr. Turner und wartete gespannt auf die Antwort. Noch wusste ich ja nicht, ob mein Freund wirklich in diesem Hotel abgestiegen war. Wenn nicht, riss die einzige Spur, noch ehe ich sie aufgenommen hatte.
»Ja, die Gentlemen haben Zimmer bei uns«, antwortete der Angestellte in Tunis. »Mit wem soll ich verbinden?«
»Mr. Conolly!«, rief ich und atmete bereits auf. Das Telegramm war also doch nicht ernst zu nehmen. Vielleicht war der Text auch nur verstümmelt wiedergegeben worden.
Es klickte, dann blieb es ungefähr eine halbe Minute still. Ich hörte nur das Rauschen und Knistern, das immer in Fernleitungen rumort, und manchmal drangen auch fremde Gesprächsfetzen herein. Dann klickte es erneut, aber anstelle von Bills Stimme hörte ich wieder den Angestellten des Hotels Mirage.
»Sind Sie noch da, Sir?«
»Ja, natürlich!«, rief ich. »Was ist denn? Sind sie ausgegangen?«
»Tut mir leid, Sir«, antwortete der Hotelangestellte höflich. »Ich habe meinen Dienst erst vor zehn Minuten angetreten. Davor hatte ich zwei Tage frei. Ich habe eben erst von meinem Kollegen erfahren, dass Mr. Conolly und Mr. Turner ihre Zimmer zwar im voraus bezahlt haben, dass sie aber seit zwei Tagen nicht mehr im Hotel aufgetaucht sind.«
Mir war, als würde sich eine eisige Hand um meinen Hals legen. Ich rang nach Luft. Es war also doch etwas geschehen! Eine harmlose Erklärung gab es nicht!
»Wie lange sind die Zimmer noch bezahlt?«, fragte ich heiser.
»Bis heute Mittag, Sir«, kam prompt die Antwort. »Die Koffer stehen oben, die Kleider sind noch ausgepackt. Ich fürchte, wir müssen heute Mittag das Zimmer räumen lassen.« Von Polizei schien er nichts zu halten.
Ich blickte auf die Uhr. Viel fehlte nicht mehr bis Mittag.
»Tun Sie das auf gar keinen Fall!«, rief ich hastig. »Hören Sie, ich komme mit der nächsten Maschine nach Tunis, und ich bezahle alles!«
Das war das Zauberwort. Der Angestellte versicherte, er werde die Zimmer auf eigene Verantwortung bis zu meiner Ankunft zurückhalten. Außerdem reservierte er drei Zimmer unter meinem Namen.
Ich knallte den Hörer auf den Apparat und stürmte in mein Vorzimmer, dass Glenda erschrocken zusammenzuckte.
»Rufen Sie sofort Miss Collins und Mr. Suko an«, trug ich ihr auf. »Sie sollen sich bereithalten. Und besorgen Sie mir drei Tickets für die nächste Maschine nach Tunis!«
Dann war ich auch schon draußen und platzte in Sir Powells Büro. Der Superintendent fuhr hinter seinem Schreibtisch hoch und musterte mich besorgt. Ich musste einen ziemlich gehetzten Eindruck machen, da er den Kopf schief legte und seine Augen hinter den dicken Brillengläsern immer größer wurden.
»Was ist denn passiert, John?«, erkundigte er sich.
»Ich muss sofort nach Tunis«, sagte ich knapp. »Suko und Jane brauche ich ebenfalls.«
Sir Powell, für seine Verdienste um Scotland Yard endlich nach langer Wartezeit geadelt, erinnerte mich ausnahmsweise nicht an einen magenkranken Pavian. Er verzichtete auch auf sein übliches Sprudelwasser und die Magentabletten. Vermutlich nahm er sie ein, sobald ich wieder aus seinem Büro war.
»Sie sind heute so ernst, John«, stellte er fest. »Sie versuchen gar nicht, mich mit den drohenden Spesen zu ärgern.«
Ich lächelte flüchtig. »Dazu ist die Sache zu Ernst. Wahrscheinlich sind Bill Conolly und einer seiner Kollegen in Gefahr.« ’
Ich schilderte ihm mit wenigen Worten, was ich bisher wusste. Es war ohnedies nicht viel. Sir Powell war mit mir einer Meinung, dass da etwas passiert sein musste.
Als ich zehn Minuten später sein Büro verließ, war von seiner Seite alles klar. Er hatte die Dienstreise und die Spesen für Suko genehmigt. Glenda hatte die Tickets schon bestellt. Doch dann tauchten die ersten Schwierigkeiten auf, harmlos zu dem, was mich in Tunesien erwartete.
»Ich konnte Miss Collins und Mr. Suko nicht erreichen, Sir.« Glenda Perkins zuckte geknickt die Schultern. »Tut mir leid!«
»Und mir erst!« Ich warf einen Blick auf die Uhr. Meine Maschine ging in zwei Stunden. »Versuchen Sie es weiter. Treffpunkt Flughafen. Und ich mache mich auf die Suche nach den beiden.«
»Viel Erfolg!«, rief sie mir hinterher.
»Kleinigkeit«, rief ich zurück. »Es gibt ja nur ungefähr acht Millionen Menschen in London!«
Und das war grob geschätzt.
*
Der Karawanenführer war ein erfahrener Mann. Er kannte jeden Fußbreit der Sahara. Das behauptete er zumindest, wenn er mit seinen Kenntnissen angeben wollte. So ganz aus der Luft gegriffen war das allerdings nicht. In den zwanzig Jahren, die er die Sahara nach allen Richtungen durchquerte, hatte er sämtliche Karawanen sicher an ihr Ziel gebracht.
Er kannte die Sandstürme ebenso wie die gefährlichen Sandseen, die man vom sicheren, festen Untergrund nicht unterscheiden konnte, in denen aber eine ganze Karawane spurlos versinken konnte.
Der Mann hieß Habbas. Nannte man diesen Namen irgendwo in der Wüste, nickten die Männer mit Ehrfurcht.
Ausgerechnet diesem Habbas widerfuhr etwas Unglaubliches. Er hörte plötzlich ein Geräusch, das er nicht kannte! Ungefähr eine Stunde war verstrichen, seit er die Karawane in einem weiten Bogen um das Gebirge herumgeführt hatte. Er ahnte, dass sich in den Felsen etwas Unbegreifliches verborgen hielt, und er schauderte, wenn er nur daran dachte.
Und nun dieses Geräusch! Unruhig blickte sich Habbas nach allen Seiten um. Er konnte nichts sehen. Nirgendwo ein Anzeichen von Sandsturm. Wilde Tiere waren auch nicht in der Nähe, noch viel weniger Menschen.
Es war ein Sausen, Brausen und Rauschen wie von riesigen Vögeln. So genau Habbas, der Karawanenführer, auch den Himmel absuchte, er entdeckte keinen einzigen Vogel.
Plötzlich stieß einer seiner zehn Begleiter einen schrillen Schrei aus. Habbas fuhr zu dem Mann herum, der als Einziger auf einem Kamel saß. Die anderen Männer gingen neben der langen Reihe der Tiere einher.
Der Treiber hatte sich im Sattel umgedreht und deutete heftig gestikulierend zu den Bergen zurück. Er brachte jedoch kein einziges Wort hervor. Von seinem Hochsitz aus musste er mehr sehen als die Männer im Sand.
Habbas lief zu seinem Helfer. »Was ist los!«, schrie er zu dem Mann hinauf. »Sag es schon!«
Der Treiber versuchte zu sprechen, schaffte es jedoch noch immer nicht. Es war nicht mehr nötig. Jetzt sah auch Habbas die schwarzen Punkte, die sich durch den Himmel schwangen und sich rasend schnell vergrößerten.
Vor Schreck taumelte Habbas zurück. So etwas hatte er in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen.
Es waren gigantische Fledermäuse mit einer Spannweite, die kein lebender Vogel erreichte. Mit ihren schwarzen Flügeln hätten sie gleichzeitig zwei Kamele bedecken können!
Sekunden später waren die Bestien heran. Und nun sah Habbas auch ihre Körper. Der Schreck lähmte ihn.
Schuppige Leiber blitzten im Sonnenlicht. Andere Ungeheuer waren mit dichten schwarzen Federn bedeckt, wieder andere mit einem schmutziggrauen räudigen Fell. Abscheuliche Schädel mit gewaltigen Mäulern und dolchspitzen Zähnen grinsten den vom Grauen geschüttelten Karawanentreibern entgegen.
Die Dämonen flogen bereits den ersten Angriff, als Habbas aus seiner Erstarrung erwachte und sein Gewehr von der Schulter riss.
»Schießt, Männer, schießt!«, brüllte er seinen Leuten zu und riss den Abzug durch.
Er war ein ausgezeichneter Schütze, und die Kugeln fuhren einem der Ungeheuer in die Brust. Es zeigte jedoch keine Wirkung.
Sekunden später stieß der Flugdämon auf Habbas herab. Das mächtige Maul schnappte zu. Die grässlichen Zähne enthaupteten den Karawanenführer.
Seine Begleiter starben auf dieselbe Weise.





























