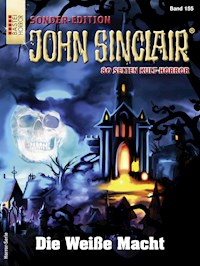
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Sinclair Sonder-Edition
- Sprache: Deutsch
Rom - Ewige Stadt. Aber auch Sitz der Weißen Macht, Geheimdienst des Vatikans.
Lange hatten dessen Agenten vergeblich nach dem Versteck der Bundeslade gesucht. Dann aber ergab sich plötzlich doch eine Spur, und Father Ignatius rief uns nach Rom. Als wir dort eintrafen, war diese Spur aber längst wieder verwischt. Und statt ein Erfolgserlebnis feiern zu können, erlebten wir den blanken Horror. Horror, der sich gegen die Weiße Macht selbst richtete. Baal, ein uralter Dämon, war erweckt worden und streckte nun seine Klauen nach ihr aus ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Die Weisse Macht
Vorschau
Impressum
John Sinclair ist der Sohn des Lichts.Der Kampf gegen die Mächte derFinsternis ist seine Bestimmung.
Die Weisse Macht
von Jason Dark
Rom – Ewige Stadt. Aber auch Sitz der Weißen Macht, Geheimdienst des Vatikans.
Lange hatten dessen Agenten vergeblich nach dem Versteck der Bundeslade gesucht. Dann aber ergab sich plötzlich doch eine Spur, und Father Ignatius rief uns nach Rom. Als wir dort eintrafen, war diese Spur aber längst wieder verwischt. Und statt ein Erfolgserlebnis feiern zu können, erlebten wir den blanken Horror. Horror, der sich gegen die Weiße Macht selbst richtete. Baal, ein uralter Dämon, war erweckt worden und streckte nun seine Klauen nach ihr aus ...
Es passierte auf einer der Tiber-Brücken in Sichtweite der Engelsburg!
Lorenzo Amber wusste sofort, dass sie ihn erwischt hatten. Ausgerechnet jetzt, ausgerechnet in dieser stockdunklen Nacht, ausgerechnet so kurz vor dem Ziel.
Er war ihnen immer wieder entwischt, hatte sich die raffiniertesten Verstecke ausgesucht und sie mehr als einmal regelrecht geleimt. Doch sie hatten sein Ziel gekannt und waren schlau genug gewesen, ihre Leute zu postieren.
Unter ihm gurgelte der Tiber. Er schlängelte sich wie ein breites schwarzes Band durch sein Bett, manchmal von Strudeln unterbrochen, die Schaumkronen bildeten.
Um diese Zeit, es war zwischen drei und vier Uhr morgens, schlief die italienische Hauptstadt. Lorenzo kannte sich aus. Er war oft genug in Rom gewesen, und zu dieser Stunde kam ihm die Stadt vor wie ein Maul, das kräftig ausatmete.
Amber wusste nicht einmal, wie viele Personen auf ihn warteten. Zwei Schatten hatte er gesehen, eigentlich harmlos, doch seiner Meinung nach hatten sie sich zu schnell bewegt, um auf nur Nachtschwärmer zu sein.
Was tun?
Zurücklaufen, weitergehen? So einiges ging ihm durch den Kopf, und auf der Zunge hatte er den bitteren Geschmack der Niederlage.
Er merkte, wie es in ihm vibrierte. Seine Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Kälte durchströmte ihn. Sie wechselte sich ab mit einer flammenden Hitze.
Einen Ausweg gab es nicht. Er musste dennoch weitergehen, egal in welche Richtung.
Überdeutlich hörte er plötzlich die Geräusche. Da war das leise Winseln des Windes, das Klatschen der Wellen und auch die Geräusche der Autos. Niemand interessierte sich für die Brücke, er war allein, und doch wirkte dieses Bauwerk auf ihn bedrohlich.
Amber setzte seinen Weg fort. Er hatte sich entschlossen, so zu tun, als hätte er nichts bemerkt. Es ergab einfach keinen Sinn, wenn er losrannte oder anfing zu schreien. Sie würden ihn so oder so schnappen. Deshalb ging er weiter und hoffte immer noch, sich letztendlich geirrt zu haben.
Eine einsame Lampe verstreute ihr Licht. Er huschte schnell durch diesen Kegel und war froh, als er ihn hinter sich gelassen hatte. Der Schweiß aber blieb auf seinem Gesicht.
Rom wurde als die Ewige Stadt bezeichnet. Für ihn konnte sie nun das Tor zur Ewigkeit werden!
Auch ärgerte er sich darüber, sich nicht richtig abgesichert zu haben. Er hätte anrufen sollen, seine Freunde hätten dann einen Sicherheitsring um ein gewisses Gebiet gezogen. Dafür aber war es jetzt längst zu spät.
Lorenzo Amber dachte an seine Mutter, die ihn immer davor gewarnt hatte, sich auf gefährliches Pflaster zu begeben. Er hatte nicht auf sie gehört. Er war in die Welt hinausgegangen. Er hatte sich immer als ein Suchender betrachtet. Als jemand, der Gerechtigkeit wollte, um so die Ungerechtigkeit bekämpfen zu können. Er war ein Träumer gewesen, das hatte er einsehen müssen, wobei es nichts an seiner Einstellung geändert hatte.
Der Wind wehte ihm den dünnen Klang einer Glocke entgegen. Viermal hatte sie angeschlagen, eine Totenglocke, die sich in einer fernen Welt befand.
Er blieb stehen.
Plötzlich erschien vor ihm ein Mann. Er musste im Schatten der Brückenmauer gekauert haben, ähnlich wie es die Bettler tagsüber tun, aber er war plötzlich vor ihm, hatte den rechten Arm halb erhoben und drehte etwas Weißes zwischen Zeige- und Mittelfinger. Eine Zigarette.
»Hast du Feuer, Freund?«
»Nein, habe ich nicht.«
»Schade.« Der Mann zog sich wieder zurück.
Lorenzo Amber atmete auf. Der Mann mit der Zigarette war harmlos gewesen. Natürlich hatte er Feuer, aber er hatte eben rein schreckhaft reagiert. Er fand den Mann auf dem Boden hockend und warf ihm eine schmale Zündholzschachtel zu. »Hier, die habe ich noch gefunden.«
»Danke.«
Lorenzo Amber setzte seinen Weg fort, als hinter ihm das Zündholz aufflammte. Von den Schatten hatte er nichts mehr bemerkt, aber sie waren da, das wusste er.
Er drehte sich um.
Schwärze. Auf der Brücke war niemand zu sehen. Auch kein Boot fuhr mehr auf dem Tiber. Es war keine gute Idee von ihm gewesen, sich zu Fuß durch Rom zu schlagen, aber er wollte auch keinen anderen in Gefahr bringen.
Amber ging schneller. Sein Gesicht war verkniffen. Er spürte mit jedem Schritt das Wachsen der Gefahr. Bisher war er auf der Brückenmitte gegangen, nun wählte er die rechte Seite. Die Schatten hatte er auf der anderen Seite gesehen.
Kamen Sie?
Hatte er sich getäuscht?
Mit dem jedem Auftreten brandeten diese Gedanken durch seinen Kopf. Sie waren wie Feuerstöße, die das Gehirn in Brand wollten. Angst konnte schlimm sein, besonders die Angst vor gewissen Dingen, die er nicht sah und die trotzdem vorhanden waren.
Dann passierte es.
Lorenzo hatte damit rechnen müssen. Er war trotzdem überrascht, als sie plötzlich auf ihn zuliefen. Sie waren zu zweit, trugen wahrscheinlich Turnschuhe, in denen sie sich lautlos bewegen konnten. Sie schienen aus der Tiefe des Raumes gekommen zu sein, Gestalten, die konturenlos waren und trotzdem brandgefährlich.
Er sah ihre hellen Gesichter, die sich bei den Bewegungen in tanzende Masken verwandelten, als hätte er sich zum Karneval nach Venedig verirrt.
Messer blinkten.
Lorenzo riss ein Bein hoch. Er hörte einen Laut der Wut, seine Hände katapultierte er vor und schleuderte den ersten Angreifer zur Seite. Er fiel auf das Pflaster.
Leider war der zweite noch da. Er pfiff scharf und schrill. Wahrscheinlich hatte er nicht mit Gegenwehr gerechnet, also musste Nachschub her.
Lorenzo Amber bewegte sich wie eine Gazelle. Seine Angst war verflogen. Plötzlich wusste er, was er zu tun hatte. Mit einem hastigen Sprung zur Seite entging er einem gefährlichen Messerstoß, der nächste Satz brachte ihn auf das Steingeländer der Brücke.
Er zögerte keine Sekunde, sondern stieß sich ab und sprang.
Flüche klangen hinter ihm auf.
Lorenzo Amber tauchte ein in die Fluten. Zuerst kam ihm das Wasser fast schockartig kalt vor. Das verging, als er bis zum Grund vordrang, seine Hände wühlten jetzt im Schlamm. Er bewegte sich unter Wasser weiter, tauchte erst nach einer Weile wieder auf und sah die zuckenden, hellen Kegel über die Wasserfläche tanzen. Sie suchten mit Lampen nach ihm, und diese Dinger waren ungeheuer leuchtstark. Es würde ihm schwerfallen, diesen hellen Lanzen zu entwischen.
Wieder tauchte er ein.
Genau da fiel ein Schuss.
Auf der Brücke hatte eine Gestalt gestanden und sich zum Zielen Zeit genommen. Obwohl die Entfernung relativ groß war und der Schalldämpfer einen gewissen Unsicherheitsfaktor darstellte, gelang dem Schützen ein Treffer.
Lorenzo Amber konnte nicht mehr jubeln, als er an der linken Schulter den Schlag spürte, als wäre dieser von einer brennenden Faust abgegeben worden.
Die Wucht und der Schock des Treffers drückten ihn unter Wasser. Für einen Moment hatte er das Gefühl, tot zu sein. Doch als Toter konnte er nicht spüren, fühlen, reagieren oder handeln. Er wollte nur weg. Er wollte überleben, er wollte ans Ufer, weil er die verzweifelte Hoffnung hegte, sich dort retten zu können.
Unter Wasser kämpfte er sich weiter vor. Selbst seinen verletzten Arm bewegte er dabei, und er riskierte sogar ein kurzes Auftauchen.
Vor sich sah er einen Schatten.
Er hörte eine Stimme. »Fassen Sie zu, schnell!«
Lorenzo tat, was ihm gesagt worden war. Er hätte sich selbst vom Teufel aus dem Wasser ziehen lassen, um sein Leben zu retten. Und das hing im Augenblick am wulstigen Kork eines Rettungsrings ...
✰
Mit dem Zuschlagen der schweren Holztür waren auch die Sonne und die Hitze verschwunden. Suko und ich atmeten durch, als wir die angenehme Kühle spürten, obwohl sich der Schweiß auf unseren Stirnen jetzt in eine kalte, hauchzarte Fettschicht verwandelte. Die Halle war groß, die Wände hellgrau gestrichen, das Holz einer Treppe schimmerte dunkel, und die Fenster ließen wegen ihrer geringen Ausmaße nur eine bestimmte Lichtmenge hinein.
»Sie waren angemeldet, nicht wahr, Signores?« Die fragende Stimme der Frau riss mich aus meinen Gedanken. Ich drehte den Kopf nach links. »Sicher, Signora, warum?«
Ich erhielt zunächst keine Antwort. Zudem stand die Frau im Schatten. Sie war dunkel gekleidet und wirkte wie ein großes Hindernis. »Schon gut, Signores. Manchmal ist es besser, wenn man Vorsicht walten lässt.«
»Das stimmt.«
Das ›Hindernis‹ bewegte sich und trat auf uns zu. Auf den Lippen lag ein Lächeln. Nun erkannten wir, dass die Frau schon ziemlich alt war. Wahrscheinlich ging sie auf die Achtzig zu. Ihre Kleidung reichte bis zum Boden. Um den Kopf hatte sie ein Tuch gebunden. Ihr zerknittertes Gesicht sah aus wie ein kleiner Apfel. Eine Brille schien sie noch nicht zu brauchen.
»Hatten Sie eine gute Reise, Signores?«
»Ja, es klappte alles vorzüglich. Selbst der Verkehr in Rom hat uns nicht aufhalten können.«
»Das ist gut«, erklärte sie und nickte. »Darf ich Ihnen trotzdem eine Erfrischung anbieten?«
»Gern.«
»Bitte kommen Sie mit.«
Sie drehte uns den Rücken zu. Suko, der bisher nichts gesagt hatte, hob nur die Schultern. Wir hatten mit einem anderen Empfang gerechnet, der hier war uns etwas suspekt. Die Atmosphäre in der Halle gebot es einfach, leise zu sein. Wir folgten der alten Frau, die eine schlichte Tür öffnete und uns in einen ziemlich großen Raum geleitete.
Lange Vorhänge filterten das Licht der Sonne. Es war ein Arbeitszimmer. Hohe Regale reichten bis an die Decke. Sie waren mit Büchern vollgestopft. Um an die obere Reihe zu gelangen, stand eine Rollleiter bereit. Die Decke war holzverkleidet, und die Möbel, Schreibtisch, Sessel und zwei Tische wirkten sehr wuchtig. Das braune Leder zeigte einen leichten Glanz. In der Luft hing der Geruch von Bohnerwachs und Tee. Die Kanne stand auf einem kleinen Stövchen aus Porzellan, in dem eine Kerze brannte und das Getränk warmhielt.
Auch Tassen standen bereit, und die Frau schenkte uns ein. »Nehmen Sie doch bitte Platz, es wird noch einige Minuten dauern, denke ich mir.«
»Danke sehr.«
Als wir saßen, lächelte sie uns zu, dann ging sie davon. Auch sehr leise, sie schwebte förmlich aus dem Raum wie ein großer dunkler Engel, der alles kontrollierte.
Suko hatte die Tasse angehoben und schlürfte die ersten Schlucke. Er war zufrieden. Ich sah es an seinem Nicken, trank ebenfalls und stellte die kleine Tasse vorsichtig wieder zurück.
»Was denkst du, John?«
Für einen Moment schaute ich ins Leere, und meine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. »Ich denke mal, dass sich einiges verändert hat an seinem neuen Arbeitsplatz.«
»Stimmt, und ich frage mich, ob er sich glücklicher fühlt.«
Da hatte er das Thema angesprochen. »Von Schottland nach Rom. Aus der Kühle in die Hitze. Nicht für jeden ist die Ewige Stadt eine Offenbarung.«
»Aber die Weiße Macht wollte ihn.«
»Richtig, wir haben keine Beschwerden gehört.«
Wie dem auch sein mochte, egal, welche Überraschungen uns noch bevorstanden, wir jedenfalls waren dem Ruf unseres Freundes Father Ignatius gefolgt. Er, der so lange Jahre im Kloster St. Patrick gelebt und sich dort wohl gefühlt hatte, war von der Weißen Macht, dem Geheimdienst des Vatikans, nach Rom geholt worden, um effektiver gegen die Feinde ankämpfen zu können.
Die Weiße Macht hatte es sich in den Kopf gesetzt, gegen die Kreaturen der Finsternis zu kämpfen, gegen das Ur-Böse sozusagen, und damit stand sie auch auf unserer Seite. Bisher war es zwischen dieser Organisation und uns nur zu einer sporadischen Zusammenarbeit gekommen, was sich in Zukunft aber ändern konnte.
Den genauen Grund hatte uns Father Ignatius nicht genannt, aber wir konnten ihm vertrauen, er hatte uns nicht grundlos nach Rom reisen lassen.
Wir waren überrascht gewesen, unseren Freund in einem derartigen Haus zu finden. Es lag außerhalb der Vatikanstadt und erinnerte überhaupt nicht an ein irgendwie klerikal geprägtes Gebäude, zumindest nicht von außen. Es war ein prächtiges Haus in einer herrlichen Parklandschaft. Kein Schild am Eingang hatte darauf hingewiesen, welche Organisation hier residierte. Das war Absicht. Es gab nicht kaum Außenstehende, die überhaupt etwas von der Weißen Macht wussten.
Im Prinzip verfolgte die Organisation dieselben Ziele wie wir. Die Vertreibung des Bösen, dessen Vernichtung, die Jagd auf schlimme Feinde. Aber bei der Weißen Macht blieb es schon mehr auf eine bestimmte Kraft konzentriert, eben auf die Kreaturen der Finsternis. Und die waren letztendlich nur zurückzudrängen, wenn es der Organisation gelang, die Bundeslade zu finden. Das stand als Fernziel fest, und darauf arbeitete man hin.
Auch wir hatten uns schon auf die Suche nach der Lade gemacht, mit bescheidenen Resultaten. In Israel entdeckten wir Spuren, die nach Äthiopien führten, nur versickerten die im Wüstensand.
In dem Arbeitszimmer herrschte eine besondere Stille. Keiner von uns empfand sie als bedrückend. Sie war irgendwo greifbar, als würde sie an dünnen Fäden von der Decke herabhängen und auch unsere Körper umklammern.
Wir sprachen nicht, warfen uns nur hin und wieder Blicke zu, wobei Suko dann die kleine Teekanne nahm und noch einmal nachschenkte. »Er schmeckt zu gut, als dass man ihn wegkippen sollte. Diese Frau kann Tee kochen, alle Achtung.«
»Ob sie für Ignatius arbeitet?«
»Wahrscheinlich.« Suko stellte die Teetasse wieder zur Seite. »Wenn ich mich so umschaue, hat unser Freund einen guten Tausch gemacht, denn so komfortabel war das Kloster St. Patrick nicht. Ich denke schon, dass er sich in seinem neuen Job wohl fühlen wird.«
»Davon hat er in den Telefonaten nie etwas gesagt.«
»Wie oft hast du mit ihm gesprochen?«
»Zweimal.«
Er winkte ab.
»Da ging es doch nur um die Sache.«
Die Erinnerung an die Gespräche ließ mich lächeln. »Nein, nicht nur. Wenn ich ehrlich sein soll, weiß ich nicht, was momentan läuft. Ich kann mir auch nicht denken, was wir hier sollen, Suko. Er hat ja nichts angedeutet.«
»Die Kreaturen der Finsternis, glaube ich.«
»Das ist die Frage«, sagte ich.
»Jedenfalls braucht er unsere Hilfe.«
Davon ließ sich Suko auch nicht abbringen. Ich schaute zu, wie er trank und lehnte mich in dem Sessel zurück, wobei ich dem Knarzen des Leders lauschte. Ich blickte zum Fenster. Das Glas sah aus, als würde in der Glut der Sonne hell brennen.
Im Raum gab es noch eine zweite Tür, umgeben von Regalen, in einer kleinen Nische. Genau diese Tür bewegte sich nun, und einen Moment später wurde der Rahmen von einer Gestalt ausgefüllt.
Ein Mann trat näher.
Wir hatten ihn bereits gehört und erhoben uns. Sekunden später wurde die Stille von einem hellen, freundlichen Lachen unterbrochen. Father Ignatius stand vor uns.
✰
Der Kork des Rettungsrings drückte gegen das Kinn des Mannes. Die Wellen spielten mit Lorenzo Amber und trugen ihn davon. Die Stimme seiner Verfolger überhörte er, denn er konzentrierte sich einzig und allein auf seine Rettung und hoffte, dass die andere Stimme keine Halluzination gewesen war.
Er dachte auch nicht daran, dass er jetzt seinen Verfolgern den Rücken zudrehen musste. Er wollte einfach nur heraus aus den Fluten des Tibers, und es war ihm letztendlich egal, wer ihn da aus dem Wasser holte.
Es fielen keine Schüsse mehr, aber die Lichtkegel huschten noch immer über die Wellen. Er hörte die Stimme wieder. »Achtung, wir ziehen Sie hoch!«
Erst jetzt fiel ihm auf, dass eine Frau gesprochen hatte, aber das machte ihm nichts. Ob Frau oder Mann, wichtig war nur, dass er endlich herausgezogen wurde.
Ambers linker Arm fühlte sich taub an. Dort hatte ihn die Kugel erwischt. Ob sie im Fleisch steckte, wusste er nicht, er konnte nur hoffen, dass er die Verletzung überlebte.
»Festhalten!«
Den rechten Arm hatte er von unten in den Rettungsring hineingeschoben und ihn so gedreht, dass er mit einer Hand den Wulst richtig umklammern konnte. Er schrammte beim Hochziehen an der Bordwand des Schiffes entlang. Es war ausgerechnet die linke Schulter, die malträtiert wurde, und wieder biss der Schmerz durch seinen Arm.
Der kurze Weg nach oben kam ihm unendlich lang vor. Wasser rann aus seinen Haaren, es lief über das Gesicht und die Lippen, und Amber hatte den Eindruck, verdünntes Öl zu schmecken. Die Kleidung hing schwer an seinem Körper, er fühlte sich hilflos und beinahe kampfunfähig, und er merkte, wie ihn allmählich die Kraft verließ.
Aber da streckten sich ihm die helfenden Hände entgegen. Er hatte sie nicht gesehen und spürte nur, wie sie unterfassten und in die Höhe zerrten.
»Vorsichtig ...«
Wieder hatte die Frau gesprochen und damit auch Erfolg gehabt, denn man legte ihn behutsam auf die Planken und löste seine Rechte vom Wulst des Rettungsrings.
Geschafft! Er war in Sicherheit! Keine blitzenden Lichter mehr, die nach ihm suchten, keine Angst vor einer Kugel, die in seinen Rücken schmettern würde. Er war bei Freunden, die ihn aus dem Wasser gezogen hatten, obwohl er diese Freunde gar nicht kannte. Aber sie gehörten zu den Menschen, die Courage beweisen, und hatten sich auch durch Schüsse nicht einschüchtern lassen.
»Er ist verletzt«, sagte ein Mann.
»Schwer?«, fragte die Frau.
»Moment mal.«
Lorenzo Amber bekam mit, wie jemand seinen Arm untersuchte. Er zuckte zusammen, als er um die Schulterwunde herum die Finger spürte. »Es ist gar nicht schlimm, nur ein Streifschuss. Eine lange Schramme.«
»Gut.«
»Bleibt es dabei?«
»Ja, ihr könnt ihn nach unten bringen«, erwiderte die Frau. Aber seid vorsichtig, bitte.«
Lorenzo Amber hatte jedes Wort gehört. Nichts war an ihn persönlich gerichtet gewesen, und er fühlte sich nicht gut. Er kannte die Menschen nicht, die ihn da aus dem Wasser gezogen hatten. Er hätte den Männern und der Frau dankbar sein müssen, dieses Gefühl wollte sich bei ihm jedoch nicht einstellen.
Die Hände hatten ihn angehoben, schleppten ihn über das Deck und eine Treppe hinunter. Sehr schnell wurde die Luft schlechter, regelrecht stickig. Dann musste er die Augen zusammenkneifen, als ihn das Licht einer Deckenlampe blendete.
Die Frau war ihm gefolgt. Er hörte ihre Stimme. Sie befahl den beiden Männern, ihn auf die Liege zu legen, ihn auszuziehen und Handtücher zu bringen.
Die beiden gehorchten.
Lorenzo Amber ließ alles über sich ergehen. Er trug nichts Verdächtiges bei sich, nicht einmal eine Waffe hatte er eingesteckt. Sein Name stimmte, aber kein Dokument wies auf seinen Beruf hin, dem er nachging. Das war geheim und sollte auch so bleiben.
Als er nackt war, fror er. Weiche Tücher trockneten seinen Körper. Seine Wunde wurde abgetupft, und das Fleisch schien bei der Berührung zu zucken. Im Unterbewusstsein merkte er, dass das Boot Fahrt aufgenommen hatte.
Es war ihm egal. Amber hielt die Augen halb geschlossen, hörte hin und wieder flüsternde Stimmen, dann verarztete jemand seine Wunde. Es wurde ein teuflisches Desinfektionsmittel hineingeträufelt, das wie Feuer brannte, und Lorenzo musste an sich halten, um nicht aufzuschreien, aber er wollte sich keine Blöße geben. Seine Retterin hatte er noch nicht gesehen, sie hielt sich allerdings noch in seiner Nähe auf, denn er hörte hin und wieder ihren Kommentar.
Seine Wunde wurde verbunden. Anschließend hob man ihn an. Jemand zog ihm einen weichen flauschigen Bademantel über, und danach ließ man ihn allein.
Bevor alle verschwunden waren, strichen noch weiche Hände über seine Wangen. Er hörte ein leises Lachen und die weibliche Stimme, die sagte: »Wir werden uns bald unterhalten, mein Lieber. Ruhen Sie sich zunächst einmal aus. Sie haben es sich verdient.«
Lorenzo Amber hörte die leichten Tritte. Eine Tür öffnete sich, das Licht an der Decke verlosch, und ihn umgab eine bedrückende Finsternis, die ihm wie ein grauer Sack vorkam.
Der Mann lag auf dem Rücken. Die Luft drückte. Kein frischer Hauch streifte durch die Kabine, und Amber lauschte dem Klatschen der Wellen und dem Geräusch des Motors. Er musste sich erst an das Schaukeln des Bootes gewöhnen. Er wusste nicht, wohin sie fuhren, und machte sich darüber auch keine Gedanken. Ihm war nur klar, dass er seinen Auftrag nicht erfüllt hatte, und dass sie ihn dicht vor dem Ziel abgefangen hatten. Das wiederum wurmte ihn. Er hätte seinen Bericht gern abgegeben. Er wusste inzwischen einiges, aber er hätte nie damit gerechnet, verletzt auf einem fremden Boot zu liegen. Das kam ihm erst jetzt in den Sinn, als er über seine Lage nachdachte. Es gab keinen Grund, in Jubel auszubrechen, und er rechnete damit, vom Regen in die Traufe gelangt zu sein.
Das Boot schlich dahin, als wäre alle Zeit der Welt vorhanden. Die aber hatte Lorenzo Amber nicht.
Er beschäftigte sich bereits mit Fluchtgedanken. Nur würde er eine jämmerliche Figur abgeben, sollte es ihm nicht gelingen. Er war nackt, und jemand hatte ihm nur den Bademantel über den Körper gestreift, das war alles.
Er hätte bei einer Flucht Aufsehen erregt, das wiederum war ihm nicht egal, denn sein Dienst arbeitete so geheim wie möglich.
Amber brauchte Zeit, um nachzudenken. Er musste sich mit der neuen Situation zurechtfinden und sich einen Plan zurechtlegen, bevor die Frau zurückkehrte.
Obwohl noch zwei Männer bei ihr gewesen waren, glaubte Lorenzo, dass sie hier das Sagen hatte. Sie war der Boss, an sie musste er sich halten, und sie hatte ihm zudem versprochen, sich mit ihm zu unterhalten. Worüber?
Seine Lippen zeigten ein hartes Grinsen, als er die verschiedenen Möglichkeiten durchging. Da stand sein Job, der Auftrag natürlich, an erster Stelle. Nur würde er ihr nicht den Gefallen tun und etwas preisgeben, das ihn in Schwierigkeiten bringen konnte. Gewisse Dinge musste er einfach für sich behalten.
Lorenzo Amber zwang sich dazu, das Zukunftsdenken zu beenden. Er wollte und musste sich auf die Gegenwart konzentrieren, und die sah so aus, dass er rücklings auf einem fremden Bett in einer fremden Kabine auf einem ebenfalls fremden Schiff lag.
Punkt und basta!
Das Licht war gelöscht worden. Durch die zwei schmalen Fenster würde normalerweise etwas Licht fallen, zu dieser nächtlichen Stunde aber fanden höchstens Lichtreflexe einen Weg in sein Gefängnis.
In der Tat empfand er diese Kabine als Gefängnis, und dieses Gefühl hatte er schon immer gehasst. Ein Mann wie er ließ sich nicht festhalten, er probierte zumindest gewisse Dinge aus, und deshalb wollte Amber auch nicht länger liegenbleiben. Doch er wollte nichts überstürzen. Immer alles der Reihe nach, dann ging die Sache wie von selbst.
Amber freute sich darüber, dass ihn kein Schwindel überkam, als er sich hinsetzte. Auf dem Rand blieb er hocken, starrte in das dichte Grau und hatte den Eindruck, als wäre sein Kopf sehr schwer geworden. Er sank nicht nach unten, Amber hielt sich gut, und er atmete auch einige Male tief durch.





























