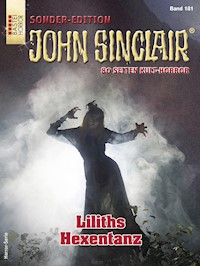
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Sinclair Sonder-Edition
- Sprache: Deutsch
Menschen vergessen, der Teufel nicht! Über Jahrhunderte hinweg hatte er sich auf seine Hexen als treue Dienerinnen verlassen können - bis Lilith, Luzifers Geliebte, wieder mitmischte. Sie meldete ihre Ansprüche an, und zahlreiche Hexen verließen den Teufel.
Der aber sann auf Rache und wollte sich zurückholen, was ihm gehörte. So schickte er Smasch, den mörderischen, grausamen Hexenfresser.
Aber auch Lilith blieb nicht untätig, und ausgerechnet zwei Todfeinde sollten ihr jetzt helfen: Jane Collins und ich. In einer düsteren Halloween-Nacht sollte sich unser ungleicher Kampf gegen gleich zwei unbarmherzige Gegner entscheiden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Liliths Hexentanz
Vorschau
Impressum
John Sinclair ist der Sohn des Lichts.Der Kampf gegen die Mächte derFinsternis ist seine Bestimmung.
Liliths Hexentanz
von Jason Dark
Menschen vergessen, der Teufel nicht! Über Jahrhunderte hinweg hatte er sich auf seine Hexen als treue Dienerinnen verlassen können – bis Lilith, Luzifers Geliebte, wieder mitmischte. Sie meldete ihre Ansprüche an, und zahlreiche Hexen verließen den Teufel.
Der aber sann auf Rache und wollte sich zurückholen, was ihm gehörte. So schickte er Smasch, den mörderischen, grausamen Hexenfresser.
Aber auch Lilith blieb nicht untätig, und ausgerechnet zwei Todfeinde sollten ihr jetzt helfen: Jane Collins und ich. In einer düsteren Halloween-Nacht sollte sich unser ungleicher Kampf gegen gleich zwei unbarmherzige Gegner entscheiden ...
Der Dämon war nackt!
Gerade wegen dieser Nacktheit sah er widerlich und abstoßend aus. Sein überaus heller Körper glich dem eines Albinos, nur kam bei ihm noch das ebenfalls helle Fell hinzu, das seinen gesamten Körper, vom Kopf bis zu den Füßen, mit einem hellen Flaum bedeckte und auch das Gesicht nicht verschonte. Es war eins mit den Haaren, denn am hinteren Kopf wuchsen das Fell und die Haare zusammen, wobei er die langen, hellen Fransen zusammengeknotet hatte, damit sie nicht störten.
Seine Hände waren sehr groß und wirkten knorrig. Aber auch auf ihnen wuchs dieses helle Fell, bis hin zu den Fingernägeln, die lang und spitz waren wie Messer, damit der Dämon seine Beute besser reißen konnte.
Er wartete auf Beute. Er war hungrig. Er hockte in der Mulde, wo ihn keiner sah, und er bewegte sich in einer fürchterlichen und schrecklichen Welt, die für Menschen nur den Tod bringen konnte.
Es war eine Vorhölle. Ein totes Land. Ohne Wasser, ohne Wälder, dafür von dicken Rauchschwaden durchzogen, die bestialisch stanken, denn überall in dieser Dimension wurde das Fleisch der Opfer gebraten.
Hier zählten nur die Gewalt und das Überleben. Das wusste der Dämon mit dem weißen Fell. Er war hungrig, und der Hunger wühlte in seinen Eingeweiden. So als wollte ihn ein ihn von innen her auffressen.
Fressen! Er wollte, er musste fressen.
Fleisch zerreißen, um die blutigen Klumpen roh zu verzehren. Er sah nicht nur widerlich aus, er war es auch. Und sein Gesicht wirkte so, als hätte es sich bei der Entstehung weder für Menschen noch Tier entscheiden können.
Öffnete er sein Maul, zeigte er seine messerscharfen Zähne.
Er hockte noch immer in seinem Versteck und wartete. Manchmal strich er mit den Krallenhänden über sein Fell, als wollte er sich die hellen Haare büschelweise herausreißen.
Das tat er nicht.
Er kratzte den Boden auf. Trockener Staub wirbelte hoch. Eine Zunge drang aus seinem Maul. Sie war lang und grau. Er leckte damit um sein Maul, und er dachte daran, dass es sehr lange her war, dass er sich so richtig satt gefühlt hatte.
Tiere gab es genug.
Er aber wollte etwas anderes.
Menschen!
Bestimmte Menschen!
Welche, die einmal seinem Herrn gehört hatten, dann aber zu jemand anders übergelaufen waren. Das hatte sein Herr und Meister nicht verkraftet, aber er konnte sich auch nicht offen gegen diese andere Person stellen, weil sie einen überaus mächtigen Verbündeten hatte, den mächtigsten überhaupt. Wer ihm in die Quere kam, war verloren, der verschwand von der Bildfläche, denn er wurde verdammt.
Der Dämon knurrte. Seine Zunge zuckte wieder zurück. Genau in dem Augenblick vernahm er einen hellen Schrei, der wie ein Signal über das unfruchtbare Land hallte. Er zuckte zusammen. In seinem Innern tobte die Wut, und er drosch mit den Krallen auf das Gestein, weil er so hungrig war und die anderen sich satt essen konnten.
Die Wut verrauchte zwar nicht, aber er drängte sie zurück und dachte nach.
Der Schrei war in der Nähe erklingen. Das hieß, dass es nicht weit entfernt von seiner Mulde jemanden geben musste, der eine Beute gefangen hatte.
Beute, dachte er.
Auf einmal glühten seine Augen. In dieser Dimension herrschte das Recht des Stärkeren. Wenn er stärker war als derjenige, der die Beute gefangen hatte, dann gehörte sie ihm.
Das Gesetz der Wildnis. Der Dämon richtete sich auf. Er streckte seinen Körper. Er ruderte mit den Armen. Sein helles Fell sträubte sich, bevor er sich gut fühlte und mit heftigen und gleitenden Bewegungen den Hang hochglitt, um die Mulde zu verlassen.
Witternd wie ein Tier, kauerte er am Rand der Mulde und bewegte seinen Kopf von einer Seite zur anderen.
Er konnte kaum etwas sehen, weil der Dunst wie gelbliche Schwefelgase über die öde Landschaft hinwegtrieb. Menschen wären daran erstickt, nicht aber die Dämonen, die diese Welt bevölkerten. Für sie war es der reinste Balsam.
Auch für den weißfelligen Jäger. Seine kräftige Nase bewegte sich schnuppernd. Er saugte die Luft ein, er öffnete den Mund. Wieder erschien seine Zunge für einen kurzen Augenblick, als wollte er auch noch schmecken, was er da eingesaugt hatte.
Der Dämon wusste Bescheid.
Langsam richtete er sich auf. Seine nackte, fellbesetzte Gestalt hob sich für einen Moment am Rand der Mulde ab, dann duckte er sich und lief vor.
Er bewegte sich mit kräftigen und raumgreifenden Schritten. Seine Füße mit den Krallenzehen tappten dabei immer wieder auf den Boden, und aus dem offenen Mund drang nach jedem Schritt ein Zischen.
Der Schrei hatte sich nicht wiederholt, aber der Dämon wusste genau, aus welcher Richtung er gekommen war. Er musste sich links halten, wo diese Welt anders aussah und starre Bäume in die Höhe wuchsen, deren Wurzeln sich in den felsigen Untergrund dieser zeitlosen Dimension gekrallt hatten.
Es war ein Wald – oder einmal ein Wald gewesen. Die Bäume standen noch, doch an ihren Zweigen und Ästen wuchs kein einziges Blatt mehr. Die Bäume waren grau, taub und verdorrt. Manche ragten schlank in die Höhe, andere wirkten weit ausladend und boten den Vögeln viel Platz, die in dieser Dimension die Lüfte beherrschten.
Totenvögel, Aasvögel ...
Sie hatten Ähnlichkeit mit Geiern, nur waren sie größer und hässlicher, wobei die krummen Schnäbel scharf waren wie Lanzenspitzen.
Ihre Augen sahen kalt und blass aus. Zudem waren sie kugelrund und ragten weit aus den Augenhöhlen. Nicht eine Feder wuchs auf den langen Hälsen, die aussahen wie weißgraue Schläuche. Dafür verteilten sich Federn in unterschiedlichen Schattierungen auf den Körpern der Vögel und bewuchsen auch die breiten Schwingen.
Sie waren die Resteverwerter dieser Welt. Sie fraßen das, was andere übrig ließen. Wenn ihr Hunger zu groß war, dann zerfleischten sie sich sogar gegenseitig.
Der weißfellige Dämon hatte einen Blick für die Vögel. Er behielt sie im Auge, denn wo sie hockten oder hinflogen, gab es zumeist die Beute.
Einige von ihnen hatten bereits im kahlen, grauen Geäst der toten Bäume ihre Plätze gefunden. Angelockt durch den Duft des Bratens und den Geruch des Feuers, segelten auch andere herbei.
Beides war schon längst in die Nase des Dämons gedrungen, der jetzt durch den Wald eilte und auf nichts Rücksicht nahm, was ihm im Weg stand. Seine Arme wirbelten dabei wie Dreschflegel. Manchmal trat er zu wie ein Fußballspieler.
Der Boden war ebenso grau und aschig wie die übrige Umgebung. Farbe gab es in dieser Unnatur nicht.
Hier herrschte das Gesetz des Fressens und Gefressen Werdens.
Manchmal kratzte er mit seinen Nägeln an den grauen Stämmen entlang und hinterließ dort hellere Schleifspuren. Er hatte Mühe, sich zu beherrschen, denn der Hunger wühlte in seinen Eingeweiden. Wer immer sich die Beute geholt hatte, der Dämon würde kurzen Prozess machen und sofort über denjenigen herfallen.
Einen Farbklecks nahm er schon wahr. Es war das Feuer, dessen Flammen kniehoch schlugen. Dort lag das Fleisch, das die anderen so gern essen wollten.
Sie würden sich wundern. Sie sollten nur alles vorbereiten. Er wollte so wenig Arbeit wie möglich haben, und seine lange Gestalt glitt nach vorn, sodass er beinahe bäuchlings den Boden berührte und sich so weiter an sein Ziel heranschob.
Der Staub der Erde kratzte über sein helles Fell und blieb darin kleben. So sah er aus wie mit Asche bestreut, was ihm nichts ausmachte, denn er wollte endlich satt werden.
Zwei Gestalten waren es, die um die Feuerstelle herumhockten. Darauf verließ sich der hungrige Dämon nicht. Oft kam es vor, dass ein dritter in einem Versteck Wache hielt. Das war hier wohl nicht so. Die beiden fühlten sich sicher. Er konnte niemanden entdecken.
Der Dämon bewegte sich näher heran. Er konnte vor Gier kaum noch an sich halten. Hin und wieder zuckten seine Muskeln. Er musste sich zusammenreißen, um nicht schneller voranzueilen. Dann hätte er einfach zu leicht gehört werden können.
Hinter einem abgestorbenen Baum, dessen Stamm sich teilte und dabei wie eine zweizinkige Gabel wirkte, verharrte er für einen Moment auf der Stelle und richtete sich vorsichtig auf. Nur keine Geräusche machen, sich nicht zu hastig bewegen, denn das hätte auch die Vögel stören können. Wenn sie plötzlich wegflogen, wären die anderen beiden gewarnt.
Er sah sie jetzt besser.
Sie gehörten einer Gruppe an, die er verachtete. Ihre Körper waren aufgedunsen und fett. Aus den Gesichtern schauten Glotzaugen hervor. Beine hatten sie keine, nur lange Arme, die mit einem Chitin-Panzer versehen waren.
Um sich bewegen zu können, waren auf ihren Rücken Flügel gewachsen, allerdings nur kleine, und sie konnten sich auch längst nicht so lange in der Luft halten wie Vögel. Aber es reichte aus, um Feinden entkommen und Beute schlagen zu können, denn wenn sie blitzartig nach unten stießen, hatte kaum jemand eine Chance.
Wen oder was sie brieten, sah der Dämon nicht. Der eine wandte ihm direkt den Rücken zu, der andere die Seite. Sein Gesicht sah aus wie ein dickes Oval, in dem nur der breite Mund auffiel, in den sie ihre Nahrung hineinstopften.
Der Weißfelldämon hatte genug gesehen. Er schob sich rechts an dem kahlen Stamm vorbei und visierte den an, der ihm den Rücken zudrehte. Der andere würde ihn zwar eher sehen, dann aber war er nicht mehr aufzuhalten, das stand fest.
Ein letztes Mal stieß er sich ab, weil er den nötigen Schwung bekommen wollte. Dann jagte er mit langen Sätzen auf die Gestalten am Feuer zu, und es gab auch kein Hindernis, das ihn hätte aufhalten können. Er war schlau genug gewesen, um sich den Weg zuvor genau ausgesucht zu haben. Nur einmal brach unter ihm trockenes Holz. Dieser Laut spornte ihn eher noch an.
Er stieß sich genau im richtigen Augenblick ab – und packte zu. Die Gestalt, die ihm das Profil zugedreht hatte, war also als erste aufmerksam geworden.
Von der Seite raste der Weißhäutige auf sie zu. Sie hörte etwas, sah etwas, drehte sich – und konnte nicht mehr ausweichen, denn der andere war bereits über ihr.
Zwei Hände griffen zu. Die Krallen bohrten sich in den aufgeblasenen Körper, auf dessen Rücken sich die kurzen Flügel heftig bewegten, aber die Gestalt nicht von der Stelle brachten, denn der Weißhäutige lag auf ihr. Er rollte sein Opfer herum, auf das Feuer zu, dessen Qualm träge über die beiden hinwegtrieb.
Ein wimmerndes Klagen drang aus dem Maul der Gestalt, die keine Chance mehr hatte.
Der Albino-Dämon war grausam. Er schlug so brutal auf das Wesen ein, dass die Gesichtshaut wie Papier riss. Die Krallenfinger drangen tief in das Fleisch. Sie hatten Wunden gerissen, aus denen eine Flüssigkeit hervorquoll, die nicht rot wie das Blut eines Menschen aussah, dafür gelblichgrün und dick wie Sirup.
Das Wimmern verstummte. Der Treffer hatte die Gestalt vernichtet, und der Weißfellige schleuderte den Kadaver fort. Dicht über sich spürte er einen Luftzug. Er ahnte, was da geschehen war, riss auch den Kopf herum und hob die Arme.
Für ihn war es zu spät, denn dicht über ihn hinweg flog bereits die zweite Gestalt mit den Stummelflügeln, die sich hektisch bewegten. Ein Mensch hätte sie vielleicht mit einer fliegenden Schildkröte verglichen. Plump bewegte sie sich durch die Luft, aber noch immer schneller als der Killer, der es auch mit einem Sprung nicht schaffte, sie zu packen.
Er zog sich wieder zurück, riss die Arme hoch und schrie seine Wut hinter der flüchtenden Gestalt her. Diese Flucht hatte ihm überhaupt nicht gefallen.
Sein Zorn verrauchte schnell. Er wollte und musste sich um die Mahlzeit kümmern, die über dem Feuer briet.
Der Körper wurde bereits geröstet. Was es für ein Wesen war, konnte er nicht mehr erkennen. Es war gehäutet und zerteilt worden. Auf dem primitiven Rost lag ein Klumpen über der Glut. An einer Seite war er bereits schwarz.
Der Dämon zerrte den Körper vom Feuer weg, warf ihn auf den Boden, riss ihn aber noch nicht in Stücke, sondern schaute nach der Gestalt, die er getroffen hatte.
Sie war vernichtet und blutete aus. Das Gesicht sah aus wie eine weiche, zusammengedrückte Frucht. Der Dämon dachte darüber nach, ob er den anderen ebenfalls noch verschlingen sollte, doch er wollte erst mal abwarten.
Dann kümmerte er sich um das andere Fressen.
Er hockte sich neben das Feuer. Den Körper, an dessen Haut noch einige Fellhaare hingen, riss er zuerst in zwei Hälften, dann teilte er diese noch einmal, um handliche Stücke zu bekommen. Erst dann hackte er seine mächtigen und auch spitzen Zähne hinein, um die Stücke aus dem Fleisch zu reißen.
Sie schmeckten ihm. Er schmatzte. Es störte ihn auch nicht, dass der Saft an seinen Mundwinkeln entlang nach unten rann. Er schmatzte und schlürfte, er zerrte mit den Zähnen. Er riss die Stücke aus der Masse heraus und verschlang sie gierig.
Sein Appetit war ungebrochen. Er aß, bis er die blanken Knochen und Sehnen entdeckte, erst dann schleuderte er die Reste hinter sich. Vor ihm brannte das Feuer allmählich nieder. Nur noch der stinkende Rauch umwehte ihn wie ein Gespinst, aber das war ihm egal. Der Weißfell-Dämon war noch längst nicht satt.
Er nahm sich auch die nächsten Stücke vor, zerrte das Fleisch von den Knochen, kaute schmatzend, schluckte und schmatzte.
Zu trinken brauchte er nicht. Der Saft des Fleisches reichte ihm aus.
Er überlegte, ob er alles auffressen sollte. Nach dem zweiten Stück Fleisch legte er eine Pause ein und schaute sich um. Er musste immer damit rechnen, dass andere ebenso reagierten wie er und versuchten, ihm die Beute abzunehmen. Er sah keinen. Trotzdem spürte er etwas. Plötzlich hatte er den Eindruck, nicht mehr allein zu sein. Jemand hielt sich in seiner Nähe auf, den er nicht sah, sondern nur spürte. Sein rechter Arm sank nach unten. Er öffnete die Faust, und der letzte Bissen Fleisch fiel zu Boden.
Der Dämon fühlte sich unwohl. Er hatte gegessen, er hatte den Sieg errungen, er hätte eigentlich zufrieden sein müssen, aber er war es trotzdem nicht.
Jemand beobachtete ihn.
Deckung gab es für den anderen genug, denn auch er selbst hatte sie ja ausgenutzt. Die toten Bäume, dieser graue Wald ohne Blätter und Feuchtigkeit. Irgendwo zwischen den Stämmen musste jemand seinen Standplatz haben, der ihn nicht aus den Augen ließ.
Er knurrte leise.
Auf seinem Rücken sträubten sich die hellen Haare. Ein Zeichen, dass er unter Druck stand. Die Gefahr war da, er hatte sie sich nicht eingebildet, und etwas, das er kaum kannte, stieg in ihm hoch. Es war das heiße und zugleich bedrückende Gefühl der Angst. Wie eine dicke Platte aus Blei lagerte sie in seinem Körper und schien seine inneren Organe erdrücken zu wollen.
Er stand auf. Da hörte er das Knacken.
Der Dämon fuhr herum – und duckte sich. Aber nicht zum Sprung, sondern nur aus einem Grund. Jemand war erschienen, der stärker, viel stärker war als er, der herrschte und für den die Menschen viele Namen erfunden hatten.
Einer lautete unter anderem »Teufel« ...
Er stand da, als wäre er aus dem Nichts gekommen. Er war zwar zu sehen, aber nicht richtig zu erkennen, denn der weißfellige Dämon wusste sehr genau, dass der Teufel nicht immer gleich aussah. Er schaffte es auch, sich immer wieder zu verändern. Er konnte mal als schaurige Gestalt, dann wieder als schöner Jüngling auftreten oder als grässliches Monstrum. Er war da sehr flexibel.
Vor ihm stand er als, ja, als was denn?
Zu erkennen war wenig von ihm, weil er sich in einer Wolke versteckte, die zwischen den Stämmen zweier Bäume hing. Dass es der Höllenherrscher war, wie er sich gern selbst nannte, konnte der Dämon nur spüren. Er kannte diese Aura genau. Nicht dass sie ihm Angst oder Schrecken eingejagt hätte, der Teufel gehörte schließlich zu ihnen und war im gewissen Sinne einer von ihnen, nein, es war der Respekt vor einer Kreatur, die mächtiger war als er.
Deshalb gab er sich unterwürfig. Sein flaches Gesicht verzog sich zu einem Grinsen. Dabei streckte er einen Arm aus und deutete auf den Rest der Beute.
»Nein!«, donnerte es ihm aus der Wolke entgegen. »Ich will nicht essen.«
Der Teufel sprach mit ihm. Er übermittelte ihm eine Botschaft, und der Dämon hatte ihn verstanden, obwohl es eine Sprache war, die hier nicht gesprochen wurde, sondern in einer Welt, wo die Menschen das Sagen hatten.
Aber er konnte sie verstehen, und darüber war er sehr glücklich. Sein Maul bewegte sich. Saft vom Gebratenen rann hervor. Noch immer rührte sich die Gestalt nicht, gab dem Dämon aber den Befehl, sich zu setzen.
Das tat er. Den Blick hielt er nach vorn gerichtet. Die wie Krallen wirkenden Hände um seine dürren Knie verschränkt. Er schaute zu, wie die Wolke näher auf ihn zuwanderte, sich dabei aber nicht auflöste, sondern nach wie vor so dicht blieb und der Teufel selbst sich nur als ein Schatten in dieser Wolke abmalte.
Dunkel, in den Konturen zerschnitten und zerfließend. Deshalb sah es so aus, als würden in der Wolke nur einzelne Teile schweben, die sich hin und wieder nur zusammensetzten, um danach aber auseinanderzudriften, sodass sie sich erst finden mussten.
Der Teufel wollte etwas von ihm, und der Weißfell-Dämon fühlte sich geehrt. Er zitterte unter der Erwartung. Seinen noch vorhandenen Hunger hatte er vergessen, denn was der andere von ihm wollte, das war wichtiger, viel wichtiger.
»Ich habe dich beobachtet«, hörte er den Teufel sprechen. »Ich weiß auch, dass du dich nicht fürchtest – oder?«
»Nein, nein!«
»Es gibt also nichts, vor dem du Angst hast?«
»Nein, nichts.« Das war gelogen. Der Dämon kannte die Angst schon, aber vor stärkeren Feinden, wie zum Beispiel dem Teufel, doch der war zum Glück kein Feind.
»Das ist gut. Ich brauche dich!«
Die beiden schlicht dahingesprochenen Sätze ließen den Dämon nervös werden. Er spürte eine Hitzewelle durch seinen Körper jagen, als läge er selbst über den Resten des Feuers, um gebraten zu werden. Diese schlichten Worte hatten dafür gesorgt, dass bei ihm ein Traum in Erfüllung gegangen war.
Der Teufel brauchte ihn. Ausgerechnet ihn. Himmel, er wollte etwas von ihm. Vielleicht sogar seine Hilfe.
In seinem Innern drehte sich ein Karussell. Ihm wurde schwindelig. Er hatte Mühe, auf seinem Platz zu bleiben, stützte sich jetzt mit den Klauen ab, und seine Krallen kratzten über den harten und staubigen Boden.
Er braucht mich! Er braucht mich! Ich bin für ihn so etwas wie ein Freund und Helfer.
Die Wolke waberte näher. Die dunkle Gestalt darin nahm an Deutlichkeit zu, ohne sich allerdings klar zu erkennen zu geben. Letztendlich blieb er diffus.
Der Dämon nickte. »Ja, du kannst auf mich zählen. Was immer es auch ist. Ich werde alles tun.«
»Das ist gut. So habe ich es erwartet.«
»Was soll ich für dich tun?«
Der Teufel lachte. Er hörte sich ungewöhnlich an, nicht so wie bei einem Menschen. Aus der Wolke drang ein krächzendes Geräusch, vermischt mit einem Kratzen. Das Lachen verstummte abrupt. »Nicht so schnell. Nur nicht so schnell, mein Lieber. Ich weiß ja, dass du dich darauf freust, mir behilflich zu sein, aber es gibt da noch einige Dinge zu erledigen, das muss ich dir sagen.«
»Ja, ja, ich warte.«
»Wie heißt du?«
Schweigen.
Der Teufel lachte. »Ich wusste es – du weißt es nicht. Du kannst es auch nicht wissen, denn niemand ist hier gewesen, der dir einen Namen hätte geben können. Deshalb bist du noch der Namenlose. Ich sage bewusst noch, denn das möchte ich ändern. Ich bin auch gekommen, um dir einen Namen zu geben, denn das ist wichtig. Du sollst einen Namen bekommen, der letztendlich Furcht und Schrecken verbreitet, denn keiner, der eine so große Aufgabe bekommt, kann ohne Namen sein. Die Feinde müssen wissen, wer sie vernichtet.«
Der Weißhäutige wusste nicht, was er darauf erwidern und wie er sich bedanken sollte. Ihm fehlten einfach die Worte. »Das ist – das ist wie, ich meine ...«
»Willst du, oder willst du nicht?«
»Ja, ich will!« Er hätte gern geschrien, aber er konnte nur krächzen. »Ich will ...«
Der Teufel war zufrieden. »Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ein Name ist wichtig. Man braucht ihn in der Welt der Menschen, aber davon später mehr.«
»Wie soll ich denn heißen?«
Der Teufel gab ihm die Chance, sich selbst einen Namen auszusuchen.
»Darüber habe ich noch nicht nachgedacht«, antwortete der Dämon.
»Das dachte ich mir. Deshalb habe ich mir einen ausgesucht. Du wirst dich Smasch nennen, hörst du? Einfach nur Smasch.«
Der Dämon überlegte. Der Name rollte als Gedanke durch sein Hirn. Er wiederholte ihn immer und immer wieder. Smasch!
Gefiel er ihm? Gefiel er ihm nicht? Das war eigentlich egal. Hauptsache, er hatte einen Namen, nur das zählte. Nun gehörte er nicht mehr zu den Namenlosen, die diese Welt bevölkerten. Er war durch die Benennung hervorgehoben worden, und in seinem Innern spürte er eine tiefe Zufriedenheit.
»Smasch«, wiederholte er. Dann erneut wieder. »Smasch ...« Er nickte. »Ja, der Name ist gut.«
»Ich wusste es!«, erwiderte der Teufel, als hätte er nichts anderes erwartet.
Die längere Schweigepause gefiel dem Dämon nicht. Er wusste, dass sich der Teufel mit der Namensgebung nicht von ihm verabschieden wollte. Das war erst der Anfang, und so fragte er, obwohl es sehr neugierig war: »Was soll ich tun?«
In der Wolke bewegte sich der Schatten. Es sah aus, als nickte er zweimal. Dann hörte Smasch wieder die Stimme. »Wie ich es schon andeutete, ich möchte nicht, dass du in dieser Welt bleibst. Du sollst sie verlassen. Du solltest in einer anderen Welt zurechtkommen und dort für mich etwas tun.«
»Alles!«, stieß Smasch hervor. »Ich werde alles für dich tun. Das weißt du genau.«
»Sicher, ich weiß es. Da du keine Freunde und Gleichgesinnte hast und ein Einzelgänger bist, kannst du das tun, was ich von dir verlange. Du sollst töten!«
Smasch nickte. Er nahm es hin. Für ihn war es selbstverständlich, wie er erst vor kurzem bewiesen hatte. Das Töten gehörte ebenso dazu wie das Leben. In dieser Welt war es ein Kreislauf, hier überlebte eben nur der Stärkere.
»Kannst du dir vorstellen, dass ich Feinde habe?«
»Ja!«
»Das stimmt«, gab der Teufel zu. »Ich habe große Feinde. Unter den Menschen natürlich, aber auch unter anderen Wesen, unter den Dämonen, verstehst du? Ich habe Feinde unter unseresgleichen, die nicht wollen, dass meine Macht wächst. Sie hassen mich. Sie wollen mich klein halten. Ich soll mich nicht weiter ausbreiten können, und es gibt nicht nur einen Feind, es gibt viele. Aber ich werde es mir nicht gefallen lassen. Ich werde auch meine Feinde ausräuchern, und dazu brauche ich dich. Du wirst mir dabei helfen.«
»Das tue ich gern.«
»Sehr gut.« Der Teufel lachte schallend. »Aber du kennst meine Feinde nicht. Du weißt nicht, wie mächtig und gefährlich sie sind, und es sind nicht nur die Menschen.«





























