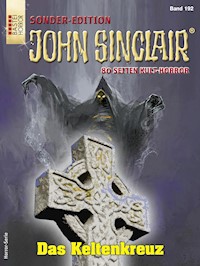
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Sinclair Sonder-Edition
- Sprache: Deutsch
"Lasst das Kreuz stehen! Lasst es bitte stehen!"
Die sieben Männer lachten über diese Warnung des Abtes. Sie wollten das Keltenkreuz von der Insel Iona holen, die man auch ‚der grüne Hügel der Engel‘ nannte, und es ihrem Auftraggeber bringen.
Der Sonnengott Lug aber war stärker, und die Männer verschwanden bis auf einen spurlos. Das Kreuz blieb auf der Insel. Nun wurde ich, John Sinclair, damit beauftragt, das Rätsel um die sechs verschwundenen Männer zu lösen. Was ich dann auf Iona erlebte, ließ mich an meinem Verstand zweifeln ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
DAS KELTENKREUZ
Vorschau
Impressum
John Sinclair ist der Sohn des Lichts.Der Kampf gegen die Mächte derFinsternis ist seine Bestimmung.
DAS KELTENKREUZ
von Jason Dark
»Lasst das Kreuz stehen! Lasst es bitte stehen!«
Die sieben Männer lachten über diese Warnung des Abtes. Sie wollten das Keltenkreuz von der Insel Iona holen, die man auch ›Der grüne Hügel der Engel‹ nannte, und es ihrem Auftraggeber bringen. Der Sonnengott Lug aber war stärker, und die Männer verschwanden bis auf einen spurlos. Das Kreuz blieb auf der Insel. Nun wurde ich, John Sinclair, damit beauftragt, das Rätsel um die sechs verschwundenen Männer zu lösen. Was ich dann auf Iona erlebte, ließ mich an meinem Verstand zweifeln ...
Die Luft, die aus der Tiefe hochströmte, war kaum zu atmen. Sie stank nach Fäulnis, nach feuchtem Gemäuer, nach einem Burgkeller, der in den vergangenen hundert Jahren nicht ein einziges Mal gelüftet worden war.
Duncan Cameron öffnete die Tür noch weiter, damit ich die Stufen besser sehen konnte, die in das Dunkel hinabführten. Sie waren breit, aber auch hoch, und es war bestimmt nicht einfach, die Treppe schnell hinabzusteigen.
»Was sagen Sie, Mr. Sinclair?«
»Das ist also der Keller von Cameron Castle.«
Der Clan-Chef lachte rau. »Nein, nicht der Keller. Tatsächlich ist es mehr ein Verlies, in dem meine Vorfahren diejenigen Typen unterbrachten, die ihrer Arbeit nicht so nachgingen, wie es sein sollte.«
»Ah ja, der Frühkapitalismus.«
Camerons Stirn zeigte Falten des Unwillens. »Wie können Sie so etwas nur sagen?«
»Das hat die Geschichte gezeigt, Mr. Cameron. Die Clan-Chefs waren die Herrscher im Land. Sie hielten sich Leibeigene und behandelten sie schlechter als Ratten. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, weshalb so viele Schotten und Iren in die Staaten ausgewandert sind? Weil sie hier ihres Lebens nicht mehr sicher waren und härteste Fronarbeit verrichten mussten. Das ist eine Tatsache.«
»Die Sie mir aber nicht unterstellen wollen, oder?!«
»Nein, nicht Ihnen persönlich. Oder haben Sie damals schon gelebt, Mr. Cameron?«
»Gott bewahre.« Er wechselte das Thema, als er in das Dunkel wies. »Da unten gibt es zwar Licht, aber nicht an allen Stellen.«
»Über der Treppe denn?«
»Ja.«
»Dann ist ja alles klar.«
»Eines noch«, sagte Cameron, bevor er das Licht einschaltete. »Ich hoffe, Sie werden später anders über mich denken, wenn Sie gesehen haben, was ich Ihnen zeigen will.«
»Sicher. Mein Chef sprach davon, dass Sie einen besonderen Gefangenen hier unten beherbergen.«
»Das kann man wohl sagen.« Er nickte heftig. »Sie werden sich wundern, wenn Sie ihn sehen.«
»Darf ich Sie dann bitten vorzugehen? Schließlich sind Sie hier der Hausherr.«
Er brummte etwas, schaltete das Licht ein, dessen gelber Schein von verschiedenen Lampen abgegeben wurde und seinen größten Teil über die gewölbeartige Decke hinwegschickte, mit der dieser jenseits der Treppe liegende unterirdische Raum bestückt war. Er war wirklich sehr hoch, und ich konnte mich nur darüber wundern.
Duncan Cameron ging mit schweren Schritten vor. Er war stockkonservativ und nicht gut auf die Engländer zu sprechen, wie fast alle Schotten. Mich sah er übrigens als einen Landsmann an – und er besaß eine große Macht. Noch immer, denn das Geschlecht der Camerons hatte einiges in Schottland zu sagen. Noch immer gehörten dem Clan Ländereien und Whisky-Brennereien. Die Familie war sehr verzweigt, und der alte Cameron hatte dafür gesorgt, dass seine Verwandten an den Schaltstellen der Politik und der Wirtschaft saßen. Sein Einfluss reichte bis hinunter nach London, zu einem gewissen Sir James, der mich auf die Reise nach Schottland geschickt hatte. Hoch in den Norden, nicht weit von der Küste entfernt, wo die Sommer nie so richtig heiß wurden, was mich überhaupt nicht störte.
Vom Alter her war Duncan Cameron schlecht zu schätzen. Er konnte sechzig, aber auch schon siebzig Jahre alt sein. Wahrscheinlich lag sein wahres Alter irgendwo dazwischen.
Er war ein kerniger Typ. Das schüttere, rötlichblonde Haar trug er gescheitelt. Auf der breiten Seite hatte er es nach hinten gekämmt. Wenn einer, wie er sich in die südliche Sonne legte, wurde er regelrecht gebraten, denn seine Haut war ziemlich hell und von zahlreichen Sommersprossen bedeckt.
Er trug den Kilt und die dazu passenden Kniestrümpfe sowie geschnürte Schuhe. Alles perfekt, nur über die helle Haut der Beine musste ich ein wenig grinsen. Ein Jackett hatte er ebenfalls übergestreift. Zum grasgrünen Stoff trug er ein grün und weiß gestreiftes Hemd und eine exakt gebundene Streifenkrawatte.
Wer sein Gesicht beschreiben wollte, der kam um den Vergleich mit einem Felsen nicht herum, der zwar bearbeitet, aber nicht geschliffen worden war. Der Mund war breit, das Kinn eckig. Unter der dünnen Haut zeichneten sich die Wangenknochen ab, und die Nase wirkte ebenfalls wie ein Kanten. Dafür sahen seine Augen aus wie Kieselsteine, die bläulich schimmerten.
Duncan Cameron lief die Stufen der Treppe hinab, ohne sich am Geländer festzuhalten. Er wollte mir wohl beweisen, welche Kraft noch in ihm steckte. Am Treppenende blieb er stehen, drehte sich um und nickte zufrieden, als er sah, dass auch ich das Geländer nicht berührte.
Ich beschloss, ihn ein wenig auf die Probe zu stellen, und fragte: »Habe ich etwas falsch gemacht?«
»Nein, es ist alles richtig.«
»Dann bin ich ja zufrieden.«
»Das können Sie auch.«
»Ich gebe das Kompliment gern zurück«, erklärte ich und drehte mich mit ausgestreckten Armen auf der Stelle, um so auf die großen Whiskyfässer deuten zu können, die in diesem Teil des Kellers die entsprechende Dekoration bildeten. Es waren auch zwei Bänke vorhanden, zwischen denen ein Holztisch stand. »Hier kann es ein durstiger Mensch schon länger aushalten«, sagte ich. »Alle Achtung.«
»Das ist meine Schatzkammer.« Stolz schwang in der Stimme des Mannes mit. »Flüssiges Gold. Uralter Whisky. Für jeden Kenner mehr als ein Genuss.«
Ich fragte: »Haben Sie schon mal Bourbon probiert?«
Wäre er jünger gewesen, ich hätte seine Hände sicherlich an meiner Kehle gespürt, so aber strafte er mich nur mit einem Blick der Verachtung und sagte dann: »Kommen Sie mit.«
Wieder ging er vor, denn das hier unten war sein Reich, und ich spielte nur den Gast. Wir liefen an den zahlreichen aufgereihten Whiskyfässern vorbei und erreichten eine Stelle, wo sich das unterirdische Gewölbe verengte und im weitesten Sinne so etwas wie einen Gang bildete.
Nach links zweigten andere Gänge ab, die ebenfalls erleuchtet waren. Mir fiel auf, dass der Boden überall blitzsauber war. Man hätte von ihm essen können. Der alte Cameron sorgte eben für Ordnung und Sauberkeit.
Er wohnte sowieso in einem prächtigen Haus, direkt am Ufer eines Sees, dessen Wasser in zahlreichen Farben schimmerte. Vom dunklen Blau bis hin zum hellen Grün. Ich hatte das Gewässer gesehen, und meine Begeisterung war nicht gespielt gewesen.
»Bald, Sinclair«, sagte Duncan Cameron, und die Umgebung gab seiner Stimme einen hallenden Klang, »werden wir unser Ziel erreicht haben. Dann werden Sie erkennen, dass sich die weite Reise für Sie durchaus gelohnt hat, mögen Sie jetzt noch denken, was Sie wollen.«
»Woher wissen Sie, was ich denke?«
»Wer einmal so alt geworden ist wie ich, der hat seine Erfahrungen mit Menschen sammeln können. Und ich, das kann ich Ihnen versprechen, habe immer gut aufgepasst.«
»Da kann man ja nur gratulieren.«
»Können Sie auch. Aber ich habe nicht mehr viel Zeit. Zwar bin ich gesund, doch in meinem Alter kann viel passieren, und deshalb möchte ich noch eines geregelt wissen.«
»Was denn?«
Er blieb stehen und drehte sich um. »Das werde ich Ihnen gleich zeigen.« Er tippte mir die Spitze seines Zeigefingers gegen die Brust. Auf dem Finger selbst verteilten sich kleine Härchen. »Und ich wette, dass auch Sie geschockt sein werden.«
»Das hört sich an, als hätten Sie ein Monster gefangen«, sagte ich.
Duncan Cameron verengte die Augen, als er über meine Antwort nachdachte, um dann zu nicken. »Unter einem Monster stellt man sich ja wer weiß was vor, aber im Prinzip haben Sie recht. Sie sind doch Fachmann, Sinclair. Ist das Böse auch ein Monster?«
Ich hob die Schultern. »Man kann es so sehen. Es kommt darauf an, welche Einstellung man hat.«
»Genau das, mein Lieber, ist es.« Er ließ mich weiterhin im Unklaren, drehte sich um und ging tiefer in den Keller hinein.
Eine Lampe brannte etwas heller und sein Licht fiel auf eine mächtige Tür. Erst als wir stehenblieben, erkannte ich, dass unter der Decke ein Strahler angebracht worden war.
Cameron klopfte mit dem Knöchel des rechten Mittelfingers gegen die Tür. Sie war so dick, dass nur ein dumpfes Geräusch entstand. »Wir sind am Ziel. Dahinter ist es, Sinclair.«
»Ist was?«
»Mein Monster!«, zischte er durch die Zähne und suchte nach einem Schlüssel. Er fand ihn in der linken Jackentasche.
Ich hatte mir inzwischen das Schloss angeschaut. Es war in das Holz der massiven Tür integriert und gehörte nicht eben zu den modernen Schlössern. Es konnte mittels eines normalen Schlüssels geöffnet werden, aber wer da ausbrechen wollte, der musste stark sein wie Herkules.
Duncan Cameron schloss noch nicht auf. Er hatte sich gebückt und vom Holztisch zwei Taschenlampen genommen. Das Geschirr, das darauf stand, beachtete er nicht. Ich hatte festgestellt, dass es schon benutzt worden war. Wahrscheinlich musste das Monster jenseits der Tür auch essen. Da es von normalen Tellern und mit einem normalen Besteck aß, konnte es nicht so schlimm sein.
»Hier, nehmen Sie.« Cameron reicht mir eine Lampe. »Sie werden sie brauchen können.«
»Dahinter gibt es kein Licht?«
»Kein elektrisches. Nur Kerzen. Normalerweise. Aber die brauchen wir jetzt nicht.«
»Es lebe der Fortschritt«, sagte ich.
Meine Bemerkung gefiel ihm nicht, denn er verzog den kantigen Mund. Es sah aus, als würde eine Statue grinsen. Dieser Mann war knochenhart. Wer sich gegen ihn stellte, würde es verdammt schwer haben, das stand fest. Bei einem Vorgesetzten, wie Cameron, hätte ich es keine drei Tage ausgehalten. Ich konnte auf seinen Rücken schauen und wurde Zeuge, wie er die Tür öffnete.
Der Schlüssel bewegte sich zweimal. Die Tür war offen. Cameron richtete sich auf. »Atmen Sie noch mal durch, Sinclair, denn gleich werden Sie ihn sehen.«
»Ihn?«
»Ja.«
»Hat dieser ER auch einen Namen?«
»Er heißt Curly Brown.«
Ich hob die Schultern. »Sorry, aber dieser Name sagt mir nichts.«
»Das spielt keine Rolle. Es geht um ihn. Zunächst einmal«, fügte Cameron hinzu und machte mich neugierig. Aber ich hielt mich zurück. Dafür schaute ich zu, wie Cameron die Klinke nach unten drückte, die Tür aufzog und ich mich gezwungen sah, zur Seite zu treten, um ihm nicht im Weg zu stehen.
Ein dunkles Loch tat sich auf, ein Verlies, da hatte der Mann schon recht gehabt. Nur blieb es nicht lange dunkel, denn Cameron schaltete seine Lampe ein, und der breite Strahl wurde durch das Zimmer geschwenkt. Ich hielt mich noch zurück, auch deshalb, weil er mir den Weg in das Verlies versperrte, aber sein Licht reichte aus, um mir einen ausgezeichneten Blick durch diese Felsenkammer zu gestatten.
Sah so ein Verlies aus?
Es war mehr eine moderne Gefängniszelle. Es gab einen Tisch und einen Stuhl. Einige Zeitschriften lagen auf dem Boden, und der Tür gegenüber stand ein Bett, dessen Rahmen aus Metall gefertigt war.
Auf dem Bett lag ein Mann!
Er hatte dunkles Haar, das ziemlich lang war, trug eine helle Hose und ein braunes Hemd. Die Augen hielt er geschlossen. An den Seiten und über die Bettdecke hinweglaufend schimmerte etwas hell, was mich irritierte.
Cameron hatte mich beobachtet und fragte: »Haben Sie was?«
»Nicht direkt.«
»Sondern?«
»Das ist also Curly Brown«, sagte ich.
»Ja, und er ist oder war einer von meinen Leuten.«
»Wie ein Monster kommt er mir zwar nicht vor, aber mich irritiert schon, was da rechts und links seines Körpers schimmert und den Strahl der Lampen zurückwirft.« Zur Bestätigung leuchtete ich an die linke Seite des Mannes.
»Es sind Ketten.«
»Oh – warum?«
»Weil man Monster in Ketten halten muss, Sinclair. Wenigstens tun wir das hier, und es ist auch gut so.« Er hatte es mit einer Stimme gesagt, die keinen Widerspruch duldete. Ich hielt mich zurück. Nicht aus Respekt vor Cameron, sondern mehr aus Neugierde.
Anscheinend vermisste er eine Antwort, denn er schaute mich von der Seite her an. »Nun ...?«
»Ich sehe kein Monster, Mr. Cameron.«
»Doch, da liegt es.« Der Schotte hob seinen Arm und deutete auf das Bett. »Das ist unser Monster.«
»Es ist ein Mensch«, korrigierte ich ihn.
Duncan Cameron blieb stur. »Seinetwegen sind Sie hierhergekommen, Mr. Sinclair. Er sieht nur äußerlich wie ein Mensch aus. Ober glauben Sie etwa, dass wir ihn grundlos angekettet haben? Die Zeiten der Clan-Macht, von der Sie gesprochen haben, sind vorbei.«
»Okay, dann schaue ich ihn mir aus der Nähe an.«
»Seinetwegen sind Sie überhaupt hergekommen, Mr. Sinclair.«
Es war für mich noch immer nicht direkt verständlich, aber was sollte ich tun? Die lange Reise lag hinter mir, und ich konnte Cameron schlecht sagen, dass ich alles irgendwo lächerlich fand.
Einen Metalleimer für die Notdurft passierte ich ebenfalls. Der Eimer war glücklicherweise leer. Aus ihm strömte mir der stechende Geruch von Desinfektionsmitteln entgegen. Cameron hielt sich im Hintergrund, während ich mich neben das Bett stellte.
Ich schaute auf den Mann nieder, der nach wie vor die Augen geschlossen hielt.
Entweder schlief er tatsächlich, oder er wollte mit uns nichts zu tun haben und zeigte das durch die geschlossenen Augen an. Die dunklen Haare waren mir schon bei meinem Eintritt aufgefallen. Jetzt huschte mein Blick über die bleiche Gesichtshaut hinweg. Die Wangen waren eingefallen. Die Lippen standen etwas vor, sie waren ziemlich dick. Dunkle Bartschatten verteilten sich auf dem Gesicht.
»Schläft er?«, fragte ich.
Cameron lachte zunächst. »Das kann ich nicht glauben. Der weiß genau, was er will. Er wartet ab.«
»Auf was?«
»Darauf, dass wir die Nerven verlieren und verschwinden.«
Ich hob die Schultern. »Das werde ich tatsächlich, wenn es so weitergeht, Mr. Cameron.«
Der Schotte hatte sich am Fußende des Betts aufgebaut und beide Hände auf den Metallrahmen gestemmt, den er mit seinen Fäusten umschloss. »Sie werden ihn zwingen müssen, die Augen zu öffnen. Er soll nicht weiter hier den Schlafenden spielen. Sagen Sie ihm das. Sagen Sie ihm, dass Sie seinetwegen gekommen sind.«
»Und das wird helfen?«, fragte ich skeptisch.
»Kann ich nur hoffen.«
Überzeugt war ich davon nicht, aber ich wollte auch nichts unversucht lassen. Der Schotte hatte recht. Die lange Reise sollte wirklich nicht grundlos hinter mir liegen.
»Er heißt Curly Brown«, erinnerte mich der Alte noch.
»Danke.«
Die Lippen des Mannes zuckten, denn er hatte seinen Namen gehört. Er öffnete jetzt auch den Mund. In mir breitete sich die Vorstellung aus, dass ich zwei Vampirzähne sehen würde, aber es war nicht der Mund, der seltsam war.
Es waren die Augen!
Er hatte sie zur selben Zeit geöffnet, und in diesem Augenblick wusste ich, was Cameron meinte.
In Curly Browns Augen malten sich scharf und sehr gut erkennbar zwei kleine, schwarze Kreuze ab. Ja, es waren Kreuze, aber es gab einen Unterschied.
Sie standen auf dem Kopf!
Ich reagierte nicht und trat auch nicht vom Bett zurück. Aber ich beobachtete die Augen des Mannes genau. Die beiden Kreuze verschwanden nicht. Sie sahen aus, als wären sie in die Pupillen eingezeichnet worden. Da malten sie sich ab. Scharf umrandet und ...
Etwas veränderte sich, und meine Gedanken zogen sich automatisch zurück. Die Kreuze, zuerst schwarz, lösten sich nicht auf, auch wenn es zuerst so ausgesehen hatte, nein, sie veränderten nur ihre Farbe und glänzten in einem kalten Weiß. Dann waren sie wieder als schwarze Gegenstände zu sehen, aber ihre Haltung hatte sich nicht verändert, denn sie blieben auf dem Kopf stehen.
Genau das war das Problem!
Kreuze, die auf dem Kopf standen, waren ein Synonym für den Sieg des Bösen über das Gute. Bei schwarzen Messen wurden umgedrehte Kreuze benutzt. Immer wenn sie erschienen, war man dabei, Kontakt zum Satan zu knüpfen. So auch hier. Die beiden Zeichen in den Augen mussten einfach in einem Zusammenhang mit der Hölle stehen.
Er schaute mich an, und die Kreuze in seinen Augen behinderten ihn dabei nicht. Zumindest hatte ich den Eindruck. Einfach nur nach vorn starren, in das Gesicht hinein, ohne Ausdruck, ohne eine Spur von Gefühl, einfach kalt.
Ja, kalt, denn ich fröstelte ebenfalls unter diesem Blick. Es waren nicht nur die abgebildeten Kreuze, die mich störten, auch ihre Umgebung empfand ich als schlimm. Ich spürte den kalten Schauer, der über meinen Rücken lief.
Duncan Cameron war am Ende des Bettes stehengeblieben. Ihm war die Veränderung natürlich nicht entgangen. Er atmete schwer und drehte seine Hände immer wieder um die Bettstange. »Wissen Sie jetzt, weshalb ich Ihren Chef um Hilfe gebeten habe?«
»Ich kann es mir denken!«
»Mehr sagen Sie nicht? Schauen Sie in die Augen. Da malen sich die auf dem Kopf stehenden Kreuze ab. Wissen Sie eigentlich, was das bedeutet?«
»Sicher, sonst wäre ich wohl nicht hier. Dieser Mann steht unter dem Einfluss des Bösen.«
»Ja, verdammt, unter dem der Hölle, des Teufels, des Satans, wie immer Sie wollen. Und er ist nicht so harmlos, wie er aussieht. In seinen Augen malen sich die Kreuze überdeutlich ab, aber das geht auch tiefer, wenn Sie verstehen. Die Augen sind nur das äußere Zeichen dafür, dass er geradewegs darauf dressiert ist, der Hölle oder dem Bösen zu gehorchen.«
»Deshalb ketteten Sie ihn an?«
»Wir mussten es tun. Er hat getobt. Er hat geschrien. Er wollte alles zertrümmern, und er wollte morden!«, erklärte Cameron mit lauter Stimme. »Ja, killen!«
»Sie?«
»Wahrscheinlich auch. Zuvor hat er es bei anderen versucht.«
»Hatte er Erfolg damit?«
»Einer meiner Waldarbeiter wurde umgebracht. Durch seine eigene Motorsäge. Ich glaube nicht, dass ich noch deutlicher werden muss, Mr. Sinclair.«
»Nein, das brauchen Sie nicht. Aber Sie hätten Brown der Polizei übergeben können.«
Cameron winkte ab. »Unsinn! Hier ist er besser aufgehoben. Außerdem hätten mir die Dorfpolizisten nicht geglaubt oder hätten sich in die Hose gemacht. Der Tod meines Arbeiters wurde als Unglücksfall deklariert. Den Einfluss habe ich zum Glück noch, wenn man Cameron heißt und Clan-Chef ist.
»Haben Sie einen Verdacht?« Bisher waren Camerons Antworten auf meine Fragen stets prompt erfolgt. Das änderte sich nun, denn er schwieg ziemlich lange. Er senkte sogar den Blick, und seine Hände drehten sich um das Metallrohr, wobei sie ein Quietschen hinterließen.
»Nun?«
»Ja, den habe ich.«
»Welchen?«
Duncan Cameron schüttelte seinen mächtigen Schädel. »Nein, nicht jetzt, später, wenn wir allein sind.«
»Wie Sie wollen.«
»Kümmern Sie sich jetzt um ihn. Sie kennen sich doch aus in diesen Fällen. Das hat sich schon bis zu uns hier oben herumgesprochen. Sehen Sie zu, dass Sie ihn zum Reden bringen, aber geben Sie acht, denn er kann urplötzlich explodieren, da ihm die Ketten schon einen Spielraum lassen. Es würde mich nicht freuen, wenn er plötzlich seine Stirn in Ihr Gesicht rammt.«
»Das passt mir auch nicht.«
»Gut.«
Curly Brown hatte kein einziges Wort gesprochen. Er lag unbeweglich auf seinem Bett, wobei ich davon ausging, dass er uns sehr gut verstanden hatte. Ich versuchte es zunächst auf die normale Art und Weise. »Können Sie mich hören, Mr. Brown?«
Er sagte nichts.
»Wollen Sie mir keine Antwort geben?«
Bei ihm trat eine Veränderung ein. Die Augendeckel senkten sich etwas. Das Gesicht bekam einen etwas lauernden Ausdruck. »Wer bist du?«, hauchte er mir entgegen. »Was willst du hier?«
»Mit Ihnen reden.«
»Hau ab! Hau schnell ab! Ich kenne dich nicht. Ich will nicht mit dir sprechen.«
Cameron nickte heftig. »Wie gehabt«, sagte er und fluchte. »Alles wie gehabt. Auch bei mir hat er sich angestellt. Aber geben Sie acht. Wenn er durchdreht, erleben wir hier so etwas wie eine Hölle. Er ist nicht so harmlos, wie er aussieht.«
Das konnte ich mir vorstellen. Nur wurde ein Mensch nicht grundlos so gezeichnet. Die Kreuze in den Augen waren ein Zeichen, ein Makel und zugleich ein Hinweis darauf, zu wem er tatsächlich gehörte, und ich machte mich schon auf etwas gefasst.
»Ich werde nicht gehen, Curly. Im Gegenteil, wir beide werden uns unterhalten.«
»Nein!«
Ich tat so, als hätte ich seine Antwort nicht gehört. »Mich interessieren nun mal die Kreuze in Ihren Augen. Weshalb haben Sie das Zeichen des Bösen bekommen?«
Jetzt zeigte er ein scharfes Grinsen, als sollten die Mundwinkel die Ohren berühren. »Es ist kein Zeichen des Bösen. Es ist ein Zeichen der Macht. Der Dunklen Macht. Verstehst du?« Seine Stimme hatte zunächst grollend geklungen. Bei den letzten Worten aber war sie höher und schriller geworden und hinterließ in meinen Ohren ein unangenehmes Echo.
»Ja, ich habe Sie gehört. Nur würde ich gern wissen, wer oder was sich hinter dieser Dunklen Macht verbirgt.«
»Alles«, flüsterte er. »Alles, was uns Menschen glücklich macht. Und ich sage euch, dass sie nicht schläft. Ich habe sie erlebt, andere ebenfalls. Da könnt ihr mich noch so anketten und gefangen halten. Irgendwann ist alles anders. Dann schlage ich zurück. Und ich weiß auch, dass ihr Angst vor mir habt. Ich bin nicht so wie ihr. Ich bin anders, und ich bin stärker, denn mich beschützt die Dunkle Macht.«
»Man sieht es in deinen Augen.«
Sein Mund verzerrte sich noch stärker, als er sagte: »Richtig. In den Augen, nur in den Augen! Ich weiß genau Bescheid, und ich spüre meine Stärke.« Zum ersten Mal bewegte er seine Hände, und wir konnten das leise Klingeln der Kettenglieder hören.
»Wo?«, fragte ich. »Wo hast du Kontakt mit dem Bösen gehabt? Was ist passiert?«
Er lachte mich scharf an. »Man kann es überall finden, wenn man die Augen offenhält. Ich habe es gefunden. Ich und andere auch. Wir werden es in die Welt hineintragen. Wir beginnen mit der Missionierung, und niemand kann uns dabei stoppen. Ich weiß nicht, wer du bist und wo du herkommst, aber ich rate dir, zu verschwinden, bevor du hier dein Grab finden wirst. Das kannst du mir glauben.«
»Das haben schon viele gesagt, Mr. Brown. Ich habe vor, noch eine Weile zu leben, und ich muss Ihnen sagen, dass mir das Böse nicht fremd ist.«
»Ach!« Plötzlich riss er die Augen wieder auf und präsentierte mir seine Kreuze. Sie waren wieder schwarz geworden. Dunkel wie kleine Brikettstücke. »Es ist dir nicht fremd?«, fragte er mit einer Stimme, als könnte er es nicht glauben. »Es ist dir wirklich nicht fremd?«
»Nein!«
»Dann gehörst du zu uns. Bist du gekommen, um mich aus diesem Keller zu holen?«
»Tut mir leid, wenn ich Sie enttäuschen muss, Curly, ich gehöre nicht zu Ihnen und zu Ihren Freunden. Mir ist das Böse deshalb bekannt, weil es mein Job ist, es zu bekämpfen. Ich jage es. Ich vernichte es, wo ich es antreffen kann.«





























