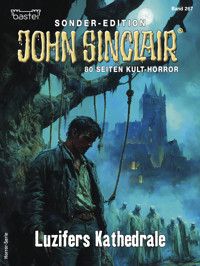
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Einsam und vom Sturm gepeitscht steht sie auf den Klippen der Insel Hoy: eine alte Kirche, verlassen, verfallen - und verdammt. Menschen sprechen nur flüsternd über sie. Man sagt, der Teufel selbst habe sie entweiht. Seitdem wagt sich niemand mehr in ihre Nähe. Doch dann will der Reporter Ian Warren wissen, was wirklich hinter der düsteren Legende steckt, und macht sich auf den Weg. Kurz darauf ist er tot - auf grauenvolle Weise gefoltert und entstellt. Jetzt liegt es an mir, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Begleitet von meinem Freund Bill Conolly, statten wir der Insel einen Besuch ab und erleben in Luzifers Kathedrale eine der schlimmsten Nächte unseres Lebens ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Luzifers Kathedrale
Vorschau
Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen?
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsbeginn
Impressum
John Sinclair ist der Sohn des Lichts.Der Kampf gegen die Mächte derFinsternis ist seine Bestimmung.
Luzifers Kathedrale
von Jason Dark
Einsam und vom Sturm gepeitscht steht sie auf den Klippen der Insel Hoy: eine alte Kirche, verlassen, verfallen – und verdammt. Menschen sprechen nur flüsternd über sie. Man sagt, der Teufel selbst habe sie entweiht. Seitdem wagt sich niemand mehr in ihre Nähe.
Doch dann will der Reporter Ian Warren wissen, was wirklich hinter der düsteren Legende steckt, und macht sich auf den Weg. Kurz darauf ist er tot – auf grauenvolle Weise gefoltert und entstellt.
Jetzt liegt es an mir, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Begleitet von meinem Freund Bill Conolly, statten wir der Insel einen Besuch ab und erleben in Luzifers Kathedrale eine der schlimmsten Nächte unseres Lebens ...
Es war die Nacht, in der der Teufel den Wind unter seine Kontrolle brachte, das Meer zu turmhohen Wellen aufpeitschte und die Wolken in seine Spielbälle verwandelte, die er über den finster gewordenen Himmel trieb.
Meteorologen sprachen gerne von den Herbststürmen in der Nordsee. Abergläubische Menschen sahen das jedoch anders – und davon gab es auf der Insel Hoy, die zu den Orkneys zählte, genug.
Bei einem derartigen Wetter verkrochen sich die meisten Bewohner in ihre Häuser, um das Ende des Sturmes in Sicherheit abzuwarten.
Nicht so Julian McBell, der Schäfer. Er war bewusst im Freien geblieben, um sich um seine Tiere zu kümmern, die ihm schließlich das Geld brachten, um überleben zu können. Es war hart genug, es gab genügend Konkurrenz, und seine Schafe waren auch sein Kapital. Er hatte seine Hunde bei den anderen Schafen gelassen, die verlorenen Exemplare wollte er selbst einfangen.
Der Mann mit dem wilden Vollbart wusste ungefähr, wohin die Tiere gelaufen waren. Er hatte noch Glück im Unglück gehabt. Die beiden verstörten Schafe hätten auch zur Klippe hin laufen können. In ihrer Panik wären sie darüber hinweggerannt und in das kochende Meer gestürzt.
Der Sturm heulte. Der Sturm pfiff. Er produzierte Töne, die nicht mal ein Musikinstrument schaffte. Mal schrie er regelrecht auf, dann wieder war ein Donnern zu hören, dazwischen auch ein Winseln, aber das alles wurde von dem ohrenbetäubenden Rauschen überdeckt. McBell hatte das Gefühl, als wären die Wellen an den Steilwänden in die Höhe geschleudert worden, um über die Klippen zu schäumen.
Zu allem Unglück fing es auch noch an zu regnen. Das Wasser fiel aus den Wolken, als hätten sich dort wahre Duschen geöffnet. Der Regen wurde ebenfalls vom Sturm erfasst, der ihn fast waagerecht peitschte und gegen den einsamen Wanderer schleuderte.
McBell fluchte. Er war wütend. Er hasste das Wetter, und er kämpfte verzweifelt gegen den Sturm und Regen an, ohne eine richtige Chance zu bekommen.
Die Stürme auf den Orkney-Inseln waren berühmt für ihre Kraft. Das bekam der Schäfer jetzt zu spüren.
Der Regen hörte nicht auf. Es goss wirklich wie aus Eimern. McBell war nicht mehr in der Lage, etwas zu sehen. Die Flut peitschte gegen sein Gesicht. Sein Umhang flatterte so stark, als sollte er ihm im nächsten Augenblick vom Körper gerissen werden.
Es hatte keinen Sinn mehr, nach den Schafen zu suchen. Er musste sie aufgeben. Das Wetter machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Er konnte nur darauf hoffen, dass es seine Tiere geschafft hatte, Schutz zu finden. Er brach die Suche ab. Es brachte nichts mehr. Es war auch dunkler geworden. Der starke Wind hatte die mächtigen Wolkenberge herangetrieben und den Himmel düster gemacht.
McBell blieb stehen und brüllte seinen Frust heraus. Er kam nicht gegen die Geräusche der Natur an, und er kam sich plötzlich noch kleiner vor. Nahezu winzig im Vergleich zu den Mächten der Natur.
Die Böen erwischten ihn mit unterschiedlicher Stärke und auch immer wieder aus verschiedenen Richtungen. Eine war so stark, dass sie ihn von den Beinen riss.
Der Schäfer landete auf dem nassen Boden und verlor für einen Moment die Orientierung. Er sah vor sich das Wasser gurgeln, das in kleinen Bächen über die Hügel floss und gegen ihn schäumte.
Der Schäfer raffte sich wieder auf. Er schrie seinen Fluch in das Tosen hinein und kämpfte sich weiter vor. Er wusste nicht, wie lange der verdammte Orkan noch andauerte. Manchmal eine Nacht lang und noch weit in den Tag hinein. Die Orkneys hatten eben ihre eigenen Gesetze. So lange konnte und wollte er auf keinen Fall im Freien bleiben. Er musste irgendwo Unterschlupf finden.
Der Stall und sein Wohnhaus waren zu weit entfernt. Die Suche hatte ihn tief in das leere Gelände hineingetrieben, und so überlegte er, wie es weitergehen sollte.
Zum wiederholten Male wischte er das Wasser aus seinem Gesicht, und zum wiederholten Male wurde er erneut von den Regengüssen überschüttet, sodass es keinen Sinn hatte, sich von den Massen befreien zu wollen. Zwei Sekunden später war er schon wieder nass.
Aber der Kampf ging weiter. Er führte ihn fort. Er dachte daran, dass es auf halbem Weg zu seinem Haus noch einen Unterschlupf gab.
Es war die alte Kirche, die Kathedrale, wie sie die Bewohner der Insel nannten. Sie hatte bisher allen Stürmen und Unbilden der Natur getrotzt, und das würde auch bei diesem Orkan so sein. Hin und wieder hatte der Sturm mal von den Seiten und von der Spitze der Kirche Brocken abgerissen und in die Umgebung geschleudert, und das würde auch in der folgenden Zeit noch so bleiben.
Sie befand sich von seinem Standpunkt nicht mal weit entfernt. Bei normalem Wetter wäre sie längst sichtbar gewesen, aber nicht in dieser stürmischen Hölle, in der alles anders war.
Nass bis auf die Haut machte sich Julian McBell wieder auf den Weg. Er schlug jetzt eine andere Richtung ein und bewegte sich mit schwerfälligen und rutschigen Schritten eine Hügelseite hoch. Er musste diesen Buckel einfach überqueren, denn es war der schnellste Weg für ihn, um ans Ziel zu gelangen.
Wieder duckte sich McBell so tief wie möglich. Der Wind packte ihn jetzt von der rechten Seite und hämmerte auch in seinem Rücken. Die Hölle hatte die Erde erreicht. Um den einsamen Schäfer herum tobten und schrien unzählige Teufel, die der Orkan aus der Hölle geblasen hatte.
Weiter. Nur nicht aufgeben. Immer voran. Sich ducken. So wenig Widerstand wie möglich bieten. Manchmal bekam er nicht mal richtig Luft, wenn ihm der Wind das Wasser massenweise ins Gesicht schleuderte. Dann hatte er für einen Moment das Gefühl, ersticken zu müssen, aber an Aufgabe dachte er nicht.
Wasser rann ihm entgegen. Die Erde fasste die nachfolgenden Massen nicht mehr. Es hatten sich zahlreiche neue Bäche gebildet, denen er nicht ausweichen konnte. Und so rutschte er des Öfteren auf dem nassen glitschigen Boden wieder zurück.
Trotzdem packte er es.
Keuchend, fluchend und auf allen Vieren legte er die Strecke zurück und erreichte sein Ziel.
Er sah die Kathedrale.
Aber er sah sie nicht normal, sondern mehr als Schatten hinter der aus den Wolken hervorströmenden Regenwand. Für die Bewohner war sie ein Relikt aus ferner Zeit, als hier noch andere Menschen gelebt hatten. Es gab Leute, die sie liebten, aber auch welche, die sie strikt ablehnten, weil sie zu düster war und in ihr etwas Schreckliches hausen sollte.
Das war Julian McBell in diesem Augenblick egal. Er wollte nur Schutz vor dem verdammten Unwetter haben, und da war die Kirche der einzige Platz.
So kämpfte er sich Meter für Meter voran, immer wieder von Regengüssen überschüttet, die ihm oft genug die Luft zum Atmen nahmen. Tief geduckt, mehr rutschend als gehend, näherte er sich diesem gewaltigen Schatten, der hinter den Vorhängen aus Regenwasser in die Höhe ragte und zu einem zittrigen Schatten geworden war.
Er hatte den Eindruck, mit dem Wasser auf die Kathedrale zugeschwemmt zu werden. Über ihm spielten sich verrückte Szenen ab. Der gesamte Himmel war in Bewegung, und wenn McBell den Kopf anhob, dann sah er nicht die zahlreichen Türme und ungewöhnlichen Gestalten, die sich an der Außenwand versammelt hatten.
Das war keine normale Kirche. Wer sie hier auf der Insel errichtet hatte, der hatte sich zugleich auch etwas dabei gedacht.
Der Wind heulte um den mächtigen Bau. Er produzierte Töne, wie sie der Schäfer noch nie in seinem Leben gehört hatte. Der Wind jaulte um die Ecken, er verfing sich in den Lücken zwischen den Türmen, er fegte und schrie, er rüttelte gegen die Tür und schien den gesamten Bau umreißen zu wollen.
Julian McBell rutschte die letzten Meter durch knöchelhohes Wasser und prallte gegen die Tür an einer der Seiten. Es gab verschiedene Eingänge in die Kathedrale. McBell war nicht erst um den Bau herumgegangen, um durch den Haupteingang die Kirche zu betreten.
Er riss die Tür auf.
Wieder erhielt er einen Windstoß in den Rücken. Er empfand ihn wie einen Tritt, der ihn letztendlich über die Schwelle in das Innere katapultierte.
Er atmete auf. Kein Regen mehr, kein Sturm, der an ihm rüttelte. Es war alles so anders geworden und auch so schnell. Er hatte Mühe, sich daran zu gewöhnen und atmete zunächst tief durch.
Etwa eine Minute brauchte er, um sich zu erholen. Erst dann wrang er einen Teil seiner Kleidung aus. Aus dem Umhang rann das Wasser, wenn er den Stoff zusammendrückte, und er schaute auf die Pfütze vor seinen Füßen, in der er stand.
Er strich sein Haar zurück. Von seinem Vollbart war nicht mehr viel zu sehen. Die Nässe hatte ihn schrumpfen lassen. Klebrig, grau und nass hing er nach unten wie ein dick gewordener Faden.
Durchatmen, wieder zu sich selbst finden. Sich in eine Bank setzen und ausruhen, das wollte er.
Zuvor warf Julian McBell einen ersten Rundblick durch das Innere der Kirche. Sie war hoch, sehr hoch sogar. Hinter den schmalen und langen Fenstern bewegten sich die Schatten und mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, als würde dort ein unheimlicher Film ablaufen. Dabei waren es nur die Wolken, deren Fetzen an den Fenstern vorbeigetrieben wurden.
Aber das Schauspiel faszinierte ihn. Seine Fantasie ging auf Reisen. Er kam sich vor wie auf einer von mächtigen Mauern umgebenen Insel, die von den Gewalten der Natur gepackt worden war, um über den Himmel getrieben zu werden.
Immer wieder schlug der Regen gegen die Scheibe. Seine Tropfen waren die Trommelstöcke eines Drummers, der sich die Fenster als Ziel ausgesucht hatte.
Der Kampf der Natur ging weiter. Draußen heulte und brodelte es. Die Geräusche, die er kannte, erreichten ihn auch hier im Innern der Kirche, aber sie hörten sich jetzt anders an.
Sie waren leiser geworden. Unheimlicher. Sie hatten sich in Stimmen verwandelt. Das Jaulen und Schreien umwehte die Mauern. Schreckliche Tiere schienen aus ihren Gefängnissen befreit worden zu sein, um mit ihren Schreien Aufmerksamkeit zu erregen.
Die leere und weite Kirche, hinzu die unheimlichen Geräusche, das war nichts für schwache Nerven.
Julian McBell hatte sich mittlerweile in eine der Bänke gesetzt. Es gab mehrere Reihen, die hintereinander standen und vorn am Altar endeten, den der Schäfer auf Grund des schlechten Lichts so gut wie nicht erkennen konnte. Er sah wohl etwas, aber es verschwamm im Grau.
Licht gab es nicht.
Es brannte keine Kerze, keine Lampe. In der Kirche herrschte ein unheimliches Zwielicht, das einem Besucher alles andere als Vertrauen einflößte und ihn mehr an ein Gefängnis erinnerte.
McBell blieb auf seinem Platz hocken. Hin und wieder strich er über sein noch immer nasses Gesicht hinweg. Er fuhr auch über die Haare und wrang sie auch jetzt noch aus. Überall hatte sich das verdammte Wasser gesammelt. Er zog die Nase hoch, er musste auch niesen, und seine gesamte Kleidung war feucht und klebte widerlich an seiner Haut.
In der Kirche war es kalt. Der Schäfer wusste nicht, ob es eine gute Idee gewesen war, hier Schutz zu suchen. Im Regen hatte er nicht gefroren, weil er sich dort bewegt hatte. Nun, da wo er still saß, begann er zu frieren und merkte, dass es kalt seinen Rücken hinabrann. Das war nicht allein eine Gänsehaut, sondern auch kleine Wassertropfen fanden den Weg nach unten.
Er rieb seine Hände. Dachte an seine Frau, die sicherlich auf ihn wartete. Aber Lena McBell wusste auch, dass er sich nicht unbedingt den Gefahren aussetzte, wenn es eine Möglichkeit gab, ihnen zu entgehen.
Er wusste auch nicht, wie lange er in der Kirche bleiben musste. Auf das Ende des Sturms zu hoffen, hatte wohl keinen Sinn, aber Atem holen und sich erst dann wieder in den Horror hineinwerfen, das konnte nicht schaden.
Noch immer tobte um den Bau herum die Hölle. Der Sturm war wie ein wütendes Tier, das sich durch nichts aufhalten ließ und es immer wieder versuchte. Er vernahm Geräusche, die er noch nie in seinem Leben gehört hatte. Schrilles Schreien, lautes Jammern, ein hohl klingendes Pfeifen, ein wütendes Brüllen – das alles vermischte sich zu einer Kakophonie, die eine unheimliche Botschaft zu transportieren schien.
Der Schäfer war kein sehr ängstlicher Mensch. In diesem Fall allerdings wurde ihm schon komisch zu Mute.
Je mehr Zeit verging, desto stärker wurde seine Unruhe. Erklären konnte er es sich nicht. Eigentlich hätte er ruhiger werden müssen, doch das war nicht der Fall. Er ging von einem Gefühl der Bedrohung aus, und das hing nicht nur mit den Außengeräuschen zusammen, sondern stammte hier aus der Kirche.
Seine Haltung wurde verkrampfter. Die nasse Kleidung klebte an seinem Körper. Eine Gänsehaut nach der anderen entstand. Aber das hing nicht mehr mit den Gewalten draußen zusammen. Es gab hier in der Kirche etwas, das ihn störte.
Julian McBell stand auf.
Es war ein widerliches Gefühl, als sich die feuchte Kleidung von seiner Haut löste. Er fror wieder, zog die Nase hoch und schaute sich im Stehen um.
Der Schäfer wusste selbst nicht genau, warum er das tat. Es musste einfach so sein. Noch immer huschten die Wolkenfetzen und die Regenschleier außen an den Scheiben entlang, als wären es Gespenster, die ihre Wohnstatt verlassen hatten.
Alles war so unheimlich und anders geworden. Eine Schattenwelt hatte sich aufgetan. Er fühlte sich plötzlich von Feinden umzingelt und bedroht.
Quatsch!, redete er sich ein. Deine Nerven sind angespannt. Da läuft nichts.
Die eigenen Worte konnten ihm keinen Mut machen. Die Furcht in seinem Innern blieb bestehen. Es war ein Druck vorhanden, den er nicht zur Seite schieben konnte, und wenn er sich in der Kirche umschaute, sah er nichts, doch er glaubte, etwas zu sehen. Unter dem Dach hinweg huschten die Schatten, gaben dort ein verwirrendes Gastspiel ab und krochen auch mit schnellen Bewegungen an den Innenseiten der Fenster entlang.
Wirklich von innen?
Julian McBell schluckte. Er sah es jetzt als keine gute Idee an, in der Kirche Zuflucht gesucht zu haben. Plötzlich war ihm diese Stätte nicht mehr geheuer und ausgerechnet jetzt fiel ihm ein, was die Menschen über die Kathedrale sagten.
Sie fürchteten sich vor ihr. Es wurden keine Messen mehr abgehalten. Und das bereits seit langer Zeit nicht mehr. Die Kirche war verlassen. Niemand kam, um sie zu schmücken, oder etwas aufzustellen. Es gab keine Kerzen, keinen Blumenschmuck, sondern nur die auch von innen dunklen Wände, die von den grauen Fenstern unterbrochen wurden. Die Scheiben zeigten keine Bemalung, aber der Sturm hatte es nicht geschafft, sie einzudrücken. Sie widerstanden ebenso wie das Mauerwerk.
Der Schäfer wusste nicht genau, was sich die Menschen alles über die Kathedrale erzählten. Es waren keine guten Geschichten. Bei Einzelheiten hatte er oft weggehört.
Der Sturm tobte draußen noch immer. Aber er war leiser geworden, das stellte McBell deutlich fest.
Dennoch fühlte er sich unwohl. Etwas anderes bereitete ihm Sorgen. Ein Geräusch, das nicht von draußen kam. Es war ein unheimlich klingendes Flöten und Schreien. Der Schall transportierte es durch die Kirche, und so drang es auch an die Ohren des einsamen Mannes.
Er legte den Kopf in den Nacken und schaute zur Decke. Er wollte etwas sehen, denn irgendjemand musste diese verdammten Laute ja abgegeben haben.
Er entdeckte nichts.
Es blieb wie es war, wenn nicht dieses leise Pfeifen gewesen wäre. Da schien jemand die Geräusche des Windes nachahmen zu wollen.
McBell lauschte weiterhin dem Geräusch nach, hielt den Blick permanent gegen die Decke gerichtet, was ziemlich anstrengend war – und entdeckte dort plötzlich die schattenhafte Bewegung, die nicht mehr als ein Huschen war.
Sie malte sich an der Decke ab. Schlangengleich und mit schnellen, zackigen Schlägen.
Einen Moment später erstarrte der Schäfer, denn ein furchtbarer Schrei erreichte seine Ohren ...
Frühwinter. Die Zeit kurz vor Weihnachten. Eine Phase der Besinnung hätte es sein sollen, aber diese Zeiten waren längst vorbei. Die Besinnung war in Hektik umgeschlagen, denn da rannten und hetzten die Menschen, um sich mit Geschenken einzudecken, die sie dann – völlig erschöpft – den Menschen zu Weihnachten übergeben wollten.
In den letzten Jahren war es immer schlimmer geworden. Das Weihnachtsfest wurde pervertiert und in der Zeit davor zu einem grellbunten Event gemacht.
Das alles hatte sich in den letzten Jahren noch stärker hervorgehoben, aber es war nichts für mich. Das musste ich ebenfalls zugaben. Ich versuchte nach Möglichkeit, dem Trubel zu entkommen, was mir hin und wieder durch dienstliche Aufgaben gelang. Ansonsten blieb ich, wenn eben möglich, auch zu Hause.
Weihnachtsmärkte waren mir suspekt geworden, weil ich dort auch den Horror erlebt hatte, wobei ich nicht das Gewühl und das Gedränge meinte, sondern einen Angriff dämonischer Gestalten.
Natürlich gab es auch für mich freie Abende. Die meisten verbrachte ich allein oder auch mit Freunden zusammen, und auf den Abend, der jetzt vor mir lag, freute ich mich, denn ich wollte mal wieder meinen Freund Bill Conolly besuchen.
Er hatte mich angerufen und eingeladen und gemeint, dass wir mal wieder so richtig einen draufmachen sollten. Wie in alten Junggesellenzeiten.
»Oha – ohne Sheila?«
»Genau, John.«
»Wo steckt sie denn?«
»Auf einer Weihnachtsfeier, die sich immer bis Mitternacht hinzieht.«
»Ich bin dabei!«
Auf diesen Abend freute ich mich wirklich, und Bill hatte mich auch mit einem breiten Grinsen im Gesicht empfangen, wobei er schon mit einer Flasche Bier winkte und glänzende Augen hatte.
»Schon allein, Bill?«
»Aber sicher. Sheila lässt dich grüßen. Sicherheitshalber hat sie schon mal das Gästebett für dich gemacht.«
»Soll es so schlimm werden?«
»Man kann ja nie wissen.«
Ich war froh, das Haus der Conollys betreten zu können, denn draußen herrschte ein Wetter zum Weglaufen. Mit Weihnachten oder Vorweihnachten hatte das nichts zu tun. Dunst und Nieselregen machten den Menschen auf den Straßen das Leben schwer und hatten die Stadt in eine schwammige Kulisse verwandelt.
Aber jetzt war ich da.
Jacke aus, aufgehängt, der leichte Bieranzug kam zum Vorschein. Eine Hose aus dünnem Cord, senffarben, und dazu ein beiger leichter Pullover über dem T-Shirt.
»Wohin?«
»Wohin du willst.«
Ich blieb vor Bill stehen und grinste ihn an. »Was ich dich noch fragen wollte, ist der Besuch rein privat oder steckt vielleicht mehr dahinter, alter Schwede?«
»Also bitte ...«
»Also nein. Ich kenne dich doch. Wenn du so anfängst, könnte mehr dahinstecken.«
»He, was denkst du eigentlich von mir?«
»Genau das Richtige.«
Bill senkte den Kopf und schüttelte ihn übertrieben heftig. Sein Grinsen blieb mir trotzdem nicht verborgen. Ich schlug ihm auf die Schulter und machte den Vorschlag, in sein Arbeitszimmer zu gehen.
»Da sind wir am besten aufgehoben. Das ist sowieso eine alte Saufbude.«
»Kannst du auch nicht so ohne weiteres sagen.«
»Denk nach, wie oft wir da schon zusammengesessen haben.«
Bill gab eine andere Antwort. Er hatte die beiden Flaschen mit deutschem Bier schon geöffnet und drückte mir eine davon in die rechte Hand. »Cheers«, sagte er und stieß mit mir an.
Wir tranken den ersten Schluck. Danach gingen wir in Bills Bude, in der es sehr gemütlich war. Es war ein altes Arbeitszimmer, das zugleich eine Bibliothek beinhaltete. Die Möbel verdienten den Namen modern nicht, aber sie schufen auch eine gemütliche Atmosphäre. Es gab ja nicht nur den Schreibtisch und die Regale mit Büchern an den Wänden, da waren auch die beiden Ohrensessel aus grünem Leder vorhanden, die ebenfalls ihre langen Jahre auf dem Buckel hatten. In das Leder waren Noppen hineingedrückt worden, sodass die Sitzfläche aussah wie aus zahlreichen kleinen Sitzkissen bestehend.
Der große Schreibtisch gehörte ebenfalls zu den Möbelstücken, die Generationen überstanden hatten, und Bill liebte ihn. Er war beherrschend, sodass der Computer und die moderne Telefonanlage kaum auffielen.
Es war ein gemütlicher Raum, der am Abend dieses Gefühl noch steigerte, wenn nur bestimmte Lichter brannten, die zudem noch von Lampenschirmen gefiltert wurden.
Wenn ich durch das Fenster schaute, fiel mein Blick in den Garten. Dass es bis Weihnachten nicht mehr weit war, das war genau zu sehen, denn Sheila hatte einige Bäume im Garten geschmückt und um sie herum Lichtschlangen gelegt.
»Wo steckt eigentlich dein Sohn und mein Patenkind?«, fragte ich wie nebenbei.
»Er ist auch unterwegs.«
»Aha. Tut sich was in Beziehung auf die Girls?«
Bill grinste breit und hob die Schultern. »Wenn da was läuft, erfahre ich es immer als Letzter. Dafür ist Sheila zuständig. Sie spricht öfter mit Johnny.«
»Das kennt man ja.«
Bill saß mir im Sessel gegenüber. Zwischen uns stand ein viereckiger Tisch, auf dem wir auch die Bierflaschen abgestellt hatten. Wir hatten das Bier mittlerweile in Gläser gefüllt, und ich schaute der Schaumkrone zu, die immer höher stieg.
»Du kommst mir so nachdenklich vor«, sagte Bill.
»Das bin ich auch.«
»Und warum?«
»Ich denke darüber nach, was der eigentliche Grund unseres Treffens ist. Nicht mehr und nicht weniger.«
Bill lachte. »Dass wir mal wieder einen tollen Abend haben. Wie in alten Zeiten.«
»Glaubst du das?«
»Du nicht?«
»Nein.«
»Ach, warum nicht?«
Ich griff zum Bierglas. »Weil die alten Zeiten irgendwie vorbei sind und nichts bleibt, wie es ist.«
Bill empörte sich. »Aber doch nicht bei uns. Du kannst dich nicht beschweren. Wie oft haben wir zusammengesessen, sei es im Haus oder im Garten und haben nur geplaudert.«
»Weiß ich.«
»Dann darfst du dich auch nicht beschweren.«
»Irrtum. Da war Sheila dann mit dabei. Ich kenne dich doch, Bill. Du sitzt wie auf heißen Kohlen und weißt nicht, wie du die Kurve kriegen kannst.«
Der Reporter war heute stur. Er rückte nicht mit der Sprache heraus und erkundigte sich, ob ich einen Whisky wollte.
»Trinkst du einen mit?«
»Klar doch.«
»Dann ist es okay.«
Bill hatte immer einen guten Whisky. Wunderbar weich und geschmeidig, einfach ein Genuss.
Summend holte er die Flasche und die entsprechenden Gläser, und ich verfolgte ihn mit misstrauischen Blicken. Seine gute Laune gefiel mir gar nicht. Sie wirkte irgendwie aufgesetzt, als wüsste er mehr, als er zugab.
Ich trank das herrliche kühle Bier und musste wieder mal eingestehen, dass mir der deutsche Gerstensaft am besten schmeckte.
Bill schenkte ein. »Schottischer Whisky, allerbeste Qualität. Du wirst es schmecken.«
»Ich hatte nichts anderes erwartet.«
»Danke.«
Die goldbraune Flüssigkeit gluckerte in die Gläser. Wir verdünnten sie weder mit Eis noch mit Wasser, das edle Getränk musste man einfach pur trinken.
»Und?«, fragte Bill mich nach dem ersten Schluck, als ich noch kurz nachgeschnalzt hatte.
»Super.«
»Sagte ich doch.«
»Aber jetzt komm zur Sache!«





























