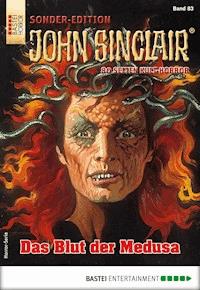
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Sinclair Sonder-Edition
- Sprache: Deutsch
Noch immer hält sich die Mär von der Schlangenfrau Medusa, die von Perseus getötet worden ist.
In Griechenland lernte ich die Medusen kennen, eine Gruppe von Frauen, die mich auf die Insel der Toten holte, wo Männer zu Stein erstarrt waren.
Auch mir blühte dieses Schicksal.
Es gab nur einen Ausweg: Ich musste in die Unterwelt und gegen Medusa kämpfen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Das Blut der Medusa
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Ballestar/Norma
eBook-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-6819-2
„Geisterjäger“, „John Sinclair“ und „Geisterjäger John Sinclair“ sind eingetragene Marken der Bastei Lübbe AG. Die dazugehörigen Logos unterliegen urheberrechtlichem Schutz. Die Figur John Sinclair ist eine Schöpfung von Jason Dark.
www.john-sinclair.de
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
John Sinclair ist der Sohn des Lichts. Der Kampf gegen die Mächte der Finsternis ist seine Bestimmung. Als Oberinspektor bei Scotland Yard tritt er Woche für Woche gegen Zombies, Werwölfe, Vampire und andere Höllenwesen an und begeistert weltweit eine treue Fangemeinde.
Mit der John Sinclair Sonder-Edition werden die Taschenbücher, die der Bastei Verlag in Ergänzung zu der Heftromanserie ab 1981 veröffentlichte, endlich wieder zugänglich. Die Romane, in denen es John vor allem mit so bekannten Gegnern wie Asmodina, Dr. Tod oder der Mordliga zu tun bekommt, erscheinen in chronologischer Reihenfolge alle zwei Wochen.
Lesen Sie in diesem Band:
Das Blut der Medusa
von Jason Dark
Vorwort
Medusa – eine Frauengestalt aus der griechischen Sage – ist eine betörende Schönheit. Ihr Name steht aber auch für Tod, Schrecken und Grauen. Medusa ist das Symbol für den Zwiespalt. Ihre Haare sind widerliche Schlangen, und jeder, dem sie in die Augen blickt, versteinert auf der Stelle.
Erst dem Gott Perseus gelingt es, die Schreckensherrschaft der Medusa zu beenden. Er köpft sie und überreicht ihren Schädel der Göttin Pallas Athene …
»Es wird a Wein sein – und wir werden nimmer sein …« Die Stimme des Sängers tönte schmalzig aus den beiden Radiolautsprechern und drang in die Ohren des Nachtwächters Fritz Hoppitzan, der vor zwei Stunden seinen Dienst im Künstlerhaus angetreten hatte.
»Schmäh«, grantelte er. »Ich kann ihn nicht mehr hören.« Er stellte den Apparat nicht ab, nur leiser, und die Stimme war so gut wie nicht mehr zu hören.
Wein, Weib und Tod. Ein bisschen Lebenslust, ein bisschen morbide, ein wenig Leichengeruch, mit dem Tod kokettieren, das war es, was die Wiener nach wie vor liebten. Da konnte noch so viel Zeit vergehen, da konnten die Menschen modern werden und dem neuesten Trend nachlaufen, etwas blieb immer im Hinterkopf.
Das Warten auf den Sensenmann …
Fritz Hoppitzan, dessen Eltern einst aus Ungarn eingewandert waren, dachte ebenfalls daran. Aber er wollte nicht so recht. Trotz seiner fünfundsechzig Jahre hatte er vor, dem Knöchernen noch einige Schnippchen zu schlagen. Und deshalb mochte er die rührseligen und melancholisch klingenden Lieder nicht, in denen so oft vom Sterben, vom Tod, vom Ende gesungen wurde. Da bekam man fast schon Sehnsucht nach dem Zentralfriedhof, der nicht mehr war wie früher, als die Leichentram fuhr und die Toten zur letzten Ruhestätte schaffte.
Hoppitzan saß in seinem kleinen Büro und stierte auf die Schreibtischplatte. Er dachte an seine Tochter Anni, die sich vor zwei Wochen hatte scheiden lassen. Jetzt hockte die Dreißigjährige zu Hause herum und redete nicht nur den ganzen Tag mit ihrer Mutter, sondern auch die halbe Nacht. Da war der gute Fritz froh, den Posten als Nachtwächter angenommen zu haben.
Er stellte das Radio wieder lauter.
Und der Sänger schnulzte weiter. Er wiederholte den Text viel zu oft.
»Scheiße!«, schrie Fritz in seinem breiten Dialekt. »Jetzt habe ich genug.« Mit einer wütenden Bewegung stellte er den Kasten aus und war erleichtert, dass endlich Ruhe einkehrte. »Sterben«, sinnierte er vor sich hin und sagte dann halblaut, »ist auch nicht das Wahre.«
Dann lachte er völlig unmotiviert. Seine Schultern zuckten, denn er dachte daran, dass die Bilder, die hinter ihm in den Hallen hingen, viel mit dem Tod, dem langsamen Sterben der Menschen und einer unheimlichen Mystik zu tun hatten. Wer die Bilder betrachtete und schwache Nerven besaß, konnte mehr als einen Schauer bekommen.
Hoppitzan überlegte, ob er sitzen bleiben oder seine Runde drehen sollte. Er beschloss, erneut durch die Hallen zu gehen, in denen nur die Notbeleuchtung brannte. Wenn ein Bild von ihrem diffusen Lichtschein getroffen wurde, wirkte es oft noch unheimlicher und manchmal sogar Angst einflößend.
Ächzend stand er auf. Die Knochen wollten nicht mehr so, wie er es gern gehabt hätte. Fritz schob es auf das Wetter, das auch nicht mehr so war wie früher.
In dieser komischen Zeit ging der Frühling direkt über in den Herbst, der schnell von einem langen Winter abgelöst wurde. In diesem Jahr war die Wiener Innenstadt im März tatsächlich vereist gewesen, und manch ein vornehmes Pärchen hatte sich langgelegt, ohne es zu wollen.
»Es wird a Wein sein …«
Hoppitzan hätte sich beinahe auf den Mund geschlagen und schalt sich einen Narren, weil er das Lied nachsang, das er gerade im Radio gehört hatte. Es ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Komischerweise dachte er auch immer stärker an den Tod und an sein eigenes Ende.
Wann würde man ihn holen?
Er ging in die erste Halle, wo auf dem Parkettboden Teppiche mit interessanten Motiven lagen. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, stets am Rand herzugehen.
Den Wert der Gemälde, die aus der Zeit des Manierismus stammten, konnte er nicht einmal schätzen. Solche Summen waren für ihn unvorstellbar. Schön waren die meisten Bilder ja. Vor allen Dingen bunt. Man konnte erkennen, was sie darstellten.
Besonders ein Bild faszinierte die Menschen. Es hatte einen Titel, der nicht so leicht zu vergessen war.
Das Schreckenshaupt.
Das Bild zeigte eine Medusa. Nur einen Kopf, ein Gesicht, das wunderschön war, allerdings weniger die Haare, denn die bestanden aus Schlangen, wie es sich für eine Medusa nun einmal gehörte. Der Künstler hatte sie herrlich naturalistisch gemalt. Wenn das Licht in einem bestimmten Winkel auf das Bild fiel, konnte der Betrachter den Eindruck bekommen, als würden die Schlangen leben und sich bewegen.
Aber sie waren nur gemalt wie die anderen Bilder. Sie zeigten fast nur Szenen aus der Antike. Da war Circe zu sehen oder Flora, die Göttin der Blumen. Handfeste Erotik hatten die alten Meister ebenfalls zu zeichnen gewusst. Mein lieber Schwan, da wurde es selbst einem alten Nachtwächter noch leicht blümerant.
Seine Schritte waren lautlos auf dem Teppich.
Allein dieser Tatsache konnte Fritz Hoppitzan es verdanken, dass er dieses seltsame Geräusch hörte.
Zuerst glaubte er an eine Täuschung, an ein Ohrensausen vielleicht. Mit den Ohren hatte er nämlich zu tun. Sicherheitshalber war er nicht mehr weitergegangen, konzentrierte sich und wartete darauf, dass sich das Geräusch wiederholte.
Das geschah tatsächlich.
Wieder dieses leise Zischen.
»Ein Gashahn!«, flüsterte er. »Verdammt, da muss ein Gashahn nicht geschlossen sein. Diese Idioten …«
Der Idiot war er selbst. Nach kurzem Nachdenken kam er zu dem Entschluss, dass keine Gashähne vorhanden waren, die hätten geöffnet werden können. Also hatte das Geräusch eine andere Bedeutung.
Aber welche?
Er überlegte, horchte und stellte fest, dass es aus dem zweiten Raum gedrungen war, wo dieses unheimliche Medusenbild hing.
Er musste nachsehen.
Nicht, weil er so pflichtbewusst war – die paar Schillinge, die er für diesen Job bekam, ließen ihn die Pflicht vergessen –, nein, es gehörte eine große Portion Neugierde zu seinen Eigenschaften, und dazu stand Fritz Hoppitzan.
Er zählte zu den Menschen, die schon mit dreißig graues Haar bekommen hatten. Jetzt, noch einmal so alt, war dieses Haar nicht mehr grau, sondern schneeweiß. Er hätte es längst wieder schneiden lassen sollen, doch die Nachbarin, die dies immer tat, war seit drei Wochen in Urlaub, und so wuchs die weiße Wolle am Hinterkopf über den Rand der Mütze hinweg in den Nacken.
Es gab nur Durchgänge und keine Türen, die hätten verschlossen werden können. Die Teppiche setzten sich fort, und so betrat der Nachtwächter den Nachbarraum ebenso leise, wie er zuvor gegangen war – und hörte wieder das Zischen.
Diesmal lauter, näher …
Er rührte sich nicht. Bedächtig drehte er den Kopf nach links. Wenn ihn nicht alles täuschte, war das Geräusch aus dieser Richtung gekommen.
Aber dort befand sich nur die Wand mit den Bildern, natürlich unterbrochen von den hohen Fenstern.
Er ging hin.
Allmählich waren die Gemälde zu erkennen. Sie tauchten aus dem Licht der Notbeleuchtung hervor wie spukhafte Gestalten. Ihre Farben, so alt sie auch sein mochten, zeigten nach wie vor eine gewisse Leuchtkraft, vor allem die, mit denen das Bild der Medusa gemalt worden war.
Ein wunderbares Antlitz, das etwas Edles an sich hatte. Ein Gesicht, das zu einer Königin gehören musste. Eine herrliche Frau. Hätte sie gelebt, Himmel, er wäre hin- und hergerissen gewesen. Das fand man heute nicht mehr. Das Zischen blieb.
Es unterbrach seine Gedanken, was für Fritz Hoppitzan wiederum ärgerlich war. Er wollte sich nicht stören lassen. Zu seiner Ausrüstung gehörte natürlich eine Taschenlampe. Da er eine Uniform trug und diese eine Koppel besaß, hatte er die Taschenlampe daran gehängt. Jetzt löste er sie.
Der Lichtstrahl war zu grell für dieses weiche Licht. So etwas tat direkt weh.
Hoppitzan hielt die Hand so, dass der Kegel ein Ziel treffen konnte. Es war das Medusenbild.
Eine Göttin mit dem Gesicht eines Engels. So wunderbar glatt die Haut, so herrlich die Augen. Pupillen, die sich nicht bewegten und trotzdem lebten. Der sinnlich geschwungene Mund, darüber die kleine, gerade Nase, die perfekten Bögen der Brauen, die samtene Stirn und im harten Kontrast dazu – die widerlichen Schlangen.
Schlangen als Haare!
So etwas war schlimm und furchtbar. Außerdem mochte Hoppitzan keine Schlangen. Es gab wenige Tiere, vor denen er sich fürchtete oder ekelte, aber Schlangen standen an der Spitze. Als Kind schon hatte er sie widerlich gefunden.
Er war mit den anderen Spielkameraden nie mitgegangen, wenn diese loszogen, um nach Schlangen zu suchen. Im Wienerwald gab es genug. Später hatte er seine Frau manchmal als Schlange bezeichnet, aber darüber lachte er heute.
So sehr er die Schlangen ablehnte, so stark faszinierte ihn das Bild. Fritz musste zugeben, dass es hervorragend gemalt worden war. Der Künstler, der so etwas schaffte, gehörte zur absoluten Spitze. Heutzutage brachte das kaum jemand fertig. Die meisten Bilder der modernen Kunst waren irgendwie tot, leer, wenn er sich die Motive anschaute, aber bei diesem Gemälde hatte er das Gefühl, als würde nicht nur das Gesicht, sondern auch die Schlangen leben.
Leben war eigentlich falsch. Die Schlangen hatten sich nur einmal kurz gerührt.
Er ging näher an das Gemälde heran. Den Teppich hatte er verlassen. Seine Schritte auf dem Parkett waren relativ laut. Der Lichtkreis nahm an Größe zu.
Fritz konnte das Gesicht der Medusa noch deutlicher erkennen.
Hoppitzan war über die Sage informiert. Gar Schreckliches wusste man über die Medusa zu berichten. Wer sie anschaute, wurde zu Stein, so hatte es in der griechischen Sage gestanden. Ein Blick in ihr Gesicht genügte, dann war es aus.
Hoppitzan wollte lächeln, er unterließ es. Es war ja nur ein Gemälde. Würde dieses Schlangenhaupt leben, dann wäre er, hätte die Sage zugetroffen, längst zu Stein erstarrt. So aber konnte er näher an das Gemälde herangehen. Zwei Schritte davor blieb er stehen und dachte darüber nach, dass er dieses Bild nie zuvor so intensiv empfunden hatte wie in dieser Nacht. Er war öfter daran vorbeigegangen, hatte ihm einen Blick gegönnt, aber nie dessen gesamte Schönheit so intensiv aufgenommen.
Das passierte ihm erst jetzt.
Obwohl er Schlangen nicht mochte, gelang es ihm nicht, den Blick von diesen sich auf dem Kopf der Frau ringelnden Wesen zu lösen. Sie waren im Verhältnis zum Kopf ziemlich dick, sogar unnatürlich dick, fast wie Arme. Sie wuchsen aus der Schädelplatte, besaßen eine graugrüne Farbe, wo Teile der Schlangenkörper einen Stich ins Rötliche bekommen hatten.
Er mochte sie nicht, obwohl sie so ausgezeichnet gemalt waren. Da wollte er sich lieber auf dieses wunderschöne Gesicht der Frau konzentrieren. Sein Blick traf die Augen.
Jetzt kamen sie ihm vor wie kleine, klare Seen, die nicht nur Oberfläche besaßen, sondern auch eine gewisse Tiefe und dennoch keine Leere. Sie steckten voller Leben.
Hoppitzan schaute sie an.
Er geriet plötzlich ins Schwitzen, war unsicher, schloss die Augen, öffnete sie wieder und ließ den Blick am Gesicht der Medusa herabgleiten bis hin zum Mund.
Der lächelte!
Hoppitzan erschrak. Der Mund war hervorragend gemalt, wie alles an diesem Gesicht. Aber er kannte das Bild gut und wusste, dass der Mund nicht gelächelt hatte. Nun aber hatten sich seine Winkel etwas verzogen. Er wirkte jetzt wie ein liegender Halbmond.
Lebte sie?
Plötzlich faszinierte das Bild ihn nicht mehr. Der gute Fritz Hoppitzan hatte es mit der Angst zu tun bekommen. Er wollte weg, es nicht mehr anschauen – und hatte plötzlich das Gefühl, auf der Stelle festgenagelt worden zu sein.
Er konnte nicht mehr gehen!
Zuerst dachte er an Einbildung. Dann hob er das rechte Bein an. Er bekam es nicht einmal einen Fingerbreit vom Boden hoch. Da war nichts zu machen.
Mit dem linken Bein erging es ihm ähnlich. Nur wurde es noch schwerer als das rechte, sodass er es überhaupt nicht mehr bewegen konnte.
Wer sie anschaut, wird zu Stein.
Ja, Fritz kannte die Legende. Voller Schrecken musste er feststellen, dass sie nicht gelogen hatte. Er hatte die Medusa angeschaut, die plötzlich zu einem furchtbaren Leben erwacht war.
Und er versteinerte.
Es war ein unbeschreibliches Gefühl. Die Schwere stieg in seinem Körper hoch. An den Füßen hatte es begonnen, längst die Beine erreicht, die Oberschenkel wurden nicht verschont, die Hüfte, die Brust.
War es bisher ruhig in der Halle gewesen, so hätte ein Lauscher nun die heftigen Atemzüge vernehmen können, die aus dem Mund des Mannes drangen.
Er atmete schlürfend, keuchend. Jedes Luftholen bereitete ihm Schwierigkeiten und hörte sich furchtbar an, während die Erstarrung immer weiter seinen Körper hochzog und in wenigen Sekunden das Herz erfassen würde.
Noch schlug es. Nur war dieser Schlag nicht normal. Ein schweres Pumpen, als hätte das Herz seine Schwierigkeiten, all das Blut zu transportieren.
Fritz Hoppitzan röchelte. Er wusste mit einer selten erlebten Klarheit Bescheid. Diesem Grauen konnte er nicht mehr entrinnen. Die Medusa, dieses verdammte Bild, war zum Leben erwacht, und ein Fluch aus der Antike erfüllte sich bei ihm.
Der Druck in seiner Brust nahm zu. Schweiß lag auf seinem Gesicht. Er hatte die Augen weit aufgerissen. Das Bild ließ ihn nicht los. Diese Faszination der Medusa nahm er mit in den Tod.
Er sah das Lächeln, das jetzt so kalt und grausam wirkte, und er sah die Schlangen auf dem Kopf.
Sie bewegten sich und zischten. Aus den Mäulern zuckten kleine, gespaltene Zungen hervor.
Ein letztes Lächeln, ein letzter Gruß, den Fritz Hoppitzan mit in den Tod nahm.
Als Statue blieb er zwei Schritte vor dem Bild der Medusa stehen. Das Grauen aus der Antike hatte wieder einmal ein Opfer gefunden …
☆
»Wenn du dich bewegst, bist du tot!«
Die Worte hatte mir mein Führer gesagt, bevor er mich hatte stehen lassen und einfach verschwunden war. Weg wie ein Schatten, mit einem leisen hässlichen Lachen zum Abschied.
Ich stand in der Finsternis dieser uralten Höhle und dachte daran, dass ich zu vertrauensselig gewesen war.
Dass ich bereits das Ziel erreicht hatte, daran wollte ich nicht glauben, vielleicht stand ich nicht einmal dicht davor, möglicherweise würde es mir so ergehen wie den anderen Menschen, derentwegen ich überhaupt die Reise in das südöstliche Europa angetreten hatte.
Es fiel mir schwer, mich in dieser feuchten Dunkelheit zu konzentrieren. Es war keine gewöhnliche Finsternis, diese kam mir rußig vor, drückend, als würde sie leben und irgendetwas in sich verbergen, das sie erst zu einem bestimmten Zeitpunkt freilassen wollte.
Nur nicht bewegen!
Der Kerl hatte gut reden gehabt. Durch einen Tipp war ich an ihn geraten, hatte ihm Geld gegeben, und er hatte mich zu dieser Höhle geführt, die auf einer menschenleeren Insel lag, von der es in der Ägäis zahlreiche gab.
Worum ging es?
Ganz genau wusste ich das auch nicht. Jedenfalls hing es mit verschwundenen Männern zusammen. Jungen Touristen aus England, Germany, Frankreich und anderen Ländern, die nicht mehr zurückgekehrt waren. Das zog sich bereits über mehr als zwei Jahre hin, wie ich erfahren hatte. In der heutigen Zeit kein Grund zur Aufregung, besonders dann nicht, weil keiner der Verschwundenen als Leiche an einem Strand angeschwemmt worden war.
Es zählte ja heute zu den Privilegien junger Menschen, alles hinzuschmeißen und auszusteigen. Das musste man hinnehmen und darauf hoffen, dass der Sohn oder die Tochter irgendwann einmal gesund zurückkehrte.
Nur war das bei den Verschwundenen nicht der Fall gewesen. Niemand war zurückgekehrt. Aber es hatte eine Spur gegeben.
Aus der Tiefe des Meeres und nach einem Unwetter, dem ein Erdbeben leichterer Stärke gefolgt war, hatte sich einiges an Masse verschoben.
Fischer, die nach dem Erdbeben wieder aufs Meer fuhren und ihre Netze auswarfen, hatten den großen Fang gemacht. Fische hatten sich kaum in den Netzen befunden, dafür ein anderer Gegenstand, der sehr schwer gewesen war.
Eine Statue!
Aber eine menschliche. Naturgetreu, als würde der Mann am Leben sein, doch er war zu Stein erstarrt.
Die Fischer hätten diesen Fund sofort wieder dem Meer übergeben, wenn ihnen das Schicksal in Gestalt eines Patrouillenboots der Küstenwacht nicht einen Streich gespielt hätte. Sie waren noch bei der Arbeit, als das Boot angehalten wurde und die Beamten an Deck gingen, um den Kahn nach Schmuggelware zu durchsuchen.
Sie fanden den Versteinerten.
Einer der Polizisten, er hatte Geschichte studiert und keinen Job bekommen, wusste Bescheid. Er war ganz blass im Gesicht, als er vom Fluch der Medusa sprach und von der Insel der Toten.
Niemand lachte über seine Worte. Die Polizisten nahmen den Versteinerten mit. In Athen begann die Untersuchung. Man stellte fest, dass es sich nicht um einen Griechen handelte. Ein schlauer Mensch hatte die Idee, den Computer einzuschalten. Dieser Mensch wusste auch von den in den letzten Jahren verschwundenen jungen Männern. Und richtig. Der Computer gab ihm die Antwort.
Diese Statue stimmte im Aussehen völlig mit einer der Personen überein, die seit einem halben Jahr verschwunden waren. Es handelte sich bei ihm um einen jungen Mann namens Rob Isle. Er stammte aus London, und die Athener Beamten setzten sich mit den englischen Kollegen in Verbindung.
Dann ging alles sehr schnell. Der Vater des Gefundenen, ein gewisser Sir Norman Isle, war ein Mann mit den besten Beziehungen. Er saß im Oberhaus, war über viele Dinge informiert und wollte unter allen Umständen, dass diese unheimliche Sache aufgeklärt wurde.
Er glaubte zwar nicht an die Medusa-Saga, doch tief in seinem Inneren blieben Zweifel zurück. Deshalb sorgte er dafür, dass ein Mann informiert wurde, der einen hohen Posten bei Scotland Yard innehatte.
Das war Sir James Powell.
Von ihm zu mir war es nur mehr ein Katzensprung. Wir hatten uns mit Sir Norman zusammengesetzt, zwar keinen Plan entwerfen können, aber ich hatte die Geschichte des Verschwundenen erfahren und glaubte, dass mehr dahintersteckte. Sogar viel mehr.
Deshalb sträubte ich mich nicht, nach Griechenland zu fahren und die Spur aufzunehmen.
In einem Hotel hatte ich einen Mann kennengelernt, der angeblich mehr über die Verschwundenen wusste und sich als Experte in Sachen Medusa bezeichnete.
Er hatte mich zu dieser kleinen Felseninsel gebracht, die von einem Höhlenlabyrinth durchzogen wurde und angeblich eine wichtige Rolle spielen sollte.
Nun stand ich allein in der Höhle, weil mich mein Führer reingelegt hatte und wie ein Schatten verschwunden war.
»Wenn du dich bewegst, bist du tot!«
Ich konnte seinen letzten Satz nicht vergessen und dachte darüber nach, ob er nun geblufft hatte oder nicht. Vor allen Dingen ärgerte ich mich über mich selbst, weil ich zu vertrauensselig gewesen war.
Aber der junge Mann hatte mich irgendwie überzeugen können. Mein Fehler.
Wenn ich mich nicht bewegen sollte, konnte ich hier stehen, bis ich versteinerte oder allmählich verweste. Das kam natürlich nicht infrage. Dieser Knabe würde sich wundern.
Erst einmal wunderte ich mich.
Ich hörte plötzlich ein Geräusch, das mir überhaupt nicht gefiel. Es war ein böses Zischen, als hätte jemand ein Gasventil geöffnet, nur standen da bestimmt keine Gasflaschen.
Mir rann es kalt den Rücken hinunter, denn ich hatte eine ungefähre Ahnung von dem bekommen, was das Zischen bedeuten konnte. Bewegen sollte ich mich nicht, darauf pfiff ich jetzt, als ich meine rechte Hand in die Seitentasche der Jacke schob und vorsichtig meine kleine Leuchte hervorholte. Ich schaltete sie sofort ein.
Mein Blick folgte dem Lichtstrahl, den ich über den Boden wandern ließ, weil dieses Zischen von dort gekommen war.
Lange Körper schoben sich in meine Nähe. Manche gestreckt, andere hoben nur träge ihre Köpfe und starrten mich aus kleinen Augen an. Wieder andere hatten sich zusammengeringelt und waren plötzlich wütend, weil sie das Licht störte.
Ich drehte mich auf der Stelle und leuchtete in die Runde.
Schlangen, wohin ich blickte!
Sie schienen am Untergrund zu kleben, sie hatten ihre Plätze in kleinen Mulden am Boden ebenso gefunden wie in den nischenartigen Öffnungen der Wände.
Sie waren überall!
Ich verfluchte wieder meine Leichtsinnigkeit und mein Vertrauen, das ich diesem jungen Griechen entgegengebracht hatte. Der Typ hatte mich in eine Schlangengrube geführt. Es war keine simple Höhle gewesen, nein, ich steckte in einer Todesfalle.
Zu zählen waren die Schlangen nicht. Ich wusste auch nicht, wie viele von ihnen giftig waren und wie viele harmlos. Ich hing ganz schön in der Klemme.
Es gibt Momente, wo einem die Kehle trocken wird. Dieser zählte dazu. Da stand ich in der stockdunklen Höhle, und ich würde hier noch in zehn Jahren als Skelett stehen, wenn ich es wagte, mich zu bewegen. Selbst mit langen Sprüngen konnte ich es nicht schaffen, den Schlangen zu entwischen, weil sie überall lagen, sich bewegten oder sich auf dem Boden ringelten.
Bei meiner Ankunft waren sie nicht zu sehen gewesen. Vielleicht hatte es der junge Mann auch geschafft, sie zu hypnotisieren. Möglich war schließlich alles.
Es half mir nichts, ich steckte in einer verdammten Klemme. Wenn ich sprang, trat ich unweigerlich auf einen Schlangenkörper. Wie gereizte Schlangen reagierten, das wusste ich. Die würden blitzschnell zubeißen, und hohe Stiefel trug ich natürlich nicht.





























