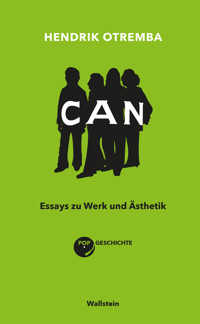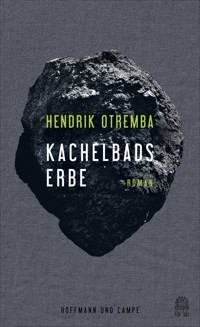
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Dieser Roman ist aus dem leuchtenden Stoff, aus dem Weltliteratur entsteht: Faszinierendes Gedankenspiel, Wissenschaft, Poesie, Philosophie, Magie." MARION BRASCH Los Angeles, Mitte der 1980er Jahre. Der deutsche Auswanderer H.G. Kachelbad friert für das kryonische Unternehmen Exit U.S. Menschen ein, die in ihrer Gegenwart nicht mehr leben können. Bald scharen sich ein abgehalftertes Schriftstellergenie, eine ukrainische Wissenschaftlerin, ein vietnamesischer Auftragskiller und andere skurrile Gestalten um Kachelbad. So unterschiedlich ihre Motivationen auch sind, alle »kalten Mieter« hegen die Hoffnung, eines Tages wieder auf getaut werden zu können. Vom jüdischen Wien der Jahrhundertwende bis ins schwule New York der frühen 1980er Jahre nimmt uns Hendrik Otrembas zweiter Roman mit auf eine Reise in die Vergangenheit, um über die Zukunft nachzudenken. Kachelbads Erbe ist ein mitreißendes Gedankenspiel, ein Experiment mit Erzählinstanzen, ein sorgenvoller Blick in die Zukunft der menschlichen Zivilisation – und reflektiert zugleich die Möglichkeiten der Literatur, ins Jenseits zu reichen. Vor allem aber erzählt der Roman eine große Liebesgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Hendrik Otremba
Kachelbads Erbe
Roman
Hoffmann und Campe
Für Fine
If you go away
As I know you will
You must tell the world
To stop turning, turning
’Til you return again
If you ever do
For what good is love
Without loving you?
Can I tell you now
As you turn to go
I’ll be dying slowly
’Til the next hello
Scott Walker, If You Go Away (1969)
The tired old man, then, will close his eyes, and he can think of his impending temporary death as another period under anaesthesia in the hospital. Centuries may pass, but to him there will be only a moment of sleep without dreams.
Robert C.W. Ettinger, The Prospect Of Immortality (1964)
Prolog
Los Angeles, 13. Juni 1987
Von hier aus kann man tief in den Abgrund blicken. Kühl zieht es von dort herauf. Der Abgrund strahlt endlos dunkel, ich kann nicht bis zum Boden sehen. Was bleibt von einem Menschen übrig, wenn er dort hineinstürzt? Was wird von mir übrigbleiben? Wo wird Geschichte geschrieben? Wo wird Geschichte geschrieben werden? Ich sitze auf einem Plastikstuhl am Rande einer Klippe. Ich wollte noch einmal die Sonne auf der Haut spüren, zum letzten Mal. Es ist so ein schöner Tag und ich bin dafür sehr dankbar.
Heute ist es soweit. Dies ist mein vorerst letzter Eintrag. Ich habe keine Angst mehr. Ich weiß, dass ich geliebt werde. Wir haben zusammen gefrühstückt. French Toast. Gleich fahren wir in die Halle. Dann sterbe ich. Zum ersten Mal in meinem Leben sterbe ich. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wiedersehen.
X
Teil IRosary
1985–87
Als ich die schwere, alte Steintreppe hinunterlaufe, fühlt es sich an wie in einer Kathedrale. Ich höre den Hall meiner eigenen Schritte, er schlägt von den Wänden zurück. Auf Paris brennt unermüdlich die Sonne nieder, doch hier, ins schattige Treppenhaus des alten Hauses, in dem ich vor zwei Monaten eine kleine Wohnung bezogen habe, findet sie ihren Weg nicht. Es ist angenehm kühl, der Boden und die Wände haben die Kälte gespeichert und schirmen das ewige Treppenhaus von der Hitze ab. Die Zeit scheint an diesem Ort stillzustehen. Wie ich da also so runterlaufe, zum Briefkasten, denn ich habe den Postboten klappern gehört, fühle ich mich wie in einer anderen Dimension, als seien die breiten Steinstufen und die dunkle Halle nicht Teil dieser Welt.
Im Briefkasten liegt die Zeitung. Vor einem Monat hat es am Gare du Lyon einen schrecklichen Unfall gegeben. 56 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Die Leichen der Opfer waren zu lange im Blech des Wagons eingeschlossen, man hätte sie nicht mehr einfrieren können. Als ich die Zeitung aus dem Briefkasten nehme, fällt eine Postkarte zu Boden. Ich habe schon auf sie gewartet. Sie wurde in Los Angeles aufgegeben, doch das Bild auf der Vorderseite zeigt eine Fotografie von Coney Island. Der Strand erstreckt sich menschenleer, nur ein schwarzer, großer Felsen am linken Rand irritiert das Bild. Er wirkt wie ein Fremdkörper, etwas, das später hinzugefügt wurde. Sofort erkenne ich die krakelige Schrift auf der anderen Seite.
Rosary, ich möchte dich bitten, alles aufzuschreiben. Genauso, wie du es empfunden hast, so, wie es war. Schreib auf, was wir getan haben, was geschehen ist, was du dich fragst. Ich umarme dich. Auf die Vergangenheit und die Gegenwart. Auf die Zukunft! Kachelbad.
Ich hole den Talisman aus meiner Tasche, den der Alte für mich gebastelt hat. Ich drehe die Schraube zwischen den Fingern und sehe ihn vor mir auftauchen. Das passiert immer, wenn ich den Anhänger betrachte, den er aus der Schraube und ein paar Muttern gefertigt hat. Auch, wenn sich meine Hand in der Hosentasche um das warme Metall zur Faust ballt, spüre ich Kachelbad bei mir. Der Talisman ist ein Medium, ein Portal, mit dem ich in meine Erinnerungen vordringen kann. Vielleicht hat Kachelbad das so gewollt. Bestimmt hat er es so gewollt.
Ich gehe zurück in die Wohnung, setze mich an den schmalen Schreibtisch und gieße mir einen Tee ein. Ich lehne die Postkarte an die Thermoskanne und lege den Briefumschlag dazu, den ich damals, bei unserem ersten Treffen, von Kachelbad bekommen habe. Vor mir steht die Maschine, die ich auf dem Trödel an der Seine gekauft habe. Ich beginne zu schreiben, tippe die ersten Worte. Die Maschine schnalzt mit der Zunge. Schnell füllt sich das Papier, die Buchstaben stürmen durch den Schnee wie Soldaten, die ein unentdecktes, ein unbeflecktes Land erobern, mit Bedeutung aufladen, mit Geschichte. Ihre kleinen Serifenstiefel stapfen durch die Landschaft und schreiben sich ihr auf ewig ein. Sie tun dem Land, in das sie da einmarschieren, Gewalt an, gleichzeitig erzeugen sie es überhaupt. Hier wächst kein Gras mehr. Hier steht etwas geschrieben.
Wir saßen in einem Diner und der dürre Kachelbad hatte ein Tablett vor sich stehen, auf dem noch ein paar Pommes lagen, die letzten Reste einer ohnehin kleinen Portion. Ich sah ihn selten essen und dies war das erste Mal. Wir sahen uns auch das erste Mal. Ja, bei unserer ersten Begegnung aß H.G. Kachelbad Pommes. Er bestellte sie immer nur, wenn sie dünn waren, taxierte beim Betreten unauffällig den Thekenbereich oder die Teller der anderen Gäste. Nur gesalzen mussten sie sein. Er bestellte sie stets ohne Ketchup oder dergleichen. Zu seinen Leibspeisen gehörten zudem Sandwiches, die er heimlich zu essen pflegte, in Unsichtbarkeit. An manchen Tagen, zur stillen Feier etwa, wenn wir wieder einmal erfolgreich einen Körper zur Suspension überführt hatten, machte er Bratkartoffeln mit Apfelmus, neben Kachelbads Namen einer der wenigen Hinweise auf seine deutschen Wurzeln. Der dürre Kachelbad wusste ein köstliches Mahl zuzubereiten, doch ging er sparsam mit dieser Begabung um.
Er hatte mir zur Begrüßung die Hand geschüttelt und seinen Namen gesagt. Seine Stimme klang kratzig, nicht besonders hoch, nicht besonders tief. Doch sie trug eine ganz eigene Note. Sie klang in ihrer Betonung sehr sicher, und das passte zu ihrer Quelle, denn Kachelbad wählte seine Worte mit Bedacht. Das Kratzen aber gab seinen Worten etwas Fragiles. Kachelbads Sprechen war wie ein Widerspruch.
Ich schaute auf ihn herunter. Er war kaum aufgestanden, hatte sich nur etwas aufgerichtet, mit dem linken Arm auf dem Tisch abgestützt. Sein Gesicht war faltig, das weiße, lichte Haar hatte er kurz geschoren. Seine Wangenknochen standen hervor, sonst waren die Gesichtszüge eher unauffällig.
»Rosary«, entgegnete ich ihm und schaute tief in seine trüben Augen, die aufblitzten, sich wieder zurückzogen, Rosary, was er also längst wusste. In dem Moment jedoch, in dem ich ihm meinen Namen zum ersten Mal selbst verriet, persönlich und während wir uns gegenüber waren und uns anschauen konnten, diesen Namen, den ich nicht verstehe und der die Menschen irritiert, den ich aber nicht loswerden kann, drückte seine fleckige Hand ein klein wenig fester zu und er legte die andere nur für einen trägen Augenblick auf meinen Unterarm, stand nun in der Hocke, im Übergang, seine Hand, die nach einem langen Leben aussah, und es wirkte, als würde er verstehen, als wolle er mir suggerieren, dass er verstand. Nicht mit einem Blick, nicht so, dass es sich wie ein Schauspiel und ganz sicher auch nicht so, dass es sich peinlich anfühlte. In seiner Geste interpretierte ich lediglich die Botschaft, dass er verstand, dass er wusste, schon lange. Was wusste? Nun, das versuche ich eben herauszufinden, während ich hier sitze, mit den Soldaten im Schnee, im Sommer über Europa.
Danach habe ich nicht mehr gesprochen, nicht an diesem Tag zumindest, nur meinen Namen habe ich gesagt und etwas zu essen bestellt, sonst nichts. Wir haben erst später angefangen zu reden. Auch Kachelbad war wortkarg, das war er bis auf wenige, sprudelnde Ausnahmen immer, an diesem Tag unserer ersten Zusammenkunft jedoch ganz besonders. Wie er schwieg aber, das war nicht unangenehm. Nicht schüchtern, eher bedacht. Auch wenn sein Blick oft finster war. Er hatte bereits in dem Diner gesessen, in das ich häufig ging und in dem wir uns nach dem letzten Telefonat verabredet hatten. Der Alte hatte für sich die Pommes bestellt, deren Reste nun vor ihm lagen, erkaltet, für mich ein Glas Wasser, das ihm gegenüberstand und mir beim Betreten des Restaurants anzeigte, wo ich mich hinsetzen sollte. Ohne Kohlensäure, so, wie ich es immer trank. Ein Glas Leitungswasser. Woher hatte er das gewusst? Wie ein Zeichen, das mich zu ihm führte, stand es dort, fleckig an den Rändern. Ein Zeichen jedoch wäre kaum notwendig gewesen, denn schon im Betreten des Diners hatte ich ihn erkannt. Er war der einzige Weiße.
Hier ging es auch nicht darum, zu sprechen. Unsere erste Begegnung sollte eine andere Überschrift tragen, die Augen, die Ruhe, die Anwesenheit, das alles spielte eine größere Rolle als unsere Stimmen, unsere Worte. »Nur noch du wirst mich sehen können«, sagte er. Dann herrschte wieder Stille. Die meisten Menschen hätten wohl noch in der Wahrnehmung eines solchen Satzes unmittelbar die Flucht ergriffen. Doch etwas hielt mich hier, bei Kachelbad, ich schenkte ihm Glauben. Aber warum vertraute ich ihm? Ich weiß es nicht. Er schien es auszustrahlen, schon damals in Harlem.
Wir schauten uns lange an, zwischendurch schloss ich sogar die Augen, ich hatte sehr schlecht geschlafen und spürte es, die Müdigkeit fraß an meinem Körper, wie zwei Hände umfasste sie von hinten mein Gesicht und zog daran. Ich träumte ja schlecht. Schon seit frühester Kindheit war ich von schrecklichen Albträumen verfolgt. Nach einer viertel Stunde, die wir zusammen dort saßen, lächelte Kachelbad mir zu, schaute sich langsam im Raum um und verschwand. Die anderen Gäste des Diners, die Bedienung, sie alle konnten ihn nun nicht mehr sehen. Nur ich. Er hatte mich eingeweiht. Sofort verstand ich und musste lachen, nur ganz leise, ich hielt mir die Hand vor den Mund, es blitzte kurz so auf. Kachelbads Atem ging langsamer, intensiver, ich sah, wie seine Brust sich hob und senkte, betrachtete das alte, furchige Gesicht, gezeichnet von einem sanften, kaum merklichen Lächeln, das ich in den folgenden zwei Jahren meist nur in diesen Situationen bemerken sollte. Die Bedienung kam und räumte seinen Teller ab, beachtete ihn nicht, schaute nur mich an und fragte, ob ich noch etwas wünschte. »Rührei und zwei Scheiben Toast, bitte«, sagte ich, »ein Glas Orangensaft und Kaffee, schwarz«, versuchte dabei, nicht Kachelbad anzuschauen, sondern sie. Ich musste wieder lachen, versuchte, es zu unterdrücken, die Bedienung hätte es nicht verstanden und sich vielleicht beleidigt gefühlt, mit Sicherheit aber wäre sie irritiert gewesen. Das hätte sie nicht verdient.
Als sie mit einem Tablett mit meiner Bestellung zurückkam, tauchte er wieder auf und das Mädchen erschrak ein bisschen. Sie hatte Kachelbad vergessen, nachdem er verschwunden war, und nun stockte ihr der Atem, das spürte ich. Ihre Stimme trat aus der Routine und sie sprach leise zu ihm, fragte nun auch ihn nach einem weiteren Wunsch. Kachelbad bestellte ein Glas Wasser, wandte sich dabei ein Stück weit der Bedienung zu, die ihm zunickte und von uns ging, rückwärts.
Während ich nun aß, saß Kachelbad einfach nur da und trank das Wasser. Dann, als ich mein Frühstück beendet hatte, stand er auf, legte ein paar Dollarscheine auf den Tisch und zog einen dicken Umschlag aus der Tasche, den er vor mir auf den Tisch legte. »Dieser Brief ist von Lee Won-Hong. Bis bald, Rosary«, sagte er, lächelte aufrichtig und verließ das Diner unauffällig. Ich schaute ihm hinterher. Er trug eine ausgeblichene, blaue Jeans, schlichte schwarze Schuhe, vielleicht waren es auch Stiefel, und eine bläulich graue Jacke, eine Art Anorak. Seine Kleidung war unauffällig, auch wenn sich hier in Harlem niemand so kleiden würde. Er trug die Uniform der alten Männer. Wie alt mochte Kachelbad sein? Ende 60 bestimmt, vielleicht Anfang 70. Ich wusste sein Alter nicht und schon war er verschwunden, bereits zum zweiten Mal innerhalb der kurzen Zeit unseres Kennenlernens.
Ich betrachtete den Umschlag. Dickes Papier, zerknittert an den Rändern und zerschlissen, hier und da mit schwarzem Panzerband verstärkt. Er schien etwas zu behüten, das dabei nicht auffallen wollte. Wie ein verfallenes Haus, in dem ein Tresor steht. Der Umschlag war mir nun anvertraut. Ich würde ihn beschützen, ihn verteidigen.
Als ich wieder vor die Tür trat, fühlte ich mich merkwürdig, wie in einem Übergang. Als würde ich jeden Augenblick die Vorstellung davon verlieren, wo oder zu welcher Zeit ich mich befand. An der Tür rempelte ich einen Mann an, der das Diner betreten wollte, ich versuchte, mich zu entschuldigen, doch kein Wort kam über meine Lippen. Nur ein verwirrter Blick stach mir aus den Augen, kurz spiegelte er sich in der Glastür und ich erschrak. Die Luft auf der Straße war heiß und drückend und die Gerüche kamen mir fremd vor. Ich schien nicht auf der Welt, schwankte. Etwas muss in dem Essen gewesen sein, dachte ich. Dann dachte ich, nein, etwas muss in dem Umschlag sein.
Der Briefumschlag war schwer, er lag wohlbehütet an meinem klopfenden Herzen, unter meiner Jacke. Auf dem Weg nach Hause begegnete ich Menschen, die zu meinem Leben gehörten, Verkäufer mit Karren, von denen es dampfte und zischte und nach Mais und Maronen roch, eine Blumenverkäuferin, von der ich zwar nie Blumen kaufte, weil ich kein Geld hatte, die mir aber jedes Mal, das ich an ihr vorbeikam, freundlich zuwinkte, der Polizist, Schwein, Zahnschmerzen bekam ich, wenn ich den Schlagstock sah, der ihm an der Seite herunterbaumelte. Immer schneller lief ich, umschlang meinen Körper mit den Armen, weil ich Schutz brauchte vor dieser Welt, die mir plötzlich fremd vorkam, fremder denn je, und weil ich alles verlieren durfte, nur den Umschlag nicht.
Ich öffnete ihn erst, als ich in meinem Zimmer im Wohnheim war. In dem schmalen Raum lag nur meine Matratze, das immerzu quietschende Bettgestell hatte ich in den Keller verbannt, außerdem war da meine Holzkiste mit der wenigen Kleidung, den Büchern, dem Fotoalbum. Ein paar Andenken an meine Kindheit. Der Affe aus Stoff, den ich mir nicht abgewöhnen kann und der mich begleitet, seit ich zu denken im Stande bin. Wahrscheinlich ist er sogar noch länger da, doch das weiß ich nicht.
Nachdem ich die Tür verschlossen und das Kofferradio auf eine Frequenz zwischen zwei Sendern eingestellt hatte, so, als müsse das lärmende Rauschen einen Schutzraum bieten, in dem mich niemand hören konnte, uns, mich und den Brief, öffnete ich den Umschlag, der von zwei Metallklammern geschlossen war. Ich zog den löchrigen Vorhang vor das gekippte Fenster, ließ mich auf die Matratze fallen. Da ging es schon besser, besser als auf der Straße. Ich zog die Seiten heraus und es fielen ein paar Blätter roten und gelben Laubs und ein Bündel Geldscheine mit aus dem Umschlag. Der Brief roch wie der Oktober. Ich zählte das Geld. Es waren 1000 Dollar und ich kann heute kaum mehr sagen, welche der drei Arten Papier mich damals schwindeliger machte. Das Laub verteilte sich auf dem Boden und wurde immer mehr, es tänzelte um meine Füße, und das Geld entlockte mir einen spitzen Schrei, mehr ein Schreck als eine Überraschung. So viel hatte ich noch nie besessen.
Ich las leise, wenn ich mir die Worte auch vorsprechen musste. Die ersten Blätter beinhalteten eine Nachricht an mich, mit einer Schreibmaschine geschrieben. Das Papier sah alt aus, vergilbt und fleckig. Fast wie das Laub auf dem Boden. Warum schrieb ein Mensch auf solch einem Papier?
Los Angeles am 21. April 1985
Rosary?
In der Zukunft. Auf die Zukunft!
Schwarzer Schatten zieht durch eine staubige Gasse, die Mauern kalt, die Mauern rau. Der Stoff seines Umhangs fällt weich und wendet die Wärme nach innen. Über ihm, geblendet vom Licht, hängen weiße Fetzen, Kleider, Hemden, gewaschen und zum Trocknen gespannt. In den Häuserschluchten flattern sie im Wind, geben ihre Feuchte dem Dunst, der ihnen den Geruch der großen Stadt einwebt. Der Schatten schaut nach oben, sein Blick geht zur Sonne, seiner Widersacherin, seinem Feind, seiner Quelle, der Zeit – durch die Hemden, durch die Hosen, durch die Kleider. Zwischen dem Weiß des Feuerballs und der Dunkelheit am Grunde der Schlucht zeichnet sich ein Spiel aus Graustufen. Er trägt einen Umhang, er ist ein Phantom. Er wohnt in einem Turm.
Verzeihen Sie mir diesen pathetischen Auftakt, Rosary, aber der Tod ist nicht das Ende. Von diesem Glauben zeugen die Religionen, die allesamt an die Existenz einer Form des ›Danach‹ glauben, den Himmel, die Hölle, an eine Wiedergeburt. Jeder weiß etwas. Selbst der Atheismus kennt ein Leben nach dem Tod, wenn der Körper in der Verwesung zum Nährboden der Maden wird. Vielseitig, die Angebote. Wird die Hülle also wieder eins mit der Mutter am Boden, gehen die Gläubigen davon aus, dass der Geist sich von ihr gelöst hat und längst an einem anderen Ort ist, ein Ort, den nur die Toten kennen, der alles sein kann. Einen Beweis dafür gibt es nicht, da gehen Sie d’accord? Wer braucht auch Beweise, wenn er einen Glauben hat, der Trost spendet und über die Unwissenheit hinwegtäuscht. Es scheint, als brauche der Mensch einen Glauben oder die Überzeugung von etwas ›Anderem‹, das er nicht erfassen kann. Er glaubt, dieses Andere zu erfahren, wenn er stirbt, wenn seine Zeit als lebendiges Kind der Mutter Erde vorbei ist. Der Mensch unterwirft sich dieser Unwissenheit und der Tod wird zum Schlüssel einer kommenden Erkenntnis. Der Mensch macht sich dumm, fügt sich der Dummheit. Bis zu dem Tag, an dem er stirbt. Ob er danach schlauer ist, weiß keiner, denn niemand ist je zurückgekehrt.
Auch wir haben einen Glauben. Aber dieser will sich auf die Religionen nicht verlassen: Die Kryonik ist eine Geisteshaltung, sie geht über das Leben hinaus. Der Geburt, dem Beginn des Lebens, ist der Mensch ausgesetzt, er wird ins Leben geworfen, das keinen Sinn, keine Verlässlichkeit trägt. Wir bemühen uns darum, dem Tod einen anderen Charakter zu geben.
Was also, wenn ein Leben nach dem Tod möglich wäre, hier auf der Erde, und Krankheit, das Alter, das Unglück wären besiegt? Was, wenn der Tod nicht das Ende wäre, sondern der Anfang eines Neubeginns? Vielmehr: Was wäre, könnten wir die Phase des Todes überspringen, eine Brücke bauen in eine Zeit danach, nicht im Jenseits, sondern hier und jetzt? Was wäre, wenn wir nicht verfallen würden, wenn wir zurückkämen, ohne Sorgen, ohne Leid?
Wir glauben an die Wiederauferstehung eines jeden Menschen, wir wissen davon – von einem zweiten Leben auf Erden. Irgendwann. Seit 1964 beschäftigt sich die Kryonik mit der Zukunft der Menschheit, nach ihrem Tod. Es existieren in den USA zwei Institutionen, die die Kryonik praktizieren. Eine davon ist Exit U.S., in deren Namen ich mich an Sie wende. Wir frieren Menschen ein, um sie eines Tages wieder aufzuwecken – wenn dem Verfall des menschlichen Körpers, den Symptomen des Alterns, dem Sterben adäquat begegnet werden kann. In der Forschung geht es pfeilschnell voran und bald schon wird es möglich sein, die Erkenntnisse der Universitäten in den Dienst der Kryonik zu stellen. Wir wollen das Sterben nicht länger akzeptieren.
Ich möchte Sie zu uns einladen, um Ihnen hier in Los Angeles persönlich vorzustellen, worin unsere Arbeit besteht. Ich hoffe, Sie erschrecken nicht und geben mir die Chance, mich zu erklären. Zunächst nämlich klingt es unheimlich: Nach dem Ableben unserer Klienten bewahren wir ihre gefrorenen Körper auf, bis in der Zukunft eine Möglichkeit gegeben ist, sie aufzutauen. Auf dieses Ziel arbeiten wir in intensiver Forschung hin. Wir sind sicher, dass das technologische Fortschreiten der Menschheit die Möglichkeit der Wiederauferstehung, des Erwachens aus dem Kälteschlaf, in greifbare Nähe rückt. Ja, eines Tages wird es möglich sein! Die Alten werden wir auftauen, wenn der Mensch gegen das Altern gesiegt hat, die Kranken erwecken, wenn ihre Krankheit heilbar ist, und jene, die heute nicht mehr leben wollen, begrüßen wir in einer anderen Zeit zurück, wenn sich die Bedingungen geändert haben, wenn ein Leben möglich ist, das ihren Bedürfnissen entspricht.
Die Gründe für eine Suspension sind äußerst unterschiedlich, sich dabei jedoch nicht unähnlich. Das Potenzial der Wiederauferstehung jedoch übersteigt die Vorstellungskraft des menschlichen Geistes. Was wir wissen: Der Mensch wird die Zeit besiegen, Krankheit, Alter und Tod, wird Distanzen zu fernen Planeten überbrücken können, Planeten, die noch nicht entdeckt sind, wird Orte finden in einer Distanz, für deren Überbrückung ein menschliches Leben nicht ausreichen kann. Er wird über der Zeit schweben. Wir werden unsterblich sein.
Die Frage nach dem größten Topos der Menschheitsgeschichte, dem Jenseits, der Zeit nach dem Tod, wird neu gestellt werden müssen. Die Religion und die Philosophie drehen sich schwindlig in dieser Auseinandersetzung, seit Menschengedenken, und so wurde diese Frage zum Grund für Kriege, Verfolgung und Auslöschung. Könnte ihre Beantwortung, ihre wirkliche, unwiderlegbare Auflösung, nicht gar für Frieden sorgen? Könnte sie nicht einen ewig währenden Streit mit der Wahrwerdung eines universellen Traums versöhnen?
In der Kryonik schlummern große Potenziale. Mit diesem Denken wenden wir uns jedoch nicht gegen die Religionen, wir wollen nur den Zeitraum verlängern, bis diese zuständig werden. Wir wollen ihnen zuspielen. Ihnen Gewissheit schenken. Ihnen ermöglichen, den Fokus neu auszurichten. Kein Hexenwerk: Auch Gläubige gehören zu unseren Schützlingen.
Doch unsere Arbeit stößt in diesen Tagen noch auf große Skepsis, weitestgehend agieren wir daher im Verborgenen. Es nützt ja nichts, Ihnen etwas vorzumachen, Rosary: Die Kryonik ist ein Tabu. Wir aber wollen sie emanzipieren. Der Weg ist geebnet, was wir tun, ist nicht illegal. Doch von der Gesellschaft, von den Religionen, von der Politik, vom Militär und von den vorwiegend konservativen Flügeln der Wissenschaft werden wir als Scharlatane angesehen. Nur in der Kunst und in der Philosophie haben wir Freunde. Auch in Ihnen hätten wir gerne eine Freundin. Ja, eine Komplizin. Denn wir brauchen Hilfe.
Wir sind überzeugt davon, dass Sie die Fähigkeiten besitzen, unserer Idee zu dienen und uns zu unterstützen. Sie kennen den menschlichen Körper, wissen, wie er funktioniert. Wir möchten Sie in unsere Gruppe von Mitarbeitern aufnehmen und Ihnen die Kunst der Suspension – den Prozess hin zur Wiederauferstehung – beibringen.
Im Briefumschlag finden Sie ein wenig Geld, mit dem Sie sich um Ihre Angelegenheiten kümmern können. Sollte die Reise teurer werden oder sie darüber hinaus zu Ausgaben zwingen, werden wir selbstverständlich zusätzlich dafür aufkommen. Neben dem Geld liegen dem Brief weitere Informationen zur Kryonik bei, Zeitungsartikel, Forschungsbeiträge, Interviews, die Ihnen ein Bild unserer Tätigkeiten zeichnen sollen. Es werden Fragen bleiben, die dieser Brief nicht erschöpfend beantworten kann. Auf manche Fragen gibt es auch keine Antworten. Doch wir wollen es versuchen, soweit wir kommen.
In der Zukunft. Auf die Zukunft!
Lee Won-Hong
Das, was ich dort las, übte eine unbändige Anziehungskraft auf mich aus. Ich ging auf die Toilette auf dem Gang, schloss mich in meine gewohnte Kabine ein, die vorletzte auf der linken Seite, an deren Rückwand eine Ecke des verblendeten Fensters etwas Sonne spendete. Deutlich erinnere ich mich an das Licht, das dort hindurchfiel, und wie sich die Schatten der Blätter auf den weißen Kacheln bewegten. Es wirkte, als wögen sie langsamer hin und her. Ich blieb dort sicher eine viertel Stunde, ohne es zu bemerken. Erst, als jemand die Waschräume betrat, kam ich zurück in die Gegenwart. Ich stob mir kaltes Wasser ins Gesicht, dann ging ich wieder auf mein Zimmer und las die fünf Seiten erneut. Ich war ohne Zweifel willens, mich dem Gedankenspiel hinzugeben, mehr noch, mich mit Won-Hong und Kachelbad zu treffen.
Wenn etwas geschieht, also wirklich etwas geschieht, etwas, das Konsequenzen mit sich bringt, das sich nicht mehr rückgängig machen lässt, und man begreift diese Entwicklung, dann verändert sich auch die Umgebung. Der Ort, an dem man ist, wird zum Protagonisten jener Verschiebung, er nötigt einen, sich zu verhalten, zu reagieren, sich der neuen Situation zu stellen. So ging es mir damals, mit dem Brief in der Hand, dem Geld in der Tasche und dem Laub auf dem Boden. Das Zimmer kam mir bereits viel enger vor, enger denn je, die schmale Stube schob ihre Wände auf mich zu, und das Laub schien sich zu verdichten, schon waren meine Füße bis zu den Knöcheln davon bedeckt. Das Fenster, das diese Seiten mir geöffnet hatten, schrie nach mir. Es war der einzige Ausweg aus diesem Raum. Ich musste schnellstmöglich auch das restliche Papier begutachten, das in dem Umschlag steckte. Doch es sollte nicht hier geschehen, nicht an diesem Ort, nicht in meinem Zimmer, in dem die Wände keine Ohren hatten, wohl aber Augen. Ich wirbelte durch den Raum, das Laub stob auf und tänzelte in den dünnen Sonnenstrahlen, die durch die Löcher im Vorhang drangen. Langsam glitt es zu Boden. Die Blätter ließ ich liegen, sie passten in dieses Zimmer. In meine Tasche aber packte ich die Unterlagen, mein Notizbuch und den schlichtesten Kugelschreiber, den ich finden konnte, eine Sonnenbrille und eine dünne Decke. Dann verließ ich das Wohnheim.
Erst im Mount Morris Park las ich weiter, während ich mit einem weißroten Strohhalm von meiner Limonade trank, machte mir Anmerkungen. Die Kohlensäure kitzelte mir die Nase. Dem Brief und dem Geld war ein umfangreiches Dossier beigegeben. Zunächst fand ich die Kopien zweier Lexikoneinträge:
Dem Rana sylvatica, bekannt als Waldfrosch oder auch Eisfrosch, ist es möglich, den Winter zu überdauern, indem er seine Körperflüssigkeiten einfrieren lässt. Bei diesem Zustand völliger Passivität handelt es sich laut der Unterlagen nicht etwa um einen gewöhnlichen Winterschlaf, sondern um ein anteiliges Einfrieren des Körpers, das der Frosch in Reaktion auf einen starken Temperaturabfall begünstigen kann. Ein todesähnlicher Kälteschlaf. Der Frosch erfriert nicht, er gefriert. Das in Nordamerika und Kanada und bis zum Polarkreis vorkommende Tier erzeugt ein körpereigenes Frostschutzmittel aus Glukose und Harnsäure, welches verhindert, dass im Blut während des Einfrierens Eiskristalle entstehen, die die Adern von innen verletzen würden. Froschblut.
Ich musste an die Frösche denken, die ich als Kind im Sommer aufgelesen hatte, so groß wie eine Fingerkuppe, an ihre menschenähnlichen Extremitäten. Wie sie feucht in meiner Hand gelegen hatten, in geduckter Haltung, mich nervös taxierend. Fragend ihre schwarzen Augen, ob ich eine Gefahr für sie darstellte. Durch die Position ihrer Augen sah es dabei immer so aus, als schauten sie gleichzeitig von mir weg, wären in Gedanken schon woanders. Ihre kleinen Körper kitzelten kalt auf der Handinnenfläche und ich erinnere, wie mir ein angespanntes und zugleich euphorisches Gefühl durch die Arme zu meinem Herzen stieg. Ich hatte sie dann immer möglichst tief ins undurchsichtige Grün gebracht, wo sie niemand finden konnte.
In einem dieser Sommer hatte ich ein Feuchtbiotop gebaut, aus einem großen Einmachglas, hatte es mit Erde gefüllt und mit Schilf, hatte Wasser dazu gefüllt und Löcher in den Schraubdeckel gestochen, so, dass in der Sonne eine tropische Atmosphäre entstand. Stundenlang hatte ich beobachtet, wie die winzigen Tiere einfach nur dasaßen, auf einem Stein, geschützt von der unsichtbaren Wand. Was Frösche wohl träumen?
Es gab ein paar Jungs damals, ich sehe noch unscharf ihre Gesichter, denen es eine helle Freude machte, die Frösche zu quälen, ihnen Beine auszureißen oder sie gegen die Wand zu werfen. Die Frösche wollten leben, das zeigte sich in jedem Sprung, mit dem sie ihren Peinigern zu entfliehen versuchten. Aus dem Gebüsch beobachtete ich die Untaten der mir Gleichaltrigen, verfluchte sie, spürte Zorn und den Wunsch, auch ihnen ein Bein auszureißen oder sie mit eben jenen Feuerzeugen und Glasscherben zu malträtieren, mit denen sie die Frösche folterten. Am Ende des Sommers entließ ich meine Freunde aus dem Feuchtbiotop, zerstörte das Glas, zu groß war meine Angst, die Jungen könnten mein Werk entdecken, sodass der Schutzwall, den das Glas doch eigentlich ausmachte, den Fröschen zur tödlichen Falle würde. Im Jahr darauf machte ich mit Kellerasseln weiter, die sich als weitaus pflegeleichter herausstellten, nahm das Biotop sogar heimlich mit in mein Zimmer. Dann verlor ich das Interesse und wurde langsam erwachsen.
Ich verstand nicht alles, was in dem Artikel zu lesen war, wohl aber, dass die Frösche durch einen chemischen Prozess im Körper den Gefrierpunkt austricksen, damit sie keinen Schaden nehmen, dass sie aber de facto wirklich tot sind im Winter, dass die Atmung und in der Folge auch der Herzschlag ganz aussetzen und erst wiederkehren, wenn die Temperaturen milder werden und ihre Körper von der Frühlingssonne aufwärmen. Für diese Zwischenzeit, den Winter der Frösche, fehlte mir der Begriff, den Tod hatte ich immer als endgültig verstanden. Es handelt sich bei der Phase ja nicht um ein Koma oder dergleichen, die Frösche sind in dieser Zeit Dinge, Kadaver, leblose Körper, ehemalige Lebewesen, vorrübergehend tote Wesen. Bis sie in der Frühlingssonne wieder erwachen. Die Frösche leben dann weiter wie zuvor, kehren an ihre angestammten Laichplätze zurück, pflanzen sich fort, und wenn es wieder kalt wird, frieren sie ein, immer wieder. Sie sparen die unwirtlichen Zeiten aus, schalten sich ab, leben nur, wenn die Umwelt sich so konstituiert, dass sie ihnen ein unbeschwertes Dasein erlaubt.
Wie gern hätte ich Zeiten in meinem Leben einfach verschlafen. Die Winter in Harlem sahen schön aus, wenn der Schnee liegen blieb und alles ganz still wurde. Ich ging dann gerne spazieren oder kletterte auf ein Hausdach, um im Mondlicht die weißen Dächer und Straßen zu betrachten. Doch die Kälte durchdrang die maroden Fenster und das Mauerwerk der alten Häuser und sorgte dafür, dass ich die kalte Jahreszeit meist frierend und in einige Decken gehüllt verbringen musste, trotz Unmengen heißen Tees von schweren Erkältungen geplagt. Das Heim war alt, die Fenster undicht, die Heizung schwach. Ich konnte nicht mit meinem körpereigenen Adrenalin auf diese gefühlte Bedrohung reagieren, konnte nicht der dem übergreifenden Frost innewohnenden Gefahr der Vertrocknung durch die Produktion von Harnstoff entrinnen, konnte nicht im Erfrieren Glukose erzeugen, um meinen Körper gegen die Kälte zu schützen.
Auch ein paar Fotografien des Frosches waren in dem Artikel enthalten. Ich strich über seine graue Haut und musste an jene Bilder aus der Zeitung denken, die ein Mädchen zeigten, das in der Nachbarschaft verschwunden war und dessen Leiche man nach Monaten in einer Gefriertruhe fand. Sie war ermordet worden und blieb tot, auch, nachdem die Gerichtsmediziner ihren jungen Körper aufgetaut hatten. Auch ihre Haut war ganz grau, auf den Fotos ohnehin, aber auch in den Umschreibungen des Journalisten, der ihren Leichnam gesehen hatte. Ihr schmaler Körper verfolgte mich damals bis in den Schlaf. Träumen Frösche überhaupt?
Ich musste auch an die Obdachlosen denken, die wir im Winter auflasen, in der Zeit, als ich noch als Rettungssanitäterin gearbeitet hatte. An die vom Frost geschwollenen Finger, wie Ingwerknollen, blass, grau, fast blau. Wenn wir sie noch rechtzeitig fanden und auf die Station brachten, sie sich erholten und ihre Körper wieder aufwärmten, wurde ihre Haut dann bronzefarben, egal ob sie vorher dunkel oder hell gewesen war. Ein eigentümlicher Farbton, eigentlich ohne Vergleich. Oft jedoch hatten wir sie direkt ins Leichenschauhaus bringen müssen, wo sie grau blieben. Anders als bei dem Mädchen aus der Zeitung trugen ihre Gesichter am Ende immer friedliche Züge. Vielleicht hatten sie sich im Erfrieren vorgestellt, dass sie nur eine unwirtliche Zeit überdauerten, bis der Schnee wieder schmolz. Das Mädchen war schon tot, als man sie in die Truhe gesteckt hatte, hieß es. Ich nahm einen Schluck von meiner Limonade, um den Geruch aus der Nase zu bekommen, der sich in die Bilder meiner Erinnerung eingebrannt hatte. Keine Romantik lag im Sterben der Obdachlosen, ihre Haut war von der Kälte verbrannt, der Tod hatte ihnen die Farbe entzogen.
Der zweite Lexikoneintrag umschrieb das sagenhafte Wesen des Acutuncus antarcticus. Dieses außerirdisch erscheinende und nur unter einem Mikroskop sichtbare Tier ähnelt optisch einem See-Elefanten, hat acht Beine und ist nicht mehr als einen Millimeter lang. Es verfügt über eine Art Rüssel und scheint nach heutigem Kenntnisstand das resistenteste Lebewesen zu sein, das es auf der Erde gibt. Der Acutuncus antarcticus ist nicht nur äußerst unempfindlich gegenüber Umweltbedingungen, die für andere Organismen längst tödlich sind, er ist zudem, auch wenn er sich durch eine Befruchtung der vom Weibchen ausgetragenen Eier paaren kann, in seiner Fortpflanzung vom Sexualakt unabhängig. Diese wahren Überlebenskünstler lassen die Hypothese zu, sie seien eine außerirdische Spezies, ist ihre Resistenz doch Bedingungen angepasst, die auf der Erde schlichtweg nicht vorkommen. Sie können etwa Temperaturen von bis zu –273° Celsius aushalten, ein Kältegrad, der auf der Erde nicht natürlich existiert und nur künstlich hergestellt werden kann. Der Acutuncus antarcticus aber ist älter als die Labore der Menschen. Ähnlich wie der Waldfrosch sorgt er durch eine Reaktion des Stoffwechsels dafür, dass das in seinem Körper enthaltene Wasser nicht einfrieren kann. Diese Eigenschaft erlaubt ihm nicht nur eine für das menschliche Auge unsichtbare Population des gesamten Planeten, durch seine Widerstandsfähigkeit ist ihm ja ein Vorkommen bis in lebensfeindlichste Gefilde gewährt, es befähigt ihn darüber hinaus auch zu einer bis zu acht Monate andauernden todesähnlichen Dormanz, eine Entwicklungsunterbrechung, die sich ähnlich wie beim Frosch als totalen Kälteschlaf definieren ließe. Der Acutuncus antarcticus kann Umstände überdauern, die eigentlich den Tod bedeuten.
Handschriftliche Notizen in den Kopien kommentierten, dass dieser Schlaf bis zu 30 Jahre andauern könne, die Namen der entsprechenden Forscher jedoch konnte ich nicht entziffern. Als ich las, dass die einer ebenfalls in Kopie beiliegenden mikroskopischen Aufnahme nach äußerst niedlich wirkenden Lebewesen auch bei einer Testreihe im Weltraum mühelos überlebten, musste ich die Papiere zur Seite legen und mich hinlegen. Ich schüttelte den Kopf, immer wieder.
Als Nächstes fand ich einen Zeitungsartikel über eine norwegische Ärztin, die bei einem Skiunfall unter die Eisdecke eines Flussbettes gesogen worden war, wo sie zunächst zwar in einer Luftblase noch hatte atmen können, dann aber, nach etwa einer Dreiviertelstunde, aufgrund der Unterkühlung und Erschöpfung das Bewusstsein verlor. Als sie schließlich geborgen werden konnte, hatte ihr Körper bereits eineinhalb Stunden im Eiswasser gelegen. Ihre Begleiter, zu ihrem Glück ebenfalls Ärzte, unternahmen ohne Unterlass Wiederbelebungsmaßnahmen, doch bis sie mit einem Rettungshubschrauber ins nächstgelegene Krankenhaus eingeliefert werden konnte, waren drei Stunden vergangen. Ihre Körpertemperatur lag unter 15° Celsius und sie war klinisch tot, weder das Hirn noch das Herz zeigten Aktivität. Die Ärzte zapften ihr Blut über einen Schlauch ab, wärmten es in langsam steigender Temperatur wieder auf und reicherten es mit Sauerstoff an, parallel wurde die Frau bereits seit ihrer Bergung künstlich beatmet, eine Hydraulikpumpe unternahm zudem eine stetige Herzmassage. Keiner der Ärzte glaubte daran, dass ihr Körper eigenständig würde überleben können. Dann jedoch fing ihr Herz wieder an zu schlagen, ihr Hirn wurde aktiv. Nach zwei Wochen hatte sie sich von ihrem Unfall und ihrem klinischen Tod erholt, noch im selben Jahr konnte sie ihre Arbeit als Ärztin wieder aufnehmen.
Bis zu diesem Ereignis hätte ein Mensch, dessen Herz und Hirn nicht mehr selbstständig arbeiteten, als tot gegolten. Den bis zu diesem Präzedenzfall gültigen Kriterien nach also wäre der Körper der Ärztin eigentlich als Leiche gewertet worden, als man sie barg. Doch sie kehrte zurück, weil die Ärzte ihren kurz vor dem Gefrierpunkt stehenden Organismus permanent Wiederbelebungsmaßnahmen aussetzten, man sie in langsamen Schritten erwärmt und ihr Blut dabei präpariert hatte. Ein paar der Erkenntnisse des reißerisch verfassten Zeitungsartikels kannte ich schon aus meiner Ausbildung und Praxis als Rettungssanitäterin, die Verschiebung der Definition des Todes etwa, seit in den 1960er Jahren die Herz-Lungen-Maschine entwickelt worden war, die auch das Überleben der Ärztin begünstigt hatte. Was dieser Umstand jedoch letztendlich für eine Tragweite hatte, was er wirklich bedeutete, wurde mir erst jetzt bewusst.
Die weiteren Unterlagen versammelten wissenschaftliche Papiere, die die Erkenntnisse und Potenziale fundierten, die sich aus den ersten Artikeln ableiten ließen. Auch wenn noch nicht klar war, ob eines Tages die Körper der tiefgefrorenen Menschen wieder aufgetaut werden könnten, geschweige denn, ob es eine Antwort auf die Gründe geben würde, aus denen sie sich einfrieren ließen, das Altern, tödliche Krankheiten oder schlichtweg das Unvermögen, in dieser Gegenwart zu leben, war bereits die Möglichkeit gegeben, Menschen so zu präparieren, dass ihre Körper nach dem Tod zumindest keine Veränderung, keinen Verfall durchlebten. Es war möglich, den Toten die Zeit anzuhalten. Das war die bisherige Grenze der Erkenntnis. Doch es half mir, die Stasis zumindest als etwas Weltliches zu begreifen. Und ich wollte mehr erfahren, über die Kryonik, über Kachelbad und die Unsichtbarkeit. Was sprach nicht alles dafür. Ich hatte New York nicht oft verlassen und war auch nie in Los Angeles gewesen. Das Geld sollte für die Reise reichen. Oder für ein paar unbeschwerte Monate in Harlem?
Ich hatte den Tod allein aus medizinischer Perspektive immer als endgültig akzeptiert, hatte nie darüber nachgedacht, dass es einen Weg geben könnte, einen Menschen wieder aufzuwecken. Den Begriff der Kryonik, seine Bedeutung, kannte ich erst seit der Kontaktaufnahme durch Exit U.S. Wie so oft merkte ich, wie ich mich in meinem Denken selbst überholte, stolperte, mich um mich selbst wand, verknotete, den Überblick verlor. Doch diesmal hatte ich einen guten Grund dazu. Fragen rauschten durch meinen Kopf. Was waren das für Menschen, die ein Verfahren anboten, dessen Ausgang völlig ungewiss war? Und wer waren die Menschen, die sich von Exit U.S. einfrieren ließen? Warum reiste Kachelbad quer durch die Vereinigten Staaten, um mich zu treffen? Warum ich? Niemand sonst interessierte sich doch für mich.
Noch im Morgengrauen lag ich wach, das Radio rauschte wieder, und bis die Sonne aufging, blickte ich in die Dunkelheit, die nur vom Scheinwerferlicht der Autos durchbrochen wurde, die sporadisch am Wohnheim vorbeifuhren. Mein Körper war durchdrungen von einer kitzelnden Unruhe, ich lag dort, ganz still, doch ich spürte schon die Bewegung, verspürte einen Drang, direkt aufzubrechen, wollte keine Zeit mehr verlieren. Im Dunkel der Nacht tanzte das Laub durchs Zimmer. Alles hinter mir lassen. Alles verlassen. Auf die andere Seite der Vereinigten Staaten reisen. Umziehen. Niemanden kennen. Bei Fremden anheuern. Wieder mit dem Tod zu tun haben. Leichen einfrieren. Mir wurde warm und kalt bei dem Gedanken an die in einen flüssigen Stickstofftank getauchten Körper.
Kachelbad. Ich hatte ihn verschwinden sehen und ich wollte ihm dorthin folgen.
Kurze Zeit später saß ich in einem Flugzeug nach Los Angeles. Ich flog vom östlichsten Zipfel der USA in den tiefsten Westen. Das Unternehmen Exit U.S., das ich neben Kachelbad bisher lediglich in der Person Lee Won-Hongs kannte, mit dem ich noch ein kratziges Telefongespräch geführt hatte, bestand nur aus diesen beiden. Es gab noch einen Arzt, ein paar Anwälte, Techniker, Lieferanten und Helfer, deren Dienste sie bei Bedarf in Anspruch nahmen, aber der feste Kern bestand aus dem Guru der Kryonik, Won-Hong, und seinem Helfer H.G. Kachelbad.
Mir gefiel das Fliegen, auch wenn sich beim Start meine Hände tief in die Armlehnen krallten und ich kurz die Augen schließen musste. Durch die Wolken zu fliegen aber, mit dem Drang, durch das runde Fenster in sie hineinzugreifen, ihren Geschmack zu erfahren, war ein wunderbares Gefühl. Ich hatte die Erdoberfläche noch nie aus solch einer Distanz betrachtet, was mich zu gleichen Teilen ängstigte wie auch beruhigte. So waren meine ersten Berührungspunkte mit Exit U.S. bereits ein Abenteuer, noch bevor meine Beschäftigung dort begann.
Meine wenigen Sachen waren vorsorglich im Keller des Wohnheims verstaut. Alles, was ich wirklich benötigte, hatte ich in eine große Reisetasche gepackt. Auch den Stoffaffen hatte ich mitgenommen und das Fotoalbum. Sollte ich mich überzeugen lassen, für Exit U.S. zu arbeiten, würde meine Tätigkeit direkt beginnen.
In Harlem ließ ich keine Freunde zurück. Ich war allein. Selbst im Wohnheim war niemand, von dem mir der Abschied hätte schwerfallen können. Mama Neté, die für viele von uns Mädchen eine Mutter bedeutet hatte, war zwei Jahre zuvor gestorben. Mit ihrem Tod war ich zum zweiten Mal verwaist und dabei endgültig erwachsen geworden. Ich wusste also nicht, ob ich jemals zurückkehren würde. Zeit, dass ich unabhängig wurde. So war dieses Angebot bereits jetzt schon für mich zu einer Tür geworden, ein anderes Leben zu betreten, egal, ob dies sich in Los Angeles oder irgendwo sonst auf der Welt abspielen würde. Ich ließ etwas hinter mir, ohne genau zu wissen, was auf mich zukam.
Die Reise in der großen Maschine dauerte über sechs Stunden und wie gebannt starrte ich aus dem Fenster, beobachtete die Wolken unter mir. Eine Stewardess nahm die Bestellung der Reisenden auf. Ich ließ mir Kaffee bringen, wollte wach bleiben, den Flug zurück durch die Wolken nicht verpassen, wenn wir schließlich zur Landung ansetzten. Noch einmal alles von oben betrachten.
»Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?«, fragte die nette Dame und durchdrang mich mit ihren tiefen, weißen Augen. »Nein«, antwortete ich, »vielen Dank, ich glaube nicht.« Das Essen rührte ich nicht an, schenkte es dem Mann neben mir, der es gierig verschlang. »Das erste Mal nach L.A.?«, fragte er irgendwann, doch ich gab ihm nicht mehr als ein »Ja« und ein flüchtiges Lächeln, wir kamen nicht ins Gespräch. Ich fühlte mich wie auf einer geheimen Mission. Auf eine Art war ich das ja auch.
Die Landung dann war unsanft und meine Hände krallten sich wieder in die Sitzlehnen, doch anders als beim Start lächelte ich diesmal. Bevor ich die Maschine verlassen konnte, kritzelte ich mit einem Bleistift ein Haiku auf die Bordkarte und ließ sie in der Hoffnung auf meinem Sitz liegen, dass die Stewardess sie finden würde. Es ist nie verkehrt, ein flüchtiges Gedicht zu verschenken.
Landung im Nebel
Ein Tretminentanz
Dein Brief hat mich erreicht
Vor dem Terminal wartete Kachelbad auf mich, er stand vor seinem grauen Lieferwagen, den ich schon in Harlem vor dem Diner gesehen hatte. Der Alte war also mit dem Van mindestens einmal quer durch die USA gefahren, vielleicht zweimal. Er trug dieselben Sachen wie bei unserer ersten Begegnung. Ich betrachtete das Fahrzeug nun eingehender, während ich mir ein paar Atemzüge gab, in Los Angeles anzukommen. Die Schrift auf der Seite des Transporters war entfernt worden, dort jedoch, wo die Zeichen und Buchstaben gestanden hatten, war das bläuliche Grau des Blechs etwas heller. So offenbarte sich die vorherige Berufung des Wagens zunächst in chinesischen Schriftzeichen, die ich jedoch nicht zu lesen vermochte. Darunter aber fand sich in kleinerer Schrift eine Übersetzung. New World Laundry. Der an den Rändern der Radkästen schon vom Rost ergriffene Ford hatte zu einer chinesischen Wäscherei gehört. Ich ahnte, was nun darin transportiert wurde.
Kachelbad reichte mir die Hand zur Begrüßung, in seinem Gesicht lag bereits etwas mir Vertrautes, auch wenn wir uns erst ein einziges Mal gesehen hatten. Meine Tasche stellte ich zwischen uns auf die Sitzbank. Kachelbad startete den Motor und fädelte sich mit gekonnter Zurückhaltung in den dichten Stadtverkehr ein. Der Transporter wirkte im Inneren viel neuer und auch der Motor hörte sich kräftiger an, als das leicht lädierte Äußere des Fords vermuten ließ. Ich strich über das Armaturenbrett.
»Der Wagen ist zuverlässiger, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Ich habe den Motor verbessern lassen, in einer Werkstatt. Ein paar Sachen habe ich auch selbst gemacht. Dieses Auto hier ist sehr schnell. Aber es ist unauffällig, weil es Patina angesetzt hat. Schnelle Fahrzeuge stimmen misstrauisch. Du sitzt in einem Phantom, Rosary.«
Kachelbads Stimme wirkte etwas angespannt auf mich, doch er lachte, während er über den Lieferwagen fachsimpelte, schien sich zu freuen, dass ich in L.A. angekommen war. Während der Fahrt schilderte ich ihm meine Eindrücke vom Fliegen und nahm Abstand davon, ihm all jene Fragen zu stellen, die mich, seit ich nach unserer ersten Begegnung das Dossier gelesen hatte, nicht mehr losließen. Ich ging davon aus, dass der Besuch bei Exit U.S. Licht in dieses Dunkel bringen würde. Vielmehr interessierten mich in diesem Augenblick außerdem die Fragen nach der Unsichtbarkeit.
»Wie du das in dem Diner gemacht hast, das war unglaublich. Wie funktioniert das?«
»Wir reden darüber, wenn es an der Zeit ist.«
Das Institut, so nannten sie es, auch wenn es kein Institut war, lag in einem Industriegebiet am südlichen Rand von Los Angeles. Rechtlich gesehen war Exit U.S. eine Stiftung, anders hätten Won-Hong und Kachelbad ihre Tätigkeiten nicht ausüben können. Doch was dort geschah, hatte in meinen Augen nicht viel mit der Arbeit einer Stiftung zu tun.
Die Gegend, in der das Institut lag, war schmutzig. Anders als in Harlem. Auch dort lag der Dreck auf den Straßen, hier aber schien sich der scharfe Smog, der Unrat und der Abfall der Zivilisation in den Asphalt, das Mauerwerk, ja, schlichtweg in die gesamte Umwelt eingeschrieben zu haben. Trotzdem wuchsen zwischen den Steinplatten des Gehwegs und dort, wo der Boden aufgebrochen war, grüne Gräser in Nachbarschaft verdorrter Triebe, und überall schoss der Löwenzahn aus dem Boden. Viele der Anlagen, die wir passierten, schienen ungenutzt, waren verfallen, lagen brach, die Fensterscheiben eingeworfen. Schrott stand auf den fahlen Grünflächen und Schmierereien zierten das Mauerwerk. Inmitten dieser Landschaft lag also eine Halle mit gefrorenen Körpern, die auf eine bessere Zukunft hofften.
Wir hielten schließlich vor einem von Stacheldraht gesäumten, maroden Maschendrahtzaun, der ein weiter hinten liegendes Gebäude umgab. Es sah verglichen mit der Umgebung recht intakt aus. Kachelbad stieg aus und öffnete ein massives Vorhängeschloss, das mit schweren Ketten um das Tor gewunden war, dann fuhren wir auf die Lagerhalle zu. Etwa zehn Meter hoch erhob sich der anonyme Kasten in den Himmel von Los Angeles, bis auf ein paar Oberlichter war er komplett fensterlos. Das Gebäude schien eine alte Fabrik oder Lagerhalle zu sein, es wirkte robust, massiv, die Mauern waren dick und unverwüstlich. Wie ein überdimensionales Mausoleum erschien mir die Niederlassung von Exit U.S., und mit dieser Assoziation hatte ich ja auch nicht ganz unrecht.
Wir fuhren langsam auf den Eingang zu, nachdem Kachelbad den Drahtzaun wieder sorgsam verriegelt hatte, hielten vor dem Rolltor, das sich nun klappernd und wie von Geisterhand nach oben schälte. Die Farbe war weitläufig abgeblättert. An der Seite, äußerst unauffällig gehalten, erkannte ich auf einem verblichenen Schild das Exit U.S.-Logo, das ich bereits in dem Dossier gesehen hatte. Dafür, dass es hier um die Zukunft der Menschheit gehen sollte, sah der Laden ziemlich runtergekommen aus.
Als sich das Tor in etwa so weit nach oben bewegt hatte, dass der Transporter hindurchpasste, fuhren wir in den dunklen Schlund dieses unheimlichen Ortes. Kurz ging mir durch den Kopf, dass niemand wusste, dass ich hier war. Ich musste an die Kühltruhe aus dem Zeitungsartikel denken, an das gefrorene Mädchen. Wenn niemand weiß, wo ich bin, dann bin auch ich bereits unsichtbar, dachte ich, während wir die kalte Grabesstätte betraten.
Lee Won-Hong wartete am Rolltor, welches er hinter uns wieder absenkte. Der kleine, schmächtige Mann betätigte einen Lichtschalter, und als die Leuchtstoffröhren mit einem Knall aufflackerten und die weite Halle in ein schmerzendes Neonlicht tauchten, erkannte ich die Tanks, über die ich schon im Dossier gelesen hatte. Sie nahmen mit einigem Abstand zueinander fast die gesamte rechte Seite der Halle ein, zwei nebeneinander, etwa zehn hintereinander. In dunklem Grau erhoben sie sich vor meinen Augen. Sie erinnerten in ihrer Anordnung an die Grabsteine eines riesigen Friedhofs, nur dass sie rund waren und gut fünf Meter hoch. Massive, mit Stickstoff und gefrorenen Körpern gefüllte Grabkammern, der Mikrokosmos einer künstlichen Eiszeit. Aus dem Dossier wusste ich, dass in jeden der Tanks sechs Körper passten. Bis zu 120 eingefrorene Menschen umgaben uns also, und auch, wenn ich wusste, dass es völliger Unsinn war, meinte ich, ihre kalten Blicke zu spüren.
Wir fuhren noch ein Stück weiter in die Halle und hielten neben einem flachen Pavillon, der in der riesigen Halle einem Schuhkarton gleichkam und in dem sich durch die Fenster ein Büro erkennen ließ. Kachelbad stoppte den Wagen mit einem kurzen Quietschen der Reifen und wir stiegen aus. Ein chemischer Geruch drang mir in die Nase, nicht sehr intensiv, aber durchaus spürbar. Auch er passte zu dem, was ich hier sah. Ein von Menschenhand geschaffenes Konstrukt, das zwischen Leben und Tod operierte, eine Brücke zwischen zwei Welten, eine Pforte ins Reich der Toten und zurück, vielleicht zurück. Eine Zwischenwelt. Der Geruch hing über dem ganzen Raum und wurde intensiver, je näher man dem Operationssaal kam, der sich weiter hinten in der Halle befand. Vorne in der Halle lag ein Tank auf einer Rollkonstruktion, die mit einem Gabelstapler verbunden war. Liquid Nitrogen stand darauf. Sicher beherbergte er den flüssigen Stickstoff, der regelmäßig nachgefüllt werden musste. Auch davon hatte ich im Dossier gelesen, doch die Dinge nun direkt vor mir zu sehen, sie anfassen zu können, hatte einen ganz anderen Effekt auf mich. Der abstrakte Gedanke wurde konkret, ich konnte nun sehen, dass es die Kryonik wirklich gab, sie unlängst Praxis war. Menschen betraten hier einen hypothetischen Raum, den Tod zu überlisten. Gleichzeitig machte sich die Hypothese vom Menschen abhängig. Der Tank mit dem flüssigen Stickstoff koppelte die Vision der Kryonik ja an die Menschheit, denn es brauchte stets eine Person, die für den Nachschub sorgte. So war der Tank gleichzeitig eine Kette am Bein und ein umgekehrter Mutterkuchen, der nicht Leben schenkte, sondern es aufhielt, stoppte, aussetzte. Ich warf meine gefütterte Jeansjacke über, knöpfte sie zu und schlug den Kragen hoch. Dann wandte ich mich um und blickte zu Won-Hong, der mit weit geöffneten Armen lächelnd auf mich zuschritt.
»Rosary. Willkommen im Kühlhaus!«
»Guten Tag.«
Lee Won-Hong umarmte mich und drückte mich an sich, als würden wir uns schon lange kennen, eine Geste, die mich irritierte. Seine Kleidung roch alt, doch es war ein Geruch, der fest an ihm haftete, egal, was er trug. Dieser Geruch schien der Zeit enthoben, genau wie Lee Won-Hong. Er war anders als die Menschen, die ich kannte, er verkörperte eine Idee, hinter der er als Mensch zu verschwinden schien. Anders noch als Kachelbad, der eine Passivität besaß, eine Zurückhaltung, die sich auch in seinem Vermögen zur Unsichtbarkeit manifestierte, wirkte Lee Won-Hong dabei wie ein Geschäftsmann. Er trug den Anzug eines Handelsvertreters, der Zweiteiler hatte seine besten Jahre hinter sich. Die Kleider waren durchaus gepflegt, aber abgenutzt, der Stoff schon dünn an den Knien und Ellenbogen. Ich schätzte Won-Hong auf etwa 50 Jahre, war mir aber nicht sicher. Sein Körper und seine Haut wirkten auf mich wie ein Kostüm, was eine Einordnung seines Alters schwierig machte. Auch sonst entzog er sich mir. Trotz seiner Offenherzigkeit war er nicht wirklich greifbar. Ein Hochstapler, dachte ich.
Nach ein paar mehr oberflächlichen Sätzen Lee Won-Hongs meine Anreise betreffend folgte eine Führung durch die weite Halle. Die Tanks wurden oberhalb von einem begehbaren System verbunden, das sich in Gittern über die ganze Halle erstreckte und so ermöglichte, die monolithischen Zylinder zu betreten.
Die Körper wurden durch einen zur mobilen Hebebühne umgebauten Gabelstapler nach oben geschafft, um dann in die Tanks getaucht zu werden. Vor meinem inneren Auge sah ich sechs Körper, sechs pro Tank, ausdruckslos. Ein kalter Schauer zog mir über den Rücken, er verband sich mit der Kälte des weiten Raumes.
Dann erklärte mir der Kopf von Exit U.S., was ich bereits gelesen hatte. Die Leichen wurden in dem Operationssaal präpariert, in dem Won-Hong gemeinsam mit einem Arzt, den er pro Suspension bezahlte, das Blut über ein Transfusionsverfahren gegen eine Flüssigkeit aus Ethylenglykol und Dimethylsulfoxid austauschte. Bei dem Arzt handelte es sich um Dr. Gruber, den ich bald kennenlernte, und auch, wenn ich diesem Verdacht nie auf den Grund ging, strahlte er in meiner Wahrnehmung eine Vergangenheit aus, die es ihm verbot, in seriöseren Umfeldern sein Geld zu verdienen. Er sprach kaum. Ich sah ihn immer nur, wenn wir jemanden zur Suspension einlieferten oder wenn er mal mit zu einem kalten Mieter fuhr, wie wir die Klienten von Exit U.S. nannten, um den Totenschein auszustellen.
Das Gemisch, das mit einer Pumpe während der sogenannten Vitrifikation über die Halsschlagader gegen das Blut getauscht wird, dehnt sich bei Frost nicht aus, sondern verglast, wodurch kein Schaden im Gewebe entstehen kann. Bis der Körper aber auf den Operationstisch gelegt wird, hat eine hydraulische Herzkompressionsmaschine hundert Mal in der Minute einen Druckimpuls auf den Brustkorb gegeben, über eine Beatmungsmaske wird zudem im besten Fall ab dem eindeutig festgestellten Todesmoment alle zwanzig Sekunden Luft in die Lunge gepumpt. Auch, wenn der Mensch offiziell tot ist und dies ja auch bleiben soll, zunächst zumindest, müssen die Zellen am Leben erhalten werden. Durch die medikamentös gedrosselte Wiederbelebung wird der Verfall des Körpers, der mit dem Tod einsetzt, verhindert. Keine Wiederbelebung also. Für dieses Stadium fehlt letztlich das Vokabular, die Kryonik trifft sprachlich auf eine Grenze. Es handelt sich um eine Art De-Animation. Ein Wort zwischen Leben und Tod. Ein Widerspruch. Wenn die Grenzen unserer Sprache die Grenzen unserer Welt ausmachen, betreten wir hier eine neue.
Die Verwesung also, die ja nichts weiter ist als eine Vergiftung des Körpers, wird aufgehalten. Alle Zellen, alle Moleküle und jedes Atom sollen bleiben, wo sie sind. Für die Körper wird durch die Animation die Zeit angehalten, sie befinden sich dann in einem statischen Zustand zwischen Leben und Tod. Herz und Hirn arbeiten nicht mehr selbstständig, doch durch Beatmung und die maschinelle Herzmassage wird der Prozess des Ablebens unterbrochen. Nach wenigen Minuten gewinnt die Haut, die nach dem Tod aschgrau geworden ist, wieder an Farbe, schimmert in einem bronzenen Ton, was gleichzeitig ein Indikator dafür ist, dass der Gasaustausch in den Zellen funktioniert. Bleibt die Haut grau, ist eine Fortführung der Suspension sinnlos.
Den Klienten, den leblosen Körpern, die sie werden, verabreicht man Medikamente, ein Beruhigungsmittel, eine Heparin-Spritze ins Herz als Gerinnungshemmer und Morphium, sodass sie nach ihrem offiziell bestätigten Tod nicht versehentlich wieder aufwachten. Sie sollen ja aufwachen, aber erst, wenn es bestimmten Kriterien nach Sinn macht.
Lee Won-Hong redete sich in seinen Erläuterungen in Rage und ich verstand, dass in ihm zwar ein unternehmerischer Geist schlummern mochte, er hier aber vielmehr seinem Idealismus folgte. Er ruderte mit den Armen, seine Stimme wurde schärfer.
»Die Kryonik ist ein auf den ersten Blick vorsichtiger, zaghafter, bei genauerer Betrachtung jedoch äußerst wilder Tanz auf einem schmalen Grat, ja, die Tanzenden müssen auf dem Kuppelring eines Vulkans balancieren und ihn dabei immer wieder umrunden, und auf ihren Schultern tragen sie die leblosen Körper ihrer Schützlinge. Ein Abrutschen bedeutete den sicheren Tod oder eine verfrühte Wiedergeburt, doch weder das eine noch das andere soll in dem Moment der Suspension stattfinden. Die Kryonik bedeutet, nicht blinzeln zu dürfen, über Jahre, trotz Sonne, Wind und Müdigkeit, trotz des Sandes der Zeit, welcher sich in den Augen festsetzt. Sie muss auf einem schmalen Grat balancieren, ein Abrutschen wäre mehr als ein Fehltritt, es relativierte das gesamte Unterfangen und zöge uns Wächter mit in den Abgrund. Es muss so lange balanciert werden, bis eine Lösung gefunden ist, bis eine noch unbekannte Hand Halt gibt, einem die Körper abnimmt und auf festen Untergrund befördert, sich um sie kümmert. Sie wieder zu lebendigen Menschen macht, repariert, integriert, erlöst. So lange werden wir balancieren müssen, selbst wenn die Erde bebt, wenn der Vulkan Lava spuckt, wenn es Asche und Gestein herabregnet. Und wenn wir alt sind, wenn der Sandsturm über uns hereinbricht, müssen wir neue Generationen von Wächtern ausbilden.«
Er sprach wie der Führer einer Sekte, griff zu abgedroschenen Bildern, die sich mir jedoch einprägten. Er schaute mich eindringlich an. Ich sollte eine neue Wächterin werden.
Das Blut und die Gewebeflüssigkeit gegen das Frostschutzmittel auszutauschen, das vom Prinzip dem Gemisch entspricht, welches der Waldfrosch selbst zu produzieren im Stande ist, wird notwendig, damit die Adern unversehrt bleiben. Ohne diese Operation würden sie zerplatzen, wie es mit Rohren geschieht, die durch das Gefrieren des Wassers bersten. Ideal wäre es, diese Operation bereits direkt nach Eintreten des Todes zu unternehmen, doch die Apparaturen, mit denen der Austausch der Flüssigkeiten vollzogen wird, sind zu sensibel, als dass man sie in einem Wagen mit zu den Orten bringen könnte, an denen die Klienten von Exit U.S. sterben. Deshalb kommt es beim Transport der Leichen auf die Zeit an. Der Körper wird schon beim Transport heruntergekühlt, ein Prozess, der direkt nach dem Tod beginnt. Das Eiswasser in dem sargähnlichen Behälter wird durch eine Pumpe zur Zirkulation gebracht, damit keine schädlichen Erfrierungen entstehen. Je nach Dauer der Fahrt muss Eis nachgefüllt werden, damit der Körper von seiner durchschnittlichen Temperatur von 36,5° Celsius langsam immer weiter abkühlt. Durch dieses Verfahren werden alle chemischen Prozesse heruntergefahren. Dann, bevor es zu den konservierenden Maßnahmen kommt, wird das Kopfhaar abrasiert und die Haut ein letztes Mal gewaschen. Es folgt der Blutaustausch, der wichtigste Teil des Verfahrens, und anschließend wird der Körper in einer Art Kühlschrank stufenweise weiter heruntergekühlt, bis er gegen 3° Celsius die Temperatur von Eiswasser erreicht hat. Schließlich wird der präparierte Leichnam dann in einen der Tanks getaucht, wo er am Ende der Suspension bei –196° Celsius auf unbestimmte Zeit eine vorläufige Ruhestätte findet.
Als Won-Hong erwähnte, dass die Körper kopfüber in den flüssigen Stickstoff getaucht werden, blickte ich ihn fragend an. Er lächelte, so wie ein Lehrer es tut, dem eine einfache Frage gestellt wird, die er mit Freude und etwas Müdigkeit zu beantworten weiß. Er erklärte mir, dass der Kopf das Wichtigste sei, wenn ein Mensch eine Suspension durchläuft. Im Gehirn nämlich ist die Persönlichkeit des Menschen verortet, die Erinnerungen, aus denen sich das individuelle Wesen konstituiert.
»Die Seele?«, fragte ich, doch Lee Won-Hong antwortete nicht, fuhr unentwegt fort. Sollte ein Tank etwa ein Leck haben und der Stickstoff auslaufen, würde der Kopf so am längsten konserviert bleiben. Won-Hong schaute mich an und verwies darauf, dass sich unser Wesen über ein Verlustgefühl oder das Leiden an einer Einschränkung hinaus nicht verändert, wenn dem Menschen etwa ein Arm oder ein Bein amputiert wird, wohingegen der Kopf und damit das Gehirn unabdingbar sind. Angewidert grinste ich ihn an, mit skeptischem Blick, auch wenn mir die Erklärung einleuchtete. Dr. Lee Won-Frankenstein.
Die Eindrücke machten mich müde, hinzu kam die Erschöpfung der Reise. Won-Hong schien dies zu spüren. Wir gingen zurück zu dem kleinen Büroraum, der auch das Besprechungszimmer von Exit U.S. beherbergte. Davor stand noch immer der Transporter, der mir in der riesigen Halle nun winzig klein vorkam. Erschöpft sank ich in einen der tiefen Sessel, die um den eckigen, dunkelbraunen Holztisch gruppiert standen. Die Männer setzten sich zu mir und Kachelbad schenkte uns schwarzen Tee ein. Die Becher schienen zusammengeklaubt, sie waren von unterschiedlicher Farbe und Form, auch das Exit U.S.-Logo suchte ich vergeblich. Kachelbad hüllte sich in Schweigen, weiterhin, er wirkte auf mich schläfrig und still. Lee Won-Hong war weitaus fahriger, somit aber auch umso gesprächiger.
»Ist das legal, was hier vor sich geht?«
»In Kalifornien schon, auch in ein paar anderen Regionen. Aber nicht in allen Bundesstaaten verhält es sich so. Deshalb die Transporte. Wir operieren mittlerweile in den ganzen USA, wobei zum Teil die Überführung der Leichen noch zu lange dauern würde. Aber daran arbeiten wir, stetig. Es lassen sich auch erste Menschen aus dem Ausland einfrieren.«
»Was passiert, wenn ein Transport von der Polizei kontrolliert wird?«
»Das darf nicht passieren.«
»Also ist das, was geschieht, illegal.«
»Nein, aber die Polizei bedeutet immer einen Verlust von Zeit, und Zeit gibt es in der Kryonik erst nach der Suspension. Sagen wir es so: Wir handeln im Interesse unserer Schützlinge und die Gesetzgebung ist dem Potenzial und den Bedingungen unserer Disziplin noch nicht angepasst. Auch das ist eine Frage der Zeit. Die Debatte um den postmortalen Kälteschlaf, wie ich zu sagen pflege, bewegt sich langsam erst in die Öffentlichkeit. Ich will ganz ehrlich sein, Rosary. Noch ist unsere Arbeit nicht sehr hoch angesehen, noch werden wir nicht ernst genommen. Aber das wird sich ändern. Die Wissenschaft macht große Fortschritte, und wenn es eines Tages möglich ist, die Körper der kalten Mieter aufzutauen und sie wiederzubeleben, wird man uns danken. Wir werden als Pioniere gelten. Wir dienen hier einer Idee. Ja, wir werden die Ersten sein und unsere Klienten werden den Fortgang der Geschichte ändern. Das ganze Leben wird sich verändern.«
Lee Won-Hong gestikulierte beim Sprechen, als würde er der Wirkmacht seiner Worte nicht trauen. Mit den Armen und Händen forderte er ein, seinen Argumenten zu folgen.
»Und wann wird das sein?«
»Der Zeitpunkt ist ungewiss. Vielleicht werden wir schon nicht mehr leben, wenn die Reanimation nach dem Kälteschlaf möglich ist. Nun, ich werde mich natürlich auch einfrieren lassen. Doch unser Vermächtnis hat Geduld, soviel ist gewiss. Wenn sich die Körper in der Stasis befinden, verändern sie sich nicht mehr. Es muss nur regelmäßig der Stickstoff nachgefüllt werden, ein- bis zweimal im Monat. Dann macht es keinen Unterschied, ob sie fünf oder fünftausend Jahre eingefroren sind.«
Würde ich mich einfrieren lassen? Ich weiß es nicht, weiß es bis heute nicht. Vielleicht bin ich zu jung für derlei Gedanken. Ich blickte Kachelbad an, doch der reagierte nicht. Würde er in einen der Tanks ziehen, eines Tages, wenn es zu Ende ging mit ihm? Etwas an seinem Wesen schien mir zu sagen, dass er aus anderen Gründen hier war. Es ging nicht um seine Zukunft. Er schaute ins Leere, und während Lee Won-Hong wild gestikulierte, schien er irgendwo anders.
»Aber was hat das mit mir zu tun? Warum haben Sie gerade mich eingeladen? Mich interessiert sehr, was hier geschieht, aber ich verstehe noch immer nicht ganz, welche Rolle ich dabei spielen soll.«