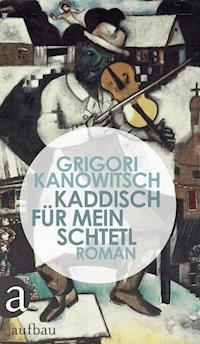
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein wunderschöner Familienroman voller Poesie und Altersweisheit über die letzten zwanzig Jahre des Schtetls in Osteuropa. Ein anrührendes und sehr poetisches Denkmal für ein verschwundenes Stück jüdischen Lebens. Der junge Schneider Schlejmke wird für zwei Jahre in die litauische Armee eingezogen, doch seine Liebe zu Chenka überdauert diese Zeit. Schließlich setzt er sich gegen seine strenge Mutter Rocha durch und darf seine Chenka heiraten. Ihr gemeinsamer Sohn Girschele – Grigori Kanowitsch selbst – erzählt die Geschichte seiner Familie in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts, die zugleich die Geschichte vom Untergang des Schtetls in Osteuropa ist. Ein warmherziger, nostalgischer Blick zurück. Trotz der Umwälzungen und Bedrohungen der Zeit nicht im Zorn, sondern mit viel Sympathie und ein wenig Wehmut erzählt. "Ich bin kein jüdischer Schriftsteller, weil ich russisch schreibe, kein russischer Schriftsteller, weil ich über Juden schreibe, und kein litauischer Schriftsteller, weil ich nicht auf Litauisch schreibe." Grigori Kanowitsch. „Kanowitsch lässt eine Welt wiederauferstehen, die es längst nicht mehr gibt.“ FAZ.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Informationen zum Buch
»Kanowitsch lässt eine Welt wiederauferstehen, die es längst nicht mehr gibt.« FAZ
Ein wunderschöner Familienroman voller Poesie und Altersweisheit über die letzten zwanzig Jahre des Schtetls in Osteuropa. Ein anrührendes und sehr poetisches Denkmal für ein verschwundenes Stück jüdischen Lebens.
Der junge Schneider Schlejmke wird für zwei Jahre in die litauische Armee eingezogen, doch seine Liebe zu Chenka überdauert diese Zeit. Schließlich setzt er sich gegen seine strenge Mutter Rocha durch und darf seine Chenka heiraten. Ihr gemeinsamer Sohn Girschele – Grigori Kanowitsch selbst – erzählt die Geschichte seiner Familie in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts, die zugleich die Geschichte vom Untergang des Schtetls in Osteuropa ist. Ein warmherziger, nostalgischer Blick zurück. Trotz der Umwälzungen und Bedrohungen der Zeit nicht im Zorn, sondern mit viel Sympathie und ein wenig Wehmut erzählt.
»Ich bin kein jüdischer Schriftsteller, weil ich russisch schreibe, kein russischer Schriftsteller, weil ich über Juden schreibe, und kein litauischer Schriftsteller, weil ich nicht auf Litauisch schreibe.« Grigori Kanowitsch
Grigori Kanowitsch
Kaddisch für mein Schtetl
Roman
Aus dem Russischen von Ganna-Maria Braungardt
Mit einem Nachwort von Brigitte van Kann
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Zweiter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Nachwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Anmerkungen
Anmerkungen der Übersetzerin
Über Grigori Kanowitsch
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
A jidische mame,
eß git nischt beßers ojf der welt.
A jidische mame,
oj wej, wi biter wen si felt.
Jiddisches Volkslied
ERSTER TEIL
1
Ich wollte schon lange über meine Mutter schreiben, mit dem freudigen Eifer und der unbeschwerten Ausführlichkeit, mit der man sich an seine Eltern, die nächsten und liebsten Menschen, erinnern sollte. Zu meiner Schande habe ich diese gute Absicht immer wieder aufgeschoben oder nur bruchstückhaft über meine Mutter geschrieben, wie nebenbei, in einzelnen Episoden in Geschichten über meine Landsleute und Verwandten. Um das immer stärker werdende Schuldgefühl zu dämpfen, besann ich mich hin und wieder und machte mir Notizen, sogar im Schlaf, doch am nächsten Morgen hatte der anbrechende Tag die geträumten Worte, die mir so wunderbar erschienen waren, stets gnadenlos gelöscht.
Aber nun, im hohen Alter, habe ich entschieden, dass ich nicht weiter zögern darf; statt mich länger mit Gewissensbissen zu quälen, sollte ich mich beeilen, wenigstens teilweise meine Schuld gegenüber meiner Mutter abzutragen – schließlich könnte ich es sonst, Gott bewahre, nicht mehr schaffen …
Ich hatte wirklich beschlossen, mich zu beeilen, doch als ich in meinem seichter werdenden Gedächtnis nachforschte, was ich bis zum vorzeitigen Tod meiner Mutter über sie erfahren hatte, wusste ich, ehrlich gesagt, nicht recht, wo ich beginnen sollte. Noch bevor ich ans Schreiben ging, war mir bewusst, dass meine Erzählung weder geradlinig noch homogen sein würde, denn auch das Leben meiner Mutter war nicht glatt und gleichförmig verlaufen.
Am besten, dachte ich, fange ich wohl mit der fernen Zeit an, als ich noch nicht auf der Welt war, mit dem bis heute ungelösten Rätsel, wie es meine Mutter schaffte, als Schwiegertochter ins Haus meiner herrschsüchtigen und wählerischen Großmutter Roche Kanowitsch, geborene Mines, zu kommen, die in unserem Schtetl selbst von den Männern gefürchtet wurde. Nicht von ungefähr hatten unsere Landsleute, angeregt vom Schtetl-Doktor Izchok Blumenfeld, ihr den sonderbaren und etwas unheimlichen Spitznamen Roche-Samurai verpasst.
Großmutter Roche hielt ihren ältesten Sohn Solomon – Schlojmke – für den begehrtesten Bräutigam in dem winzigen, einem einsamen Fingerhut im Universum gleichenden Schtetl Jonava und wollte ihn vor einem verhängnisvollen Fehler bewahren. Ihrer Überzeugung nach gab es nicht nur in Jonava, sondern auch in ganz Litauen keinen zweiten so schönen Mann, von der Grenze zu Lettland bis zur Grenze zu Polen, von wo auf seltsamen Wegen mitunter ungeladene Gäste in das gesetzestreue Jonava kamen – freiheitsliebende Chassiden in langschößigen schwarzen Kaftanen. Sie sangen in ungeordnetem Chor Gebete und schrieben in bizarren Tänzen mit geschickten, gummiartigen Beinen Hieroglyphen auf das Straßenpflaster, die in dieser Gegend noch nie gesehen wurden – zum Ruhm Gottes, der seinen Stamm Israel geheißen hat, überall und unermüdlich fruchtbar zu sein und sich zu mehren.
Aus den Erzählungen und späten Bekenntnissen meiner Mutter, die bisweilen gern in ihre ferne Jugend zurückkehrte und keine Gelegenheit ausließ, in die Vergangenheit zu schlüpfen wie ein Eichhörnchen in seine liebste Vorratshöhle, entstand das bruchstückhafte, verworrene Gewebe meiner Geschichte. An ihrem Anfang standen das schwierige Verhältnis zwischen der unerwünschten Chanke Dudak und meiner Großmutter Roche und die Umstände der Heirat meiner Mutter und meiner Geburt. Damit, beschloss ich, sollte ich anfangen.
»Dovid, weißt du vielleicht, wo sich unser lieber Sohn Schlojmke abends rumtreibt?«, fragte Großmutter Roche mit unverhohlener Sorge ihren Mann Dovid, der düster wie der litauische Herbst und tief gebeugt an seiner Schusterbank saß.
Dovid zupfte sich gedankenversunken den dünnen rötlichen Bart und stach, als wäre außer ihm kein lebendes Wesen im Zimmer, weiter mit der Ahle in die Spitze eines abgetragenen fremden Schuhs. Es war seine Gewohnheit, auf Fragen, die nicht direkt mit seinem Handwerk zu tun hatten, gar nicht zu antworten oder allenfalls, wenn er sich doch dazu herabließ, mit einem Blick seiner tränenden traurigen Augen oder einem Neigen des Kopfes.
»Was schweigst du?! Ist Schlojmke etwa nicht dein Sohn?«
Die herbstliche Trauer in Großvaters Augen wurde kein bisschen geringer, doch hinter den Brillengläsern in der stumpfen Hornfassung blitzte matt ein schwaches Lächeln auf.
Dovid verlor keine überflüssigen Worte. Das Geld, das du mit Ahle und Schusterhammer verdienst, vor deiner Frau zu verbergen, das wäre Sünde, versicherte er. Das leg bis auf den letzten Groschen auf den Tisch, bitte sehr. Aber Worte? Wen interessieren schon Worte? Die bringen nur Missverständnisse und Unannehmlichkeiten. Sagst du deinem Nächsten die Wahrheit, weiß er dir nicht nur keinen Dank, nein, womöglich ist er noch beleidigt und versetzt dir unversehens eine Ohrfeige. Lügst du aber, spuckst du dir mit deiner Schwindelei selber in die Seele. Am besten, du schweigst. Der liebe Gott im Himmel schweigt mit Bedacht. Und auch uns Sündern gebietet Er, die Zunge im Zaum zu halten – für alle hat man sowieso nicht genug Worte! Wenn man sich schon an jemandem ein Beispiel nimmt, dann an Ihm und nicht an der Nachbarin Tajbe, deren Mund den ganzen Tag nicht stillsteht.
»Überleg doch mal, Roche. Was wäre, wenn der Allmächtige jeden Tag jedem antworten würde, der Ihn etwas fragt? Allein unsere Tajbe würde Ihn um den Verstand bringen!«
»Du bist schon ganz meschugge, du alter Trottel!«, fuhr Großmutter Roche ihren Mann wütend an. »Was hat Gott damit zu tun? Ich habe dich nicht nach Ihm gefragt. Dass der Herrgott im Himmel wohnt und dass er kein Schwätzer ist, das weiß ich auch ohne deine Spitzfindigkeiten. Der Herrgott sitzt bei sich zu Hause, auf seinem goldenen Thron, umgeben von Engeln und Cherubim, sie führen mit Ihm artige Gespräche, und zugleich schaut Er aus dem Augenwinkel nach uns allen, uns Sündern, ob wir mit unserem unvernünftigen Handeln Seine Schöpfung, die Erde, auch nicht zu sehr besudeln. Der himmlische Vater spaziert nicht nachts mit jungen Mädchen durchs Schtetl und küsst sie am Ufer der Vilija. Lass den Herrgott aus dem Spiel! Er ist am Ende des Tages genauso müde wie ein Schuster. Antworte lieber auf meine Frage – wo treibt sich unser herzallerliebster Sohn Schlojmele herum?«
Voller Übermut und Leidenschaft erzählte meine Mutter von den Monologen ihrer Schwiegermutter und von ihrem Schwiegervater, und durch diese endlosen, mit geistreichen Einzelheiten und Sticheleien gewürzten Plänkeleien erholte sie sich allmählich von Kälte und Unglück des Krieges und schien sogleich jünger. Sie versetzte sich gleichsam aus dem zerstörten Vilnius in ihr behagliches Jonava, ans Ufer der wasserreichen Vilija, die mit ihrem leisen, gesegneten Murmeln so manches Pärchen getraut hat.
»Ist dir Schlaukopf denn noch nie in den Sinn gekommen, dass dein lieber Sohn uns eines schönen Tages womöglich eine weißblonde Goika1 mit einem Kreuz um den Hals ins Haus bringt? Dass er hier auftaucht mit seiner Kralja2, sie vor dich schiebt und sagt: ›Mach dich bekannt, Tato, das ist Morta!‹ oder Antanina … und um deinen Segen bittet! Was tun wir beide dann? Ihm unseren Segen geben? Ihn rauswerfen? Oder gehen wir zusammen mit seinen Brüdern Motl und Ajsik und seinen Schwestern Leje und Chawe in die Kirche zu deinem alten Kunden Pater Vaitkus? Er traut sie, bespritzt das junge Paar mit Weihwasser, und wir bitten sie und die ganze Gemeinde um Vergebung dafür, dass wir dreckigen Juden in grauer Vorzeit mit Eisennägeln, die damals noch gar nicht verkauft und benutzt wurden, ihren lieben Gott Jesus gekreuzigt haben?«
Dovid nahm die Drohungen seiner Angetrauten mit sturer, kränkender Gelassenheit hin. Goiki wie Jüdinnen waren ihm schon seit langem gleichgültig. Tagein, tagaus war sein länglicher Kopf mit der schimmernden ovalen Glatze oben und dem spärlichen rötlichen Haarwuchs an den Seiten ganz in Anspruch genommen vom Nachdenken über fremde Absätze, Sohlen und Pechdraht, über die Lederpreise und über den dreimal verfluchten Husten, der ihn peinigte. Um seine explosive Frau zu beruhigen, verließ Großvater mühsam den sicheren Winkel seines Schweigens, nahm seinen Mut zusammen und sagte: »Jeder normale Mann in seinem Alter muss diejenige finden, die er sucht, Roche. Wie könnten wir sonst fruchtbar sein und uns mehren? Manchmal dauert die Suche länger … Und manchmal findet man die Seine sofort.«
Zufrieden mit dem eingetretenen erstaunten Schweigen seiner Frau, wischte er die scharf geschliffene Ahle an seiner geflickten Schürze ab und fuhr fort: »Ich habe dich sofort gefunden, ohne langes Suchen, obwohl so viele Frauen um mich herum waren! Ich wusste gar nicht, wo ich hinsehen sollte. Auch unser Sohn wird seine Roche finden. Gegen diese Dinge ist auch ein Wächter mit Knüppel machtlos!«
»Welche Dinge?«
»Na, das … Küssen und so«, antwortete er stockend. Anders als der Wortschatz seiner aufbrausenden, leicht zu erzürnenden Frau, aus deren Mund Beschimpfungen, Flüche und Schlüpfrigkeiten flogen wie ein Wespenschwarm, war der von Großvater Dovid rein und züchtig wie eine Peßach-Kippa. Er benutzte nie unanständige Ausdrücke, denn davon, so erklärte Großvater allen Kunden, die fluchten, wüchsen dem Menschen Disteln in der Seele. »Was denn, erinnerst du dich nicht mehr, wie wir beide … bis zum Morgengrauen … unter der Brücke über die Vilija … auf einem Bett aus Frühjahrsgras … So eine Freude, die vergisst man nie! Kurz gesagt, erinnere dich, wie wir beide uns Leib an Leib pressten.«
»Dass du dich nicht schämst!«, empörte sich Großmutter. »Leib an Leib! Pfui!«
»Für die Wahrheit muss man sich nicht schämen.« Großvater zuckte die Achseln. »Deine Schwiegermutter, meine selige Mama, wollte dich auch nicht zur Schwiegertochter, Rochele. Ganz und gar nicht. Sie fand, du seist böse wie eine Hexe und zu kurz geraten, auch deine Brust sei viel zu klein, um Kinder zu nähren, im Gesicht hättest du eine Warze wie eine Himbeere und dein Po sei platt wie ein Brett.«
Nach diesem Wortschwall war er ganz außer Atem und verstummte. Und wenn er sich die Zunge fusselig redete – gegen Roche kam er sowieso nicht an. Keine Schustertochter wünschte sich seine Angetraute für ihren Sohn, nein, eine Prinzessin, eine Großnichte von Rothschild oder wenigstens Slata, die Erbin des Jonavaer Müllers Mendl Waßerman, oder Chane, die Stieftochter des Apothekers Nota Lewit – dann bekäme sie, Roche, die an einem Dutzend verschiedener Krankheiten litt, von ihm ihre Medizin zum Sonderpreis …
Jeden Tag, den Gott werden ließ, schwebten diese amüsanten, diese schmerzlichen Erinnerungen an vergangene Zeiten wie Geisterwolken in unserer Gemeinschaftswohnung auf dem nach dem Generalissimus Stalin benannten Prospekt, in der die Stadtverwaltung von Vilnius mit einem Schwung drei unglückliche Familien untergebracht hatte, die aus der trostlosen Fremde heimgekehrt waren. Abends erinnerten sich die einstigen Flüchtlinge nach Herzenslust an das Leben vor dem Krieg, ließen in ihrer Erinnerung Dinge auferstehen, die erlebtes Unglück und neue, täglich zunehmende Ängste und Schwierigkeiten aus ihrem Kopf verdrängten. Von den kahlen, schlampig gestrichenen Wänden ohne Spiegel und ohne Bilder schienen ganze Scharen im Krieg verschollener Nachbarn und Landsleute in die Gemeinschaftswohnung herabzusteigen. Aus allen mit unausgepackten Bündeln und Rucksäcken vollgestapelten Ecken, aus erstaunlicherweise erhalten gebliebenen Fotoalben und einzelnen vergilbten Fotografien tauchten, in Grüppchen und einzeln, die getöteten Väter und Mütter, Brüder und Schwestern auf, kamen aus den Erschießungsgräben wieder ans Licht. Die Toten eilten zur langersehnten Begegnung mit ihren Angehörigen, die wie durch ein Wunder in der Fremde überlebt hatten. Hier verflochten sich auf verblüffende Weise verschiedene Schicksale, unermessliches Leid und unerfüllte Hoffnungen, berührten sich die Vergangenheit und die Gegenwart, die neue, unvorhergesehene Prüfungen und furchtbare, unvorhersagbare Gefahren verhieß. Doch die so anziehende Vergangenheit, die seit Jahrhunderten als Trost diente und der jüdischen Seele im Unglück Mut machte, diese Vergangenheit war weit größer als die vage Zukunft. Alle Bewohner unserer Behausung tauchten freudig Hals über Kopf in das Vergangene ein wie in das von der Sommersonne erwärmte Wasser der Vilija, das in ihrer leidvollen, von unersetzlichen Verlusten gepeinigten Erinnerung weiter ruhig dahinströmte und sie an die mit dichtem Gestrüpp bewachsenen Ufer lockte – die Ufer ihrer ersten Rendezvous und ihrer ersten Liebe.
Abends versammelten sich um den gemeinsamen Tisch am Stalin-Prospekt meine beiden aus diesen Erinnerungen auferstandenen Großväter und Großmütter, sämtliche Tanten und Onkel und die für immer verschwundenen Landsleute und Nachbarn. Wie ein entferntes Echo ertönten ihre Stimmen, ihre Sprache – mit großem Vergnügen kopiert und wiedergegeben von meiner Mutter, die stets zu Nachahmung und Spötteleien aufgelegt war. Diese Stimmen und Geschichten verstummten oft erst im Morgengrauen.
Ein ums andere Mal drehte meine Mutter die Zeit zurück wie eine Armbanduhr, um möglichst weit weg zu sein von den eiskalten Auls in der endlosen, vom Geheul hungriger Schakale erfüllten kasachischen Steppe, vom in giftigen Kohlestaub getauchten Hinterland des Ural, vom fremden, sich verkriechenden Vilnius.
»Der Mensch lebt, solange er sich an das erinnert, was er unter keinen Umständen vergessen darf«, wiederholte meine Mutter gern …
»Du machst dir unnötig Sorgen. Dein geliebter Sohn weiß selbst, was für eine andere Hälfte er braucht.«
Aus weiter Ferne dringen sie in der Laiendarstellung meiner Mutter an mein Ohr – der heisere Bariton meines Großvaters und der hohe, hitzige Alt von Großmutter Roche, die ihren Mann unentwegt mit ihren Ängsten nervte und die er sein Leben lang ein wenig fürchtete.
»Schlojmele ist ein Träumer. Den wickelt jedes Mädchen spielend um den kleinen Finger. Wir können nur von Glück reden, wenn er an ein anständiges Mädchen aus einer anständigen Familie gerät und nicht an eine Schamlose, die uns, Gott behüte, noch einen Bankert beschert.«
Gepeinigt von der Ungewissheit, hätte Großmutter Schlojmele am liebsten rund um die Uhr überwachen lassen, deshalb gebot sie ihrem Jüngsten, Motl, und dem Mittleren, Ajsik, König Salomon nicht aus den Augen zu lassen; und wenn sie ihn mit einem losen Mädchen aus dem Schtetl erwischten, sollten sie ihr dies ungesäumt melden, damit die Mutter weiß, wem ihr Sohn nachstellt. Die Brüder willigten notgedrungen ein (versuch mal, dich zu weigern, dann erhebt Roche ein solches Geschrei!), dachten aber nicht daran, Schlojmke zu verpetzen.
Um dennoch herauszufinden, wer das Liebchen ihres Sohnes ist, griff die unermüdliche Roche zu allen möglichen detektivischen Listen. Samstags versuchte sie in der Synagoge ihre gealterten tratschfreudigen Freundinnen auszuhorchen. Mit scharfen Augen musterte Großmutter die betenden Männer und Frauen und überlegte, wer eine heiratsfähige Tochter hatte und welche davon ihr Sohn erwählt haben mochte. Bräute lebten in Jonava mehr als genug: Arme, denen die Eltern nichts mitgeben konnten, wie Besitzerinnen einer stattlichen Mitgift, hoffnungslos hässliche wie Mädchen mit hübschem, aber dümmlichem Frätzchen. Keine von ihnen taugte nach Meinung der wählerischen und strengen Roche als Frau für ihren Sohn. Höchstens Slata, die Tochter des Müllers Waßerman, doch die studierte auf Zahnärztin in Deutschland oder Frankreich, kam nur in den Ferien ins Schtetl und gab sich mit den einheimischen ungehobelten Klötzen (ph!) nicht ab.
Wie groß war Roches Enttäuschung, als sie von Balegole3 Pejssach Schwarzman, der jeden Einwohner von Jonava von Angesicht kannte, schließlich erfuhr, wer die Glückliche war, zu der ihr Liebling ans Ufer der Liebe eilte.
Die Tochter des Schusters Schimon Dudak, Chanke! Auf sie hatte Schlomo – ihr König Salomon – ein Auge geworfen.
»Schlojmke, ich habe gehört, du hast eine Frau fürs Leben gefunden? Ist das wahr?« Roche-Samurai wurde im Handumdrehen vom listigen Detektiv zum unerbittlichen Vernehmer.
Mein Vater Solomon alias Schlojmke, Schlojmele, kam äußerlich wie in seinen Manieren ganz nach seinem Vater. Statt ohne Umschweife klar und deutlich auf die Fragen seiner Mutter zu antworten, kaute er nur mit den Lippen auf der mit Schusterwichse und Borschtsch gesättigten Luft herum. Doch anders als Großvaters kummervolles Grabesschweigen war das Schweigen seines Sprösslings zuweilen mit einem fröhlichen, nachsichtigen Lächeln versüßt. Was so viel hieß wie: Was soll man machen, bei uns Juden bleibt nichts lange ein Geheimnis. Wie sehr man etwas auch verbergen möchte, der Fuhrmann oder der Krämer Chajim Luzki bekommen sowieso Wind davon und posaunen sämtliche Geheimnisse in die Welt hinaus. Dafür sind Juden nun einmal Juden, um alles auf der Welt als Erste zu erfahren, zumindest danach zu streben, immer mehr zu wissen als alle Andersgläubigen zusammen. Wie sonst sollten sie sich im Falle eines Pogroms, Gott behüte, rechtzeitig vor den Mördern schützen?
»Können wir schon mit dem Rabbi reden? Die Chuppa aufstellen? Gäste einladen?«, attackierte Roche ihren bildschönen Sohn stichelnd und verwehrte ihm einen würdevollen Rückzug.
»Nicht doch, Mama …«
Das war die ganze Antwort.
»Was, muss es unbedingt die dicke Chanke Dudak sein? Stehen sie nach ihr im Schtetl etwa Schlange, und du hast Angst, zu spät zu kommen?«
»Hm …«
»Was, ›hm‹?! Ich rede ernsthaft mit dir, und du machst dauernd nur hm. Ist dir die Zunge in den Hintern gerutscht?«
»Ja«, antwortete Schlojmele frech, drehte sich um und brach auf zu seinem Arbeitgeber, dem berühmten Schneider Abram Kißin, sich seinen Lohn verdienen.
Roche aber konnte sich lange nicht beruhigen ob der unerhörten Dreistigkeit und Eigenmächtigkeit ihres Sohnes. Ihr ging dieses unscheinbare Hühnchen nicht aus dem Sinn, dieses kurzbeinige Flittchen Chanke Dudak. Wo waren seine Augen, dass er unter allen Töchtern von Schimon Dudak, dem zweiten Schuster am Ort, Dovid Kanowitschs ewigem Konkurrenten, ausgerechnet sie gewählt hatte? Er hätte doch ein, zwei Jährchen warten können, bis ihre Schwester herangewachsen wäre, die schöne Fejgele. Fejgele hatte schon jetzt, mit sechzehn Jahren, das, was in ehelichen Verbindungen bewanderte Heiratsvermittlerinnen kum aher4 nannten. Aber Chanke? Außerdem – wer kaufte auf dem Markt schon am ersten Fuhrwerk? Kluge Leute machten erst mal die Runde, schauten sich alle Waren an, betasteten alles, verglichen die Preise, kratzten sich am Kopf und holten erst dann die Geldbörse aus der Tasche.
»Sei nicht traurig, Roche! Das Leben wird alles an seinen Platz rücken, auch ohne dass wir uns einmischen. Ob wir ihm nachschnüffeln oder nicht – was geschehen soll, lässt sich nicht verhindern«, spann der friedfertige Dovid seinen Faden weiter. »Haben unsere Eltern es etwa anders gemacht, Roche?«
»Wenn du schon so schlau bist, kannst du mir vielleicht mal verraten, wo unsere Jungvermählten wohnen sollen?«, spielte Roche ihr As aus. »Wir leben zu siebt in zwei Zimmern, und Dudak hat sechs Kinder, vier Bräute und zwei Bräutigame, Schmule und Motl. Angenommen, Schlojmke und Chanke heiraten. Wo sollen sie schlafen, Dovid? Auf dem Dachboden? Im Heu bei den Mäusen? Oder treten wir ihnen unser Bett ab und gehen nächtens Arm im Arm unter den Sternen spazieren?«
»Das ist halb so schlimm. Wenn sie sich wirklich lieben, können sie auch eine Weile getrennt leben, er bei uns in der Fischerstraße, sie beim dicken Schimon in der Schmiedestraße. Wenn Schlojmke bei Abram Kißin ausgelernt hat und ein selbstständiger Meister wird, nimmt er sich eine eigene Wohnung …«
Großmutter Roche ließ ihren Mann nicht ausreden.
»Getrennt?! Dovid, vielleicht solltest du mal deinen Verstand flicken lassen? Wenn sie getrennt leben, wie sollen sie dann Gottes Gebot erfüllen und fruchtbar sein und sich mehren?«
»Keine Sorge!«, fiel ihr Dovid ins Wort. »Das werden sie schon erfüllen.«
Großmutter Roche hoffte noch, dass Schlojmele es sich anders überlegen würde. Dass er Chanke eine Weile nachlaufen, sich sattküssen und sie dann verlassen würde. Aber er überlegte es sich nicht anders.
Als mein Vater zum ersten Mal wagte, meine eingeschüchterte Mutter in die Fischerstraße mitzubringen, um sie ihren künftigen Schwiegereltern vorzustellen, musterte Großmutter Roche sie von Kopf bis Fuß, wie eine erfahrene Käuferin eine Färse betrachtet, die aus einem entlegenen Dorf zum Verkauf ins Schtetl oder in die Kreisstadt gebracht worden ist, und murmelte mürrisch: »Na, mein Kind, du siehst ja besser aus, als ich dachte. Bist keine Schönheit, aber auch nicht hässlich.«
Chanke wurde rot und senkte den Kopf.
»Wenn ich es recht verstehe, habt ihr beide ja schon alles entschieden …«, sagte die künftige Schwiegermutter, nicht freundlich tadelnd, sondern mit versteckter Drohung. »Ich meine, ihr habt schon für uns alle entschieden, ihr wollt einfach zusammenleben, ohne den elterlichen Segen, der sich für anständige Menschen gehört. Ihr sagt zu euch selber: ›Masl tow!‹5, schenkt euch ein Glas Wein ein, ruft ›Lechaim!‹6 und ab ins Bett!«
Dovid stand schweigend abseits, in der Hand die unabdingliche Ahle, als wollte er damit jeden Augenblick seine langjährige Gefährtin durchbohren.
»Ja«, sagte der Bräutigam fest. »Die Zeiten sind vorbei, als die Eltern in diesen Dingen das Sagen hatten und ihre Kinder wie Vieh bei den Hörnern nahmen und paarten.«
»Das waren gute Zeiten«, flötete Großmutter Roche plötzlich. »Nicht wahr, Dovid?«
»Gute Zeiten hat es, soweit ich mich erinnere, nie gegeben, Roche«, entgegnete ihr vorsichtiger Ehemann ausweichend und kratzte sich mit der Ahle die Stoppeln auf der unrasierten Wange. »Aber zu allen unguten Zeiten gibt es hin und wieder einzelne anständige Menschen.«
»Chanke ist ein guter Mensch«, nahm der König Salomon von Jonava, der sich nie durch besondere Kühnheit ausgezeichnet hatte, diesen Gedanken auf. »Sie ist ein guter Mensch«, wiederholte er. »Da könnt ihr sicher sein.«
Die Lobesworte und Beteuerungen ihres Sohnes überzeugten meine unnahbare Großmutter nicht. Dazu war ein Hahn schließlich ein Hahn, dass er sich auf dem Hof vor den dummen Hühnern mit schönen Gesängen spreizte. Sie verlangte von ihrem Sprössling andere, gewichtigere Beweise.
»Übrigens, was kannst du eigentlich, mein Kind, außer die Herzen junger Burschen erobern?«, führte sie mit polizeilicher Strenge ihr Verhör fort und ignorierte dabei Dovids seltsames Zwinkern und seine albernen Grimassen – es reicht, Roche, hör auf, das Mädchen zu quälen. Großvater hätte seine Frau am liebsten daran erinnert, dass sie selbst vor ihrer Heirat nicht mehr konnte, als Pellkartoffeln kochen und zu Gott beten.
»Ich kann lieben«, antwortete meine Mutter, womit sie nicht nur die unnahbare Roche verblüffte, sondern auch ihren Bräutigam. »Wer liebt, kann alles lernen.«
»Lieben kannst du? Und kochen, waschen, bügeln, Fußböden wischen und aufräumen, kannst du das auch?« Großmutter Roche verschluckte sich an ihrer eigenen Aufzählung und wurde plötzlich heiser.
»Alles, was ich tue, tue ich mit Liebe«, sagte Chanke mit treuherzigem Stolz, sah den beiden Alten, die wie versteinert dastanden, offen ins Gesicht und platzte heraus: »Ich werde auch Sie beide lieben.«
Dovid erstarrte und hätte sich beinahe die Ahle in die eingefallene Wange gebohrt, und Großmutter schnäuzte sich laut, wischte sich aber merkwürdigerweise nicht die Nase, sondern die Augen.
»Wir werden sehen«, nuschelte sie. »Wenn wir es noch erleben.«
2
Roche beschwor ihren Sohn, mit der Hochzeit noch zu warten. In ihrem Haus gebe es keinen einzigen freien Platz für die Jungvermählten. Alle Betten seien belegt, durch die holzwurmzerfressenen Wände höre man nicht nur das Pfeifen der Lokomotive und das Donnern der an Jonava vorbeifahrenden Züge von draußen, sondern auch jeden Pups und jeden Schnarcher aus dem Nebenzimmer. Wie wolle er, Schlojmele, in dieser Enge seine ehelichen Pflichten erfüllen? Er möge, so die Großmutter, doch noch ein wenig warten, bis er auf eigenen Beinen stehe, seine festen Kunden habe, mehr verdiene und für wenig Geld einen Winkel mieten könne – entweder beim Hausbesitzer Efraim Kapler, dem aufgeblasenen Puter, dem Dovid, Gott schenke ihm noch viele Jahre, sein Leben lang die Schuhe und Stiefeletten repariere, oder bei dem anderen Reichen, der Wohnungen vermiete, dem Gestütsbesitzer Klejman. So lange aber müssten er und Chanke getrennt leben.
»Getrennt?!« Der Bräutigam machte große Augen.
»Wenn Chanke dich wirklich liebt, und ich sehe an ihren Augen, dass sie dich liebt, dann wird sie nichts dagegen haben. Wird dir schon nicht davonlaufen, dein Milchbrötchen, sie wird warten. Keine Sorge. Einen Burschen wie dich verlässt man nicht, den tauscht man auch nicht gegen einen anderen«, schmeichelte Roche ihrem Sohn.
»Noch will niemand die Chuppa aufstellen und Rabbi Eliëser einladen. Wir heiraten, wenn ich vom Armeedienst zurück bin.«
»Sag bloß, die Litauer nehmen in ihrer Armee keine Verheirateten? Lassen sie zu Hause, damit ihre Frauen nicht vor lauter Sehnsucht verbotene Zärtlichkeiten suchen?«
»Sie nehmen auch Verheiratete.«
»Aber was wollen sie mit einem Schneider als Soldaten, noch dazu mit einem Juden? Mit einem Bajonett flickt man doch keine Hosen.«
Schlojmele lachte.
Die starrköpfige Roche hätte dem Bund der beiden vielleicht schweren Herzens sogar ihren Segen gegeben, denn die törichte Chanke war zu allem fähig – womöglich lief sie mit ihrem Liebsten fort aus Jonava oder wurde vor der Hochzeit schwanger. Um Schlojmele nicht zu verlieren, wäre Roche zu Kompromissen bereit gewesen, sogar dazu, im Haus enger zusammenzurücken. Mit Hilfe von Motl und Ajsik könnten sie das uralte Doppelbett in die Diele schaffen, das aus der Zeit der ägyptischen Gefangenschaft zu stammen schien, schon in die Erde eingewachsen war und eigentlich nur noch als Hühnerstange taugte. Andererseits war es wohl besser, nichts zu überstürzen, abzuwarten, möglicherweise brachte die Armee Schlojmele und Chanke auseinander. Zwei Jahre Dienst waren kein Kinderspiel. Da fanden vielleicht andere Gefallen an dem Milchbrötchen. Womöglich hielt auch das kleine Zicklein es nicht aus bis zu Schlojmes Rückkehr und verdrehte einem anderen den Kopf.
Doch das uralte Doppelbett blieb, wo es war. Schlojmke wurde zur Armee einberufen und in einen recht weit von Jonava entfernten Ort am Neman geschickt, in die Kreisstadt Alytus. Zum Erstaunen aller Juden im Schtetl kam er in ein Kavallerie-Regiment, zu den Ulanen oder Dragonern, dabei konnte sich Schlojmke weder eines besonders großen Wuchses rühmen, noch hatte er je einen Fuß in einen Steigbügel gesetzt.
»Die Kommandeure wissen besser, wer wo und als was dienen soll«, beruhigte Ajsik, der älteste Sohn und oberste Ratgeber und Tröster der Familie, seine Mutter Roche. »Es ist doch nicht schlecht, wenn unser Bruder Schlojmke neben dem Schneidern auch noch auf einem Pferd reiten lernt.«
»Wozu?«, fragte Großmutter Roche ängstlich nicht Ajsik, sondern den lieben Herrgott. »Wozu soll ein Jude auf einem Pferd reiten? Wo hast du, Ajsik, je einen Juden auf einem Pferd gesehen? Ich kenne den Balegole Pejssach Schwarzman schon eine Million Jahre, aber noch nie hab ich gesehen, dass er im Sattel sitzt, dabei hat er im Stall drei kräftige Lastpferde. Er nimmt sie immer am Zaumzeug, wenn er mit ihnen zur Vilija hinuntergeht. Normale Juden bezahlen für ein Pferd nur, wenn sie mit einem Fuhrwerk irgendwohin fahren müssen, nicht, weil sie wie die Besessenen auf einem Pferd durch Litauen galoppieren wollen. Wej zu mir, wej zu mir7, er wird noch herunterfallen, sich den Kopf aufschlagen und zum Krüppel werden!«
Großmutter Roche bekam Alpträume, sie sprang dann schreiend auf, lief durchs Haus und flüsterte Gebete. Beruhigung bescherte ihr nicht ihr Sohn und nicht ihr Mann, sondern der schnellfüßige Postbote Kazimiras, der ihr einen Monat nach Schlojmkes Einberufung einen Brief aus Alytus brachte. In dem grauen Kuvert lag eine sorgfältig in Papier eingeschlagene kleine Fotografie: Roches bildschöner Sohn in Militäruniform und mit Schirmmütze hoch zu Roß.
»Ein General«, stammelte Roche-Samurai, küsste das Foto dreimal und fing an zu weinen.
Wahrscheinlich hatte Schlojmke eine ebensolche Fotografie auch an Chanke geschickt. Ganz bestimmt. Ihr doch wohl zuallererst. Warum war sie da nicht zu ihnen in die Fischerstraße gekommen, um sich zu brüsten und die Freude mit ihnen zu teilen? Zu sagen – schauen Sie, Roche, unser Schlojmke! Ein kühner Ulan! Darauf ist die Ärmste wohl nicht gekommen. Dabei soll man Freude doch mit allen teilen, davon wird sie nicht weniger, sondern nur mehr.
Doch Chanke ließ sich nicht in der Fischerstraße blicken, obwohl sie versichert hatte, sie werde sie alle lieben.
Roche versuchte sie abzupassen, ihr aufzulauern, aber Chanke war wie vom Erdboden verschluckt. So oft Roche Freundinnen, Nachbarn, Synagogenbesucher und Krämer auch nach ihr ausfragte – alle zuckten nur die Achseln, niemand wusste Bescheid über Schimon Dudaks älteste Tochter. Da entschied die vor Neugier vergehende Großmutter Roche, keine Umwege mehr zu machen, und steuerte auf dem Hof der Synagoge wie eine Ente im Teich geradewegs Schimon Dudak selbst an, mit einem erfundenen verlockenden Vorschlag für Chanke. Ihr, also Roches, alter Freund, der Eisenwaren- und Werkzeughändler Jeschue Kremnizer, suche für seinen Enkel Rafael ein gutes jüdisches Kindermädchen. Vielleicht sei die arbeitslose Chanke ja an einer solchen Stelle interessiert? Ein paar Groschen mehr könnten doch in einer Familie mit acht Mäulern nicht schaden.
»Chanke ist nicht da«, antwortete treuherzig Schimon, der im Schtetl eher für seinen samtigen tiefen Bariton berühmt war als für seine Ahle. Wenn er an der Schusterbank saß, sang er den von den schlechten Wegen ramponierten Schuhen und Stiefeln oft fröhliche Lieder über Rabbiner und ihre gehorsamen Schüler oder über geschickte Schadchen und Kupplerinnen vor. Manchmal schmetterte Schimon auch auf Russisch eine Strophe aus dem flotten Lied über die mächtige Wolga und den Räuber, der seine persische Geliebte in den Fluss wirft. Dieses Lied hatte Dudak aus Witebsk mitgebracht, wohin der russische Zar die Juden aus dem Grenzgebiet Litauens als angebliche »deutsche Spione« umgesiedelt hatte.
»Wie – nicht da?! Wo ist sie denn?«
Großmutter hatte nicht den mindesten Zweifel daran, dass die Tochter nicht verreist sein konnte, ohne ihrem Vater zu sagen, wohin. Von Schimon würde sie also alles erfahren.
»Chanke ist zum Militär gefahren«, antwortete Großvater Dovids ewiger Konkurrent zaghaft oder mit heimlicher Besorgnis.
»Was, holen die Litauer jetzt auch schon Jüdinnen in ihr Heer? Das ist ja das Ende der Welt!«
»Chanke ist, wie soll ich sagen, sie ist aus eigenem Willen hingefahren.« Bei diesen Worten lag ein schüchternes Lächeln auf Schimons Gesicht und glättete mit seinem matten Leuchten die Furchen auf seiner Stirn. »Ihren Sohn Schlojmke will sie besuchen.« Und als wollte er ihre Tat rechtfertigen, setzte er hinzu: »Die Tochter des Krämers Luzki ist ihrem Galan, dem Blechschmied Henech, sogar nach Amerika gefolgt. Können Sie mir sagen, wer dort in Amerika so dringend einen Blechschmied braucht? Und zwar ausgerechnet aus unserem Jonava? Ich habe gehört, dass auch Ihre Leje in diese Richtung schaut.«
»So, das haben Sie also gehört, aber ich, Lejes leibliche Mutter, habe nichts davon gehört. Von wem, wenn ich fragen darf, haben Sie das denn gehört? Wer ist der Falke, der gesehen hat, in welche Himmelsrichtung Leje fliegen will?«
»Die Leute sagen das.«
»Die Leute sagen auch, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Und glauben Sie das, Schimon? Warum drehe ich mich dann nicht, und Sie drehen sich nicht, und Rabbi Eliëser mit den Thorarollen in der Hand dreht sich nicht, samt allen Gläubigen in der Synagoge?«
Schimons Worte hatten Roche betroffen gemacht, doch das wollte sie nicht zeigen. Nicht einmal in Gedanken ließ sie zu, dass ihre Kinder weggehen und sie für immer mit dem Schweiger Dovid alleinlassen könnten. Zwar hatte Ajsik einmal angedeutet, dass er nicht in Litauen bleiben würde, dass er sein Glück woanders versuchen wolle. Aber dass Leje, ihre Älteste, auswandern wollte? Noch dazu nach Amerika? Das zu glauben weigerte sich Roche.
»Sagen Sie mir lieber, Schimon, wie lange wollen Schlojmke und Ihre Tochter Chanke zusammen auf einem Pferd reiten dort in Alytus?« Roche bohrte ihre Frage wie eine Speerspitze in Schimons lächelndes Gesicht, doch der wusste nichts von gemeinsamem Reiten, gähnte herzhaft, mit weit offenem Mund, und antwortete: »Gott allein weiß, wie lange. Vielleicht ihr ganzes weiteres Leben.«
Diese Nachricht erschütterte Roche. Sie konnte ihren Unmut und ihre Bewunderung für die Hartnäckigkeit der liebenden Chanke nicht unterdrücken und entschied sogar, was eine große Seltenheit war, ihrem Mann von den Gerüchten über Lejes Absichten und von Chankes Reise nach Alytus zu erzählen.
»Was sagst du dazu?«
»Was soll man dazu sagen?«, brummte Dovid. »Kinder sind wie Vögel. Sitzen eine Weile auf einem Zweig, putzen sich die Federn, zwitschern herum und fliegen auf einen anderen Baum. Der Zweig schwankt eine Weile und beruhigt sich wieder. Und was Chanke angeht, sie ist ein entschlossenes Mädchen. Sie wird alles tun, um das Ihre zu erreichen.«
»Außer mir, deiner rechtmäßigen Frau, würdest du jeden auf der Welt unter deine warmen Fittiche nehmen, jedem über den Kopf streicheln und beistehen!«, stichelte Großmutter. »Heute, nimm mir das bitte nicht übel, aber heute würde ich einem Schatz wie dir nirgendwohin mehr folgen … Nicht nach Alytus und nicht nach Schmalytus. Ich hatte Mitleid mit dir Tölpel.«
»Was soll man machen, Roche! Nichts ist süßer als die Fehler der blinden Jugend … Vielleicht hätten wir beide wirklich Fahrkarten für verschiedene Züge gekauft, aber, meine Liebe, wir sind nun mal in denselben Waggon gestiegen und waren, wie mir scheint, glücklich. Nun müssen wir mit all unseren Sünden und Habseligkeiten im rüttelnden Zug zusammen weiterfahren, bis der Herrgott uns das Himmelstor auftut. Und Chanke, so scheint’s, wird das Ihre erreichen, sie wird nicht von unserem lieben Sohn lassen. Ob du willst oder nicht, wir werden in unserem Haus bald ein Fest feiern.«
»Hast du es aber eilig! Ein Fest! Vielleicht vergnügen sie sich in Alytus ja eine Weile und laufen wieder auseinander! Dann, Dovid, werden wir in unserem Haus wirklich ein Fest feiern.«
»Mein Herz sagt mir, Roche, sie werden nicht auseinanderlaufen.« Er wischte sich mit dem Hemdsärmel die Stirn ab, sah seine Frau voll ängstlicher Bewunderung an und setzte hinzu, als weihte er sie in ein Geheimnis ein: »Als Erstes, Roche, werde ich dir neue Schuhe machen, aus Chromleder und mit hohem Absatz. Danach gehen wir zu dem Frauenkenner Henech Scharfschtejn und bestellen bei ihm ein Kleid aus Chinakrepp, zum Schluss macht Nochem Kowalski dir eine schöne Frisur, denn du läufst ja die ganze Zeit mit zerzausten Haaren herum, und mir wird Gedalje Bankwetscher einen zweireihigen Anzug schneidern, und dann trinken wir beide auf der Hochzeit ein Gläschen auf das Glück der beiden …«
»Was höre ich da?« Roche machte ihrer Freude stichelnd Luft: »Der liebe Gott hat ein Wunder gewirkt!«
»Ein Wunder?« Ihr Mann sah sie erstaunt an.
»Nach sechzig Jahren völliger Stummheit redest du zum ersten Mal nicht wie ein Schuster, sondern wie ein Ehemann! Was ist nur in dich gefahren, mein Lieber?«
»Wieso machst du aus mir ein gefühlloses Ungeheuer?! Ohne Herz und Verstand!«, empörte sich der friedfertige Dovid.
»So etwas, Dovid, hätte ich bisher nicht einmal mit der Kneifzange aus dir herausbekommen. Schuhe aus Chromleder, ein Kleid aus Chinakrepp, eine Frisur … Wieso hast du so lange geschwiegen?« Sie trat zu ihrem Mann und umarmte ihn ungelenk. »Vielleicht machst du mir wenigstens im Alter zum ersten Mal eine Liebeserklärung?«
»Kann ich tun«, erklärte Großvater kühn. »Das kostet mich gar nichts, Gott ist mein Zeuge«, sagte er lächelnd.
»Schon gut, schon gut«, beschwichtigte Großmutter ihren Mann.
Der großzügige Schimon Dudak hatte seiner Tochter für die Reise seinen Segen gegeben und sie gemahnt, nicht zu lange in der fremden Stadt zu bleiben, damit sich ihre Eltern keine unnötigen Sorgen machten.
»Fahr nur, fahr. Ein Vogel, der die ganze Zeit auf einem Zweig sitzt, verlernt womöglich das Fliegen«, sagte er.
Schlojmke, der Sohn seines Konkurrenten und Altersgenossen Dovid Kanowitsch, gefiel ihm. Schwarze Brauen, stattlich, große Augen! Ein Stiller und kein Faulpelz. Wem würde ein solcher Schwiegersohn nicht gefallen? Zumal Schimon vier Töchter zu verheiraten hatte – es wäre schließlich keine Freude, wenn sie als alte Jungfern endeten. Was nützt ein ausgetrockneter Brunnen, aus dem keiner trinken kann? Um seine Älteste machte sich Schimon keine Sorgen.
3
In Alytus geriet Chanke in einen heftigen, schräg fallenden Regen und wurde nass bis auf die Knochen. Sie lief in einen dunklen Hauseingang, verbarg sich dort, schaute sich nach allen Seiten um und wrang fröhlich und beherzt ihre Satinbluse und ihren Rock aus. Als zwischen Wolkenfetzen, die vor dem Wind Reißaus nahmen, die karge litauische Sonne hervorkam, war Chanke ein wenig getrocknet, fasste Mut und verließ ihren Unterschlupf. Ohne jede Orientierung im Gewirr der Straßen und Gassen machte sie sich auf die Suche nach ihrem Ulanen. Sollte sie bis zum Sonnenuntergang die Einheit, in der Schlojmke diente, nicht gefunden haben, überlegte meine künftige Mutter, würde sie in der Synagoge der Stadt übernachten. In jedem Schtetl findet sich für verirrte Reisende im Bethaus stets ein klappriges Sofa mit einer dünnen Matratze, einem harten Kissen und frechen Wanzen. Sie würde im Gotteshaus übernachten und am nächsten Morgen einen Juden auf der Straße nach dem Weg zu den Kasernen fragen.
In ihrem ganzen zwanzigjährigen Leben war Chanke noch nie verreist gewesen, abgesehen von der längst vergessenen Stadt Witebsk. Dorthin war sie 1914 als kleines Mädchen zusammen mit allen – angeblich unzuverlässigen – Juden vom russischen Zaren, dessen Name im Gedächtnis ihrer Stammesgenossen für lange Zeit als Verkörperung des Hasses auf die Flüchtlinge mosaischen Glaubens haftete, aus Jonava deportiert worden. Meine Großmutter mütterlicherseits rügte ihren Mann Schimon manchmal: »Was schaust du mich mit solcher Verachtung an wie Zar Nikolai die Pejes?«
Alytus war größer als Chankes Heimatschtetl. Die Straßen waren breiter, die Häuser höher, die Schaufensterauslagen reicher. In Jonava kannte Chanke alle Gassen und Winkel, jeden Krämerladen, jede Werkstatt, jeden Frisiersalon, die Post, die Kaserne, den Exerzierplatz der Soldaten der lokalen Garnison und sogar das Polizeirevier.
Ach, würde ihr doch jetzt ein Polizist begegnen wie Vincas Gedraitis, der Ordnungshüter von Jonava, ein häufiger Gast in ihrem Haus in der Schmiedestraße, fast ein Freund der Familie, und ihr helfen, sich nicht zu verlaufen.
Vor dem Peßachfest kam Gedraitis, schneidig, in voller Uniform, gewöhnlich beim Schuster Schimon vorbei, um von Matzen und Honigwein zu kosten, vor allem aber, um mit ihm in reinstem Jiddisch über die Jungfrau Maria, den gekreuzigten Jesus Christus und über die Apostel zu reden. Gedraitis, ein eifriger Katholik, weigerte sich zu glauben, dass sie alle Juden seien.
»Das kann nicht sein, das kann nicht sein! Das ist unmöglich! Schuster gibt es bei euch, Schneider gibt es und Geldverleiher, aber keine Apostel! Die Apostel gehören alle zu uns. Die eignet euch bitte nicht an.«
»Es sind Juden, Juden«, brummte Schimon friedfertig, weil er sich nicht mit Gedraitis streiten wollte. Der Polizist sprach aus Respekt vor dem Hausherrn mit ihm nicht Litauisch, sondern immer Mameloschn. »Ebensolche Juden wie wir, stell dir vor.«
»Ein Jude kreuzigt doch keinen Juden«, beharrte der phlegmatische, gutmütige Gedraitis, Matze knuspernd. »Ein Litauer schon. Ein Pole auch. Oder ein Deutscher. Aber ein Jude – nie im Leben! Einen Stammesbruder betrügen, ja, da zuckt er nicht mit der Wimper, ihn übers Ohr hauen, ihn denunzieren, das ja. Aber kreuzigen?«
»Ist es denn so wichtig, von wem der Herrgott und seine Apostel abstammen? Sag mir lieber, wo die bösen Juden die Nägel gekauft haben, mit denen sie den armen Jesus ans Kreuz geschlagen haben?«, fragte Schimon spöttisch, während er zusah, wie der Gast Matze mampfte. »Bei Reb Jeschue Kremnizer etwa oder vielleicht in Ukmerge bei Schmuelson?«
Er kicherte.
»Schimon, du bist nicht nur geschickt im Schuheflicken, du bist mit der Zunge genauso flink wie mit dem Hammer auf dem Leisten … Darin bist du ein wahrer Meister! Aber sieh dich vor! Auch wenn du Schuster bist!«, sagte Vincas Gedraitis, verabschiedete sich bis zu den knusprigen Matzen im nächsten Jahr und umarmte den Alten fest.
In Alytus kannte Chanke niemanden. Nachdem sie mit ihrem Segeltuchköfferchen eine Weile durch die fremde Stadt geirrt war, beschloss sie doch, einen Passanten, der aussah wie ein Jude, um Auskunft zu bitten, wie sie vorm Dunkelwerden das ersehnte Ziel erreichte – die Soldatenkasernen.
Vor einem Geschäft, auf dessen Schild ein riesiger Damenschuh mit sehr hohem Absatz prangte und das in großen Lettern auf Jiddisch und Litauisch verkündete: »Mejr Liberson. Die besten Schuhe in Europa«, und unter »Europa« zum Anlocken der gewünschten Kundschaft in kleinerer Schrift: »Billig und haltbar«, vor diesem Geschäft hielt Chanke höflich einen schmalbrüstigen schwarzhaarigen Mann in einem langen schwarzen Gehrock an und fragte, ob er ihr, der Ortsunkundigen, vielleicht sagen könne, wo hier die Ulanen dienten.
»Die Ulanen?« Der Unbekannte starrte sie verständnislos an. »Wer ist denn das?«
»Soldaten«, antwortete Chanke verlegen. »Aber nicht zu Fuß, sondern auf Pferden.«
»Was will denn ein hübsches jüdisches Mädchen von berittenen Litauern?«, fragte der Mann spöttisch und tippte mit den Fingerspitzen an seinen verbeulten schwarzen Hut.
Das hübsche jüdische Mädchen deutete seine Handbewegung als Abschiedsgeste und erwiderte hastig: »Ich suche meinen Freund. Er wurde vor kurzem zum Militär einberufen und leistet hier in Alytus seinen Dienst ab.«
»Ist er Jude?«
»Ja, er ist Jude … Ein Schneider.«
»Das höre ich zum ersten Mal, dass ein Jude, noch dazu ein Schneider, zur Kavallerie einberufen wurde. Reiter hat es bei uns noch nie gegeben.« Der Fremde besprenkelte seine eingefallenen, krankhaft gelben Wangen einige Male mit einem Lächeln. »Erwartet er dich dort?«
»Nein. Aber ich habe ihn lange nicht gesehen. Und möchte ihn unbedingt wiedersehen.«
»Ein löblicher Wunsch. Kannst du wenigstens ein bisschen Litauisch?«
»Wenn Kunden aus den umliegenden Dörfern mit meinem Vater reden, er ist Schuster, höre ich zu und habe einiges behalten. Aber sprechen kann ich nur stockend, wie eine Ziege meckert«, bekannte Chanke. »Es gibt niemanden weiter, mit dem ich Litauisch sprechen könnte. Bei uns im Schtetl leben mehr Juden als Litauer.«
»Und wie willst du ihn dann finden?«
»Ich werde ihn abpassen.«
»Nun, vielleicht hast du ja Glück. Die Kasernen sind weit außerhalb der Stadt, am Ufer des Neman. Ich würde dich ja hinbringen, aber ich kann nicht. Ich muss rasch in die Apotheke, Medizin holen. Meine Frau ist krank. Sehr krank. Sie liegt schon die dritte Woche im Bett. Die Kinder, eins kleiner als das andere, sind ohne Aufsicht. Ich darf sie nicht lange allein lassen.«
»Danke. Ich werde beten für Ihre Frau, dass sie schnell wieder gesund wird.«
»Und ich werde für dich beten. Wie heißt du?«
»Chanke Dudak.«
»Liebe Chanke, Gott nur für sich selbst zu bitten ist wahrhaftig eine Sünde, wir müssen Ihn bitten für alle, und Er, der Allmächtige, wählt aus den vielen aus, wer Seiner Gnade am meisten würdig ist. Die anderen müssen sich hinten anstellen«, sagte der Mann, und nun huschte das Lächeln wie ein Sonnenstrahl über seine schütteren Bartstoppeln. »Du gehst erst geradeaus, biegst an der Werkstatt des Blechschmieds nach rechts ab, überquerst den Platz, nach hundert Metern wendest du dich nach links, dann gehst du um die Kirche herum und von dort, ohne abzubiegen, geradewegs zum Neman hinunter. Wenn du dich verläufst, komm zu uns. Kudirkos-Straße achtzehn. Ich heiße Hilel Lejserowski. Kannst du dir das merken?«
»Ja.«
»Der Allmächtige beschütze dich!«
Chanke hoffte nicht sehr auf den Allmächtigen und wandte sich im Unterschied zu ihren Landsleuten, die den lieben Herrgott von morgens bis abends mit Bitten behelligten, nie an Ihn, sondern hörte auf ihr eigenes Herz, das sie beriet, sie leitete und sie beschützte.
»Damals in Alytus hat mich die Liebe geleitet. Sie war mein treuester und bester Wegweiser«, erzählte meine Mutter mir, dem Philologiestudenten, viele Jahre später mit ironischem Stolz. »Allerdings kann einen die Liebe manchmal auch Gott weiß wohin führen. Doch mich hat sie nicht im Stich gelassen, sie hat mir geholfen, mich nicht zu verirren und schließlich mein Ziel zu erreichen.«
Chanke, in der Hand das mit Mitbringseln prall gefüllte Segeltuchköfferchen, lief lange in der Sperrzone herum und schaute in jede Ritze des hohen Zauns, der über die ganze Länge oben mit Stacheldraht bewehrt war. Den Eingang zu dem eingezäunten Gelände bewachte ein stämmiger rotwangiger Posten, der aussah wie ein Bauer, der eben vom Acker gekommen und rasch in die Soldatenuniform geschlüpft ist. Hinter breiten Lücken im Zaun sah sie das einstöckige Stabsgebäude des Kavallerie-Regiments, eine ungeordnete Reihe gesichtsloser, einförmiger Kasernen aus Stein, Pferdeställe und den weiträumigen leeren Platz für den täglichen Ausritt der Rassepferde der Armee.
Chankes endloses Hin- und Herlaufen, ihr hartnäckiges und fruchtloses Spähen durch die Ritzen erregte die Aufmerksamkeit des von Untätigkeit und Langeweile geplagten Postens. Die übermäßige Neugier der jungen Frau, die ganz offensichtlich Jüdin war, weckte bei ihm verständlichen Argwohn. Er verließ seinen Posten und kam mit schaukelndem Gang und mit einer gewissen hochmütigen Trägheit auf sie zu.
Als der Wachsoldat die ungebetene Besucherin erreicht hatte, musterte er sie von Kopf bis Fuß, als wollte er erraten, warum sie gekommen war und was für einen geheimnisvollen Koffer sie da in der Hand trug. Mir betonter Strenge fragte er: »Ko cia, panele, iesko?«8
Chanke konzentrierte sich und formte aus ihrem geringen Vorrat an Wörtern eine Antwort in der schwierigen Amtssprache des Landes: »As ieskot chaveras. Slomo Kanovich.«9
Sie brachte es fertig, sämtliche litauischen Wörter falsch auszusprechen, bis auf das Personalpronomen »ich« und den Namen dessen, den sie suchte.
Der Posten verzog das Gesicht über die Unfähigkeit des Mädchens, sich in der Sprache seines vor Feinden streng bewachten Staates auszudrücken, überwand jedoch seinen Unmut und stellte ihr eine Frage, deren Beantwortung seine Zweifel zerstreuen konnte: »Jis cia tarnauja?«10
Chankes Gefühl sagte ihr, was er wissen wollte. Sie nickte so heftig, dass ihre schwarzen Locken hüpften, öffnete schnell den Koffer, zog unter den Mitbringseln vorsichtig eine abgewetzte Brieftasche mit einem in Zeitungspapier eingeschlagenen Foto hervor und reichte es dem Wachposten.
Der Soldat warf einen Blick auf das Bild, erkannte das Regimentspferd und sagte schon freundlicher: »Palauk!«11
Er drehte sich um und lief zur Pforte.
Chanke wartete ungeduldig und dachte, wenn Schlojmke einverstanden wäre, würde sie, um ihn öfter zu sehen, in Alytus bleiben. Sie würde sich eine Arbeit als Verkäuferin suchen, am besten in einem Kurzwarengeschäft, oder sich in einem anständigen Haus als Kindermädchen verdingen, ein billiges Dachbodenzimmer mieten, von ihr aus auch ein Kellerzimmerchen mit einem winzigen Fenster!, und die gesamte Dienstzeit ihres Geliebten wie er in dieser fremden Stadt verbringen. War er dagegen, wollte Chanke in Jonava Geld verdienen, um ihn jeden Samstag in Alytus besuchen zu können. Wenn er ihr das nur nicht ausredete, wenn er nur einverstanden war! Samstags durften die jüdischen Soldaten angeblich in die Synagoge gehen. Dann würden sie alle zusammen – sie, Chanke, ihr Auserwählter und der gute Mensch Hilel Lejserowski mit seiner genesenen Frau und den Kinderchen – beten und den lieben Herrgott bitten, dass Schlojmke der Dienst leicht wurde und er, Gott behüte, nicht im Galopp vom Pferd fiel. Was machte es schon, dass weder sie noch Schlojmke zu beten verstanden, wie es die heiligen Bücher vorschrieben, obgleich ihre Eltern ihnen ständig ins Gewissen redeten und sie für ihre Unbildung schalten, im Zorn sogar voller Bitterkeit fragten, was sie eigentlich seien, Juden oder Konvertiten. Und obwohl sie alle beide ihren Eltern immer wieder erklärten, dass man nicht nur laut, mit den auswendig gelernten Formeln oder nach dem Gebetbuch beten könne, sondern auch still, mit dem Herzen, lachten diese sie nur aus und rechneten mit der unausweichlichen gerechten himmlischen Strafe.
Die Zeit schien plötzlich stehengeblieben, als wollte sie Chanke verspotten, und ihr zögerliches Vorgehen verhieß nicht den gewünschten Erfolg: Der Wachposten war wie vom Erdboden verschluckt. Chanke flüsterte Unverständliches vor sich hin und versuchte, wie eine Wunderheilerin vom Dorf, mit selbsterfundenen innigen Beschwörungsformeln die Begegnung mit dem Liebsten schneller herbeizuführen und ihn wenigstens für ein, zwei Stunden aus der Kaserne zu locken.
Als sie vom langen Warten schon der Verzweiflung nahe war, lachte ihr doch noch das Glück. In Begleitung des Wachpostens kam Schlojmke durch die Pforte, braungebrannt, in Uniform, die ihn größer und schlanker wirken ließ, und Chanke erstarrte, statt ihm, von Freude überwältigt, entgegenzustürzen.
Mit ein paar flotten, energischen Schritten war Schlojmke bei ihr, umarmte und küsste sie und wischte ihr langsam und vorsichtig die Tränen von den Wangen.
»Schon gut, schon gut«, sagte er. »Du kannst gar nicht weinen, du schniefst bloß. Komm, gehen wir zum Fluss. Bis zum Abendappell habe ich frei. Mein Kommandeur, Hauptmann Kuolalis, hat mich gefragt, wer die Frau ist, die vor unserem Zaun auf mich wartet, und ich habe, ohne mit der Wimper zu zucken, geantwortet: ›Das ist meine Frau! Sie ist aus Jonava hergekommen!‹ Er hat mir geglaubt und mir für meinen ausgezeichneten Dienst bis zum Abend freigegeben. War meine Antwort richtig, Chanke?«, erkundigte sich Schlojmke mit jungenhaftem Schalk. »Bist du wirklich einverstanden, meine Frau zu werden?«
»Ja, das bin ich«, antwortete Chanke unter Tränen, ließ den Koffer fallen und fiel Schlojmke um den Hals.
Sie gingen hinunter zum Neman, fanden eine Wiese am Fluss und setzten sich einander gegenüber. Chanke öffnete den Koffer, nahm ein Tischtuch heraus, breitete es aus und verteilte darauf, was sie mitgebracht hatte – Rosinenkuchen, Marzipankekse, Lutschbonbons, rund und glänzend wie die Knöpfe einer Gymnasiastenuniform, Walnüsse, zwei kleine neusilberne Becher und eine in ein Küchenhandtuch eingewickelte ungeöffnete Flasche Peßach-Wein. Doch der Segeltuchkoffer enthielt nicht nur Leckereien. Am Boden leuchteten auch zwei nicht essbare Geschenke – ein von Chanke eigenhändig besticktes Taschentuch mit raffinierten Schnörkeln und gestrickte Fäustlinge aus Schafwolle.
»Du hättest noch Kartoffelkugel mitbringen sollen!«, schalt Schlojmke sie zärtlich.
»Kugel werde ich dir hier machen.«
»Wo? In der Kaserne?«
»Ich habe beschlossen, in Alytus zu bleiben. Ich suche mir eine Arbeit, miete mir in der Stadt einen billigen Winkel, und dann leben wir hier, bis dein Dienst zu Ende ist, und kehren gemeinsam heim. Ist es nicht egal, wo man arbeitet?«
»Na sag mal! Du willst bleiben wegen dem Kugel? Bist du närrisch?«
»Wegen dem Kugel, ja, wegen dem Kugel … Die Kartoffeln schmecken hier besser als bei uns im Schtetl.« Chanke kniff listig funkelnd die Augen zusammen, schnitt den Rosinenkuchen auf und schenkte süßen Festtagswein in die Becher.
»Auf dich!«, sagte sie und stieß mit Schlojmke an. »Und darauf, dass dein Pferd dich liebt! Und auf dich achtgibt …«
»Auf dich, Chanke.«
Er leerte den Becher in einem Zug und fragte sie dann gründlich nach seinen Eltern, seinen Brüdern und Schwestern und nach ihrer eigenen Familie aus. Chanke berichtete ihm rasch und ausführlich von allen Neuigkeiten im Schtetl.
»Gott sei Dank sind alle gesund und munter. Keine Beerdigungen und keine Hochzeiten. Aber es sind noch mehr Juden hinzugekommen. Meine Freundin, du kennst sie, Dwojre Kamenezkaja, die hat Zwillinge geboren, einen Jungen und ein Mädchen. Die Glückliche! Sei mir nicht böse, aber das würde ich auch gern …«
»Was?«
»So. Es mit einem Mal erledigen. Unter Qualen, aber dafür mit Erfolg.«
»Was du nicht sagst! Und wenn dein künftiger Mann sich mit Zwillingen nicht zufriedengibt?«
»Ach, ich rede Unsinn. Lass uns lieber schweigen. Hier ist es so schön!«
Unten trug der Neman ruhig und majestätisch sein Wasser zur Ostsee. Aus dem Fluss tauchten oder sprangen, der Dunkelheit in der Tiefe überdrüssig, neugierige Fische ans Licht. Vom dichten Gebüsch am Ufer flogen immer wieder rastlose Vögel auf. Die Sonne hatte ihren Arbeitstag beendet und eilte zur Nachtruhe hinter den Horizont.
Schlojmke blickte immer öfter in die Richtung, in die er zurückkehren musste.
»Wenn du wieder zu Hause bist, Chanke, richte meiner Mutter aus, dass sie sich keine Sorgen machen soll. Mir tut hier niemand etwas, und mein Pferd ist ganz zahm. Wollte Gott, alle unsere Juden wären so friedlich wie mein Pferd … Du solltest nicht zwei Jahre hierbleiben, das heimische Nest gegen ein fremdes Loch tauschen. Wenn du kannst, besuch mich samstags. Dann setzen wir uns an den Fluss, essen Rosinenkuchen, lutschen Bonbons, gehen in die Synagoge und bitten Gott, dass Er uns unsere Sünden verzeiht und uns Seinen Segen gibt für ein langes gemeinsames Leben. Und wir werden uns bemühen, Ihm durch Gehorsam und Arbeit zu danken …«
»Jawohl, mein Gebieter.«
Dann sagte sie kein einziges Wort mehr, wickelte die übriggebliebenen Gaben in das Tischtuch und begleitete ihn zur Pforte. Mit einem Kopfnicken verabschiedete sie sich vom Wachposten, küsste Schlojmke auf die Wange und lief langsam in die Stadt.
4
Die Familie Dudak lebte ärmlich. Schimon legte bis spät in die Nacht Hammer und Ahle nicht aus der Hand. Er reparierte alles, was man ihm brachte – egal, ob es längst weggeworfen gehörte oder noch zu flicken war. Und er nahm nicht viel Geld. Im Schtetl hieß es scherzhaft, Dudak sei der nachgiebigste Schuster der Welt. Zu ihm gingen vor allem seine ärmeren Brüder. Dem Schnorrer Avigdor Perelman, der gut ein Jahr die Jeschiwa in Telsche besucht hatte und dem Doktor Izchok Blumenfeld wegen seiner Abkehr vom Glauben und seiner Neigung, alle auf den rechten Weg führen zu wollen und aus jedem Anlass zu philosophieren, den Spitznamen Spinoza verpasst hatte, diesem armen Schlucker flickte Schimon Dudak die Schuhe ganz umsonst.
»Gott wird es dir, Schimon, für mich hundertfach vergelten«, sagte Avigdor oft. »Er schreibt alle meine Schulden in Sein Schuldbuch und wird sie rechtzeitig und akkurat begleichen. Auch dir, Schimon, wird Er sie zurückzahlen. Ehrenwort, obwohl es eine Sünde ist, sich für Gott zu verbürgen! Er handelt, wie Er es für richtig hält. Denn Er ist unser oberster Buchhalter. Er zählt unsere Jahre und unsere Schulden.«
»Wie wird Er denn zahlen, sag mir bitte, wie? Mit Geld, mit Wechseln? Mit Glückseligkeit?«, fragte Schimon spöttisch und strich sich mit dem rauen Zeigefinger über den prächtigen, herrschaftlichen Schnauzer.
»Mit einem langen Leben. Mit guten Ehemännern für deine Töchter. Du hast ja so viele – vier Stück! Und mit Enkeln.«
Schimon war stolz auf seine Töchter, aber sie waren nicht sein Reichtum, sondern seine tägliche zehrende Sorge. Nur die Älteste, Chanke, besserte die schmale Familienkasse mit Gelegenheitsverdiensten auf. Auch die Reise nach Alytus zu Schlojmke hatte sie von dem Geld bezahlt, das sie in Berditschewskis Kutscherschenke Zu Gast bei Izchok verdient hatte, die der Inhaber selbst pathetisch als Erstes Restaurant im Schtetl bezeichnete. Chanke stand den ganzen Tag in der rauchigen Küche, kochte Essen, schälte und rieb Kartoffeln, briet Latkes, buk Rosinenkuchen und Piroggen mit Fleisch und Kohl, spülte das gesamte Geschirr und putzte den mit Essensresten und Zigarettenkippen besudelten Gastraum. Und wären nicht die Flegel gewesen, die ihr Geld mit nächtlichen Fuhren verdienten und sie angetrunken belästigten, versuchten, sie in die Brust oder in den vorgewölbten Po zu kneifen … Wären ihre Blicke nicht gewesen, lüstern wie die von Maikatern, und ihre Einladungen zu Kutschfahrten, zu Spaziergängen an der frischen Luft, weit weg auf dem Land, im Grünen, dann hätte sie wohl weiter in der Küche dieses »Restaurants« gewirtschaftet, obwohl sie sich nach der schweren Arbeit kaum auf den Beinen halten konnte …
Izchok Berditschewski, mit allen Wasser gewaschen und in ganz Jonava bekannt für seine Härte, war zufrieden mit Chanke – sie war fügsam und geschickt, eine Köchin, wie er sie brauchte. Er beschwor sie zu bleiben, versprach, sie vor schamlosen Gästen seines Hauses zu beschützen, ihren Lohn zu erhöhen, doch alle seine Versprechungen und Mahnungen waren vergebens, und sie verließ ihn.
Chanke suchte lange nach einer anständigen Arbeit. Doch wo sollte ein Mädchen, das nicht einmal die Grundschule beendet hatte und nichts konnte als kochen und backen, Fußböden wischen und Wäsche waschen, wo sollte sie eine anständige Arbeit finden? Zu Schlojmke fuhr sie nicht wieder, weil sie ihren Vater nicht um Geld bitten wollte, sie schrieb ihrem Kavalleristen in holprigem Jiddisch Briefe, die nur aus Liebeserklärungen und Klagen über das böse Schicksal bestanden, und wartete auf den Schtetl-Postboten Kazimiras so sehnsüchtig wie auf den Meschiach. Obgleich sie wusste, dass Roche ihr keinerlei Sympathie entgegenbrachte, ja sogar offene Abneigung, lief sie immer wieder in die Fischerstraße, um wenigstens irgendetwas über Schlojmke zu erfahren. Nach der Rückkehr von dem Besuch bei ihrem Kavalleristen in Alytus hatte sie Roche begeistert, ohne mit Übertreibungen zu sparen, berichtet, wie Schlojmke aussah und wie ihm der Dienst gefiel. Roche vermutete nicht ohne Grund, dass Chanke ein wenig schwindelte, unterbrach sie aber nicht. Honigsüße Worte finden über empfängliche Ohren stets den Weg in ein dankbares Herz …
»Was schreibt er?«, fragte meine Mutter ihre künftige Schwiegermutter.
»Was er schreibt?« Roches Augen wurden plötzlich feucht. »Was sein Bruder Ajsik mir und Dovid vorliest, das schreibt er. Und was, sag mir, kann man zwei vermoosten Alten wie uns schon schreiben? Ich habe Heimweh, schreibt er. Es geht mir gut, schreibt er. Nur das Essen, o Gott, schreibt er, das ist nicht koscher – Schweinswürste, Schweinefleisch, Pilzsuppe mit Schweinsfüßen. Was soll man machen … Wo soll ein Jude hin, wenn selbst die Luft ringsum nicht koscher ist? Aber wieso läufst du hier untätig herum? Hast du aufgehört bei diesem Gauner Berditschewski?«
»Ja, das habe ich.«
»Recht so. Wo sich Männer betrinken, kann ein ehrbares Mädchen seine Blume kaum bewahren. Du verstehst doch, wovon ich rede?«
Chanke nickte.
»Ja, das verstehe ich. Darum bin ich ja weggegangen. Nun suche ich eine andere Arbeit. Ich suche und suche, aber ich kann nichts finden.«
»Würdest du als Kindermädchen anfangen?«, platzte Roche zu Chankes Verblüffung ohne Vorwarnung heraus. »Eine saubere Arbeit und nicht schwer, du würdest dich den ganzen Tag um einen kleinen Jungen aus guter Familie kümmern, mit ihm im Schatten unter einem Baum sitzen und den Vögeln lauschen oder im Park spazieren gehen. Es ist ein niedlicher Junge, seine Mama ist schön und gebildet, sie spricht Französisch, wie wir beide Jiddisch reden, aber sie hat keine große Lust, sich mit dem Kleinen abzugeben.«
»Zu wem gehört der Junge?«, fragte Chanke hoffnungsvoll. Sie hätte nicht gedacht, dass Roche-Samurai, diese giftige Natter, die alle ihr nicht genehmen Bräute bekämpfte, solche Fürsorge für sie zeigen würde. Chanke machte sich Vorwürfe, dass sie so unbeherrscht gefragt hatte, von wessen Kind die Rede war. Sie hätte abwarten müssen, bis Roche selbst den Namen der Eltern nannte.
»Es sind reiche Leute, sehr reiche.« Roche verschnaufte, holte tief Luft und fuhr fort. »Früher einmal, das ist lange her, ich glaube es fast selbst nicht mehr, da sah ich alte Hexe noch nicht so aus wie jetzt, da war ich, wie es hieß, ein reizvolles junges Mädchen, ziemlich hübsch, die Männer drehten sich nach mir um, und ihnen lief das Wasser im Mund zusammen … Jetzt bin ich eine runzlige alte Frau, und meine Augen sind erloschen wie Kohle im Ofen. Widersprich mir bitte nicht! Ich habe keine Zeit, mir deine unaufrichtigen Beteuerungen anzuhören. Jedenfalls, damals, und manchmal kommt es mir vor, als wäre das nicht zu Zeiten des Schusters Dovid gewesen, sondern zu Zeiten von König David, damals bemühte sich der junge Reb Jeschaje um mich, der leibliche Bruder von Jeschue Kremnizer, dem Großvater des kleinen Jungen. Zehn Jahre nach unserer Bekanntschaft wurde er unsagbar reich durch den Handel mit Holz, das er den Neman hinunter über das Meer von Litauen nach Russland flößte, und starb urplötzlich an einer rätselhaften fremdländischen Krankheit. Den Holzhandel betreibt jetzt sein geschäftstüchtiger Neffe Arn, der Vater des Kindes. Na, nun habe ich dich mit meinem Geschwätz ganz durcheinandergebracht … Hast du irgendetwas davon verstanden?«
»Der Junge ist also der Enkel von Reb Jeschue, dem Besitzer des Eisenwarenladens in der Nähe der Synagoge und des Polizeireviers?«
»Ja, genau. Seine verstorbene Frau Golde hat Reb Jeschue natürlich oft von meinem Techtelmechtel mit seinem Bruder erzählt. Ich hätte also durchaus statt der Schusterfrau Roche Kanowitsch auch die reiche Roche Kremnizer werden können. Ich werde versuchen, ein gutes Wort für dich einzulegen.«
»Danke.«
»Du musst mir nicht danken. Ich tue es nicht für dich, sondern für Schlojmke, meinen Sohn, der dich heiraten will. Was denkst du selbst, Chanke – wird er dich heiraten oder nicht? Ja oder nein? Antworte mir geradeheraus, ohne Ausflüchte.«
»Ich glaube, er wird mich heiraten«, antwortete Chanke freimütig, die feucht schimmernden schwarzen Augen auf Roche gerichtet, besann sich plötzlich und setzte fest hinzu: »Wenn er mich heiratet, werden Sie es bestimmt nicht bereuen …«
»Geb’s Gott«, erwiderte Roche ausweichend. »Deine Aufrichtigkeit und deine Offenheit gefallen mir. Ich hasse Verstellung.«
Aus dem Nebenzimmer drangen die gleichmäßigen Schläge des Schusterhammers, und dieses monotone Klopfen beruhigte Chanke.
»Wenn ich die Stelle bei Reb Kremnizer bekomme, kaufe ich von meinem ersten Lohn zwei Fahrkarten – für Sie, Roche, und für mich. Dann fahren wir zusammen mit dem Bus nach Alytus zu Ihrem Sohn. Ich kenne mich dort schon aus. Und Sie kommen auf jeden Fall mit.«
»Ich?«, fragte Roche verwirrt. »Ich bin mein Lebtag noch nie verreist. Nirgendwohin. Ich bin in Jonava geboren, und hier werde ich auch sterben. Würde man junge Frauen zum Militär einberufen, dann hätte ich vielleicht andere Städte gesehen – Alytus, Ukmerge, Zarasai. Womöglich sogar Kaunas. Es gibt bestimmt in jeder Stadt Soldatenkasernen. Doch dem Allmächtigen hat es beliebt, dass ich die mir zugedachten Jahre in einer anderen Kaserne verbringen sollte, in der Fischerstraße, in diesem Haus mit dem undichten Dach, mit hungrigen Mäusen und einem Haufen Kinder, die großgezogen werden mussten.«
»Schlojmke wird sich sehr freuen, Sie zu sehen.«
»Und wenn sie ihm nicht freigeben und wir beide ganz umsonst hinfahren?«, fragte Roche zweifelnd.
»Es heißt, einer Mutter öffnen sich alle Türen und Tore.«





























