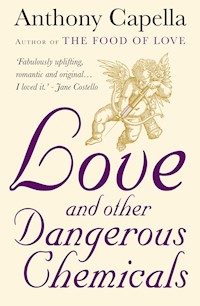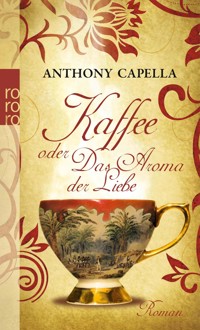
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
London, 1896: Der Dandy Robert Wallis lebt vom Geld seines Vaters, amüsiert sich mit Prostituierten und verbringt seine Zeit am liebsten im Café. Eines Tages lernt er dort den erfolgreichen Kaffeehändler Samuel Pinker kennen, der den verkannten Poeten engagiert. Er soll eine universelle Sprache für die Aromen des Kaffees finden. Robert ist zunächst wenig begeistert. Doch dann trifft er Pinkers attraktive Tochter Emily. Und Robert Wallis erhält einen ersten Geschmack davon, wie bitter und wie süß die Liebe sein kann ... «Der Roman bietet glänzende Unterhaltung … Leichthändig, souverän, mit viel Witz und Sinnlichkeit erzählt.» (NDR Kultur) «Die überraschenden Wendungen der Geschichte und die authentische Liebesgeschichte dürften aus dem Buch einen Publikumsrenner machen.» (Publishers Weekly) «Eine temporeiche Lektüre, vorangetrieben von Capellas meisterhaften Charakterisierungen.» (Kirkus Reviews)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 701
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Anthony Capella
Kaffee
oder Das Aroma der Liebe
Roman
Aus dem Englischen von Saskia Bontjes van Beek
Gestern
ein Samenkorn,
morgen
eine Handvoll Gewürze
oder Asche
Marc Aurel, Meditationen
TEIL 1
Der Hengst und die Kutsche
Vieles am Aroma des Kaffees ist und bleibt ein Geheimnis.
Ted Lingle, Das Handbuch des Kaffeeverkosters
1
Wer ist dieser junge Mann, der uns mit einer Nelke im Knopfloch und einem Spazierstock in der Hand auf der Regent Street entgegenschlendert? Man könnte annehmen, er sei wohlhabend, da er nach der neuesten Mode gekleidet ist – doch das wäre ein Irrtum; man könnte annehmen, dass er eine besondere Vorliebe für erlesene Dinge besitzt, da er vor dem Schaufenster des jüngst eröffneten Kaufhauses Liberty, das sich dem Zeitgeschmack verschrieben hat, stehen bleibt – oder bewundert er nur sein eigenes Spiegelbild, seine Locken, die ihm im Unterschied zu den übrigen Passanten bis auf die Schultern fallen? Man könnte annehmen, er sei hungrig, da seine Schritte auf dem Weg zum Café Royal, jenem Labyrinth aus Klatsch und Speisesälen nahe Piccadilly, deutlich schneller werden; und dass er hier Stammgast sei, aufgrund der Art und Weise, wie er den Kellner beim Vornamen anspricht und, während er auf einen Tisch zusteuert, eine Pall Mall Gazette vom Zeitschriftenständer nimmt. Vielleicht ließe sich aus der Art und Weise, wie er innehält, um etwas in das kalbslederne Notizbuch, das er mit sich herumträgt, zu notieren, sogar folgern, dass er ein Schriftsteller ist.
Kommen Sie mit; ich werde Sie mit ihm bekannt machen. Ja, zugegeben – ich kenne diesen grotesken jungen Mann, und bald werden Sie ihn auch kennen. Vielleicht werden Sie ja nach ein, zwei Stunden in seiner Gesellschaft das Gefühl haben, ihn eine Spur zu gut zu kennen. Ich bezweifle, dass er Ihnen besonders gefallen wird: Das macht nichts, er gefällt mir auch nicht besonders. Er ist – nun, Sie werden schon sehen, wie er ist. Aber vielleicht können Sie darüber hinwegsehen und sich vorstellen, was wohl einmal aus ihm werden könnte. So wie der Kaffee sein wahres Aroma erst dann entfaltet, wenn er gepflückt, geschält, geröstet und aufgebrüht ist, besitzt dieses besondere Exemplar neben seinen Lastern ein, zwei Tugenden, auch wenn sie vielleicht nicht leicht zu erkennen sind… Sie sehen, trotz seiner Schwächen empfinde ich für diesen Burschen nach wie vor eine gleichsam erbitterte Zuneigung.
Wir schreiben das Jahr 1896.Sein Name ist Robert Wallis. Er ist zweiundzwanzig Jahre alt. Ich bin es, mein jüngeres Ich, vor vielen Jahren.
2
Im Jahr 1895 war ich nach nicht bestandener Vorprüfung von der Universität in Oxford verwiesen worden. Meine Relegierung überraschte nur mich: Ich hatte kaum gearbeitet und mir mit jungen Männern, die für ihren Müßiggang und ausschweifenden Lebensstil bekannt waren, die Zeit vertrieben. Ich lernte sehr wenig – oder eher zu viel; es waren die Zeiten, in denen Studenten, wie Sie sich erinnern werden, während sie die High Street entlangzogen, lauthals Swinburne skandierten – Wird mich wohl noch verletzen die Süße der Lippen,/wiewohl ich verletzte?/Ein Mensch, der berührt wird, verwandelt im Nu sich/von Lilien und Sprachen der Tugend/zum Taumel, zu Rosen des Lasters – und die Angestellten des College noch immer voller Entsetzen über Pater und Wilde sprachen. In den mönchischen Kreuzgängen herrschte ein schmachtend romantisierender Geist, der Schönheit, Jugend und Indolenz zum Ideal erhob, und der junge Robert Wallis nahm diese gefährliche Doktrin neben all den anderen berauschenden Aromen dieses Ortes begierig in sich auf. Ich verbrachte meine Nachmittage mit dem Verfassen von Gedichten und dank der monatlichen Zuwendungen meines Vaters mit dem Erwerb seidener Westen, erlesener Weine, schillernder Pfauenfedern, in gelbes Pergament gebundener schmaler Gedichtbände und sonstiger für das Leben eines Künstlers unabdingbarer Objekte, die einem die Händler der Turl Street bedenkenlos auf Kredit verkauften. Da mein Kostgeld wie mein dichterisches Talent spärlicher bemessen war, als ich es wahrhaben wollte, musste dieser Zustand unweigerlich ein trauriges Ende nehmen. Zum Zeitpunkt meiner Relegierung hatte ich neben meinen finanziellen Mitteln auch meines Vaters Geduld erschöpft und sah mich binnen kurzem genötigt, mich nach einer Einnahmequelle umzusehen – eine Notwendigkeit, die ich zu meiner Schande so lange wie nur irgend möglich zu ignorieren gedachte.
London war damals ein riesiger, brodelnder menschlicher Moloch, dabei kam es vor, dass selbst auf diesem Misthaufen noch Lilien wuchsen – oder gar blühten. Wie aus dem Nichts war die Hauptstadt unversehens von einer Woge der Frivolität erfasst worden. Die trauernde Königin hatte sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Ihrer Aufsicht enthoben, begann der Prinz, das Leben auszukosten, und was auch immer er tat, wir folgten ihm. Höflinge ließen sich mit Kurtisanen ein, Dandys liebäugelten mit der Halbwelt, Aristokraten dinierten mit Ästheten, und Stricher verkehrten mit Angehörigen des Königshauses. Unsere Hauszeitschrift war das Yellow Books; unser Emblem die grüne Nelke; unser Stil war das, was später als nouveau bezeichnet wurde, und unsere bevorzugte Ausdrucksweise das Epigramm – je paradoxer, desto besser, am liebsten mit gekonnter, gelangweilter Melancholie beiläufig in das Gespräch eingestreut. Wir priesen das Künstliche gegenüber dem Natürlichen, das Künstlerische gegenüber dem Praktischen und erhoben ungeachtet eines Oscar Wilde Anspruch auf extravagante Laster, denen nur wenige von uns tatsächlich zu frönen gedachten. Es war herrlich, damals jung und in London zu sein, und ich sollte das meiste davon – verflucht nochmal! – verpassen, nur wegen einer zufälligen Bemerkung, die ich in Hörweite eines Mannes namens Pinker fallenließ.
3
Der wesentliche Faktor, der den Geschmack beeinflusst, ist die Auswahl der Bohnen.
Lingle, Das Handbuch des Kaffeeverkosters
Ich frühstückte gerade im Café Royal – eine Portion Austern, dazu üppige Scheiben Schinken mit einer grünen Soße–, als der Kellner mir meinen Kaffee brachte. Ohne von meiner Zeitung aufzublicken, nahm ich einen Schluck, runzelte die Stirn und sagte: «Verdammt nochmal, Marsden, der Kaffee schmeckt moderig.»
«Es ist haargenau derselbe Kaffee, den auch die übrige Kundschaft zu trinken beliebt», sagte der Kellner überheblich. «Meines Wissens gab es bislang noch keinen Anlass zur Beanstandung.»
«Wollen Sie damit sagen, ich sei kleinlich, Marsden?»
«Haben Sie sonst noch einen Wunsch, Sir?»
«Als Kellner, Marsden, beherrschen Sie alle Fertigkeiten, nur nicht die Kunst des Kellnerns. Als Mann von Geist beherrschen Sie alles Nötige, nur nicht den Humor.»
«Danke, Sir.»
«Und ob ich kleinlich bin. Eine gut zubereitete Tasse Kaffee ist schließlich der angemessene Auftakt zu einem müßigen Tag. Sein Aroma ist betörend, sein Geschmack süß; dabei hinterlässt er nichts als Bitterkeit und Reue. Darin gleicht er freilich den Wonnen der Liebe.» Zufrieden über dieses Aperçu nippte ich erneut an dem Kaffee, den Marsden mir gebracht hatte. «Allerdings», setzte ich hinzu, «scheint er in diesem Fall nach kaum mehr als nach Moder zu schmecken. Vielleicht mit einem leisen Nachgeschmack von verschimmelten Aprikosen.»
«Keine Ursache, Sir.»
«Gewiss.» Ich wandte mich wieder der Gazette zu.
Der Kellner zögerte noch. «Wird der junge Gentleman heute Morgen für sein Frühstück zahlen?», erkundigte er sich mit einem leichten Anflug von modisch gelangweilter Melancholie.
«Schreiben Sie’s bitte auf, Marsden. Seien Sie so freundlich.»
Nach einer Weile merkte ich, dass sich jemand zu mir gesetzt hatte. Über meine Zeitung hinweg sah ich, dass mein Tischnachbar ein kleiner, gnomenhafter Gentleman war, der sich durch seinen groben Gehrock von den üblichen Gecken und Dandys unterschied, die sonst an diesem Ort anzutreffen waren. Ich rechnete eigentlich damit, dass jeden Augenblick meine Freunde Morgan und Hunt zu mir stoßen würden, aber da es noch früh und der Raum noch wenig frequentiert war, würde man sich bei ihrer Ankunft ohne weiteres an einen anderen Tisch setzen können. Ich war jedoch ein wenig neugierig, zumal es angesichts der zahlreichen noch freien Tische umso überraschender war, dass der Fremde sich unaufgefordert gerade zu mir gesetzt hatte.
«Samuel Pinker, Sir, zu Ihren Diensten», sagte der gnomenhafte Herr mit einer leichten Verneigung des Kopfes.
«Robert Wallis.»
«Ich habe zufällig Ihre Bemerkung dem Kellner gegenüber gehört. Sie erlauben?» Worauf er meine Tasse nahm, sie an seine Nase führte und ebenso behutsam daran roch, wie ich an jenem Morgen an der für mein Knopfloch auserkorenen Blume gerochen hatte.
Ich beobachtete ihn, nicht sicher, ob ich auf der Hut oder amüsiert sein sollte. Im Café Royal verkehrten zwar etliche exzentrische Charaktere, doch ihre Exzentrizität besaß eine eher affektierte Note, wenn sie etwa einen kleinen Veilchenstrauß oder samtene Knickerbocker trugen oder einen Spazierstock mit diamantenem Knauf in der Hand kreisen ließen. Dass jemand am Kaffee eines anderen Gastes roch, war meines Wissens noch nie vorgekommen.
Samuel Pinker ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Mit halbgeschlossenen Augen inhalierte er sehr bewusst zwei weitere Male das Aroma des Kaffees. Dann hielt er die Tasse an seine Lippen und nippte daran. Sogleich gab er ein seltsames Sauggeräusch von sich, wobei er wie eine Schlange seine Zunge vor- und zurückschnellen ließ, als spüle er mit der Flüssigkeit seinen Mund.
«Neilgherry», sagte er bedauernd. «Zu lange aufgebrüht, ganz zu schweigen von der Überröstung. Sie haben allerdings recht. Ein Teil der Lieferung war verdorben. Ein leichter, aber ziemlich prägnanter Geschmack nach fauliger Frucht. Darf ich fragen, ob Sie aus der Branche sind?»
«Aus welcher Branche?»
«Aus der Kaffeebranche natürlich.»
Ich lachte, glaube ich, laut heraus. «Um Himmels willen, nein.»
«Darf ich fragen, Sir», beharrte er, «aus welcher Branche Sie dann sind?»
«Aus gar keiner.»
«Verzeihen Sie – ich hätte sagen sollen, welchen Beruf üben Sie aus?»
«Ich übe nichts wirklich aus. Ich bin weder Arzt noch Anwalt noch sonst irgendetwas Nützliches.»
«Was machen Sie, Sir?», sagte er ungeduldig. «Wie verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt?»
Tatsächlich musste ich just zu dem Zeitpunkt nicht selbst für meinen Lebensunterhalt aufkommen, nachdem mein Vater mir unlängst mit der strikten Auflage, dass es das allerletzte Mal sei, in Erwartung meines bevorstehenden literarischen Ruhmes eine weitere kleinere Summe vorgestreckt hatte. Es schien jedoch absurd, sich wegen irgendeiner Haarspalterei zu streiten. «Ich bin Dichter», gestand ich mit einer gewissen gelangweilten Melancholie.
«Ein berühmter? Ein bedeutender?», fragte Pinker begierig.
«Leider nicht. Die Ruhmesgöttin hat mich noch nicht an ihren wankelmütigen Busen gedrückt.»
«Gut», murmelte er zu meinem Erstaunen. Und dann: «Aber Sie können doch schreiben? Können gut mit Wörtern umgehen?»
«Als Schriftsteller glaube ich alles zu beherrschen, nur nicht die Sprache…»
«Diese verflixten Epigramme!», rief Pinker. «Ich meine, können Sie etwas beschreiben? Natürlich können Sie das. Sie haben diesen Kaffee beschrieben.»
«Habe ich das?»
«Sie haben ihn ‹moderig› genannt. Ja – und er ist in der Tat ‹moderig›. Darauf wäre ich nie gekommen – das Wort wäre mir nicht eingefallen–, aber ‹moderig› ist das, das…»
«Das mot juste?»
«Richtig.» Pinker warf mir einen Blick zu, der mich an meinen Tutor in Oxford erinnerte: eine Mischung aus Zweifel und einer gewissen eisernen Entschiedenheit. «Genug geredet. Ich gebe Ihnen meine Karte.»
«Ich nehme sie gern», sagte ich verblüfft, «obgleich ich wohl kaum auf Ihre Dienste angewiesen bin.»
Er kritzelte rasch etwas auf die Rückseite seiner Visitenkarte. Es war, wie mir auffiel, eine edle Karte aus festem elfenbeinfarbenem Papier. «Sie verstehen nicht, Sir. Ich bin auf Sie angewiesen.»
«Sie meinen, als eine Art Sekretär? Ich fürchte, ich…»
Pinker schüttelte den Kopf. «Nein, nein. Ich habe bereits drei Sekretäre, die äußerst tüchtig ihre Aufgaben erledigen. Sie würden ihr Team, wenn Sie erlauben, nicht wirklich bereichern.»
«Was dann?», fragte ich leicht pikiert. Ich hatte zwar nicht das geringste Bedürfnis, als Sekretär zu arbeiten, mir aber immer eingebildet, im Bedarfsfall durchaus dazu imstande zu sein.
«Ich bin angewiesen», sagte Pinker und sah mir in die Augen, «auf einen Ästheten – einen Mann der Feder. Sollte ich dieses talentierte Individuum aufspüren, so wird es bei mir in ein Unternehmen einsteigen, das uns beide zu unermesslich reichen Männern machen wird.» Er reichte mir die Karte. «Suchen Sie mich morgen Nachmittag unter dieser Adresse auf.»
Mein Freund George Hunt vermutete, der rätselhafte MrPinker beabsichtige die Herausgabe einer Literaturzeitschrift. Da Hunt sich seit geraumer Zeit mit demselben Gedanken getragen hatte – vor allem da keine Londoner Literaturzeitschrift es bislang für angebracht gehalten hatte, seine Verse zu drucken–, fand er, ich solle das Angebot des Kaffeehändlers annehmen und ihn aufsuchen.
«Er wirkt kaum wie ein Literat.» Ich drehte die Karte um. Auf der Rückseite war handschriftlich notiert: Bitte Zutritt zu meinem Büro gewähren. S.P.
«Sieh dich doch nur um», sagte Hunt und wies auf die übrigen Anwesenden. «Hier sind etliche, die sich am Unterrock der Muse festklammern.» Tatsächlich zählten zu den Gästen des Café Royal häufig ebenso viele Trittbrettfahrer wie tatsächlich Schreibende oder Künstler.
«Aber ihm hat besonders gefallen, dass ich den Kaffee als ‹moderig› bezeichnet habe.»
Der Dritte im Bunde – der Künstler Percival Morgan, der sich bis dahin aus allen Spekulationen herausgehalten hatte – lachte plötzlich. «Ich weiß, was dein MrPinker will.»
«Was denn?»
Er klopfte auf die Rückseite der Gazette. «‹Branahs patentiertes Kräftigungspulver›», las er vor. «‹Bringt den Genesenden garantiert wieder auf die Beine. Genießen Sie mit nur einem wirksamen Löffel die belebende Kraft der alpinen Erholungskur.› Das ist doch klar, oder? Der Mann will, dass du ihm seine Werbetexte verfasst.»
Ich musste zugeben, dass so etwas weitaus plausibler klang als eine Zeitschrift. Ja, je länger ich darüber nachdachte, desto wahrscheinlicher kam es mir vor. Pinker hatte sich gezielt danach erkundigt, ob ich gut beschreiben könne – eine seltsame Frage für den Herausgeber einer Zeitschrift, indessen naheliegend für jemanden, dem es um das Verfassen von Werbetexten ging. Bestimmt hatte er lediglich einen neuen Kaffee, den er lancieren wollte. «Pinker’s Munter-Macher-Frühstücksmischung. Dunkel geröstet für einen gesunden Teint», oder irgendein anderer Nonsens. Ich war ein wenig enttäuscht. Einen Augenblick lang hatte ich gehofft – nun, dass es vielleicht um etwas Aufregenderes ging.
«Werbung», sagte Hunt nachdenklich, «ist der unsägliche Ausdruck eines unsäglichen Zeitalters.»
«Ganz im Gegenteil», sagte Morgan, «ich liebe die Werbung. Es ist die einzige Form von moderner Kunst, die sich auch nur im Entferntesten mit der Wahrheit befasst.»
Sie sahen mich erwartungsvoll an. Aus irgendeinem Grund war mir jedoch nicht länger nach Epigrammen zumute.
Am darauffolgenden Nachmittag saß ich an meinem Schreibtisch und arbeitete an der Übersetzung eines Gedichtes von Baudelaire. Neben mir stand ein mit goldfarbenem Rheinwein gefüllter Kelch aus gelbem venezianischem Glas; ich schrieb wie gewöhnlich mit einem silbernen Stift auf bergamottölgetränktem mauvefarbenem Papier und rauchte zahllose Zigaretten mit türkischem Tabak, dennoch ging die Arbeit nur langsam voran. Baudelaire ist zweifellos ein großer, noch dazu aufregend abgründiger Dichter, doch er neigt zu einer gewissen Unklarheit, die die Arbeit des Übersetzers erschwert, und wären mir nicht dafür von einem Verleger drei Pfund in Aussicht gestellt worden, hätte ich die Arbeit schon Stunden zuvor hingeworfen. Ich wohnte in St.John’s Wood, nahe dem Regent’s Park, und an einem sonnigen Frühlingstag wie diesem drangen die fernen Rufe der Eisverkäufer, die vor den Parktoren auf und ab gingen, bis zu mir. Es zog mich nach draußen. Und aus irgendeinem Grund fiel mir als einziges Wort, das sich auf «Teufelskreis» reimte, «Erdbeereis» ein.
«So ein Mist», sagte ich laut und legte meinen Stift beiseite.
Pinkers Visitenkarte lag auf einer Seite des Schreibtischs. Ich nahm sie in die Hand und betrachtete sie erneut. «Samuel PINKER, Kaffeeimporteur und -großhändler.» Eine Adresse in der Narrow Street in Limehouse. Die Vorstellung, meine Räume zu verlassen, und sei es nur für ein, zwei Stunden, zerrte an mir wie ein Hund, der an der Leine seines Herrchens zieht.
Auf der anderen Seite des Schreibtischs stapelten sich Rechnungen. Schulden zu haben war für einen Künstler natürlich unvermeidlich. Ja, man konnte sich wohl kaum als solcher bezeichnen, wenn man keine hatte. Doch einen Augenblick lang deprimierte mich der Gedanke, irgendwann die nötigen Mittel auftreiben zu müssen, um sie zu begleichen. Ich griff nach der obersten, einem Beleg meines Weinhändlers. Der Rheinwein war nicht nur goldfarben: Er hatte auch, verdammt nochmal, beinahe so viel gekostet. Wenn ich mich jedoch dazu bereit erklärte, MrPinkers Werbung zu übernehmen… Ich hatte keine Ahnung, wie viel man für das Verfassen von solchem Nonsens berechnete. Immerhin, überlegte ich, ließ die Tatsache, dass Pinker nichts anderes übriggeblieben war, als sich im Café Royal nach jemandem umzusehen, der schreiben konnte, darauf schließen, dass er sich damit genauso wenig auskannte wie ich. Angenommen, man könnte ihn nicht nur zu einem einmaligen Honorar, sondern gar zu einem Vorschuss bewegen? Sagen wir – ich ersann eine akzeptable Summe, befand sie dann aber für zu gering und vervierfachte sie – vierzig Pfund jährlich? Und wenn der Kaffeehändler Freunde hatte, Geschäftsfreunde, die an ähnlichen Dienstleistungen interessiert waren – nun, dann würde es nicht lange dauern, bis man ein jährliches Einkommen von vierhundert Pfund hätte, nur weil man Zeilen wie «Genießen Sie mit nur einem wirksamen Löffel die belebende Kraft der alpinen Erholungskur» verfasste. Für Baudelaire würde einem noch alle Zeit der Welt bleiben. Gewiss, es könnte die Muse ein wenig kränken, dass man sein Talent in dieser Weise vergeudete, aber da man die ganze Angelegenheit den befreundeten Literaten gegenüber ohnehin geheim halten müsste, würde die Muse vielleicht auch nicht dahinterkommen.
Ich fasste einen Entschluss. Ich griff rasch nach Pinkers Karte, warf mir einen paisleygemusterten Mantel über, den ich die Woche zuvor bei Liberty gekauft hatte, und eilte zur Tür.
Begeben wir uns nun quer durch London, von St.John’s Wood nach Limehouse. Das klingt nicht gerade aufregend, oder? Lassen Sie mich meine Einladung also noch einmal formulieren. Durchqueren wir die größte, bevölkerungsreichste Stadt der Welt genau dann, wenn sie am geschäftigsten ist – eine Tour, bei der Sie, falls Sie mich begleiten wollen, jeden Ihrer Sinne einsetzen müssen. Hier oben in Primrose Hill ist die Luft – atmen Sie tief durch! – noch relativ frisch, mit nur einer leisen Schwefelnote von all den Kohlenfeuern und Küchenherden, die selbst zu dieser Jahreszeit in jedem Haus brennen. Hinter Marylebone geht es dann richtig los. Von den Hansom Cabs und Kutschen geht ein starker Geruch von Leder und Pferdeschweiß aus; ihre Räder rattern über das Kopfsteinpflaster; die Rinnsteine sind voll von weichem, feuchtem Dung. Überall kommt der Verkehr zum Erliegen: Karren, Kutschen, Karossen, Broughams, Kabrioletts, Gigs, Coupés, Landauer, Clarences, Barutschen, alle drängen in verschiedene Richtungen. Manche haben sogar die Form von riesigen Zylindern, auf denen in goldenen Lettern die Namen der Hutmacher prangen. Die Omnibusfahrer sind die schlimmsten Verkehrssünder, wenn sie von einer Seite zur anderen ausscheren und neben Fußgängern zum Stehen kommen, um sie für drei Penny in den Bus oder für einen weniger aufs Dach zu locken. Dann sind da noch die Velozipede und Fahrräder, die Gänseherden, die zu den Märkten getrieben werden, die wandelnden Plakatträger, die sich mit ihren Werbeschildern für Regenschirme und andere Dinge einen Weg durch die Menge bahnen, und die Milchmädchen, die mit einem Eimer und einer Kuh einfach nur die Straße entlanggehen und darauf warten, dass man sie der frischen Milch wegen anhält. Straßenhändler tragen Bleche mit Pasteten und Kuchen vor sich her; Blumenverkäufer drücken einem Lupinen und Ringelblumen in die Hände; dazu der durchdringende Duft von Pfeifen und Zigarren. Ein Mann, der über einem Kohlenfeuer Yarmouth bloaters brät, hält dir einen auf eine Gabel gespießten Bückling unter die Nase. «1a geröstet!», brüllt er heiser. «Zwei Penny das Stück!» Sogleich werden überall andere Stimmen laut. «Heiße Kastanien, zwanzig für einen Penny… Schwarze Wichse, ’n halben Penny die Büchse… Köstliche Walnüsse, sechzehn für einen Penny…», brüllen die Händler. «Frische Rüben», grölt ein Bauer von einem Eselskarren zurück. Die Schleifsteine der Messerschleifer kreischen und sprühen bei der Berührung mit den Klingen Funken. Stumm bieten Höker mit ausgestreckter Hand Streichholzschachteln für einen Penny feil. Und am Rande der Menge schleppen sich – unentwegt – die gespenstischen Gestalten der Bedürftigen dahin: die Schuhlosen, Brotlosen, Obdachlosen, Pennylosen, die darauf warten, dass sich ihnen irgendeine Chance bietet.
Wenn wir mit der Untergrundbahn von Baker Street nach Waterloo fahren, wird uns auf den schmalen Bahnsteigen der heiße, feuchte, rußige Dampf der Lokomotiven einhüllen; wenn wir die großen neuen Durchgangsstraßen wie die Northumberland Avenue entlanggehen, die durch die Slums der Londoner Innenstadt führen, wird uns eine ungewaschene Menschenmenge umgeben – zumal beiderseits der feinen Avenuen nach wie vor Mietskasernen stehen mit bis zu hundert Familien, die auf engstem Raum in einem übelriechenden Gebräu aus Schweiß, Gin, Atem und Haut hausen. Doch es ist ein schöner Tag: Wir werden zu Fuß gehen. Obgleich viele uns, während wir durch die Seitenstraßen von Covent Garden eilen, auf der Suche nach einem Taschentuch oder einem Handschuhpaar, das sie uns abnehmen könnten, begehrliche Blicke zuwerfen, werden wir im Vorübergehen nur von den halbwüchsigen Dirnen in ihrer billigen, geschmacklosen Aufmachung angesprochen, die uns in der Hoffnung, einen flüchtigen Funken Lust zu entfachen, ihre lasziven Grüße zuraunen. Aber dazu haben wir keine Zeit – zu nichts haben wir Zeit; es ist schon furchtbar spät. Vielleicht sollten wir lieber eine Droschke nehmen; da ist ja schon eine.
Während wir die Drury Lane entlangklappern, steigt uns ein leiser, eher unangenehmer Duft in die Nase, der wie ein giftiger Nebel die Seitenstraßen heraufzieht. Es ist der Geruch des Flusses. Zwar verursacht die Themse dank des Abwassernetzes von Bazalgette keinen so üblen Gestank von faulendem Abfall mehr wie einst, als die Abgeordneten ihre Vorhänge mit Kalziumsulphat tränken mussten; es funktioniert jedoch nur für all jene, deren moderne Aborte daran angeschlossen sind, und in den Mietshäusern sind nach wie vor riesige Latrinen üblich, deren faulig riechender Schlick in Londons unterirdische Wasseradern sickert. Dann sind da noch all die anderen Gerüche der verschiedenen Gewerbe, die sich am Ufer scharen, um Zugang zum Wasser zu haben. Der Hopfen aus den Brauereien riecht noch ganz angenehm, wie auch der exotische Pflanzenduft aus den Ginbrennereien; doch dann kommt der Gestank von gekochten Pferdeknochen aus den Leimfabriken, von siedendem Fett aus den Seifenfabriken, von Fischabfällen aus Billingsgate, von verwesendem Hundekot aus den Gerbereien. Kein Wunder, dass zartbesaitete Naturen Blumensträuße oder mit Eukalyptussalz gefüllte Broschen am Rockaufschlag tragen.
Während wir uns dem Londoner Hafen nähern, kommen wir an riesigen Lagerhäusern vorbei, die wie gewaltige dunkle Klippen in den Himmel ragen. Aus dem einen dringt der reichhaltige, schwere Geruch von Tabakblättern, aus dem nächsten ein süßlicher Hauch von Melasse, aus einem dritten der abstoßende Dunst von Opium. Hier ist der Weg klebrig von einem zerborstenen Rumfass, dort von einer vorübermarschierenden Phalanx rotberockter Soldaten blockiert. Und überall das Geplapper in einem Dutzend verschiedener Sprachen – flachsblonde Deutsche, Chinesen mit schwarzen Pferdeschwänzen, Schwarze, die sich helle Taschentücher um den Kopf gebunden haben. Ein Schlachter in blauem Kittel schultert eine Platte mit Fleisch, gefolgt von einem Bootsmann mit Strohhut, der behutsam einen grünen Sittich in einem Bambuskäfig mit sich herumträgt. Yankees singen ausgelassene Segelmacherlieder; Küfer rollen mit ohrenbetäubendem Getöse Fässer über das Kopfsteinpflaster; Ziegen blöken auf dem Weg zu den Schiffen aus ihren Käfigen. Und der Fluss – auf dem Fluss wimmelt es nur so von Schiffen, deren Masten und Schornsteine, so weit das Auge reicht, gen Himmel ragen: Schaluppen und Schoner und Bilander, Lastkähne voller Bierfässer und beladene Kohlenschiffe; Leichter und Aalboote, Teeklipper und Vergnügungskreuzer, Dampfer mit glänzenden Mahagonidecks und schmutzige Arbeitsbarken – sie alle bahnen sich kreuz und quer ihren Weg durch das Chaos, das von den schrillen Schreien der Dampfpfeifen, den Rufen der Kohlewipper, dem Hupen der Lotsenboote und dem nicht enden wollenden Geläute der Barken widerhallt.
Man müsste schon dem Tod sehr nahe sein, um angesichts dieser grenzenlosen, rastlosen Energie keine freudige Erregung zu empfinden: angesichts dieser Geschäftigkeit und Betriebsamkeit, die von der riesigen Stadt über den ganzen Globus ausströmt, so wie Bienen aus der vollen, triefenden Wabe im Herzen ihres Stocks ausschwirren, um alsbald wieder dorthin zurückzukehren. Ich vermochte darin jedoch keine ordnende Vernunft zu erkennen – es war erregend, aber auch ohne Sinn und Verstand, und ich sah all das an mir vorüberziehen, wie jemand sich an einer Zirkusparade erfreut. Erst ein Mann wie Pinker erkannte darin mehr – nämlich dass Zivilisation, Kommerz und Christentum letzten Endes ein und dasselbe sind und ein von der Regierung nicht reglementierter Handel strahlendes Licht in die noch verbleibenden dunklen Regionen der Welt bringen könnte.
4
«Zeder» – dieses angenehme, frische, rustikale Aroma entspricht dem von unbehandeltem Holz und ist nahezu identisch mit dem von Bleistiftspänen. Es wird durch das natürliche Duftöl der Atlaszeder exemplifiziert. Reif geerntet ist es prägnanter.
Jean Lenoir, Le Nez du Café
Der junge Mann in meinem Alter, der die Tür des Hauses in der Narrow Street öffnete, war zweifellos einer jener tüchtigen Sekretäre, von denen Pinker gesprochen hatte. Er war makellos, wenn auch altmodisch gekleidet, sein weißer Kragen sorgfältig gestärkt und sein von Macassaröl glänzendes Haar kurz geschnitten – viel kürzer als meins. «Sie wünschen?», sagte er und warf mir einen unterkühlten Blick zu.
Ich reichte ihm Pinkers Karte. «Würden Sie bitte Ihrem Dienstherrn ausrichten, dass der Dichter Robert Wallis hier ist?»
Der junge Mann musterte die Karte. «Ihnen darf Zutritt gewährt werden. Folgen Sie mir.»
Ich folgte ihm in das Gebäude, eine Art Lagerhaus. Kahnschiffer entluden von einem Pier Leinwandsäcke, und eine lange Kette von Lageristen eilte, einen Sack auf jeder Schulter, in verschiedene Bereiche des Lagers. Der Duft von röstendem Kaffee traf mich wie ein würziger Hauch. Oh, dieser Duft… In dem Gebäude lagerten über tausend Säcke Kaffee, und Pinker ließ seine großen Rösttrommeln Tag und Nacht laufen. Es war ein Duft, bei dem einem das Wasser im Munde zusammenlief und die Tränen in die Augen stiegen, ein Duft, so dunkel wie brennendes Pech; ein bitteres, schwarzes, betörendes Aroma, das einen im Rachen traf und sich in Nasenflügeln und Kopf ausbreitete. Ein solcher Duft könnte einen wie jedes Opium auf der Stelle süchtig machen.
Ich erhaschte von alldem nur einen flüchtigen Eindruck, als der Sekretär mich über eine Treppe zu einem Büro geleitete. Ein Fenster ging zur Straße hinaus, doch es gab noch ein zweites, weit größeres, durch das man in das Lagerhaus blickte. An diesem Fenster stand Samuel Pinker und sah dem Treiben unter sich zu. Neben ihm ratterte unter einer Glasglocke ein kleines Gerät aus Messing leise vor sich hin und spuckte eine mit Symbolen bedruckte Spule aus dünnem weißem Papier aus. Die wie eine komplizierte Fleur-de-Lis auf den polierten Holzfußboden fallenden, ineinander verschlungenen Schleifen stellten die einzige Unordnung im Raum dar. Ein zweiter, wie der erste gekleidete Sekretär saß an einem Tisch und schrieb mit einem Füllfederhalter.
Pinker wandte sich um und bemerkte mich. «Ich nehme vier Tonnen Brasil und eine von dem Ceylon», sagte er streng.
«Wie bitte?», sagte ich verblüfft.
«Gezahlt wird die Ladung an Bord, vorausgesetzt, dass während der Überfahrt nichts verdirbt.»
Ich begriff, dass er diktierte. «Oh, selbstverständlich. Fahren Sie fort.»
Er runzelte angesichts meiner Dreistigkeit die Stirn. «Zehn Prozent werden gegen zukünftige Proben einbehalten. Ich verbleibe etc. etc. Nehmen Sie Platz.» Da diese letzte Bemerkung eindeutig mir galt, setzte ich mich. «Kaffee, Jenks, bitte», sagte er zum Sekretär. «Der Vierer und der Neuner und danach der Achtzehner. In der Zwischenzeit unterschreibe ich das hier.» Er richtete seinen Blick wieder auf mich. «Sie haben mir erzählt, Sie seien Schriftsteller, MrWallis», sagte er missmutig.
«Ja, richtig.»
«Indessen haben meine Sekretäre in sämtlichen Buchläden von Charing Cross vergeblich nach einem Werk von Ihnen gesucht. In MrW.H.Smiths Subskriptionsbibliothek hat man noch nie von Ihnen gehört. Selbst dem literarischen Herausgeber des Blackwood’s Magazine ist Ihr Werk seltsamerweise unbekannt.»
«Ich bin Dichter», sagte ich, leicht eingeschüchtert durch den Feuereifer, mit dem Pinker seine Nachforschungen betrieben hatte. «Aber noch unveröffentlicht. Ich dachte, ich hätte das erwähnt.»
«Sie sagten, Sie seien noch nicht berühmt. Jetzt muss ich feststellen, dass man noch nicht einmal von Ihnen gehört hat. Man kann sich kaum vorstellen, wie das eine ohne das andere möglich sein kann.» Er ließ sich auf der anderen Seite des Tisches auf einen Stuhl fallen.
«Es tut mir leid, wenn ich einen falschen Eindruck erweckt habe. Aber…»
«Vergessen Sie den Eindruck. Präzision, MrWallis. Was ich von Ihnen – von jedem – erwarte, ist Präzision.»
Im Café Royal hatte Pinker zurückhaltend, wenn nicht gar unsicher gewirkt. Hier in seinem Büro war sein Auftreten autoritärer. Er holte einen Füllfederhalter hervor, nahm die Kappe ab und griff nach dem Stapel von Briefen, die er, während er weitersprach, einen nach dem anderen mit schwungvoller Geste unterschrieb. «Nehmen Sie mich zum Beispiel. Wäre ich noch immer Kaufmann, wenn ich noch nie einen einzigen Sack Kaffee verkauft hätte?»
«Eine interessante Frage…»
«Keineswegs. Ein Kaufmann ist jemand, der Handel treibt. Ergo, wenn ich keinen Handel treibe, bin ich auch kein Kaufmann.»
«Aber demnach ist ein Schriftsteller jemand, der schreibt», bemerkte ich. «Es ist nicht unbedingt notwendig, auch gelesen zu werden. Nur wünschenswert.»
«Hmm.» Pinker schien darüber nachzudenken. «Sehr schön.» Ich hatte den Eindruck, eine Art Prüfung bestanden zu haben.
Der Sekretär kehrte mit einem Tablett, auf dem vier fingerhutgroße Tassen und zwei dampfende Kannen standen, zurück und stellte es vor uns ab. «So», sagte sein Dienstherr mit einer Geste in meine Richtung. «Sagen Sie mir, was Sie davon halten.»
Der Kaffee war offenbar frisch aufgebrüht – der Duft intensiv und angenehm. Ich schenkte mir ein und nippte daran, während Pinker mich erwartungsvoll ansah.
«Nun?»
«Er ist hervorragend.»
Er schnaubte. «Und? Sie sind doch Schriftsteller, oder? Wörter sind Ihr Warenbestand?»
«Ach so.» Ich begriff, worauf er hinauswollte. Ich atmete tief ein. «Er ist ganz und gar… belebend. Wie ein alpines Sanatorium – nein – wie eine Liegekur am Meer. Ich kenne keinen besseren, milderen, belebenderen Muntermacher als Pinker’s Frühstücksmischung. Er wird nicht nur der Verdauung guttun, sondern auch die Konzentration wiederherstellen und die Konstitution verbessern.»
«Was?» Der Kaufmann starrte mich an.
«Man müsste natürlich noch etwas daran feilen», sagte ich bescheiden. «Aber ich denke, die allgemeine Richtung ist…»
«Probieren Sie den anderen», sagte er ungeduldig.
Ich machte mich daran, mir aus der zweiten Kanne einzuschenken. «Nicht in dieselbe Tasse!», fauchte er.
«Entschuldigen Sie.» Ich füllte eine zweite fingerhutgroße Tasse und nippte daran. «Schmeckt anders», sagte ich überrascht.
«Ja, natürlich», sagte Pinker. «Und?»
Mir war bislang noch nicht wirklich aufgefallen, dass es beim Kaffee so große Qualitätsunterschiede gab. Er konnte natürlich wässrig oder abgestanden oder bitter sein – nicht selten war er alles zugleich–, doch das hier waren zwei fraglos vorzügliche Kaffeesorten, die in ihrer Qualität so verschieden waren wie Tag und Nacht.
«Wie könnte man einen solchen Unterschied in Worte fassen?», sagte er, und obgleich seine Miene unverändert war, hatte ich das Gefühl, als sei dies der entscheidende Moment unseres Gesprächs.
«Der hier», sagte ich langsam und zeigte auf die zweite Tasse, «hat ein beinahe… rauchiges Aroma.»
Pinker nickte. «Das stimmt.»
«Wohingegen dieser», ich zeigte auf den ersten, «eher… blumig ist.»
«Blumig!» Pinker starrte mich unverwandt an. «Blumig!» Doch er schien interessiert – wirkte sogar beeindruckt. «Hier – lassen Sie mich das…» Er zog den Schreibblock des Sekretärs zu sich heran und notierte das Wort «blumig». «Fahren Sie fort.»
«Diese zweite Tasse hat – eine Art Beigeschmack.»
«Was für einen Beigeschmack?»
«Eher wie Bleistiftspäne.»
«Bleistiftspäne.» Pinker schrieb auch das auf. «Richtig.»
Es war wie ein Gesellschaftsspiel, vergnüglich, doch sinnlos. «Während der andere – Kastanie vielleicht?», sagte ich.
«Vielleicht», sagte Pinker und machte eine Notiz. «Was noch?»
«Der hier», ich zeigte auf die zweite Tasse, «schmeckt nach einem Gewürz.»
«Nach welchem?»
«Ich bin mir nicht sicher», gestand ich.
«Macht nichts», sagte Pinker und strich «Gewürz» durch. «Ah, da bist du ja. Vortrefflich. Gieß bitte ein!»
Ich wandte mich um. Eine junge Frau hatte mit einer weiteren Kanne Kaffee den Raum betreten. Sie war, wie mir gleich auffiel – damals hielt ich mich für einen Kenner in diesen Dingen–, ziemlich attraktiv. Sie trug ein Kleid nach der Reformmode, wie es damals von vielen berufstätigen Frauen bevorzugt wurde. Ein bis zum Hals zugeknöpftes tailliertes Jackett über einem langen Rock ohne Turnüre offenbarte nur wenig von der schlanken Gestalt darunter. Ihr Gesicht war indessen wach und lebendig und ihr Haar sorgsam aufgesteckt, elegant und goldblond.
Sie füllte eine der Tassen und reichte sie mir mit Bedacht. «Danke schön», sagte ich und erhaschte, während ich die Tasse mit einem freimütigen Lächeln entgegennahm, ihren Blick. Sie ließ sich nicht anmerken, ob ihr mein Interesse auffiel; ihr Gesicht war eine einzige Maske aus professioneller Distanz.
«Würdest du bitte mitschreiben, Emily», sagte Pinker und schob ihr seinen Notizblock zu. «MrWallis überlegte gerade, an welches Gewürz ihn unser bester Brasil erinnert, doch ihn hat die Inspiration vorübergehend verlassen.»
Die Sekretärin setzte sich an den Tisch und zückte ihren Federhalter. Ich hätte schwören können, dass ich einen Augenblick lang, während sie darauf wartete, dass ich fortfuhr, in der Tiefe ihrer grauen Augen eine Spur von Belustigung – ja sogar Schalkhaftigkeit – entdeckte. Aber ich war mir nicht ganz sicher.
Ich nahm einen Schluck von dem neuen Kaffee, ohne allerdings etwas zu schmecken. «Tut mir leid», sagte ich kopfschüttelnd.
«Pusten Sie darauf», schlug Pinker vor.
Ich pustete und nippte erneut daran. Der Geschmack war im Vergleich zu den beiden anderen sehr gewöhnlich. «So etwas wird im Café Royal serviert!»
«Ganz ähnlich, ja.» Pinker lächelte. «Ist er – ha! – ist er moderig?»
«Eine Spur.» Ich nahm einen weiteren Schluck. «Und fade. Sehr fade. Mit einem leichten Nachgeschmack von – nassen Handtüchern.» Ich warf der Stenographin einen Blick zu. Sie schrieb emsig alles mit – oder vielmehr notierte sie, wie ich jetzt sah, eine Reihe von seltsamen, beinahe arabischen Schnörkeln auf ihren Block. Das musste die Pitman’sche phonographische Methode sein, von der ich gelesen hatte.
«Nasse Handtücher», wiederholte Pinker vor sich hin lachend. «Sehr gut, allerdings habe ich noch nie ein Handtuch, ob nass oder trocken, probiert.»
Der Füllfederhalter der Sekretärin hielt inne, wartete. «Und er riecht wie – alter Teppich», sagte ich. Sogleich wurden meine Worte in weitere Striche und Zeichen übertragen.
«Teppich!» Pinker nickte. «Sonst noch etwas?»
«Ein Hauch von verbranntem Toast.» Weitere Schnörkel.
«Verbrannter Toast. Gut. Ich glaube, das reicht vorerst.» Die Notizen der jungen Frau füllten noch nicht einmal eine Seite ihres Notizbuchs. Ich verspürte einen törichten Drang, sie zu beeindrucken. «Und welcher davon ist Ihrer?», fragte ich den Kaufmann und zeigte auf die Kannen.
«Was?» Wieder schien Pinker sich über die Frage zu wundern. «Oh, sie alle.»
«Und für welchen wollen Sie werben?»
«Werben?»
«Über den hier», sagte ich und wies auf die erste Kanne, «könnte man sagen…» Ich hob die Tasse in die Höhe. «‹Ein erlesenes Gebräu, die Crème de la Crème der Kolonien, mit einem köstlichen Geschmack nach Kastanie.›» Bildete ich es mir nur ein oder gab die Sekretärin tatsächlich ein leises Lachen von sich, das sie sogleich unterdrückte? «Obgleich die meisten Werbetexte, wie mir aufgefallen ist, den Aspekt der Gesundheit hervorheben. Wie etwa: ‹Der einmalige Kastaniengeschmack belebt die Konstitution.›»
«Mein lieber Wallis», sagte Pinker, «Sie würden allerdings einen fürchterlichen Werbetexter abgeben.»
«Das glaube ich nicht.»
«Die Leute wollen, dass ihr Kaffee nach Kaffee schmeckt, nicht nach Kastanie.»
«Wir könnten ihnen erzählen, wie gut der Kastanienanteil daran ist.»
«Das Wesen der Werbung», sagte er nachdenklich, «besteht natürlich darin, die Wahrheit zu verheimlichen und nur das preiszugeben, was die Kunden hören wollen. Andererseits besteht das Wesen eines Codes darin, die Wahrheit für die wenigen Eingeweihten auf den Punkt zu bringen.»
«Das klingt sehr gut», sagte ich beeindruckt. «Das ist beinahe ein Epigramm. Aber… was meinen Sie mit dem Code?»
«Junger Mann», sagte Pinker und sah mich eindringlich an, «hören Sie mir gut zu. Ich werde Ihnen einen gewichtigen Vorschlag machen.»
5
«Wir leben in einem Zeitalter des Fortschritts, MrWallis.» Pinker zog seufzend eine Uhr aus seiner Hosentasche. «Nehmen Sie zum Beispiel diese Uhr», sagte er und hielt sie an ihrer Kette in die Luft. «Sie ist nicht nur genauer als jede andere aus den zurückliegenden Jahrzehnten, sondern auch weniger teuer. Nächstes Jahr wird sie noch preiswerter und noch genauer sein. Wissen Sie, was die letzte Ingersoll kostet?»
Ich gestand meine Unwissenheit auf diesem Gebiet.
«Nur einen Dollar.» Pinker nickte. «Und bedenken Sie den Nutzen. Konsistenz – die wichtigste Voraussetzung für den Handel. Sie zweifeln daran? Genauere Uhren bedeuten genauere Züge. Genauere Züge bedeuten mehr Handel. Mehr Handel bedeutet preiswertere, genauere Uhren.» Er nahm einen Federhalter vom Tisch. «Oder nehmen Sie diesen Füllfederhalter. Er besitzt sein eigenes Tintenfass, das auf geniale Weise in das Gehäuse integriert ist – sehen Sie? Das heißt, dass meine Sekretäre schneller schreiben und wir demzufolge mehr Geschäfte abschließen können etc. etc. Oder…» Er griff erneut in seine Uhrentasche und zog mit seinem Daumen und Zeigefinger etwas daraus hervor. «Sehen Sie sich das hier an.» Er blickte gebannt auf eine winzige Schraube mit Mutter. «Ein erstaunliches Ding, Wallis. Die Mutter stammt aus – ach, sagen wir Belfast. Die Schraube möglicherweise aus Liverpool. Trotzdem passen sie haargenau zusammen. Die Schrauben sind nämlich genormt worden.» Der Füllfederhalter der Stenographin huschte inzwischen über ihren Block – vermutlich war sie angewiesen worden, sämtliche Ausführungen ihres Dienstherrn festzuhalten, vielleicht tat sie dies aber auch bloß zu ihrer persönlichen Weiterbildung. «Vor ein paar Jahren produzierte jede Werkstätte und jeder Maschinenraum im Lande sein eigenes Schraubenmodell. Ein einziges Chaos. Das war unpraktisch. Und heute gibt es dank des Fortschritts nur noch ein einziges. Glauben Sie an die Theorien von MrDarwin?»
Überrascht über den plötzlichen Themenwechsel und um nur ja niemanden zu brüskieren – Darwin war ein Thema, das unter meinen Oxforder Tutoren zu hitzigen Diskussionen geführt hatte–, sagte ich, alles in allem würde ich das tun.
Pinker nickte zustimmend. «Darwin zeigt uns, dass Fortschritt unvermeidlich ist. Für die menschliche Gattung natürlich, aber auch für Länder, Rassen, Individuen, ja sogar für Schrauben und Muttern. Also. Überlegen wir, wie wir MrDarwins Ideen dem Kaffeehandel zugutekommen lassen könnten.»
Ich bemühte mich um einen Gesichtsausdruck, als hätte ich zu diesem Thema brauchbare Vorschläge beizutragen, die ich allein aus Achtung vor der größeren Weisheit meines Gegenübers noch für mich behielt. Eine solche Miene hatte ich des Öfteren in den Räumen meines Oxforder Tutors auflegen müssen. Hier war dergleichen jedoch nicht nötig: Pinker war in voller Fahrt.
«An erster Stelle das Aufbrühen. Wie lässt sich dieser Prozess verbessern? Ich werde es Ihnen sagen, MrWallis. Durch Dampf.»
«Dampf? Sie meinen – eine Mühle?»
«Sozusagen. Stellen Sie sich vor, jedes Café und Hotel besäße seine eigene Dampfmaschine zur Kaffeezubereitung. Wie bei der Herstellung von Baumwolle oder Getreide ergäbe sich daraus Konsistenz. Konsistenz!»
«Würden sich die Cafés dadurch nicht ziemlich – nun, ziemlich aufheizen?»
«Die Maschine, von der ich rede, ist ganz klein. Jenks, Foster», rief er, «bringen Sie bitte den Apparat herein!»
Nach einer kurzen Pause mit einigem Gepolter schoben die beiden Sekretäre einen Rolltisch herein, auf dem ein seltsamer Mechanismus zu sehen war. Er bestand aus einem Kupferkessel und einer Vielzahl von Messingleitungen, Hebeln, Skalen und Schläuchen.
«Signor Tosellis dampfbetriebene Kaffeemaschine», sagte Pinker stolz. «Wie sie auf der Pariser Weltausstellung gezeigt worden ist. Der Dampf wird für jede einzelne Tasse durch den gemahlenen Kaffee gepresst, wodurch ein viel besserer Geschmack erzeugt wird.»
«Wie wird sie beheizt?»
«Mit Gas, obgleich wir irgendwann mit einem elektrischen Modell rechnen.» Er hielt inne. «Ich habe davon achtzig bestellt.»
«Achtzig! Wofür?»
«Für Pinker’s Temperance Taverns.» Pinker sprang auf und ging im Raum auf und ab. Hinter ihm entzündete Jenks den Boiler: Der Apparat zischte und pfiff leise, während sein Besitzer sprach. «Oh, ich ahne schon, was Sie gleich sagen werden. Sie wollen anmerken, dass es im ganzen Land bislang noch keine einzige solche Abstinenzschenke gibt. Aber es wird sie geben, Wallis; es wird sie geben. Ich habe vor, die Prinzipien des Füllfederhalters und der Ingersoll-Uhr anzuwenden. Sehen Sie sich doch nur London an. Ein Pub an jeder Straßenecke! Ginpaläste die meisten, in denen der Arbeiter um seinen hart verdienten Lohn gebracht wird. Was nutzt ihm sein Rausch? Er versklavt ihn, macht ihn zu einem, der seine Frau verprügelt. Er lässt ihn so hilflos werden, dass er häufig nicht einmal mehr nach Hause torkeln kann und die Nacht im Rinnstein verbringen muss, weshalb er tags darauf nicht arbeiten kann. Doch der Kaffee – der Kaffee! – hat keine solchen Nachteile. Er setzt einen nicht außer Gefecht, sondern wirkt vielmehr belebend. Er umnebelt nicht die Sinne, sondern schärft sie. Warum sollte es nicht vielmehr in jeder Straße ein Kaffeehaus geben? Das wäre doch ein Fortschritt, oder nicht? Und wenn es tatsächlich ein Fortschritt ist, dann muss es – wird es – auch geschehen. So heißt es bei Darwin! Und ich werde derjenige sein, der dafür sorgt, dass es geschieht.» Er trocknete sich mit dem Ärmel die Stirn.
«Sie sprachen von einem Code», sagte ich. «Ich verstehe noch nicht ganz…»
«Ja. Angebot und Nachfrage, MrWallis. Angebot und Nachfrage.»
Er hielt inne, ich wartete, und die zarte Hand der Sekretärin ruhte auf ihrem Notizblock. Sie hatte ungewöhnlich lange, elegante Finger. Man konnte sich vorstellen, wie sie Geige spielten oder die Tasten eines Klaviers anschlugen. Ja, man konnte sich vorstellen, wie sie alles Mögliche – auch betörend unschickliche Dinge – taten…
«Das Schwierige an meinem Vorhaben», erläuterte Pinker, «sind die Kosten. Kaffee ist teuer – sehr viel kostspieliger als etwa Bier oder Gin. Nun, er kommt schließlich auch von weit her. Man bestellt ihn über einen Zwischenhändler, der ihn wiederum über einen anderen Zwischenhändler bezieht – ein Wunder, dass er uns überhaupt erreicht.» Er sah mich an. «Und so fragen wir uns – was?»
«Wir fragen uns», schlug ich vor, indem ich meine Aufmerksamkeit erneut ihm zuwandte, «wie das Angebot verbessert werden kann?»
Pinker schnippte mit den Fingern. «Richtig! Wir sind an die Börse gegangen. Sie haben doch von der Börse gehört?»
Das hatte ich nicht.
Er legte seine Hand auf die Glasglocke, unter der die Druckmaschine noch immer leise vor sich hin tickend und ratternd ihre endlose Reihe von Symbolen auf den Boden spulte. «Die Londoner Kaffeebörse wird unsere Art, Geschäfte zu machen, revolutionieren. Sie ist über das Unterseekabel mit New York und Amsterdam verbunden. Die Preise werden vereinheitlicht – überall auf der Welt. Der Preis wird fallen – das muss er.» Er warf mir einen verschmitzten Blick zu. «Erkennen Sie die Schwierigkeit, MrWallis?»
Ich überlegte. «Sie wissen nicht genau, was Sie bekommen. Sie kaufen nach Schema F und richten sich dabei nur nach den Kosten. Sie wollen gute Ware – für Ihre Schenken – und verkaufen den Rest weiter. So profitieren Sie von den niedrigeren Preisen, und andere bekommen den Ausschuss.»
Pinker setzte sich wieder und sah mich lächelnd an. «Sie haben’s erfasst, Sir. Sie haben’s erfasst.»
Der Apparat gab plötzlich ein keuchendes, blubberndes schrilles Pfeifen von sich. Jenks zog an einigen Hebeln, und aus den verschiedenen Öffnungen drang ein unangenehmes Gurgeln, während Flüssigkeit und Dampf in eine winzige Tasse zischten.
Ich sagte: «Wenn Sie über einen Code verfügen – nein, Code ist nicht der richtige Begriff–, wenn Sie über ein Vokabular für den Handel verfügen, eine Art, den Kaffee zu beschreiben, die Sie und Ihre Zwischenhändler im Voraus miteinander vereinbart haben, dann könnten Sie, auch wenn Sie sich in verschiedenen Ländern befinden…»
«Richtig!» Pinker griff nach der Schraube, nahm die Mutter in die andere Hand und fügte sie zusammen. «Wir haben unsere Schraube und unsere Mutter. Die beiden werden zusammenpassen.»
Jenks stellte zwei winzige Tassen vor Pinker und mich. Ich hob meine in die Höhe. Sie enthielt nicht mehr als einen Eierbecher voll von einer schwarzen, sämigen Flüssigkeit, auf der eine Wabe aus haselnussbraunem Schaum schwamm. Ich schwenkte die Tasse: Ihr Inhalt war dick- und zähflüssig, wie Öl. Ich hob sie an meine Lippen…
Es war, als sei die Essenz des Kaffees in diesem Tropfen Flüssigkeit konzentriert. Glimmende Glut, Rauch von verbranntem Holz und Kohlenfeuer tanzten über meine Zunge, prallten gegen meinen Gaumen und schienen von dort direkt in meinen Kopf aufzusteigen, ohne dabei bitter zu sein. Es fühlte sich an wie Honig oder Sirup und besaß einen Hauch von zuckerbrotartiger Süße, wie dunkelste Schokolade, wie Tabak. Ich trank die winzige Tasse in zwei Schlucken aus, aber der Geschmack schien sich noch lange danach in meinem Mund zu verstärken und zu vertiefen.
Pinker beobachtete mich und nickte. «Sie haben einen feinen Gaumen, MrWallis. Er ist noch nicht entwickelt und kaum geschult, aber Sie können es auf dem Gebiet zu etwas bringen. Und – was noch wichtiger ist – Sie besitzen das Talent, mit den Worten umzugehen. Suchen Sie nach den geeigneten Worten, die den schwer definierbaren Geschmack des Kaffees erfassen – normieren – können, sodass zwei Menschen in verschiedenen Teilen der Welt sich eine Beschreibung telegraphieren können und jeder genau weiß, was damit gemeint ist. Schaffen Sie etwas Zwingendes, Evokatives, vor allem aber Präzises. Darin besteht Ihre Aufgabe. Wir nennen es…» Er hielt inne. «Wir nennen es die ‹Pinker-Wallis-Methode zur Bestimmung und Klassifizierung der verschiedenen Aromen des Kaffees›. Was meinen Sie?»
Er sah mich erwartungsvoll an.
«Es klingt faszinierend», sagte ich höflich. «Aber ich kann das, was Ihnen vorschwebt, unmöglich erfüllen. Ich bin Schriftsteller– Künstler – und kein Produzent irgendwelcher Phrasen.» Mein Gott, der Kaffee aus dieser Maschine war stark: Ich spürte, wie mein Herz zu rasen begann.
«Ah. Emily hat mit einer solchen Antwort gerechnet.» Pinker nickte der Sekretärin zu, deren Kopf nach wie vor scheu über den Notizblock geneigt war. «Auf ihren Rat hin nahm ich mir die Freiheit, die Adresse Ihres Vaters herauszufinden und ihm ein Telegramm mit diesem Stellenangebot zu schicken. Vielleicht interessiert Sie ja die Antwort von Reverend Wallis.» Pinker schob ein Telegramm über den Tisch. Ich nahm es in die Hand: Es begann mit dem Wort «Halleluja!». «Er kann es wohl kaum erwarten, der Bürde, Sie unterstützen zu müssen, entledigt zu sein», sagte Pinker nüchtern.
«Ich verstehe.»
«‹Lassen Sie ihn wissen Schluss mit Kostgeld stop. Günstige Gelegenheit stop. Gott segne Sie Sir stop.›»
«Ah.»
«Und in Anbetracht Ihrer Relegierung– Ihr Vater erwähnt sie beiläufig – wird Ihnen die Priester- oder gar Lehrerlaufbahn vermutlich verwehrt sein.»
«Ja», sagte ich. Meine Kehle fühlte sich trocken an. Jenks stellte eine weitere winzige Tasse Kaffee vor mich. Ich kippte sie hinunter. Wohlriechende Holzkohle und dunkle Schokolade stiegen mir in den Kopf.
«Sie sprachen von unermesslichem Reichtum.»
«Ach, wirklich?»
«Gestern, im Café Royal. Sie sagten, wenn ich in Ihr… Schema passen würde, würden wir beide unermesslich reich werden.»
«Ach ja.» Pinker überlegte. «Das war nur eine Redewendung. Ich verwendete…» Er blickte zu seiner Sekretärin. «Was verwendete ich?»
«Eine Hyperbel», antwortete sie. Es war das erste Mal, dass sie etwas sagte. Ihre Stimme war leise, aber wieder glaubte ich einen Anflug von Belustigung zu erkennen. Ich sah verstohlen zu ihr, doch ihr Kopf war noch immer über den Notizblock geneigt, auf dem sie jedes einzelne Wort mit diesen verflixten Schnörkeln festhielt.
«Richtig. Ich verwendete eine Hyperbel. Als Literat müsste Ihnen das eigentlich zusagen.» Pinkers Augen funkelten. «Natürlich war ich zu dem Zeitpunkt über Ihre etwas angespannte Lage nicht gänzlich im Bilde.»
«Welche Vergütung schwebt Ihnen – genau – vor?»
«Emilys Informationen zufolge erhielt MrsHumphrey Ward für ihren letzten Roman zehntausend Pfund. Ungeachtet der Tatsache, dass sie die meistgelesene Schriftstellerin im Lande ist und Sie ganz und gar unbekannt sind, schlage ich vor, Sie zu demselben Satz zu entlohnen.»
«Zehntausend Pfund?», wiederholte ich staunend.
«Ich sagte, derselbe Satz, nicht derselbe Betrag – wieder muss ich Sie vor den Gefahren mangelnder Präzision warnen.» Er lächelte – der Schuft hatte seine Freude daran. «MrsWards Opus umfasst in etwa zweihunderttausend Wörter – das heißt sechs Shilling, drei Pence pro Wort. Ich werde Ihnen sechs Shilling, drei Pence für jedes in unseren Code aufgenommene Schlagwort bezahlen. Und bei dessen Fertigstellung einen Bonus von zwanzig Pfund. Das ist doch fair, oder?»
Ich fuhr mir mit der Hand über das Gesicht. In meinem Kopf drehte sich alles. Ich hatte viel zu viel von dem verdammten Kaffee getrunken. «Die Wallis-Pinker-Methode.»
«Wie bitte?»
«Es muss Wallis-Pinker-Methode heißen. Nicht andersherum.»
Pinker runzelte die Stirn. «Da ein Pinker der Urheber ist, gebührt Pinker natürlich die größere Anerkennung.»
«Als Schreibender werde ich die meiste Arbeit haben.»
«Wenn Sie erlauben, Wallis, so haben Sie noch nicht ganz die Prinzipien erfasst, nach denen Geschäfte gemacht werden. Um einen gefügigeren Mitarbeiter zu finden, brauche ich nur ins Café Royal zu gehen und mir dort einen auszusuchen. Ich habe Sie schließlich binnen fünf Minuten gefunden. Sollten Sie sich indessen nach einem anderen Dienstherrn umsehen, werden Sie gehörig in Nöten sein.»
«Schon möglich», sagte ich. «Aber kein Schriftsteller gleicht dem anderen. Woher wissen Sie, dass der nächste Mann seine Arbeit genauso gut macht?»
«Hmm.» Pinker überlegte. «Also gut», gab er sich plötzlich geschlagen. «Die Wallis-Pinker-Methode.»
«Und da es sich um eine literarische Arbeit handelt, benötige ich einen Vorschuss. Dreißig Pfund.»
«Eine ansehnliche Summe.»
«Das ist so üblich», beharrte ich.
Zu meiner Überraschung zuckte Pinker mit den Schultern. «Also gut, dreißig Pfund. Sind wir uns einig?»
Ich zögerte. Ich wollte eigentlich sagen, ich würde es mir noch einmal durch den Kopf gehen lassen, einen Rat einholen. Ich stellte mir bereits das spöttische Grinsen meiner Freunde Hunt und Morgan vor, sollte ich ihnen je von diesem Auftrag erzählen. Aber – ich konnte nicht anders – ich warf dem Mädchen einen verstohlenen Blick zu. Ihre Augen leuchteten, und sie schenkte mir… kein wirkliches Lächeln, sondern so etwas wie ein winziges Zeichen, indem ihre Augen sich nur ganz kurz zustimmend weiteten. In dem Moment war ich verloren.
«Ja», sagte ich.
«Gut», sagte der Kaufmann, erhob sich und reichte mir die Hand. «Wir beginnen morgen früh in diesem Büro, Sir, Punkt zehn Uhr. Emily, bist du so freundlich und begleitest MrWallis hinaus?»
6
«Herb» – ein bitterer, saurer Geschmack auf der Zunge.
Lingle, Das Handbuch des Kaffeeverkosters
Am unteren Treppenabsatz hielt ich sie auf. «Könnte ich mich wohl ein wenig im Lagerhaus umsehen? Ich wüsste gern mehr über das Geschäft, in dem MrPinker mich auszubilden gedenkt.»
Wenn sie das als Aufforderung, sich über ihren Dienstherrn lustig zu machen, verstand, ließ sie es sich nicht anmerken. «Natürlich», sagte sie nur und führte mich in den riesigen Lagerraum, in den ich zuvor nur einen Blick geworfen hatte.
Es war ein seltsamer Ort – entsetzlich heiß von den auf der einen Seite aufgereihten Rösttrommeln, deren Brenner in der Dunkelheit loderten. Das Schiff war inzwischen entladen, und die großen Türen zum Pier waren geschlossen, sodass durch die Ritze dazwischen nur ein einziger breiter Sonnenstrahl drang. Weit oben gab es Fenster, die jedoch nur wenig Licht hereinließen. Der Raum war vielmehr in einen seltsamen Nebel gehüllt, der, wie ich jetzt sah, von einem dichten Staub aus überall herumschwebenden baumwollartigen Fasern herrührte. Als ich nach ihnen greifen wollte, wirbelte die Luft um meine Hand.
«Kaffeepergamenthüllen», erläuterte sie. «Von den Bohnen, die wir geliefert bekommen, sind manche noch nicht gemahlen.»
Ich verstand kein einziges Wort, nickte jedoch. «Und all dieser Kaffee gehört Pinker?»
«Mister Pinker», sagte sie, «besitzt vier Lagerhäuser, von denen die beiden größten unter Zollverschluss stehen. In dem hier findet die Verzollung statt.» Sie streckte die Hand aus. «Der Kaffee wird auf dem Fluss per Schiff angeliefert. Nach der Entnahme von Proben wird er gewogen, geröstet, gemahlen und je nach Herkunftsland sortiert. In diesem Lager ist sozusagen die gesamte Welt vertreten. Da drüben ist Brasilien, hier Ceylon. Hinter uns Indonesien – davon gibt es nicht so viel: Die Holländer nehmen sich den Großteil der Ernte. Die reinen Arabicas bewahren wir zur Sicherheit lieber hier auf.»
«Warum müssen reine Arabicas sicherer verwahrt werden als die übrigen Sorten?»
«Weil sie am wertvollsten sind.» Sie ging zu einem Stapel prallgefüllter Jutesäcke. Einer war bereits geöffnet. «Sehen Sie nur», sagte sie, und ihre Stimme schien vor Erregung zu beben.
Ich warf einen Blick darauf. Der Sack war voller Bohnen – eisenfarben, glänzend, als sei jede einzelne geölt und poliert worden. Sie nahm eine Handvoll und zeigte sie mir. Die Bohnen waren klein, eine jede wie eine Erdnuss eingekerbt, und während sie durch ihre Finger fielen, rauschten sie wie Regen.
«Mokka», sagte sie ehrfürchtig. «Jede einzelne ein Juwel.» Sie versenkte ihren Arm bis zum Ellenbogen darin und ließ ihn mit einer sanften, hypnotischen Geste gleich einer Liebkosung kreisen, wodurch ein Hauch des dunklen, verkohlten Aromas aufstieg. «Ein Sack wie dieser ist wie ein Sack voller Schätze.»
«Darf ich?» Ich ließ meinen Arm neben den ihren gleiten. Es war ein seltsames Gefühl: Ich sah, wie die Bohnen mein Handgelenk umschlossen, als seien sie eine Flüssigkeit, dabei waren sie trocken und leicht, so immateriell wie Spreu. Der reichhaltige, bittere Geruch stieg mir in die Nase. Ich ließ meine Hand noch tiefer sinken, und inmitten der glatten, öligen Geschmeidigkeit der Bohnen war mir einen Augenblick lang so, als spürte ich etwas anderes – die zarte Berührung ihrer Finger.
«Ihr MrPinker ist wirklich ein Original», sagte ich.
«Er ist ein Genie», sagte sie gelassen.
«Ein Kaffeeimpresario?» Wie zufällig strich ich mit meinem Daumen sanft über ihr Handgelenk. Sie erstarrte und zog ihren Arm zurück, zeigte jedoch ansonsten keine Reaktion. Ich hatte recht gehabt: Hier war eine seltsame Form von Schalkhaftigkeit oder, besser gesagt, von Vertraulichkeit im Spiel. Sie war keine Frau, die sich zierte und gekünstelt kreischte.
«Ein Genie», wiederholte sie. «Er will die Welt verändern.»
«Mit seinen Temperance Taverns?»
Ich muss amüsiert geklungen haben, denn sie sagte schroff: «Unter anderem, ja.» Wie von irgendeiner sinnlichen Kraft beherrscht, tauchte sie ihre Hand erneut in den Sack und beobachtete, wie die Bohnen, dunkel wie Perlen aus Ebenholz oder Jade, zwischen ihren Fingern hindurchglitten.
«Und sonst?», fragte ich weiter.
Sie warf mir einen kühlen Blick zu. «Sie halten ihn für lächerlich.»
Ich schüttelte den Kopf. «Ich halte ihn für irregeleitet. Der Arbeiter wird nie und nimmer einen Arabica dem Gin vorziehen.»
Sie zuckte geringschätzig mit den Schultern. «Mag sein.»
«Glauben Sie nicht auch?»
Anstatt zu antworten, schöpfte sie eine weitere Handvoll Bohnen und ließ sie langsam von ihrer schaukelnden Handfläche rieseln. Mir wurde plötzlich klar, woran mich dieses düstere Lagerhaus erinnerte. Der durchdringende Kaffeeduft glich dem von Weihrauch und das schummrige, staubige Licht dem Zwielicht einer großen Kathedrale.
«Das sind nicht nur Bohnen, MrWallis», sagte sie, den Blick auf die herabfallenden schwarzen Tropfen gerichtet. «Es sind Samen – die Samen einer neuen Zivilisation.»
Sie sah auf. Ich folgte ihrem Blick, hinauf zum Fenster zu Pinkers Büro. Der Kaffeehändler stand dahinter und beobachtete uns.
«Er ist ein großer Mann», sagte sie. «Und noch dazu mein Vater.»
Sie zog ihre Hand aus dem Kaffeesack und wischte sie, während sie zu den Brennern ging, anmutig mit einem Taschentuch ab.
«Miss Pinker», sagte ich, hinter ihr hereilend. «Entschuldigen Sie bitte – ich hatte ja keine Ahnung–, wenn ich Ihnen zu nahe getreten…»
«Wenn Sie sich bei jemandem entschuldigen sollten, dann bei ihm.»
«Ihr Vater weiß doch nichts von meinen Bemerkungen.»
«Nun, von mir wird er nichts hören.»
«Und ich muss mich entschuldigen für…», ich zögerte. «Für mein Verhalten Ihnen gegenüber, das jemandem in Ihrer Position kaum angemessen ist.»
«Welches Verhalten meinen Sie?», fragte sie unschuldig. Vor lauter Verwirrung brachte ich keine Antwort hervor.
«Ich hoffe, MrWallis», sagte sie, «dass Sie mich genauso behandeln werden wie jeden anderen Angestellten meines Vaters.»
Eine Abfuhr – oder eine Aufforderung? Wenn ja, dann war sie stark verschlüsselt. Sie hielt meinem Blick einen Augenblick lang stand. «Wir sind beide hier, um zu arbeiten, oder nicht? Jegliche persönlichen Gefühle sollten außer Acht gelassen werden. ‹Am Morgen säe deinen Samen und lass deine Hand bis zum Abend nicht ruhen.› Prediger Salomo.»
Ich verneigte mich. «In der Tat. Dann freue ich mich auf den Abend, Miss Pinker.»
«Und ich mich auf den Morgen, MrWallis.»
Ich verließ das Lagerhaus gleichermaßen beschwingt wie verwirrt. Einerseits schien ich an einen lukrativen Job geraten zu sein, andererseits spürte ich, wie sich nach meinem Flirt mit der hübschen Emily Pinker meine Hose spannte. Dagegen ließ sich leicht etwas unternehmen. Ich stieg in ein Boot zum Embankment und überquerte den Strand in Richtung Wellington Street. Dort gab es diverse preiswerte, angenehme Etablissements, die ich bereits zuvor aufgesucht hatte, alle von verlässlich hoher Qualität. Heute Abend gab es jedenfalls allen Grund zum Feiern: Mein Zuschuss in Höhe von dreißig Pfund war mir zugesagt worden.
Nach einer kurzen Rast am Fenster der Savoy Tavern, wo ich eine Fleischpastete verzehrte, betrat ich das edelste Bordell in Haus Nummer 18.Im ersten Stock befand sich hinter schweren Vorhängen ein mit rotem Damast ausgekleideter Empfangsraum, in dem ein halbes Dutzend der hübschesten Mädchen Londons in ihren Negligés auf gepolsterten Diwanen lagen. Aber welches sollte man auswählen? Ein Mädchen hatte herrliche rote Locken, ein anderes ein gepudertes Gesicht wie das einer Marionette. Es gab eine stämmige, sechs Fuß große deutsche Schönheit, eine dunkelhäutige französische Kokette und etliche andere.
Ich wählte die aus, deren lange, elegante Finger mich an Miss Emily Pinker erinnerten.
7
Pinker blickt auf, als seine Tochter sein Büro betritt, und beginnt, die auf dem Schreibtisch stehenden Tassen und Kannen wegzuräumen.
«Und?», sagt er sanft. «Was hältst du von unserem Ästheten, Emily?»
Sie nimmt einen Lappen und wischt, bevor sie antwortet, etwas verschüttetes Kaffeemehl von dem polierten Mahagoni. «Er ist gewiss nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe.»
«In welcher Hinsicht?»
«Vor allem jünger. Und irgendwie eingebildet.»
«Ja», gibt Pinker ihr recht. «Aber nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das nicht unbedingt von Nachteil sein muss. Ein älterer Mann hätte womöglich eine stärker vorgefasste Meinung. Dieser hier wird hoffentlich weniger dazu neigen, sich mit deiner Idee davonzustehlen.»
«Es ist doch gar nicht meine Idee.»
«Sei nicht so bescheiden, Emily. Wenn du mit MrWallis zusammenarbeitest, kannst du dir einen solchen Luxus kaum leisten. Natürlich ist es deine Idee, und das muss auch so bleiben.» Er lässt seinen Füllfederhalter zwischen seinen Fingern kreisen. «Ich wundere mich, dass er noch gar nicht auf die Idee gekommen ist – ist dir aufgefallen, dass er, als ich erwähnte, ein Pinker sei der Urheber, annahm, ich sei gemeint?»
«Und das mit Recht! Vor allem da er zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass ich deine Tochter bin.»
«Schon möglich.» Pinker beobachtet sie, während sie das Geschirr auf das Tablett stellt. «Wirst du’s ihm erzählen? Ich meine, dass du den Guide erfunden hast?»
Sie stapelt die Tassen übereinander. «Nein», sagt sie nach einer Weile.
«Warum nicht?»
«Ich denke momentan, je weniger er über unser Vorhaben weiß, desto besser. Wenn wir ihm davon erzählen, will er womöglich mehr darüber erfahren, wozu der Guide konzipiert worden ist. Und alles, was wir sagen, könnte irgendwie zur Konkurrenz durchdringen – vielleicht sogar zu Howell.»
«Weise bist du, wie immer, Emily.» Ihr Vater wendet sich um und beobachtet, wie der Börsentelegraph stotternd auf seine endlosen Papierstreifen einhämmert. «Dann lass uns hoffen, dass er der Aufgabe gewachsen ist.»
8
Halten Sie den Verkostungsraum frei von jeglichen äußeren Einflüssen wie etwa Bildern, Klängen und Düften. Überdies konzentrieren Sie sich ganz auf die jeweilige Aufgabe.
Lingle, Das Handbuch des Kaffeeverkosters
Am darauffolgenden Tag war es an Jenks, dem leitenden Sekretär, mich herumzuführen. Hatte das Lagerhaus am Abend zuvor noch wie eine Kathedrale oder Kirche gewirkt, so stellte sich an der Seite von Jenks schon bald heraus, dass es sich eigentlich um eine Maschine handelte – um einen gewaltigen, doch höchst simplen Mechanismus zur Anhäufung von Profit. «Das Material», wie er den Kaffee nannte, werde bei Flut angeliefert, in dem riesigen kastenförmigen Lagerhaus von einem Punkt zum anderen geschafft, geschält, in Trommeln geröstet und in manchen Fällen gemahlen, bevor es bei der nächsten Flut wieder hinausbefördert werde, wobei sich sein Wert in der Zwischenzeit vervierfacht habe. Er zeigte mir die durchgehend in seiner Handschrift geführten Bücher; riesige Hauptbücher, in denen die Bewegung eines jeden Sackes, einer jeden Bohne auf ihrer unaufhaltsamen Reise von einer Spalte zur nächsten festgehalten war.
Die meisten Kaffees, die in dieses Lager gelangten, seien für einen von insgesamt nur vier Blends bestimmt: Pinker’s Mocca Mix, Pinker’s Old Government Java, Pinker’s Ceylon und Pinker’s Fancy. Diese Mischungen seien nicht wirklich das, was sie versprächen. Der Old Government Java beispielsweise trage diesen Namen, weil die niederländische Regierung ihren Kaffee reifen lasse, bevor sie ihn auf den Markt bringe, wodurch ein milder Geschmack entstehe, wie er auf dem Kontinent beliebt sei. Wegen der Steuern auf niederländischen Kaffee komme es jedoch vor, dass der tatsächliche Anteil von Java in Pinker’s Blends lediglich ein Drittel betrage und der Rest aus Indien und Brasilien stamme. So sei, erläuterte Jenks, die Ceylon-Mischung ursprünglich aus Pinkers eigenen dortigen Plantagen hervorgegangen. Seitdem die gesamte Ernte durch Mehltau zunichtegemacht wurde, sei der Name jedoch eher eine Beschreibung der Sorte als ein Hinweis auf ihre Herkunft, da über achtzig Prozent der Mischung aus günstigerem brasilianischem Kaffee bestehe.
Ich muss überrascht gewirkt haben, denn er setzte entschieden hinzu: «Das ist in der Branche so üblich – daran ist nichts fragwürdig.»
«Selbstverständlich.»