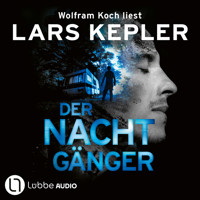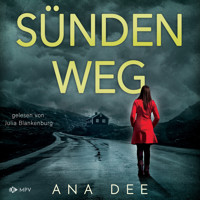3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
KAFKANIEN ist ein Krimi in dem niemand stirbt, sieht man vom Glauben des Protagonisten an Politik, Medizin und Rechtsstaat ab. Erzählt werden die Erlebnisse des Josef L., dessen Karriere und Existenz, sein glückliches und aktives Leben, zunehmend zerrinnen, bis ihn der unerklärliche Leistungseinbruch auf allen Ebenen in die Hände von Ärzten treibt. Diese finden bei keiner Untersuchung eine Ursache für seine unzähligen Symptome und stempeln Josef daher als psychisch erkrankt ab. Er beginnt selbst zu recherchieren und findet sehr schnell eine logische Erklärung. Doch nun beginnt erst recht eine Odyssee durch einen Ärztedschungel, der sich als ratlos, oft überheblich und schließlich als mangelhaft ausgebildet herausstellt. Dazu zieht ihn die Erwerbsunfähigkeit immer tiefer in den Strudel von Politik und Behörden. Einsprüche werden praktischerweise gleich selbst abgelehnt, Protokolle schlampig manipuliert, Gutachten mit Fantasiediagnosen gefüllt, Befunde verschwinden reihenweise, sogar vor Gericht wird gelogen, wofür aber kein Minister, keine Kammer und keine Anwaltschaft verantwortlich sein wollen. Für Josef stellen sich nun Fragen. Warum kennt sich kein Arzt mit seiner Krankheit aus? Wieso dürfen staatliche Psychiater ungestraft ins Blaue lügen? Warum stimmt praktisch nichts, was die schwarzen Schafe unter den Staatsangestellten behaupten? Trägt der Oberarzt der Versicherung vielleicht nicht zufällig den gleichen Familiennamen wie ein hoher Politfunktionär? Warum beschäftigt der Staat einen Anhänger einer staatsfeindlichen Organisation? Wieso entstammt dieser ausgerechnet einer Familie mit NS-Vergangenheit, die ein Kinderfolterheim betrieb, mit dem man Josefs Vater drohte, wenn es in seinem Kinderheim noch nicht gewalttätig genug zuging? Wer hatte diese infamen Verleumdungen beauftragt? Warum ist es in unserem Land zweifellos besser, ein Täter denn ein Opfer zu sein? Und was hat das alles mit der Steuerflucht großer Konzerne zu tun?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1360
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über den Autor
Harald Christian, geboren in Wien, machte Karriere in der Computerbranche, ist am Höhepunkt Niederlassungsleiter internationaler Firmen, bis ihn eine vorerst unerklärliche Krankheit Stück für Stück aus dem Leben reißt. Seiner schweren Behinderung geschuldet, inzwischen Mitte fünfzig, erfindet er sich neu, erweckt ein vorhandenes Talent und wird Romanautor. Dazu engagiert er sich für die Verbesserung der medizinischen Versorgung für Patienten mit einem besonderen Krankheitsbild in einem österreichischen Selbsthilfeverein.
Der erste Roman KAFKANIEN von Harald Christian behandelt die Themen unerforschte Krankheiten, medizinische Ethik, Machtmissbrauch, Korruption, Sozialkrieg und Steuerflucht. Diese, für Normalbürger abstrakten Probleme, konzentriert der Roman in der Person des Josef L. und zeigt dazu, dass diese Hölle, etwa durch einen Unfall, jeden treffen kann. Auch in den kommenden Romanen wird sich der Autor mit sozialkritischen Biografien vor realem Hintergrund beschäftigen.
Über den Roman
KAFKANIEN handelt in einer Welt, in der Wahrheit und Recht nicht gelten, die für eine nicht betroffene Mehrheit der Bürger unvorstellbar, für Schwerkranke aber schonungslos real ist. Der Roman bezieht seine Kraft aus tatsächlich Geschehenem, für die Geschichte des Josef L. musste nichts erfunden und nichts übertrieben werden. Originalzitate aus Akten und Büchern, zur Verdeutlichung kursiv gedruckt, belegen wiederholt das Geschilderte, das Unvorstellbare, das einem unbescholtenen Unschuldigen von Medizinern und Behörden tatsächlich so zugefügt wurde.
Der Roman entwickelt gleich zwei Handlungsstränge, die der Protagonist, einem Krimi gleich, aufzuklären hat. Schritt für Schritt lichtet sich der Nebel über den von Behörden an Josef L. begangenen Ungeheuerlichkeiten. Und ebenso schrittweise, muss Josef L. seine seltsame, lebenszerstörende Krankheit selbst recherchieren, denn die Antworten einer ratlosen Medizin, psychiatrische Pseudodiagnosen und Psychopharmaka, will er, mit Recht, nicht gelten lassen.
Harald Christian
oder
Warum man Josef L. wegen einer unerforschten Krankheit wie einen Staatsfeind behandelte
Roman
© 2021 Harald Christian
Autor: Harald Christian
Umschlag & Illustration: Harald Christian
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback
ISBN 978-3-347-30526-7
Hardcover
ISBN 978-3-347-30527-4
e-Book
ISBN 978-3-347-30528-1
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Originalzitate in KAFKANIEN, Auszüge aus Büchern und Akten, sind als solche durch Kursivsetzung gekennzeichnet und werden im Text ausnahmslos auch als Zitate bezeichnet. Die Namen der im Roman agierenden Personen sind frei erfunden. Zufällige Namensgleichheiten wären unerwünscht und daher auch unbeabsichtigt. Historische Persönlichkeiten sind mit Klarnamen erwähnt und durch Kursivsetzung gekennzeichnet.
Pro, über den Verlag verkauftem, Hardcover oder Paperback spendet der Autor €1,- an die „SCHLEUDERTRAUMA-SELBSTHILFE - Verein zur Verbesserung der Situation von Patienten mit Kopfgelenksinstabilität“.
Mehr unter: www.schleudertrauma-selbsthilfe.at.
Für meine Familie
Mein Dank gehört Simone, Michael und Andreas.
„Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden.“Auszug aus der „Genfer Deklaration“, dem Gelöbnis für Ärzte
Prolog: Karriere
Kapitel 1: Burn-Out
Kapitel 2: Psychosomatik
Kapitel 3: Krankenstand
Kapitel 4: Arbeitsfähig
Kapitel 5: Arbeitslos
Kapitel 6: Konversionsstörung
Kapitel 7: Vagus
Kapitel 8: Verschlimmerung
Kapitel 9: Hypochondrie
Kapitel 10: Kollegen
Kapitel 11: Im Namen der Republik
Kapitel 12: Silke
Kapitel 13: Der Anwalt
Kapitel 14: Noch ein Jahr
Epilog: Menschenrechte
Prolog: Karriere
Die Sonne schien über dem Land. „Ick bin ain Bearliner“, kauderwelschte John Fitzgerald Kennedy vor einer nach Hoffnung und Freiheit dürstenden Menge. Eine Stunde danach, tat in Wien Josef seinen ersten Schrei ins Leben. Die Sonne schien auch über ihm, doch das sollte nicht immer so bleiben. Und da von einem Josef K. bereits eine beklemmende Geschichte aus vermeintlich schlechteren Zeiten erzählt, soll der Josef dieser Geschichte daher L., Josef L., heißen.
Josefs Kindheit war anstrengend, ein steter Kampf um Anerkennung seiner Persönlichkeit, gegen die eigenen Zweifel und die Langeweile. Das Größerwerden ein ebensolcher Kampf und größer wurde mit zunehmendem Alter auch die Anstrengung, mit der er mit sich selbst und um seinen Platz in der Gesellschaft kämpfte. Nur dass Josef keinen, seiner Ausbildung zum Chemieingenieur entsprechen Beruf ausüben wird, stand schon vor der Abschlussprüfung fest. Für diese Branche war seine Nase schlicht zu empfindlich.
So wusste Josef damals nicht im Ansatz, wohin der Lebensweg führen würde. Er fühlte sich nie als Künstler, war aber an praktisch allen Formen von künstlerischem Schaffen interessiert. Er belegte fürs Erste zwei Orchideenfächer an der Universität in Wien, Vorlesungen besuchen konnte er aber noch nicht, denn der Staat rief gleich nach dem Ende seiner Ausbildung zum Zivildienst. Und da Josef immer seinen eigenen Mut ausreizen musste, meldete er sich zum Dienst an der Baumgartner Höhe, einem psychiatrischen Krankenhaus mit architektonischem Weltkulturerbe-Status, aber auch einer höchst unrühmlichen Geschichte. Wienern ist dieses Krankenhaus unter den Namen Am Steinhof oder Spiegelgrund bekannt und schon die Nennung dieser Worte jagt leichte Kälte über den Rücken. Josef aber sah eine Herausforderung und weil sie angeboten wurde, musste er sie annehmen. Gegen sich selbst zu verlieren, hätte er sich niemals verzeihen können.
Leider würzte Josef seinen Mut oft mit einem kleinen Schuss Selbstüberschätzung. Dass der Aufenthalt unter den Psychiatriepatienten fordernd sein würde, hatte er erwartet. Unerwartet belastete ihn aber das vollkommene Fehlen von Herzenswärme der maßgeblichen Mitarbeiter dieses Krankenhauses. Denn, Patienten mit offensichtlich körperlichen Erkrankungen wie Krebs, Herzinfarkt, Diabetes oder Sportverletzungen werden von der Medizin mit Respekt und Recht auf Menschenwürde behandelt, Patienten mit Erkrankungen des Denkens dagegen eher skeptisch, immer gepaart mit einer kleinen Prise aus Überheblichkeit, Verharmlosung und Verachtung. Und auch die Gesellschaft außerhalb der psychiatrischen Krankenhäuser hat über Jahrhunderte für Menschen mit psychischen Leiden mehr Abstoßung als Anteilnahme entwickelt, vor dem Unsichtbaren fürchtet man sich eben mehr. Nach kurzer Zeit war es für Josef dann jedoch erstaunlich einfach, gegenüber den psychisch Erkrankten, das richtige Verhältnis zwischen würdevollem Umgang und Selbstschutz zu finden.
Neben vielen tatsächlich, oft altersbedingt, an Funktionsstörungen des Gehirns leidenden Patienten, bestand beinahe die Hälfte der ans psychiatrische Krankenhaus Eingelieferten aus Männern um die Fünfzig, vom Leben und den in diesem verborgenen Schicksalsschlägen in die Alkoholsucht Getriebenen. Für Josef war dies eine Erkenntnis. Er erkannte die vielen möglichen Stolpersteine, die einem Menschen auf dem Lebensweg begegnen können und verstand die Aufgabe, sich diesen stellen zu müssen, ohne daran zu zerbrechen. Einer dieser vielen Gestrandeten des psychiatrischen Krankenhauses wollte er nie werden. Dieses Bild vor Augen wird ihm für seine Zukunft immer wieder Kraft geben, sich selbst in schwierigen Lebenssituation kontrollieren zu können.
Nach dieser Charakter-Lehre ließ Josef erst einmal seine Seele baumeln. Er war so viele Monate an griechischen Stränden, dass er in späteren Jahren behaupten wird können, insgesamt zwei Jahre seines Lebens im Land der antiken Weisen zugebracht zu haben. Inzwischen Mitte Zwanzig, landete Josef, mehr zufällig als geplant, dann an der Südküste des Mittelmeeres. Er bereiste das für die meisten Mitteleuropäer vollkommen aus dem Bewusstsein gedrängte Algerien, damals das zweitgrößte, inzwischen durch die Spaltung des Sudan, größte Land Afrikas. So scheinbar unendlich groß und geheimnisvoll wie die Sahara, ist auch der heute vergessene Anteil, dieses vor wenigen tausend Jahren noch üppig blühenden Landes, an der Menschheitsgeschichte. Und so groß wie die Sahara, sind dort auch die Herzen der Menschen, Josef lernte eine Gesellschaft, fern von der egomanen mitteleuropäischen kennen.
Damals wurde die Wüste noch von Touristen bereist, sie kamen gruppenweise in Jeeps, benahmen sich in der lokalen Gesellschaft wie Außerirdische und wurden von den Algeriern auch als solche empfunden. Josef aber kam allein und stand nach einigen Tagen der Akklimatisation im französisch-arabisch geprägten Algier, das ihm wie die levantinische Schwester Marseilles erschien, mit seinem kleinen Rucksack an einer Bushaltestelle und dem Ziel, so südlich wie möglich zu kommen. Doch nach zwei Etappen mit dem Bus durch die Gebirge von Tell- und Saharaatlas, merkte er, dass er anonym blieb, so nicht in das Leben der Menschen vor Ort eindringen würde. Also stellte er sich mit der Daumen-nach-oben Geste an den Straßenrand und begann eine über zweieinhalbtausend Kilometer führende Reise als Autostopper durch die Sahara. Wenn überhaupt ein Fahrzeug kam, in der Mehrheit waren dies Lastwagen, hielten die Fahrer an und nahmen ihn für eine Etappe, bis zur nächsten Oase, auch mit. Dort aber ließen sie ihn nicht nur einfach aussteigen, sondern stellten ihm oft die Familie der Schwester, eines Cousins oder eines Freundes vor, die ihn herzlich aufnahmen, bewirteten und übernachten ließen. Und selbst am nächsten Tag noch, wurde er in vielen Oasen dann mit Proviant und frischem Wasser für seinen Kanister ausgestattet und oft einem weiteren Bekannten übergeben, der ihm Mitfahrgelegenheit für die nächste Etappe bot.
Josef war in diesen Wochen vom Touristen zum Reisenden geworden, zu einem geachteten Teil der Menschen vor Ort. Er lebte in einer Gesellschaft, deren Wurzeln nicht im rücksichtslosen Erstreben Einzelner nach mehr gesellschaftlich anerkannten Gütern als Andere, sondern durch Zusammen-Leben funktionierte. Der hierzulande vermeintlichen, und von den skrupellosesten der egomanischen Einzelkämpfer nur am geschicktesten missbrauchten, sogenannten, Rechtssicherheit, bedarf es in dieser Gesellschaft nicht. Dort wird nicht der am meisten geachtet, der es auf die rücksichtsloseste Weise zum größten, in Steueroasen versteckten, Vermögen gebracht hat, sondern der, der den größten Beitrag zum Wohlergehen aller Bürger einer Oase leistet.
Und dann sah Josef seine Frau fürs Leben, für ihn konnte es nicht anders sein, an einem Strand an der Küste Kretas. Bis sie ein Paar wurden musste noch einige Zeit vergehen, aber schon als er Agnes das erste Mal sah, wusste Josef sofort, wohin und mit wem die Reise seines Lebens gehen sollte. Und Agnes ging es ganz ähnlich. Eine solche Angelegenheit gehört jedoch ordentlich geprüft und so verschwiegen sie sich ihre gegenseitige Zuneigung vorerst. Als Josef zwei Jahre später ein wenig Musik für eine Vernissage machte und Agnes, wie es im Leben immer wieder so ist, an diesem Abend eigentlich nicht in Stimmung war und erst von Freunden zum Besuch der Veranstaltung überredet werden musste, passierte der magische Moment. Schon mit dem ersten Augenkontakt verrieten sie sich ihre Sehnsucht und Josefs Musik, von den Gästen bis zu diesem Augenblick vielgelobt, flachte ab. Mit Sternen in den Augen konzentriert man sich eben schlecht.
Sie galten im Freundeskreis als Traumpaar und so kam nach einiger Zeit Wunschkind Max zur Welt. Max war erst wenige Tage alt, als Josef den Plan schmiedete, seine aus inzwischen fünf verschiedenen Studienrichtungen stammenden Zeugnisse zu einer Fächerkombination Geschichte zusammenzulegen, was aber erst durch die Fakultät bestätigt werden musste. Der Vorschlag zu seinem Spezialstudium wurde tatsächlich genehmigt. Als er aber, überglücklich, sein Leben von jetzt an als Historiker zu verbringen, von diesem Termin an der Universität nach Hause kam, hörte er schon beim Aufsperren die Klingel seines Telefons. Er eilte durch das Vorzimmer und schaffte es noch rechtzeitig, den Hörer abzuheben. Der Anrufer war sein erster Arbeitgeber, für den Josef, sofort nach dem Zivildienst und parallel zum Studium, schon einige Jahre vielfältige Aufgaben in dessen Computergeschäft erledigt hatte. Dieser erzählte von der Gründung einer neuen Firma und bot ihm eine Arbeitsstelle an.
Josef erbat sich einen Tag Bedenkzeit, es galt, eine lebensbestimmende Entscheidung zu treffen. Der Weg zur Historikerkarriere war gerade eine Stunde besiegelt, da sollte er schon wieder verworfen werden und Josef sein Leben als Computerverkäufer verbringen? Doch als junger Familienvater entschied er sich für den pragmatischen Weg und eine Woche später saß er bereits in seinem neuen Büro, zweifellos unterfordert, aber doch glücklich, im Sinn seiner Familie verantwortungsvoll entschieden zu haben.
Josef war in seinem neuen Beruf durch sein psychologisches Geschick im Umgang mit Kunden, seine Ehrlichkeit und seine Verlässlichkeit erfolgreich. Im Vergleich mit seinen Kollegen, trug er nach zwei Jahren den größten Beitrag zum Firmengewinn bei, sein Gehalt aber stagnierte. Als er ein Angebot einer anderen Firma im selben Betätigungsfeld, angeboten bekam, nahm er dies nach kurzer Überlegung an. Wieder war er nach einiger Zeit der erfolgreichste Mitarbeiter, ein Aufstieg aber verwehrt, denn alle leitenden Positionen waren vergeben, doch um ihn ein wenig zu trösten, ernannte man ihn zum Senior Salesman. Und so wie, insbesondere in der gerade boomenden Computerbranche, Konzerne weltweit laufend fusionierten, wurde auch Josefs Firma von einem amerikanischen Konzern, dem größten seiner Zunft, aufgekauft.
Dadurch zerfiel der Führungsstab seiner nunmehrigen Firma, doch bis zur faktischen Zusammenlegung der beiden Unternehmen bedurfte es eines interimistischen Leiters. Ausgerechnet an Max fünftem Geburtstag, stand der Europachef des Konzerns vor ihm und ernannte Josef, vollkommen überraschend, zum interimistischen Geschäftsführer für die kommenden Monate. Josef hatte für sein Leben immer Ambitionen, aber dass er schon fünf Jahre nach seiner vernunftgeleiteten Entscheidung gegen das zu erwartend brotlose Historikerdasein, bereits an der Spitze einer Firma angekommen war, hatte er so nicht erhoffen dürfen. Der Konzern verlangte von ihm, den vorhandenen Warenbestand bis zu einem kalkulierten Verlust eines Viertel des Wertes abzubauen, man hatte aber nicht mit Josefs Ehrgeiz gerechnet. Der von ihm tatsächlich in dieser limitierten Zeit erzielte Umsatz, betrug am Ende das Dreifache des Erwarteten, der erzielte Verlust nur noch ein Viertel des Geplanten und die für einen geordneten Abschluss zu einer Fusion notwendige Prüfung durch internationale Wirtschaftsprüfer, wurde als Anerkennung einer Spitzenleistung, mit einer symbolischen römisch Eins für seine Führung abgeschlossen.
Die Zahlen also stimmten. Und wie zumeist im Geschäftsleben, konzentrierte man sich auf Umsatz und Gewinn aber unterschätze den menschlichen Faktor. Josef musste in diesen Monaten nicht nur den Verkauf ankurbeln, sondern auch die verbliebenen fünfunddreißig, in dieser Umbruchssituation sehr verunsicherten, Mitarbeiter zusammenhalten. Als vormaliger Kollege, und gerademal Mitte dreißig, die für ihn eigentlich fordernde Aufgabe. Es gelang nicht mit allen Mitarbeitern, doch er konnte seinen Stab erstaunlich gut führen, selbst in dieser kurzen Zeit zum hochmotivierten Team zusammenschweißen. Damals wurde Josef ein erstes Mal in seinem Leben bewusst, dass er auf dem Gebiet der Psychologie vielleicht ein wenig Talent hatte.
In dem neu entstanden Großkonzern wollte er aber nicht arbeiten. Wie immer musste er sich nicht bewerben, sondern wurde von einem der Mitbewerber angesprochen und verbrachte die nächsten Monate auf einem Versorgungsposten. Diesmal fühlte er sich noch mehr unterfordert, empfand sich als Abteilungsleiter ohne Abteilung. Bis eines Morgens sein Telefon mit unterdrückter Nummer läutete.
„Guten Morgen, mein Name ist Kammseher, ich bin der Geschäftsführer eines asiatischen Weltkonzerns, wir gründen in Österreich eine Niederlassung, und Sie sind der Niederlassungsleiter. Sie werden jetzt aber nicht frei sprechen können, ich sage Ihnen meine Telefonnummer, rufen Sie mich mittags zurück.“ Josef war irritiert, an Märchen glaubte er eigentlich nicht, vielmehr dachte er an einen Anruf seiner aktuellen Firma, die, vielleicht bevor sie ihn mit höheren Aufgaben betrauen, noch seine Loyalität prüfen wollten.
Doch bei diesem vereinbarten Telefonat setzte man bereits ein erstes Treffen am Wiener Flughafen fest und als Josef wenige Tage später zu dem Termin aufbrach, leerte er beim Verlassen seines Hauses noch den Briefkasten in dem zufällig die von ihm privat abonnierte, aktuellste Ausgabe eines internationalen Branchenmagazins lag. Während der Autofahrt packte er dieses beiläufig aus und staunte über die Titelgeschichte. Am Cover prangte formatfüllend ein Bild von Herrn Kammseher und kündigte ein großes Interview mit diesem an. Josef wusste also, wen er in der Flughafenbar suchen musste. Als ihn Kammseher mit dem Branchenmagazin unterm Arm nähern sah, begrüßte er Josef zwar herzlich, riss aber dann mit den Worten, „entschuldigen Sie, ich muss nur noch schauen ob die letzten besprochenen Änderungen durchgeführt wurden“, das Magazin an sich und vertiefte sich für einige Minuten. Besser konnte man das Eis einer künftigen Beziehung nicht brechen. Josefs Branchenkompetenz und Eignung als Niederlassungsleiter eines Weltkonzerns standen somit gar nicht zur Diskussion, sofort war man bei Fachthemen angelangt. Nach zwei kurzen Stunden griff Kammseher zum Telefon, um seiner Assistentin die Buchung eines Businessclass-Tickets nach Deutschland anzuweisen, wo Josef bereits in der Folgewoche seinen Vertrag unterschreiben sollte. Mit seinem Unglauben an Märchen war sich Josef jetzt nicht mehr so sicher.
Und märchenhaft verlief auch seine neue Unternehmung. Die Gründung, Büro- und Mitarbeitersuche waren gelungen, das Geschäft begann sich zu entwickeln. Nach drei Jahren konnte er auf zwei goldgerahmte Auszeichnungen aus der asiatischen Zentrale blicken, die er, zwei Jahre in Folge, für die beste Planerfüllung aller Niederlassungen weltweit, erhalten hatte. Den in jeder Branche so bedeutenden Marktanteil hatte er zu einem vor und nach seinem Wirken nie mehr erreichten Wert verdreifacht, die Firma an die international vielbeachtete dritte Position im Land gebracht, und doch sollte, wie schon einmal, eine Fusion seinen Lebensweg verändern. Der neu entstehenden, um ein Vielfaches größeren Firma, stülpte man auch einen neuen Geschäftsführer über. Josef, der immer die Produkte seiner Firmen besser als sich selbst verkaufen konnte, traute man, trotz seiner bisher hochgeschätzten Leistungen, die Führung unter den künftig stark veränderten Umständen nicht zu. Bei gleichen Konditionen verblieb er noch über ein Jahr in der zweiten Reihe, bis man sich von ihm, großzügig entschädigt, trennte.
Noch aber strahlte die Sonne über ihm. Bereits am ersten Arbeitstag nach dem Verlassen der ersten, von ihm in Österreich aufgebauten Konzernniederlassung, bekam er wieder einmal einen Anruf.
„Hallo Josef, ich habe von Deinem Abgang beim asiatischen Konzern gehört. Ich bin mit meiner Großhandelsfirma gerade in Verhandlungen, die Vertretung eines deutschen Mittelständlers zu übernehmen. Sollte ich diesen Vertrag bekommen, wirst Du diese Division leiten.“
Das war ein alter Geschäftspartner, ein gewichtiger Mann in der österreichischen Computerwirtschaft, mit dem er schon einige Jahre erfolgreich zusammenarbeitete und den Josef gleich bei ihrem ersten Treffen schwer beeindruckte, als er, zugegeben mit einigem Zähneknirschen, akzeptierte, dieses aus Termingründen an einem familienfeindlichen Samstag abzuhalten. Das Gleichgewicht zwischen Arbeitseinsatz und Familienleben, ist für Menschen an der Spitze der Wirtschaft schwer zu finden, davon zeugen viele gescheiterte Ehen. Damals fiel es Josef daher nicht leicht, den verlangten Samstagtermin zu akzeptieren, nun aber sollte er die Früchte dafür ernten.
Doch die Entscheidung über die Struktur der künftigen Firma ließ auf sich warten. So genoss er, mit finanziellem Puffer versorgt, einen herrlichen Sommer mit Agnes und Max, und er spürte das Bedürfnis in sich, seinem Leben einmal mehr eine radikale Wende geben zu müssen. Bislang kannte er ein Leben auf zwei Rädern nur als Radfahrer, hatte in der Jugend sogar an kleinen Rennen teilgenommen, doch ein Moped besaß er nie. Als er aber ein Jahr zuvor im Urlaub für einige Wochen auf einer griechischen Insel einen Roller ausgeborgt und viel Geschick und Freude damit hatte, war eine Sehnsucht geboren worden. Er hatte zwar großen Respekt vor den Gefahren des motorisierten Zweiradfahrens, sah aber wieder einmal eine Herausforderung und machte innerhalb weniger Tage den erforderlichen Führerschein. Er kaufte sich zuerst eine kleine Maschine, fuhr damit sofort einmal ans Meer, verstand aber nach wenigen Wochen, warum seine motorraderfahrenen Freunde mit der Erkenntnis, Kubik kann durch nichts ersetzt werden, nur allzu recht hatten. Dem Anfänger-Bike fehlte einfach der richtige Biss. An einem Sonntag kam er von seiner, mehr qual- als lustvollen, Kroatienreise zurück. Am Montag früh stand Josef beim Händler und tauschte die kleine gegen eine richtig schwere, große Maschine. Long, low and loud, musste sein neues Spielzeug sein.
Vor wenigen Wimpernschlägen seines Lebens stand er noch im Dreiteiler mit Krawatte auf Bühnen um vor Kunden Vorträge zu halten, nun knatterte er in Lederkluft durch die Stadt, mit einem weiteren passenden Spruch im Kopf, den er in den Geschäftsführeretagen so oft gehört hatte, Big toys, for big boys. Doch er selbst, war der Gleiche geblieben. Mit viel Respekt vor den Gefahren und Verantwortung für seine eigene Gesundheit und damit das Glück seiner Familie, fuhr er seine Maschine. Und nach einigen Wochen seines Motorrad-Sabbaticals wurde es wieder Zeit für den Ernst des Lebens. Josef machte an einer Autobahnraststätte eine Pause, da läutete in der Seitentasche des riesigen hinteren Kotflügels sein Telefon. Der alte Geschäftsfreund rief an, um ihm zu sagen, dass der deutsche Investor sich für einen anderen Partner entschieden hatte, die Aussicht auf diese Anstellung somit geplatzt sei. Aber er hinterließ die Nummer des Deutschen. Josef brauchte einige Tage, um sich ein Konzept für seinen Anruf zu überlegen und griff dann entschlossen zum Telefon.
Herr Hoffmann hob gleich nach dem ersten Läuten ab, Josef stellte sich vor und erzählte von seinen bisherigen Positionen in der Computerbranche. Hoffmann war angetan und als Josef ihm vorschlug, anstelle mit einer Partnerfirma, doch gleich selbst eine Niederlassung zu gründen, um in Österreich Geschäfte zu machen, hatte er seinen Gesprächspartner gewonnen. Wie sehr den Schwaben Hoffmann vor allem die Argumente, Einsparungsvermögen durch die vorgeschlagene Firmenkonstruktion und bessere Kontrollierbarkeit einer eigenen Niederlassung, ins Mark trafen, konnte Josef bei diesem Erstkontakt noch gar nicht ahnen. Nun erbat sich Herr Hoffmann Bedenkzeit, rief tatsächlich einige Tage später zurück und vereinbarte ein erstes Treffen in der deutschen Firmenzentrale. Doch diesmal musste Josef mit dem eigenen PKW anreisen und die für ihn gebuchte Unterkunft stellte sich als eine in die Jahre gekommene Gasthauspension heraus. Die Zeit der Businessclass-Tickets und Nobelhotels war nun vorbei.
Die Gespräche verliefen positiv, wieder war man fachlich auf Augenhöhe, ein erster, noch vager aber ambitionierter Fahrplan für die Gründung einer österreichischen Niederlassung wurde bereits besprochen, doch die Errichtung der strukturellen und technischen Notwendigkeiten, dauerten um viele Monate länger als vorerst geplant. Josef war inzwischen mit dem Motorrad zu unzähligen Objekten in Wien unterwegs, auf der unerwartet mühevollen Suche nach einem geeigneten Standort der künftigen Niederlassung.
In dieser Zeit bezog Josef Arbeitslosengeld. Als die für ihn zuständige Mitarbeiterin des Arbeitsamts ein Datum für den nächsten Kontrolltermin bestimmte, musste er um eine Alternative bitten, da gerade für jenen Tag bereits ein nächster Termin in der Stuttgarter Zentrale seines künftigen Arbeitsgebers vereinbart war. Herr Hoffmann wollte an diesem Tag, neben weiteren Arbeitsgesprächen, auch endlich einen konkreten Arbeitsvertrag mit ihm abschließen. Die Arbeitsamtsmitarbeiterin war über diese, eigentlich sehr gute Nachricht, aber nur empört.
„Sie dürfen als Arbeitsloser das Land nicht verlassen,“ herrschte sie ihn an. Als Josef erklärte, dass es sich dabei ja nicht um eine Urlaubsreise, sondern um einen Termin zur Unterzeichnung eines Vertrags, mit dem eine neue Firma und damit nicht nur sein eigener künftiger, sondern noch einige weitere neue Arbeitsplätze in Österreich geschaffen werden sollten, beharrte die Dame auf der Einhaltung der Vorschriften und schlug auch gleich eine Lösung vor.
„Dann suchen Sie sich halt einen Job in Österreich.“
Verständnis für ungewöhnliche Lebenswege und Flexibilität für ehrliche Firmengründer sind im Gesetz offenbar nicht vorgesehen.
Natürlich hielt Josef, den so wichtigen Termin in Stuttgart ein. Doch ausgerechnet für diesen einen Tag, an dem er seinen neuen Arbeitsvertrag unterschrieb, erhielt er vom Arbeitsamt kein Geld und war auch den ersten Tag seines Lebens nicht krankenversichert. Nach weiteren verzögerten Monaten konnte endlich das Geschäft begonnen werden und entwickelte sich, wie es Josef nicht zu hoffen gewagt hatte. Im ersten Monat verkaufte sein neues Team bereits das Doppelte des bisher importierten Volumens, im Zweiten verdoppelten sie den ersten Monat, im Dritten den Zweiten und hielten dies so über das ganze erste Halbjahr. Das Ziel des Fünfjahresplans erreichte Josefs neues Baby in der halben Zeit, eine internationale Qualitätsprüfung bezeugte seiner Firmenführung Europaspitze, die Firma war mit neunzig Prozent Markanteil am Zenit und doch befiel Josef schon einige Zeit ein zunehmend schlechtes, undefinierbar seltsames Gefühl.
Als in den Wochen nach dem Kollaps der Lehmann Bank die Verunsicherung über die Wirtschaftsentwicklung ihren Höhepunkt erreicht hatte, stand auch für die von Josef geleitete Firma, die Budgetplanung des Folgejahres an. Als Pragmatiker berechnete er eine leichte Stagnation, eine zu diesem Zeitpunkt weltweit konziliant vertretene Sicht. Für den Louis-de-Funès-Charakter von Firmeninhaber Hoffmann, war ein realistisch zu erwartender leichter Geschäftsrückgang aber unerträglich. So wurden die Budgetverhandlungen zusehend gereizter. Josef hörte sich während des entscheidenden Telefonats selbst dabei zu, wie er seinem Arbeitgeber Dinge sagte, die seine normale Hemmschwelle überschritten, die man gewöhnlich seinem Vorgesetzten auf eine weniger direkte Art vermittelt.
Während man den Schotten Sparsamkeit zuschreibt, so ist diese bei Schwaben zu Geiz erblüht und so geizte Hoffmann für das Krisenjahr mit Budgetposten. Josefs Posten sparte er gleich zur Gänze ein.
Am Höhepunkt der wirtschaftlichen Verunsicherung stand Josef beruflich auf der Straße, um den Lohn seiner Aufbauarbeit von drei gut etablierten Firmen und die gesellschaftliche Stellung eines Geschäftsführers gebracht, doch auf die Einnahmen eines Jobs zur Finanzierung seines kürzlich erstandenen Einfamilienhauses dringend angewiesen. Denn, wie praktisch allen privaten Investoren der letzten Dekade vor der Subprime-Krise, dem Platzen der zur Vertuschung um die fortschreitende Verarmung des amerikanischen Mittelstands unverantwortlich gewährten, zu sogenannten Derivaten gebündelten, damit über Jahre versteckten und nun uneinbringlichen Kredite, hatten österreichische Banken auch Josef einen Fremdwährungskredit aufgeschwatzt. Was sich fürs Erste nach Win-Win-Situation anhörte, sollte mit dem Beginn der weltweiten Finanzkrise zusehends mehr zum Damoklesschwert über der Existenz seiner Familie anwachsen.
Immerhin galt das Österreich der zweiten Republik als wirtschaftlich starkes Land mit einer harten Währung, der Schilling zur D-Mark fixiert und der Kurs zum Schweizer Franken de facto ebenso daran gebunden. Weder als Leiter fremder Firmen noch in eigenen wirtschaftlichen Angelegenheiten, zeigte sich Josef bislang risikobereit, viele Ideen zur Gründung eigener Geschäfte hatte er in seiner Karriere deshalb wieder begraben. Den von Finanzberatern und Banken so wortreich angepriesenen Verlockungen niedriger Frankenzinsen aber unterlag Josef, war er doch eben erst durch die schwäbische Schule für Sparsamkeit gegangen.
Doch mit Krisenausbruch, war eben nichts so wie gewohnt. Österreich wurde mit der Euroeinführung zu einem Weichwährungsland, weltweit flüchteten Anleger von den Krisenwährungen Dollar und Euro zu Schweizer Banken. Damit begann der Anstieg des Frankenkurses und daraus resultierend, für Josef nicht kontrollierbar, der Anstieg seiner Schulden. Die Bank Österreich entwickelte sich für ihn zusehends zum Casino Österreich, welches er als verantwortungsvoller Mensch nie betreten hätte.
So hatte die Krise der amerikanischen Kreditwirtschaft Josef den Job gekostet und gleichzeitig die Hoheit über sein Vermögen genommen. Seine Existenz war nun von Wechselkursen und Indizes von Börsen abhängig geworden, welche zunehmend hysterischer auf die Launen der Mächtigen dieser Welt reagierten. Josef fühlte, wie auf seinem Himmel immer mehr und mehr dunkle Wolken aufzogen. Damals beschrieb Agnes diese ersten Schatten mit einem Satz, dessen Reichweite selbst der größte Pessimist nicht vorausahnen konnte.
„Es wird alles immer schlimmer.“
Schon seit einiger Zeit bewältigte Josef die wachsenden Sorgen vorerst mit Ironie, die zusehend in Zynismus umschlug, um noch später in verbittertem Sarkasmus zu gipfeln. Im österreichischen Umgangston ist Ironie eine durchaus gängige Ausdrucksform, ein Deutscher hat jedoch dafür keinen Sinn und der Schwabe Hoffmann erst recht nicht. Seiner mehr als schlechten Laune durchaus bewusst, gab sich Josef zu einem Teil selbst schuld, im letzten Gespräch mit Hoffmann keinen gemäßigteren Tonfall gefunden und seinen Jobverlust so mitverschuldet zu haben. Aber in Josef war auch lange Jahre viel Ärger über Hoffmanns, seinem Charakter geschuldeten, Geschäftsgebaren angestaut. Und tatsächlich hatte es Josef sogar genossen, einmal etwas frecher als angebracht, gewesen zu sein.
War Josefs Karriere bislang durch Empfehlungen praktisch von selbst fortgeschritten, bot sich ihm jetzt eine ungewohnte Situation. Er begann aktiv Annoncen zu lesen und nahm sehr bald Kontakt mit einem weiteren asiatischen Konzern seiner Branche auf. Vormals österreichsicher Chef des unmittelbaren Mitbewerbers, stand seine fachliche Qualifikation natürlich wieder nicht zur Diskussion. Eine Frage seiner künftigen Abteilungsleiterin Gabriele aber ließ ihn aufhorchen, „hätten Sie ein Problem mit einer weiblichen Vorgesetzten?“ So eine Frage impliziert sofort, dass es in der Vergangenheit ein Problem mit seinem Vorgänger gegeben haben musste, Josef aber konnte nur schmunzeln, für ihn war schon immer die Gleichwertigkeit von Mann und Frau so unanfechtbar, wie Urknall- und Evolutionstheorie. Gabriele kündigte zum Abschied dann noch ein weiteres Orientierungsgespräch an, „unser Europachef möchte Sie sehen.“ Wenige Tage später begrüßte ihn Herr Pabst sichtlich gut gelaunt, „wir kennen einander ja bereits.“ Tatsächlich trafen sie sich schon vor Jahren bei diversen Branchenmeetings auf Chefebene, was Pabst zum Anlass nahm, von alten Zeiten zu schwärmen und kein gutes Haar an Josef Nachfolger an der Spitze des Mitbewerbers zu lassen. Da aber wurde Josef aufmerksam, hatte er doch eine Lebensweisheit seiner Mutter im Kopf, niemals über ehemalige Vorgesetzte schlecht zu reden, der künftige Vorgesetzte könnte die Befürchtung gewinnen, man wird einst auch über ihn schlecht reden. Und so sehr es Pabst sichtlich genoss, ordentlich zu poltern und dabei den Keksteller gänzlich zu verputzen, Josef gelang es, sich zurückzuhalten, zu schweigen und nur milde zu lächeln.
Wohl war ihm dabei aber nicht. Nach über einer Dekade an der Spitze, sollte er die kommenden Jahre nichtmehr als Chef, sondern als Sales Manager im Außendienst, in einer Unterabteilung des Konzerns, verbringen. Als eines der ersten Finanzkrisenopfer fühlte er sich gleich ins dritte Glied zurückgeworfen. Und auch wenn er, nüchtern betrachtet, ehrlich froh sein durfte, sofort eine Anstellung in dieser wirren Zeit gefunden zu haben, die Emotionen entsprachen einfach nicht mehr denen, die er als Gründer und Entwickler seiner ehemaligen Firmen, seiner Babys, verspürte. Da half auch die in dieser neuen Position viel geregeltere Freizeit, in der er nun öfter ans Meer fahren konnte und auch die Tatsache nicht, dass sein Gehalt in diesem ausgesprochen korrekt geführten Konzern, selbst im dritten Glied, praktisch noch seinem Gehalt als österreichischer Chef des schwäbischen Familienunternehmens entsprach. Josef wurde stetig schlechter gelaunt.
Auch an seinem Motorrad, inzwischen mehr geputzt als gefahren, konnte er bald keine Freude finden. Die zunehmende Unsicherheit beim Fahren führte Josef damals noch auf die stetig geringer werdende Fahrpraxis zurück und so traf er wieder eine pragmatische Entscheidung. Nach einem halben Jahrzehnt unfallfreiem Fahrspaß verkaufte er sein Eisenschwein wieder.
Die neue Aufgabe fiel Josef leicht. Sein neues Leben spielte sich ein, er genoss mit Agnes das Mehr an Freizeit, war wieder fleißig und erfolgreich. Er fuhr in diesen Jahren so viele Kilometer mit seinen Firmenwägen, dass der Mechaniker der Servicewerkstätte einmal sogar einen schadhaften Kilometerzähler an einem der neuen Autos vermutete, denn so viele Kilometer wie Josef, könne man, „mit dem Wagen unmöglich bereits gefahren sein.“
Dass ihn oft schon beim Betreten des Firmengebäudes ein, die Selbstsicherheit raubendes Gefühl in der Magengrube befiel, führte er auf die ungewohnte Situation im dritten Glied zurück und ebenso darauf, plötzlich hunderte Kollegen zu haben, in Strukturen, die nicht er selbst von Beginn an aufgebaut, und auch nach Jahren noch nicht verstanden haben wird. Man grüßte einander höflich, fand aber keine Gesprächsbasis. Josef vereinsamte innerlich und spürte das gleiche verwirrende Gefühl bald auch unter seinen Freunden. Seinen grauen Gedanken wollte keiner mehr zuhören. Irgendwie funkten Josef und die Menschen um ihn, plötzlich auf unterschiedlichen Wellenlängen.
Dies, und die Sorgen um die stetig steigende Höhe seiner Hypothek, glaubte Josef in diesen Jahren als Grund für seine zunehmend wachsende Schwere, die nun auch schon seinen Körper erfasste. Immer öfter sah er sich auf seinen langen Autofahrten gezwungen, einen Parkplatz für ein Stündchen Mittagsschlaf aufzusuchen, in der glücklichen Lage, sich die Zeit in seinem, von Vielen beneideten Job, gänzlich frei einteilen zu können. Und doch wurde ihm der Kampf, um die Fähigkeit seinen Arbeitsaufwand bewältigen zu können, zusehends mühevoller.
An einem Herbsttag traten dann erstmals unverkennbare Boten eines außergewöhnlichen, nicht gesunden Zustandes auf. Josef kam nach einer siebenstündigen Autofahrt in sein leeres Zuhause, Agnes war zu einem Kurzurlaub bei ihren Eltern in den Bergen, Max zum Feiern in der Stadt, als Josef ein, nun nicht mehr zu verleugnender, seltsam leerer, Zustand befiel. Es war der Abend, an dem inzwischen auch hierzulade Halloween gefeiert wird. Seinem beinahe letzten verbliebenen Freund, einem Amerikaner, für den dieses Fest den Höhepunkt des Jahres darstellte, bedeutender noch als Weihnachten oder Thanksgiving, der die zwei Wochen vor seiner Halloween-Party mit der Dekoration seines Hauses verbrachte und dutzende Gäste, zum Jahresmotto passend verkleidet, eingeladen hatte, musste er absagen. Anstatt zu feiern, legte sich Josef an diesem Abend erstmals bewusst auf sein großes Sofa und zog sich eine Decke bis über den Kopf. Noch war dies nicht Rückzug genug, denn einer Begegnung mit den nun an der Türe läutenden Kindern mit ihrem, Süßes oder Saures, Spruch fühlte er sich nicht mehr gewachsen, so kappte Josef die Stromversorgung der Hausglocke und verdunkelte alle Fenster. Am Sofa unter zwei Decken versteckt, verbrachte er die langen Stunden dieses Abends ein erstes Mal einsam, in die Luft starrend, nicht verstehend, welcher Zustand ihn da befallen hatte.
Im folgenden Jahr ließen es sich Josef und Agnes richtig gut gehen. Sie verbrachten im Sommer viele glückliche Wochen an der portugiesischen Atlantikküste und doch musste sich Josef zusehends eingestehen, dass auch, beispielsweise beim Wandern über die Dünen, sein körperliches Vermögen nicht mehr das gewohnte war.
Auch die Bemühungen, sein wachsendes Leistungsdefizit im Arbeitsalltag zu überspielen, empfand er zunehmend als Qual und inzwischen häuften sich die Vorfälle bei denen Josef dies nicht mehr gelang. In Besprechungen verließ ihn nun öfter die Konzentration, seine Chefin Gabriele hatte dies mit den Worten, „hörst Du mir nicht zu?“, bereits bemerkt. Und auch unterwegs in Kundengesprächen, die schon immer mehr freundschaftlich privat als geschäftlich waren, fiel es Josef zunehmend schwerer, professionell bei der Sache zu bleiben und nicht bloß über seine private Situation zu klagen.
Auch hatte Josefs anhaltend mürrische Stimmung bereits viel zu tiefe Spuren bei seinen Freunden hinterlassen, die Kontakte waren nun zur Gänze im Sand verlaufen, ein nächstes ein Jahr verging, in dem sie einander nicht mehr sahen. Und im Familienleben mit Agnes, wandelte sich Josef mehr und mehr von der Lokomotive der Beziehung zum Tender.
Zum Jahresende hin wurde ihm sein Zustand selbst immer rätselhafter. Schon kleine Arbeiten im Haushalt vielen Josef zusehends schwerer und er verhielt er sich dabei auch noch besonders ungeschickt, machte dabei fast täglich etwas kaputt, sodass er bald mit dem Reparieren nicht mehr nachkam. Nach Abwaschen oder Staubsaugen war er meist schweißüberströmt und so reizbar, dass er immer öfter danach mit rotem Kopf lauthals seine Alltagsprobleme vor Agnes und Max herausschrie. Dabei hatte er zunehmend die höchst verunsichernde Erkenntnis, dass ihm in diesen Situationen die Kontrolle über die Intensität seiner Erregung entglitten war. Josef war fraglos ein emotionaler Mensch, und doch zeitlebens weit von dem verzweifelten, cholerischen Monster entfernt, in das er sich nun immer öfter verwandelte.
Als er in diesem Jahr ohne Agnes zum nachbarschaftlichen Krampuskränzchen ging, sie war nach ihrem Arbeitstag einfach zu müde, überfiel Josef unter den eigentlich doch gut Befreundeten, ein unheimliches Gefühl der Unsicherheit, eine gewisse Verwirrung und schließlich ein Drang zur Flucht. Er wusste nicht mehr, was er mit seinen Mitmenschen reden sollte, und zu ungetrübtem Scherzen war ihm ohnehin schon lange nicht mehr zumute. Nach einer halben Stunde begannen die Stimmen zur Kakophonie eines einstimmenden Orchesters zu verschwimmen und Josef die Gesichter seiner Mitmenschen mit bedrohlichen Raubtierfratzen zu vergleichen. Es quälte ihn so lange, bis er sich nur mehr einsam und hilflos in einem Löwenkäfig fühlte. Mit gebrochener Seele schlich er frühzeitig von der Party nach Hause, versteckte sich auf seinem Sofa, gleich unter zwei Decken vor der Welt und schlief bis zum Morgen durch.
Wochen später verbesserte ein Weihnachtsurlaub seinen Zustand kein bisschen. Und als Josef an einem der ersten Arbeitstage im neuen Jahr nach einem Kundentermin, gerade erst im Abfahren vom Parkplatz, wegen einer kurzen Unkonzentriertheit den ersten selbstverschuldeten Autounfall seines Lebens verursachte, der jedoch zum Glück so harmlos verlief, dass das Auto des Gegners nicht einmal einen Kratzer hatte, war ihm endgültig bewusst, dass sein Zustand den Rahmen normaler Leistungsschwäche und schlechter Laune deutlich sprengte.
Kapitel 1: Burn-Out
Am darauffolgenden Freitag ging Josef in dieser Angelegenheit zu einem ersten Besuch bei seiner Hausärztin. Typisch Mann, kannte er Arztbesuche nur, wenn er ein oder zwei Mal pro Jahr ein paar Tage Krankenstand brauchte, um eine Verkühlung auszukurieren. Für diesen Zweck tat seine Hausärztin ihre Dienste sehr gut, denn richtig erkrankt war, und fühlte sich, Josef sein ganzes Leben nicht. Frau Dr. Ganser schien die Ernsthaftigkeit seiner Worte, mit denen er sie diesmal begrüßte, daher nicht zu erkennen.
„Mit mir ist irgend Etwas“, sagte Josef. „Ich bin zusehends zerfahren und unkonzentriert.“
Dr. Ganser war eine robuste, kleine Person, die immer viel Zuversicht auszustrahlen versuchte. So behielt sie ihr breites Lächeln aus der Begrüßung bei, als ihr Josef von seiner seltsamen Vereinsamung und Irritation unter Menschen erzählte und von der unerklärlichen Erregbarkeit, der Unkonzentriertheit, sowie dem deshalb kürzlich selbstverschuldeten, kleinen Autounfall. Dr. Ganser diagnostizierte umgehend.
„Wissen Sie, was Sie haben? Sie haben eine vorübergehende Belastungsstörung.“
Folgerichtig verwies sie Josef zu einer psychologischen Untersuchung und schwenkte auch gleich mit einer Visitenkarte eines Psychologen. Dr. Polensky beschrieb sie als sehr renommiert, ja dass sie ihn sogar persönlich kenne und in seinem Wochenendhaus auch bereits zum Essen eingeladen war. Dr. Ganser stellte Josef eine Bestätigung aus, ein, einer Überweisung sehr ähnliches Formular, was sie mit ein wenig Unsicherheit begründete, „ich glaube, Psychologen brauchen da etwas Anderes.“ Sehr oft schien sie nicht, Patienten zu Psychologen zu überweisen.
Aus ihrer Hausapotheke verkaufte sie ihm gegen die vorübergehende Belastungsstörung auch gleich ein passendes Medikament namens Cipralex, das er fortan einmal täglich zu nehmen habe.
Ein wenig zuversichtlicher verließ Josef die Arztpraxis, vereinbarte gleich am nächsten Arbeitstag einen Termin bei Dr. Polensky, nahm regelmäßig das verschriebene Medikament und arbeitete weiter, wie gewohnt. Das bedeutete, er fuhr mit seinem Firmenwagen weiterhin weit über tausend Kilometer pro Woche, erlitt unerklärliche, quälende Unsicherheitsgefühle unter seinen Kollegen im Büro und versuchte seine Unkonzentriertheit so gut es ihm nur möglich war, zu überspielen. Noch öfter überwältigte ihn auf diesen langen Autofahrten die Müdigkeit, so dass er einen Autobahnparkplatz zu tiefem Schlaf aufsuchen musste, aus dem er dann immer schweißgebadet aufwachte. Josef konnte kaum mehr länger als zwei Stunden ohne Pause, in der er auf seinem umgelegten Autositz eine Stunde schlief, am Stück fahren. Vielleicht aber, war dieses noch weiter gesteigerte Schlafbedürfnis, inzwischen auch nur dem von Dr. Ganser verschriebenen Psychopharmaka geschuldet? Auswirkungen auf seinen höchst beunruhigen Zustand hatte das Medikament jedenfalls keine. Auch nicht auf die von Schweißausbrüchen begleiteten Hilfeschreianfälle in der Küche oder der Garage, die er nun regelmäßig, selbst schon bei kleinen Hausarbeiten, bekam.
In Gesprächen mit seinen Kunden war es ihm schon einige Jahre zusehends schwerer gefallen, professionell zu bleiben. Viele seiner Ansprechpartner kannte er über Jahrzehnte, mit einigen hatte er ein mehr freundschaftlich als geschäftliches Verhältnis, jetzt aber konnte Josef das Erzählen seiner privaten Belastungen gar nicht mehr zurückhalten. Es schien, als würde das, einem gesunden Menschen anerzogene, psychische Schutzschild zusehends rissig, einer zerschlissenen Regenplane gleich, deren Material aufgrund der Altersschwäche zunehmend mehr Feuchtigkeit durchlässt. Auch diese Gespräche wurden mehr und mehr zu Hilfeschreien, an Freunde, die ihm nicht helfen konnten, zur Lösung eines Problems, das nur schwer fassbar war, mit einer Ursache, die niemand erkannte.
Und dann kam der Tag, an dem das Schicksal ein Rauschen und ein Pfeifen in Josefs Kopf einschaltete.
Zwölf Tage nach dem ersten Besuch bei Dr. Ganser war Josef wieder bereits einige Stunden auf der Autobahn unterwegs, als er sich plötzlich unter einem Wasserfall stehend glaubte. Es begann bei heiterem Himmel, während er, eigentlich völlig entspannt, seinem Ziel entgegenrollte. Und es kam aus ebenso heiterem Himmel.
„Schschsch, Iiiihhh“, kreischte es im Kopf, als ob dem Wasserfall auch noch ein Umspannwerk angeschlossen wäre, oder ein Nachbar eine Kreissäge eingeschalten hätte. Es kam von einem Moment auf den anderen und wollte sich auch nicht mehr ausschalten lassen.
Dazu spürte er im Inneren seines rechten Ohrs einen Schmerz, einer Mittelohrentzündung gleich. Josef war davon so heftig getroffen, dass er das Gefühl hatte, den Schmerz im Ohr richtig hören zu können. Unmittelbar verglich er dieses Stechen mit seinen Erinnerungen an die Nachwirkungen eines rund zehn Jahre zuvor absolvierten Schnuppertauchkurses im bakterienverseuchten Pool einer tunesischen Hotelanlage. Auch dachte er an die Qualen, die Kinder mit Mitterohrentzündung erleiden, und noch dazu weit häufiger daran erkranken als Erwachsene. Ein Entzündungsherd in der Mitte des Ohrs strahlt auf einen anliegenden Knoten vieler zentraler Nervenstränge aus, daher fühlen sich diese Schmerzen so intensiv an, ist eine Mittelohrentzündung zurecht gefürchtet.
Josef hatte noch eine gute Stunde Fahrt bis zu seinem Hotel vor sich. Eigentlich sollte er direkt zu einem vereinbarten Termin mit einem gut befreundeten Kunden fahren, der aber Verständnis zeigte, als ihm Josef absagte. In dieser quälenden Stunde bis zum Hotel, bekam er zusehends Angst. Angst davor, die kleine Kreuzfahrt, die er mit Agnes in weniger als einer Woche unternehmen wollte, nicht wird antreten können. Angst davor, ein Krankenhaus mit so vielen fremden Menschen aufsuchen zu müssen, und Angst vor den immer wieder auftretenden Schmerzen im rechten Ohr.
Nachts lag er im dunklen Hotelzimmer und hörte dem Pfeifen im Ohr und dem Rauschen im Kopf zu. Die Schmerzen waren etwas abgeklungen. Aber das Pfeifen beunruhigte Josef sehr, auch wenn er sich eine lebenslange Konsequenz noch gar nicht vorstellen konnte. Erst spät schlief er, trotz des Wasserfalls in seinem Kopf, endlich ein. Am Morgen galt der erste Gedanke wieder dem elektrischen Zirpen und dem Rauschen im Kopf. Zwar etwas milder als am Vorabend, aber es war noch immer da.
Ganz wie gewohnt, bereitete er sich auf seinen Arbeitstag vor. Doch als sich im Frühstücksraum des Hotels auch die Ohrenschmerzen, mit gleicher Intensität wie tags zuvor, wieder zum Rauschen dazugesellten, rief er alle für diesen Tag geplanten Kunden an, um die Besuchstermine abzusagen. Der letzte Anruf galt Tom, einem Kollegen aus der Gegend zu dem er ein besonders gutes Verhältnis hatte, um ihn zu fragen, welches Krankenhaus, möglichst nahe dem Ort seines Hotels gelegen, er empfehlen könne.
„Kurz vor der Landeshauptstadt gibt es ein ganz neues Krankenhaus. Auch ist der Weg für Dich kürzer als in die Stadt“, riet ihm Tom.
Schon die Suche nach dem Spital, einer Parkmöglichkeit, dem Haupteingang und der Anmeldung, war für Josef erniedrigend. Seltsam verwirrt, verfuhr und verlief er sich schon seit einiger Zeit ständig. Besonders in fremder Umgebung fühlte er sich ungewohnt orientierungslos, obwohl er ein Leben lang stolz auf seinen besonderen Orientierungssinn sein konnte. Das Gefühl der Enttäuschung, dass es in diesem Spital keine Abteilung gab, an die er sich mit seinen Ohrenschmerzen wenden konnte, fuhr ihm im wörtlichen Sinn in Mark und Bein. Es kribbelte am ganzen Körper, so als wäre er an eine Stromleitung angeschlossen.
Josef blieb der Weg in die Stadt also nicht erspart, wieder nur mit großer Mühe fand er sich in den Straßen und am Gelände des Landeskrankenhauses zurecht. An diesem sonnigen Jännertag saß er schon eine gute Stunde im Wartesaal der HNO-Ambulanz, als er endlich aufgerufen wurde.
Eine junge Ärztin empfing ihn in einem hellen, überraschend großen, an eine Schulklasse erinnernden, Behandlungsraum. Sie besah sich seine Ohren durch einen Metalltrichter und schickte ihn gleich zu einem Akustiktest weiter. Eine, so sympathisch wie akkurat agierende, medizinisch-technische Assistentin setzte Josef in eine schalldichte Kabine und spielte ihm verschiedene Frequenzen und Klopfgeräusche in unterschiedlichen Lautstärken über Kopfhörer ein. Josef erinnerte sich, eine solche Situation hatte er schon einmal erlebt, vor über dreißig Jahren, bei der Stellungskommission des Bundesheers. Die Auswertung ergab eine leichte Hörminderung des rechten Ohrs, das Rauschen im Kopf könne aber mit keinem Test gemessen werden. Und gegen die Schmerzen in Ohr und Hals verschrieb man ein Cortison beinhaltendes Medikament. Die junge Ärztin verabschiedete Josef mit einem guten Rat.
„Sie sollten drei Monate in Krankenstand gehen, sonst geht der Tinnitus nie mehr weg.“ Tinnitus, diesen Begriff kannte er gut. Sein Vater, Jahrzehnte unter schweren Rückenschmerzen und noch mehr leidend, hatte diesen Begriff oft erwähnt, doch zum ersten Mal wurde er nun bei Josef diagnostiziert.
Selbstverständlich war an einen längeren Krankenstand nicht zu denken. Josef drohte zwar nicht direkt seine Anstellung zu verlieren, doch drehte sich die Schraube, mit der Kosten gesenkt und Aktienkurse angehoben werden sollen, seit den neunziger Jahren zunehmend schneller. Die costcutting-Seuche, hatte längst auch die payrolls der Konzerne infiziert. Ein fire by excel, wie es Gabriele ausdrückte, erzeugt bei jedem Mitarbeiter unvermeidbar ein in die Grundfesten der Psyche dringendes Unsicherheitsgefühl, die vielzitierte Existenzangst. Und Hypotheken, so wie sie Josef für sein Haus regelmäßig abzuzahlen hatte, potenzieren diese Unsicherheit noch. Er begann genau abzuwägen, wie weit er die Schmerzen zu ertragen bereit sei, um seinen Job nicht durch Krankenstand zu verlieren.
Am Ende dieser Arbeitswoche fand die psychologische Untersuchung durch Dr. Polensky statt. Überpünktlich erschien Josef in der Praxis des Psychologen, im zweiten Stock eines Wiener Gründerzeithauses, und wähnte sich unversehens in einem mittelalterlichen Schloss. Das Wartezimmer dominierte eine mit Helm, Harnisch und Lanze überkomplette Ritterrüstung und auch das Mobiliar in den überhohen Räumen verstärkte den Eindruck, mehr in einer Burg als in einem Zinshaus zu sein. Ins Behandlungszimmer gebeten, erblickte Josef sofort eine stolze Bibliothek und ein deutlich veraltetes Computermodell auf dem mit Unterlagen überquellenden Schreibtisch. Und stolz wird Dr. Polensky wohl auch auf sein Bild am Titelblatt des amerikanischen Fachblattes Psychology Today sein, das er gerahmt in einem Regalfach präsentierte und damit unmissverständlich seine fachlichen Qualitäten bezeugte. Noch etwas drängte sich Josef auf, das Wort Chinchilla, für die Farbe von Dr. Polenskys Bürstenhaarschnitt.
Josef hatte ein gutes Gefühl. Sein Gesprächspartner begann, ihm einige psychologische Standardtest vorzulegen, darunter auch den offenbar unvermeidlichen Rohrschach-Test, bei dem, wie oft fälschlich angenommen, der Patient nicht bloß auf seine Interpretation der teilweise farbigen Tintenklekse, sondern auch auf die im Zusammenhang mit dem Test stehenden Äußerungen und Aktionen hin beobachtet wird. Während Josef danach einige Fragebögen ausfüllte, die sich zu seiner Überraschung nicht wesentlich von den viel belächelten Psychotests in diversen Wochenendbeilagen von Tageszeitungen unterschieden, begab sich Dr. Polensky in ein Hinterzimmer. Josef war längst fertig, als der Psychologe zurückkam und ihn in ein Gespräch verwickelte. Er klagte über seinen Karriereknick, an dem ihm weniger die finanziellen Einbußen belasteten als der Verlust der beruflichen Gestaltungsmöglichkeiten, das Kribbeln der Herausforderung die richtigen Entscheidungen treffen zu müssen und das wohlige Gefühl, im Führen der Untergebenen ein guter Mensch zu sein. Und allem voran, litt Josef durch den Karriereknick unter dem Verlust des Gewichts seiner Worte bei seinen Mitmenschen. Den Aussagen eines Chefs wird Gehör und Glaube geschenkt, ein Vertreter, wie es Josef seit einiger Zeit nun war, wird von der Gesellschaft gleich mehrere Ebenen tiefer kategorisiert, in der Schublade mit der Aufschrift, Achtung, unglaubwürdig! Behauptungen eines Chefs, der bewiesen hat, es im Leben zu Etwas gebracht zu haben und Verantwortung tragen zu können, so das Klischee, müssen daher auch richtig sein, die eines Vertreters doch wohl nur dem Ziel, etwas verkaufen zu wollen geschuldet und daher von der Gesellschaft mit Skepsis betrachtet.
Nachdem Dr. Polensky noch einige Minuten der wertvollen Untersuchungszeit selbst von seinen Wüstenabenteuern in Jugendtagen erzählte, empfahl er Josef mit den Worten, „das bekommen wir schon wieder hin“, eine Psychotherapie bei ihm zu machen. Doch einen von der Krankenversicherung bezahlten Therapieplatz könne er erst in zehn Monaten anbieten. Das von Dr. Ganser ausgestellte Bestätigungsformular stellte sich als das falsche heraus, Dr. Polensky wollte seinen Befund aber erst ausstellen, nachdem Josef das richtige Formular nachgebracht habe. Josef erwähnte seine anstehende Kreuzfahrt und erklärte dem Psychologen, dass er daher erst in zwei Wochen die richtige Überweisung bringen könne.
So fuhr er mit einem guten Gefühl nach Hause, um für die kommende Reise zu packen, doch fiel vorerst, durch die Anstrengungen der Untersuchung besonders tief erschöpft, in einen mehrstündigen Schlaf auf seinem Sofa. Die Kreissäge im Kopf begleitete ihn nun bereits den fünften Tag, und wie schon in seiner ersten Nacht mit Rauschen und Pfeifen im Kopf, bemerkte er ebenso eine kleine Milderung nach dem Schlaf und ein wieder Anschwellen sobald er sich aufsetzte und erste Schritte machte. Das Holen des Reisegepäcks aus der Abstellkammer im Keller, das Strecken nach den Urlaubsaccessoires in den obersten Kastenfächern, das oftmalige Bücken, um seine Kleidung in die geöffneten Koffer auf dem Teppich zu legen, und unzählige Male Stiegen steigen in seinem Reihenhaus, ließen ihn zunehmend erregen, so dass schon eine kleine Widrigkeit reichte, um wieder einmal einen seiner seltsam verzweifelten Redeschwallanfälle auszulösen. Mit dunkelrotem Kopf, aus den Poren spritzendem, stark säuerlich riechendem Schweiß, stand Josef in der Nacht vor dem Abflug zu der so sehnlich erwarteten Nilkreuzfahrt in seiner Küche, schrie und spuckte sich die Seele aus dem Leib, nach Hilfe zur Bewältigung eines Zustands, der er nicht einmal selbst richtig fassen konnte.
Josef war auf Reisen immer wohler als zuhause. Schon vor der mittlerweile bereits einige Jahre kontinuierlich verstärkenden Menschenscheu, fühlte er sich als Fremder im eigenen Land. Zu Beginn seines Lebens war er ein Ausgegrenzter, weil er, als einziges Kind seines Lebensraums, von den Eltern dazu angehalten wurde, nicht Dialekt zu sprechen, mit Selbstgenähtem gekleidet wurde, schon früh eine Brille trug und dazu noch etwas pummelig war. Der erwachsene Josef interessierte sich für Jazz, hörte im Radio nur den Kultursender und las großformatige Zeitungen. In einer Zeit, in der der gesellschaftliche Wandel zur Abgrenzung, von Meinungsmachern aller Art propagiert wird, verstärken sich auch die Grenzen innerhalb einer heterogenen Gemeinschaft, eine Minderheit mutiert scheibchenweise vom bunten Fleck zum angepatzten Ausgegrenzten. Josef hatte sich zu den Themen Religion, Politik, Geschichte und so weiter, aus den Zusammenhängen eine eigenständige Meinung gebildet, dies unterschied ihn von der Mehrheit, dies grenzte ihn im eigenen Land aus.
So fühlte er sich keiner Gesellschaft als deren typischer Vertreter angehörig, ob im eigenen Staat oder einem anderen. Seine Mitbürger im eigenen Land irritierte so ein scheinbar Zugehöriger, und doch Außenstehender. Auf Reisen war aber dieser Status des Fremdseins klar definiert, er war ein nicht hier Ansässiger, und als solcher beinahe überall auf der Welt willkommen.
Schon am Flughafen von Kairo lebte er auf. Für den Fremden war die Fremde eine Heimat, in der er nun angekommen war. Schon mit den ersten Menschen, die ihm bei der Passkontrolle und dem anschließenden kurzen Inlandsflug begegneten, fühlte er sich auf Augenhöhe. Als er gegen Mitternacht, während der mehrstündigen Busreise zum Liegeplatz ihres Kreuzfahrtschiffes, die Sitte der ägyptischen Autofahrer beobachtete, alleine auf dunklen Landstraßen ohne Licht zu fahren, und erst knapp vor dem Entgegenkommenden dann mit Fernlicht diesen zur herzlichen Begrüßung zu blenden, zeichnete dies ein breites Lächeln in sein Gesicht und erzeugte eine glückliche Wärme in seinem ganzen Körper. Josef liebte fremde Sitten in fremden Ländern. Bis er sich an den Anblick der an den allgegenwärtigen Checkpoints stehenden, immer vollkommen schwarz gekleideten und doch nicht richtig uniformierten, Männer mit umgehängter Maschinenpistole gewöhnte, dauerte es allerdings einige Tage.
Agnes und Josef fuhren auf einem der klassischen Nilkreuzfahrtschiffe, deren Größe an die Breite der Schleusen und die Höhe den wenigen Brücken über den Nil angepasst und daher einheitlich war, stromaufwärts, von einem am Flussufer liegenden Tempel zum nächsten. Josef hatte in diesen Tagen Glücksgefühle in der Tiefe seiner Persönlichkeit, er hatte die gleiche Aufgabe, ein klares Ziel wie auch dreißig Jahre zuvor während seiner Saharareise, nämlich so weit wie möglich Richtung Süden zu kommen. Er spürte seit langem wieder diesen, für seine Person stimmigsten Sinn des Lebens.
Schmerz produziert der Körper als Alarmsignal. Man bemerkt ihn nur, wenn man ihn soeben hat und vergisst ihn, zum Überleben unverzichtbar, sofort nach dem Abklingen. So dauerte es bis Josef bewusst wurde, dass ihn die Ohrenschmerzen schon einige Tage verschont hatten. Ebenso konnte er das Rauschen tagsüber teilweise aus seinem Bewusstsein verdrängen, doch nur um dann nachts im Bett umso heftiger vom Fortissimo des Orchesters im Kopf gequält zu werden. Der Leistungseinbruch, die Ermüdbarkeit, die Konzentrationsschwäche und die niedere Reizbarkeitsschwelle begleiteten sein Leben aber auch auf dieser Urlaubreise, sie ließen sich mit keiner Anstrengung ignorieren. Ebenso verunsicherte ihn seine emotionale Labilität weiterhin. Wenn sie gemeinsam das Schiff für einen Ausflug zu einem der vielen mächtigen Tempel entlang des Nils verließen, fühlte er sich an Agnes Seite beinahe so selbstbewusst und persönlichkeitsstark wie in seinen guten Jahren. Alleingelassen, dämmerte jedoch immer öfter die Erinnerung an eine Verunsicherung, die ein Kindergartenkind während einer Gardinenpredigt empfindet.
Da die Touristenströme in die nordafrikanischen Länder nach dem Zusammenbruch des Arabischen Frühlings, der nicht anders als beispielsweise der Prager Frühling, nur mit einem Abgleiten in eine noch restriktivere Militärdiktatur als zuvor endete, praktisch vollends versiegt waren, genossen Josef und Agnes die tausende Jahre alten Kulturstätten entlang des Nil als Privatvorstellung. Tausende waren vor dem großen Einbruch auch die Besucher, die einander täglich durch die einschüchternd monumentalen Tempel, wie den des Pharao Ramses II und seiner Hauptfrau Nefertari in Abu Simbel, ganz im Süden Ägyptens, beinahe an der Grenze zum Sudan gelegen, durchströmten. Josef und Agnes aber standen ganz allein vor den riesigen steinernen Kolossen des Tempeleingangs als sie um sieben Uhr Früh den Sonnenaufgang über dem östlichen Nilufer erleben durften und sich, angesichts Josefs unverändert besorgniserregendem Gesundheitszustand, in zärtlicher Umarmung Trost spendeten.
Vor den Unruhen und vereinzelten Bombenattentaten fuhren rund vierhundert Kreuzfahrtschiffe, die so notwendigen Devisen bringenden, Touristen den Nil entlang. Im Jahr als Josef und Agnes reisten, waren es nur noch dreizehn. Ebenso verwaist wie alle touristischen Stätten war daher auch das religiöse Zentrum des alten Ägypten, die Tempelstadt Karnak am Rande von Theben, der Stadt, die nach der Eroberung furch die Araber im siebenten Jahrhundert von diesen, angesichts der überwältigenden Pracht, in Luxor, dem Ursprung des Wortes Luxus, umbenannt wurde. Nur dem allgegenwärtigen Bakschisch konnten sie es verdanken, dass die berühmte nächtliche Lightshow, deren rund dreitausend Sitz- und Stehplätze früher nur bei rechtzeitiger Buchung noch zu bekommen waren, für ihre vierzehnköpfige Gruppe überhaupt aufgeführt wurde. So konnte Josef die gespenstische Leere unter den unvorstellbar mächtigen Säulen zu, bei normalem Besucherstrom unmöglicher, längerer Betrachtung nutzen. Und dabei fielen ihm einige Hieroglyphen auf, die weit tiefer als üblich in den Sandstein gemeißelt waren.
Ihr wissenschaftlicher Führer durch diese Woche, ein Professor für Ägyptologie aus Berlin, erklärte Josef, „dies sind Inschriften, in denen der neue Herrscher den Namen seines Vorgängers ausmeißeln und durch den eigenen ersetzen ließ, um die Ruhmestaten als die seinen auszugeben. Und damit dies nicht auch seine Nachfolger ebenso machen können, wurde der neue Pharaonenname gleich zentimetertief eingemeißelt.“ Der Nachweis der psychologischen Erkenntnis, dass der Schelm so ist, wie er denkt, ist also mitnichten neu. Josef konnte ein Schmunzeln nicht unterdrücken, musste er doch unmittelbar an Herrn Hoffmann denken, der Kameras im Büro installieren ließ, um seine Mitarbeiter zu kontrollieren, ständig Verdächtigungen aussprach und doch selbst für seine kreativen Berechnungen, und auch dafür bekannt war, in neun von zehn Fällen glatt nicht die Wahrheit zu sagen. Wer rundum seine Mitmenschen des Betrugs verdächtigt, wird wohl einen guten Grund dazu haben, das gilt nicht nur für Hoffmann.
Die letzte Station auf ihrer Reise war das Tal der Könige. Mit einem Bus überquerten Sie das Nilufer, besichtigten die Memnon-Kolosse, und Josef kaufte sich am Fuße des Hatschepsut-Tempels einen Schal, praktisch direkt vom Webstuhl einer Berberfamilie. Er trug schon seit einiger Zeit ständig einen Schal, ganz eng um den Hals gewickelt. Josef war immer schon Moden seiner Zeit ein kleines Stück voraus. So trug er als erster einen Dreitagebart oder gestreifte Krawatten, immer ein wenig bevor es, wie ein geheimes Zeichen, auch von vielen anderen Männern getragen wurde. So war es auch mit Schals, und es fiel daher nicht weiter auf, dass Josef neuerdings auch im Sommer instinktiv das Bedürfnis hatte, seinen Hals zu schützen.
Über das Tal der Könige hatte Josef schon als Kind einige Bücher gelesen, allen voran die Biografie Howard Carters, des Entdeckers des Grabes von Tut-Ench-Amun. Er hatte daher eine einigermaßen genaue Vorstellung des Tals, doch als er sich nun diesen lange gehegten Kindheitstraum tatsächlich erfüllte und persönlich am Eingang zu den Königsgräbern stand, überwältigten ihn die Gefühle in einem bisher nicht gekannten Ausmaß. Die innere Rührung war auf eine bislang noch nie erfahrene Weise intensiv, dass er ein von heftigem Weinen begleitetes, lautes Schluchzen, vor den Augen aller seiner Reisebegleiter, nicht mehr halten konnte. Josef war eben allen seinen Emotionen, den guten und den bösen, nicht mehr Herr.
Noch tief von den Eindrücken dieser Reise inspiriert, stieg er am ersten Tag nach dem Urlaub wieder in sein Auto, um die gewohnte Tour zu seinen Kunden anzutreten und nach kurzer Zeit wieder den stechenden Schmerz im rechten Ohr zu verspüren. Dass Josef bereits nach wenigen Kilometern Autofahrt endlos lange gähnen musste, seine Ohren verschlagen waren als wäre er eine Bergstraße hinaufgefahren, das Rauschen eines Bachs in seinem Kopf zum Wasserfall eines Flusses angestiegen und er seine Probleme verzweifelt mit vielen kleinen Spucke-Tröpfchen an die Windschutzscheibe herausschrie, war nun schon Regel geworden. Noch am selben Abend besuchte er Dr. Ganser, erzählte von diesen Zuständen und verlangte das korrekte Überweisungsformular für Dr. Polensky, um es diesem zu schicken. Bis Josef das dafür notwendige Kuvert zuhause gefunden, eine Briefmarke gekauft und einen der heute nur mehr spärlich vorhandenen Briefkästen entdeckt hatte, brauchte es allerdings zehn Tage.
Inzwischen hatte Josef die erste Packung des Psychopharmakas aufgebraucht und bei Dr. Ganser eine zweite gekauft. Beinahe wäre Josef zum Gehen aufgestanden, da fiel ihm ein, Dr. Ganser auch von seiner schmerzhaften Hand zu erzählen. Dieses Problem war, unter all den anderen, bisher untergegangen. Ohne ein einziges Wort zu verlieren, drehte sie sich ihrem Computer zu und nach nur wenigen Augenblicken, mit einem Überweisungsschein zu einer Orthopädin in der Hand, zu Josef zurück.
Dr. Polensky hatte während des Auslandsaufenthalts ein recht unfreundlich gehaltenes Mail geschickt, in dem er Josef aufforderte, das richtige Formular zu bringen, da er sonst den Befund nicht wird ausstellen können. Dass Josef deutlich angekündigt hatte, für eine Woche außer Landes zu sein, hatte dieser offenbar vergessen. Nach Polenskys Unfreundlichkeit, hatte Josef daher keine Lust mehr, wie geplant die empfohlene Psychotherapie bei ihm zu machen und begann im Internet nach Ersatz in einem möglichst nahe gelegen Ort zu suchen. Josef vereinbarte einen Termin, irrte wieder einmal beängstigend orientierungslos durch eine Kleinstadt und landete im Hinterhof einer schäbigen Autowerkstätte.
Über eine gespenstisch knarrende Treppe gelangte Josef in einen Vorraum, in dem zwei antik wirkende Orientteppiche ausgebreitet waren. Als er im Behandlungszimmer weitere Teppiche erblickte, sprach er die ältere, auffallend farblos wirkende Therapeutin darauf an, bekam von dieser aber keinerlei Reaktion. Die für Therapiesitzungen üblichen fünfzig Minuten lang, erzählte er von seiner unerklärbaren Erregtheit, der psychischen Labilität, der Unsicherheit im Kontakt mit seinen Mitmenschen und vergaß auch nicht, Karriereknick und die einhunderttausend Euro Verlust durch den Fremdwährungskredit zu erwähnen.
Schnell begann sich Josef zu wundern, dass diese fünfzig Minuten so ganz anders verliefen als bei seiner ersten Begegnung mit einem Psychologen vor einem Monat. Anstelle eines Dialogs, so wie Dr. Polensky, praktizierte diese Therapeutin eine Art Verhör, bei der sie in ihrem abgewetzten Ohrensessel durchgehend schwieg und ihn, wie ein Raubvogel seine Beute, von einem höhergelegenen Punkt goutierte. Josef, der es in seinem Beruf gewohnt war, Gespräche zu leiten, empfand diese Situation als aggressiven Akt, sprach die Therapeutin mehrmals direkt an, um sie in das Gespräch einzubinden, und scheiterte damit bei jedem Versuch. „Die fünfzig Minuten sind um, ich bekomme achtzig Euro von ihnen, eine Rechnung gibts nach der dritten Stunde“, war der einzige Satz der Therapeutin, an den sich Josef im Anschluss erinnern konnte. Dass es nicht einmal zu einer zweiten Sitzung kommen wird, stand schon fest als er, über die wieder beängstigend knarrende Treppe, von dieser Therapie flüchtete.
Am darauffolgenden Tag räumte er seine Garage auf. Sie war erst drei Jahre zuvor errichtet worden und als Teil eines Anbaus sehr geschmackvoll gelungen. Josef hatte vom ersten Skizzen-Strich bis zum Verlegen des letzten Pflastersteins dieses Projekt vollkommen allein realisiert, hatte dabei zwei Lkw-Ladungen Ziegel, Schotter, Zement und Sicherheitstechnik innerhalb eines Jahres verarbeitet, und fühlte sich danach stolz und ausgelaugt. Darum hatte er auch die ersten Jahre danach Fahrrädern, Skiern, Werkzeug und Sonstigem, nie einen richtigen Platz gegeben und wollte das an diesem Tag endlich erledigen. All das Bücken, Heben, Drehen, Strecken, ließen ihn Stück für Stück tiefer in graue Gedanken versinken. Die allgegenwärtigen Schicksalsschläge hämmerten nicht nur im Kopf, vielmehr in seinem ganzen Körper, bis sich dieser zu einem Betonblock verspannt hatte. Zusehends bekam er ein rotes Gesicht, musste seinen ungewöhnlich säuerlichen Schweiß riechen und schrie nun die Verzweiflung aus seinem Körper in die Welt hinaus.
So dauerte es nicht lange bis die ersten Nachbarn bei Josef standen und sich sorgten, was ihm denn passiert sei. Einer davon war sogar Arzt. Zwar kannten sie einander nur von kurzen Partygesprächen, aber es war genug Sympathie zwischen Ihnen, dass sich Josef seinem Rat anvertraute und sich von ihm ins Haus begleiten ließ. Dr. Sepp Bayermüller war als Anästhesist prädestiniert dazu, Patienten ruhig zu stellen, folgerichtig holte er sehr bald ein kleines braunes Fläschchen aus seiner Hosentasche und tropfte in ein Glas etwas klare Flüssigkeit, die er Psychopax nannte. Josef hatte um Ärzte und Medikamente gerne einen Bogen gemacht, von einem solchen Mittel noch nie gehört, und musste über den so vielsagenden Namen nun doch heftig schmunzeln. Trotz der geradezu körperlichen Verzweiflung in ihm, hatte er seinen Humor nicht verloren. Das entspannte ihn endlich ein Stück und das Medikament tat ebenso sehr bald seine verheißende Wirkung.
Josef fiel ohnehin bereits nach jeder noch so kleinen Erledigung in einen zumindest einstündigen Tiefschlaf, da hätte es des Psychopax gar nicht bedurft, um ihn nun von der Dämmerung bis zum Morgengrauen schlafen zu lassen.
Er schämte sich. Schämte sich vor seiner Frau, seinem Kind und seinen Nachbarn für diese entwürdigende Entgleisung des Vortags. Und, hatte er sich schon seit bald zwei Jahren kontinuierlich aus der Gesellschaft dieser Nachbarn zurückgezogen, da selbst Smalltalks schon seltsame körperliche Reaktionen auslösten, kam nun ein realer Grund dazu, Begegnungen mit Nachbarn noch mehr zu scheuen.