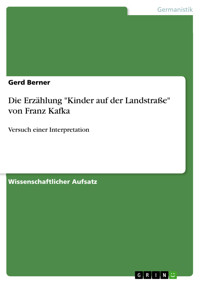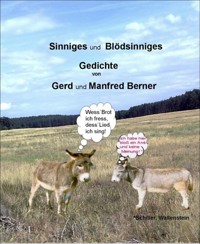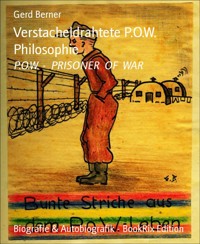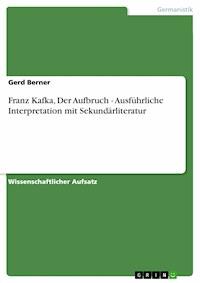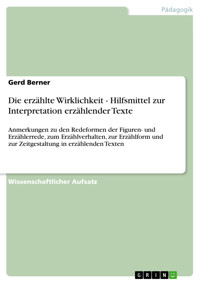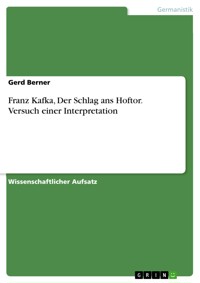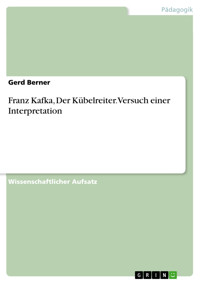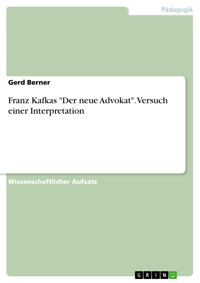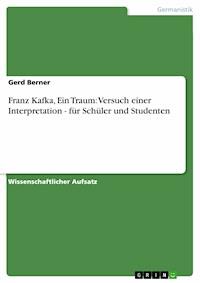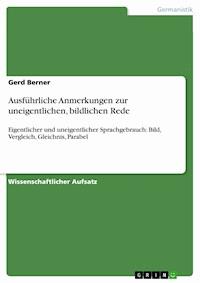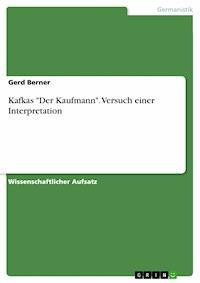
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Literatur, Werke, , Sprache: Deutsch, Abstract: Die folgende Arbeit versucht, eine Übersicht über verschiedene Interpretationsmöglichkeiten von Kafkas "Der Kaufmann" zu geben und ordnet den Text zunächst in das Gesamtwerk des Autors ein. Anschließend wird die Bedeutung des Begriffs 'Betrachtung', sowie der Junggeselle als betrachtendes Ich diskutiert. Es folgt eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Vernachlässigung der Betrachtungs-Texte und untersucht, ob Kafka auch im "Kaufmann" ein "Apologet des Kleinbürgertums" ist. Anschließend folgt die Analyse der Erzählform und des Erzählverhaltens, sowie eine inhaltliche und formale Textanalyse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einordnung des Textes in Kafkas Gesamtwerk
2. Die beiden Bedeutungen des Begriffs ‚Betrachtung‘
3. Der Junggeselle als betrachtendes Ich
4. Die wissenschaftliche Vernachlässigung der Betrachtungs-Texte
5. Kafka auch im Kaufmann ein „Apologet des Kleinbürgertums“?
6. Ich-Erzählform und personales Erzählverhalten
7. Inhaltliche und formale Textanalyse
8. Schlussbemerkung
Literaturverzeichnis
Anhang – „Der Kaufmann“
1. Einordnung des Textes in Kafkas Gesamtwerk
„Die Einteilung von Kafkas Werk in eine Frühphase (bis 1912), die Reifezeit (1912 - 1917/20) und eine Spätphase (1921-1924) deckt sich mit wichtigen Zäsuren im Leben des Dichters, besonders die Jahre 1912 (Kennenlernen von Felice Bauer, Heiratspläne) und 1917 (Ausbruch der Krankheit) können als wichtige Lebenswende-punkte gelten, die auch für die Werkphasen von Bedeutung sind.“[1]
Zu den Werken der Frühphase zählen die Beschreibung eines Kampfes (1904/05), das Fragment Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande (1906/07) und „die achtzehn im Band Betrachtung (1913) zusammengefassten kleinen Prosaskizzen sowie einige verstreut publizierten [sic!] Stücke, [...].“[2] Über die Texte der Betrachtung schreibt Beicken, sie erhellten „den zwischenmenschlichen Bereich, Konflikte, Einsamkeiten, Abweisungen im Erotischen, gespensterhafte Visionen, verfremdete Alltagsrealität, die Befreiung vom Eingesperrtsein im Familiären, die Junggesellenproblematik und die Existenzsorgen eines Kaufmanns, der sich geschäftlich ausgeliefert [...] und als Mensch dem Übergriff feindlicher Mächte ausgesetzt fühlt [...].“[3]
Beicken spricht bei den Betrachtungs-Texten von Prosaskizzen. Barbara Neymeyr räumt im Kafka-Handbuch (Metzler) ein, eine „präzise Gattungsbestimmung [sei] schwierig“, sie zählt einige der vom Autor im Tagebuch und in Briefen verwendeten Bezeichnungen für diese Texte auf: „Kleine Prosa“, „Stückchen“, „Sachen“, „meine kleinen Winkelzüge“. Neymeyr hält die Begriffe „Prosaminiaturen“, „Skizzen“ oder „Studien“ für „legitim“, weil sie die Distanz zu tradierten Werkbezeichnungen andeu-teten, weil sie das Subjektive und Vorläufige und auch das Reflexive mit einschlös-sen.[4]
Ritchie Robertson findet einschränkend: „Die Skizzen der Betrachtung hinterlassen eher den Eindruck von Stimmungsbildern als von Erzählungen.“[5]
Man kann aber der Gattungsproblematik aus dem Weg gehen, wenn man von kurzen Prosatexten bzw. -stücken spricht, bei denen das Narrative dominant ist (z. B. in der die Betrachtung einleitenden ‚Kindergeschichte‘ Kinder auf der Landstraße) oder das Reflexive überwiegt (z. B. in Die Bäume) oder erzählerische Elemente sich mit Reflexionen mischen.
„Da ein Text der entstehungs- und druckgeschichtlichen Fakten nicht entraten kann“[6], gibt Paul Raabe in der Taschenbuchausgabe der Erzählungen einige philo-logische Hinweise. Für Kafkas Kaufmann sind die allerdings sehr knapp: „Der Kauf-mann - Erstdruck (ohne Überschrift) im Hyperion Bd. 1 (1908), H. 1, S. 91. Entstan-den wohl 1907.“[7] Diese Datierung stimmt überein mit der von Gerhard Rieck vorge-legten „Ordnung der Kafka-Texte“, in der er die von Pasley/ Wagenbach vorgenom-mene Datierung ergänzt hat um eine Spalte „Textentstehung lt. Kritischer Ausgabe“. Das ältere Entstehungsdatum „1907 spätest.“ benennt den Terminus ante quem, die Kritische Ausgabe (KA) mit der Angabe „1904/07“ lässt die Frage offen, ob der Kauf-mann nicht schon eher, also in den Jahren nach 1904 und vor 1907 entstanden sein könnte (1904 wäre dann der Terminus post quem).[8]
„Schon während seines kurzen Gastspiels an der Assicurazioni Generali hatte Kafka sein Debüt als Schriftsteller in der Öffentlichkeit vollzogen. Die von Franz Blei (1871-1942) herausgegebene Zweimonatszeitschrift Hyperion druckte in ihrer ersten Ausgabe im März 1908 unter dem Titel Betrachtung acht kurze Prosastücke: Die Bäume, Kleider, Die Abweisung, Der Kaufmann, Zerstreutes Hinausschaun (sic!), Der Nachhauseweg, Die Vorüberlaufenden und Der Fahrgast. Kafka kannte den Herausgeber über Brod, der mit Blei zusammenarbeitete.“[9] Für die Mai-Ausgabe 1909 steuert Kafka zwei weitere Texte bei: Gespräch mit dem Beter und Gespräch mit dem Betrunkenen, Abschnitte aus der wohl 1903 oder 1904 entstandenen Be-schreibung eines Kampfes. Der Hyperion, der überwiegend Texte der literarischen Avantgarde gedruckt hat, muss nach zwei Jahren sein Erscheinen einstellen.
Barbara Neymeyr ergänzt die Ausführungen Ekkehard Harings im KHb, die acht „Prosaminiaturen“ seien unter dem Titel Betrachtung „mit römischen Ziffern, aber noch ohne Überschriften in der von Franz Blei und Carl Sternheim“[10] edierten Zeit-schrift erschienen. Gerhard Kurz betont, die 1908 im Hyperion veröffentlichten Prosa-texte ohne Einzeltitel seien Kafkas „erste Publikation überhaupt.“[11]
Die Prager Tageszeitung Bohemia, in der ein von Kafka verfasster Nachruf auf den exklusiven Hyperion erscheint, „in welchem er [dessen] Bedeutung für randständige Autoren betont“[12], druckt 1910 fünf Prosastücke Kafkas, nämlich diese Titel: Am Fenster (später: Zerstreutes Hinausschaun), In der Nacht (später: Die Vorüberlaufen-den), Kleider, Der Fahrgast und als neuen Text Nachdenken für Herrenreiter.[13]
Ende Juni 1912 fährt Kafka mit Max Brod - es ist ihre letzte gemeinsame Reise - nach Weimar und in den Harz. Auf dem Hinweg machen sie Station in Leipzig und treffen dort den Verleger Ernst Rowohlt und seinen Kompagnon Ernst Wolff (er ist stiller Teilhaber). Man verständigt „sich über die Vorbereitung eines ersten Prosaban-des, der kürzere Erzählungen enthalten soll.“[14] Am Ende werden diesem Band 18 kurze Prosatexte angehören.
Ernst Rowohlt bringt dann gegen Ende des Jahres 1912 unter dem Titel Betrach-tung die erste Buchveröffentlichung des jungen Autors Franz Kafka heraus. Neben den neun Texten von 1908 (Hyperion) und 1910 (Bohemia) enthält der in 800 un-nummerierten Exemplaren erschienene Band neun weitere kurze Texte mit eigenen Überschriften: Kinder auf der Landstraße, Entlarvung eines Bauernfängers, Der plötzliche Spaziergang, Entschlüsse, Der Ausflug ins Gebirge, Das Unglück des Junggesellen, Das Gassenfenster, Wunsch, Indianer zu werden und Unglücklichsein.
Der Band Betrachtung besteht somit „zur Hälfte aus unveröffentlichten, zur Hälfte aus veröffentlichten Stücken.“[15] Überdies hat Kafka sich mit der Zusammenstellung der Texte schwergetan: Der Ausflug ins Gebirge, Kleider, Die Bäume und Kinder auf der Landstraße stammen aus den verschiedenen Fassungen der Beschreibung eines Kampfes; Raabe bemerkt treffend, man erkenne, „dass Kafka sein frühestes Werk wie einen Steinbruch abbaute.“[16]
„Kafkas Widmung „Für M. B.“ in der Buchversion der Betrachtung gilt seinem Freund Max Brod, der ihm den Verlagskontakt vermittelt hatte.“[17]