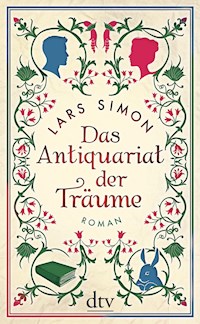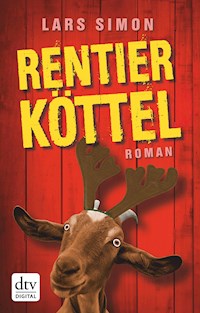7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Comedy-Trilogie um Torsten, Rainer & Co.
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Willkommen im Club »Mucho Gusto« Lieber ' ne Piña Colada in der Karibik bei dreißig Grad im Schatten als stinkenden Fisch bei schwedischem Dauerregen. Dazu: Sonne, Aracaris, Bikinis und so weiter. Gedacht, getan. Kurzentschlossen bucht Torsten Flug und Club-Hotel, besorgt für alle Fälle noch schnell zwei Badehosen und fliegt über den Großen Teich, wo ihn neben seinen Gödseltorp-Kampfgenossen Rainer und Bjørn einige Überraschungen erwarten. Der Kaiman im Swimmingpool ist dabei erst der Anfang …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Ähnliche
Lars Simon
Kaimankacke
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Alle Personen und Ereignisse in diesem Buch sind frei erfunden.Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen oder realen Ereignissen sind entweder rein zufällig oder vollkommen beabsichtigt.
Am Ende des Buches findet sich ein kleines Spanisch-Kompendium.
caca vulg. [’kaka] (-as)f; Substantiv, feminin – 1. Kackef; fig.Mistm – unangenehme Wendung eigentlich als positiv vorhergesehener Abläufe; 2. Scheißef – Exkremente oder Kot; verdaute Ausscheidung oder fig. wie 1.
caimán zool. [kai:man] (-es) m; Substantiv, maskulin – Kaiman (Caimaninae) m – Gruppe der Alligatoren. Verbreitungsgebiet: Südamerika; eine Ausnahme bilden die Krokodilkaimane, die man auch in Mittelamerika findet.
caca del caimán vulg.zool. [’kaka del kai:man] (-es)f; Substantiv, feminin – Kaimankackef – 1. Kot eines bisweilen mächtigen Exemplars besagter Gruppe der Alligatoren; 2. Wundermittel, hergestellt aus der unter 1. beschriebenen Masse, wobei man zu allem Überfluss auch noch von einem Klugscheißer gesagt bekommt, dass das Quatsch sei, weil Kaimane nämlich ausschließlich in Süd- und nicht in Mittelamerika vorkämen; 3. der größte anzunehmende Mist, der einem im Gandoca-Manzanillo-Regenwald passieren kann.
WAS BISHER GESCHAH
Torsten Brettschneider ist Mitte dreißig und führte bis vor Kurzem ein durchschnittliches Leben in Frankfurt a.M. Sein Job befriedigte ihn genauso wenig wie seine kriselnde Beziehung, was er durch eine Ur-Mann-Therapie vergeblich in den Griff zu bekommen versuchte.
Als er völlig überraschend den Bauernhof seiner Großtante Lillemor im mittelschwedischen Kaff Gödseltorp erbt, beschließt er, sein Leben grundlegend zu ändern; Er kündigt seinen Job und zieht ins Land der Elche, um Schriftsteller zu werden.
Leider entwickelt sich seine Vision zum Albtraum. Die gute Nachricht: Alle Beteiligten überleben diese Elchscheiße irgendwie.
Die schlechte: Nur weil man nach all den Strapazen und nervenaufreibenden Erlebnissen gemeinsam Urlaub macht, muss das noch lange nicht heißen, dass der Irrsinn ein Ende hat – er bekommt nur in einem anderen Land ein anderes Gesicht.
Alles, was Torsten sich von einem Urlaub erhofft, sind Erholung, Entspannung und Ruhe. Ist das denn wirklich zu viel verlangt?
Scheint so …
ETT
Eine ziemlich fette, grünlich schimmernde Fliege klatschte gut hörbar gegen das einen Spaltbreit geöffnete Fenster. Wahrscheinlich hatte sie sich direkt von einem dicken Kuhfladen auf den Weg in meine Küche gemacht, in der festen Absicht, mir das Essen zu versauen. Das hatte sie jetzt davon.
Ich blickte nach draußen. Die Sonne schien fahl, und die Vögel hatten auch keine Lust zu zwitschern, ganz so, als würden sie dafür nur unterdurchschnittlich bezahlt werden und daher lediglich Trällern nach Vorschrift machen. Mürrisch strich der frühherbstliche Wind durch die Wipfel der Birken, deren Blätter sich bereits zu verfärben begannen. Es war nicht eben warm für Anfang Oktober. Nicht einmal für Schweden.
Gedankenverloren starrte ich den vor mir stehenden Kaffee an, als würde er mir weiterhelfen können. Der Notizblock neben meiner Tasse, auf dem ich Ideen für die weitere Handlung meines zweiten Romans sammelte, war nämlich leider genauso leer wie mein Kopf. Immerhin schien die Fliege draußen noch am Leben zu sein. Sie summte irgendetwas Unverständliches, wahrscheinlich Kaskaden schwedischer Schimpfwörter, bevor sie sich hochrappelte, um taumelnd davonzufliegen.
Ich seufzte. Selbstmitleid kann so herrlich sein, und als Schriftsteller konnte man sich das ja wohl mal erlauben.
Das Klingeln des Telefons riss mich aus meinen Gedanken. Mechanisch ging ich in den Flur und nahm ab, ohne auf die Nummer im Display zu achten, was ich schon im nächsten Augenblick bereute.
»Hallo, Herr Brettschneider. Schön, dass ich Sie erwische. Geht es Ihnen gut?«
Meine Agentin. Ich hatte mir eine gesucht, nachdem der FunnyTimes-Verlag aus München netterweise beschlossen hatte, mein Manuskript Elchscheiße zu veröffentlichen. Für einen Folgeroman wollte ich eine professionelle Unterstützung an meiner Seite wissen. Schließlich hatte ich vor, in erster Linie zu schreiben und nicht um Prozente zu feilschen oder ständig mit Lektorinnen essen zu gehen.
Frau Dr.Schmidt-Heinemann hatte die Angewohnheit, die Tonlage ihrer Stimme in ungeahnte Höhen zu schrauben, je dringlicher ihr das besprochene Thema erschien, bis sie wie ein schlecht gelaunter Zahnarztbohrer klang. Sie hätte nicht viele Bewerbungsgespräche absolvieren müssen, um eine Stelle als Top-Verhörspezialistin in einer gefürchteten Sondereinheit der Polizei angeboten zu bekommen, davon war ich schon länger überzeugt. Wer so summt, dem sagt man alles, dem macht man nichts vor. Sonst war sie mehr als nur umgänglich, eigentlich richtiggehend nett, aber ich wollte lieber nicht erfahren, auf welche Drehzahlen sie noch beschleunigen konnte, wenn man einen Abgabetermin nicht einhielt. Doch leider ging es genau darum, befürchtete ich, denn es wäre nicht unser erstes Telefonat in dieser Sache. Ich ging mit dem Hörer in der Hand in die Küche zurück und setzte mich.
»Gut so weit, danke der Nachfrage«, antwortete ich. Es erschien mir verdächtig, dass sie anrief, um sich nur nach meinem Wohlbefinden zu erkundigen – das war so gar nicht ihre Art.
»Das ist schön«, surrte sie. »Und bitter nötig, denn Sie wissen ja: Der zweite Roman ist bekanntlich der schwerste. Die Vorbestellungen für Elchscheiße sind zwar mehr als zufriedenstellend, das muss ich schon sagen, aber auf seinen Lorbeeren darf man sich als Autor niemals ausruhen. Deshalb brauchen wir spätestens im Januar das neue Manuskript fürs Lektorat und am besten schon einen Monat vorher eine Leseprobe.« Sie lief auf achthundert Touren, schätzte ich. Irgendetwas war im Busch.
»Jaja, schon klar! Mir ist bewusst, wie dringend es ist. Haben dem Verlag denn meine ersten hundertfünfzig Seiten vom Manuskript nicht gefallen?« Mit einem virtuellen Geschirrtuch tupfte ich mir kleine Schweißtropfen von der Stirn.
»Genau deswegen rufe ich Sie an. Nein.«
Ich erstarrte.
»Öööh, aber das war doch witzig und auch irgendwie abgedreht und skurril, so wie der erste …«
»Schön, dass er Ihnen gefällt, Herr Brettschneider. Ich hingegen hatte da ein wenig mehr erwartet.« Dreitausend Umdrehungen.
Zum Glück war in diesem Moment von draußen Motorengeräusch zu hören, der Kies knirschte, und Lindas dunkelblauer Volvo erschien in meinem Küchenfenster-Blickfeld. Sie hupte zweimal kurz, stellte den Motor ab und stieg aus.
»Ach, Frau Dr.Schmidt-Heinemann, wie ärgerlich! Entschuldigen Sie bitte vielmals. Der Klempner ist eben gekommen wegen der … defekten Wasserpumpe.« Ich schämte mich in Grund und Boden, aber da musste ich jetzt durch. »Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schwer es ist, hier in Schweden einen Klempnertermin zu erwischen. Das ist mein Glückstag.«
»Hören Sie, Herr Brettschneider«, fuhr meine Agentin ungerührt fort, »ich brauche ein neues Konzept und eine neue Geschichte von Ihnen. Die Story, die Sie da abgeliefert haben, richtet sich nach Einschätzung des Verlags nur an echte Fans«, kam es schneidend zurück. »Eine Wikingersekte in Lappland, die die Weltmacht übernehmen will? Was soll das denn für ein Schwachsinn sein?«
»Asen«, korrigierte ich sie, »eine Asensekte.«
Ich lauschte in den Hörer. Meine Agentin sagte nichts, aber ich bildete mir ein, sie summen zu hören. Leise. Gefährlich. Hochfrequent. Fünfundzwanzigtausend Touren – ein Zahnarztbohrer kurz vorm Lagerschaden.
»Ob Asen oder Wikinger ist mir wurscht!«, rief sie. »Geschichten über Typen mit gehörnten Helmen will keiner lesen.«
Ich überlegte eine Millisekunde lang, ob ich ihr erklären sollte, dass weder die Wikinger noch deren Gottheiten, die Asen, jemals Hörner an den Helmen getragen hatten und dass diese zugegebenermaßen pittoreske Vorstellung von den Nordmännern lediglich einer Romantisierung des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts entsprungen war. Aber angesichts ihrer hohen Drehzahl verzichtete ich darauf und sagte schlichtend: »Ich melde mich bei Ihnen, sobald ich Ihnen eine neue Leseprobe zuschicken kann. Wollen wir so verbleiben?«
Drehzahl: Dreißigtausend – ein Durchschnittskiefer wäre bereits zu einem matschigen Klumpen organischen Materials mutiert.
»Herr Brettschneider!«, schleuderte Frau Dr.Schmidt-Heinemann mir durch den Hörer entgegen. »Es gibt jede Menge aufstrebende Autoren, die nur darauf warten, einen Programmplatz in Ihrem Verlag zu ergattern, und ich muss auch mein Geld verdienen. Ich will bis Ende Januar eine neue Geschichte, und diesmal werde ich sie mir gut durchlesen, bevor ich sie in blindem Vertrauen an den Verlag weiterreiche, das können Sie mir glauben. Auf Wiederhören!«
»Auf Wiederhören, Frau Dr.Schmidt-Heinemann, und vielen Dank für Ihr …«
Doch sie hatte bereits aufgelegt.
Ich seufzte wieder. Jetzt hatte ich ein Problem.
Falsch.
Eigentlich waren es zwei.
Das zweite kam gerade zur Küchentür herein und stand einen Augenblick später bildhübsch und mit zwei ICA-Tüten im Raum: Linda. Sie stellte ihre Einkäufe vor mich auf den Tisch. Wie beiläufig blies sie sich eine Strähne aus dem Gesicht. »Ich habe alles bekommen, sogar ein tolles Stück Lachs«, sagte sie. »Wir können uns also nachher etwas richtig Schönes zu essen machen.« Sie strahlte dabei weitaus heller als der Herbsttag draußen.
Ich musste lächeln und gab ihr zwei zaghafte Begrüßungsküsse auf die Wangen, bevor ich ihr dabei half, die Sachen aus den Plastiktragetaschen zu räumen.
»Danke fürs Einkaufen«, entgegnete ich möglichst unbeschwert, aber der Versuch, meine innere Anspannung über das soeben geführte Telefonat mit Lockerheit zu überspielen, war vergeblich. Ich war einfach kein guter Darsteller.
»Ist doch selbstverständlich«, sagte Linda, während sie den frischen Fisch, der in einem ölgetränkten Aftonbladet eingeschlagen war, in den Kühlschrank legte. Dann drehte sie sich um und verschränkte die Arme. Sie schaute mich mit einem Blickcocktail an, den nur Frauen in einer solchen Situation mixen können: ein bisschen Überlegenheit, ein klein wenig Mitleid, eine Spur Forderung, ein Barlöffel Verständnis, Eiswürfel rein, rühren, abseihen. Dann mal Prost!
»Was ist denn los? Ich dachte, du freust dich genauso auf diesen Abend wie ich?«
»Nein … äh … ja … doch … natürlich … will sagen: Klar freue ich mich«, druckste ich überrumpelt herum und versuchte mich an einem unbefangenen Lächeln.
Lindas Blick wandelte sich. Stirnrunzelnd fragte sie: »Und? Weiter?«
»Ich meine, die Vorbestellungen für mein Buch sind prima, es könnte ein echter Verkaufserfolg werden«, führte ich aus, »und der Verlag ist mehr als zufrieden. Gerade eben hatte ich mit meiner Agentin ein Gespräch dazu. Aber genau das macht mir Angst, denn ich habe den Eindruck, dass meine Kreativität momentan im Urlaub ist.«
»Dir fällt nichts ein? Oder was meinst du?« Lindas Mundwinkel bewegten sich versöhnlich nach oben.
»Doch, doch, eingefallen ist mir schon etwas. Eine ganze Menge sogar«, antwortete ich. »Aber das, was ich bis jetzt abgeliefert habe, hat dem Verlag nicht gefallen und deshalb auch nicht meiner sensiblen und einfühlsamen Agentin. Irgendwie habe ich mir das leichter vorgestellt mit einem zweiten Roman. Jetzt soll ich bis Januar eine komplett neue Geschichte abliefern. Seit drei Wochen hocke ich Tag für Tag am Rechner und schreibe an meiner Geschichte, und nun soll das alles für die Autorenschublade gewesen sein? Wie soll ich in so kurzer Zeit etwas Neues und gleichzeitig Gescheites zustande bekommen? Ich glaube, ich kriege eine Schreibblockade!«
»Es sind noch gute dreieinhalb Monate bis zur Abgabe«, versuchte Linda mich zu beruhigen. »Bis dahin wird dir bestimmt etwas Grandioses einfallen, davon bin ich überzeugt. Hat doch schon mal geklappt.«
Ich war mir da nicht so sicher. Beim ersten Roman war es etwas anders gelaufen. Schließlich hatte ich ursprünglich einen Ratgeber für Männer in der Midlife-Crisis schreiben wollen, doch dann war mir diese Sache mit Gödseltorp dazwischengekommen, die mir eine Bombengeschichte geliefert hatte. Besser hätte es nicht laufen können. Eine Story mit irren Figuren, einer gewaltigen dramaturgischen Kurve und einem anständigen, biblischen Inferno. Konnte man sich so etwas überhaupt ausdenken? Konnte ich das? Schließlich hatte doch das Leben Regie geführt, nicht ich, der Autor – ich hatte es nur protokolliert, wie eine Art Schicksalstippse. Oder musste ich alles selbst erleben, um es zu Papier zu bringen? Wenn ja, war ein einsames Ferienhaus in der Nähe von Leksand der denkbar ungünstigste Ort dafür, denn hier passierte nicht viel – außer ich schrieb einen Roman über das Leben einer fetten Stubenfliege, die gegen verschiedene Küchenfenster klatschte und dann herummeckerte. Frau Dr.Schmidt-Heinemann wäre sicherlich entzückt!
Ich verwarf den Fliegenromangedanken und ließ mich auf meinen Platz vor den mittlerweile eiskalten Kaffee fallen.
»Wie bist du denn das letzte Mal auf die Geschichte gekommen?«, fragte Linda, als hätte sie meine Überlegungen mitverfolgt, während sie Dill- und Petersilienstängel kürzte und die Kräuter in ein mit Wasser gefülltes Glas stellte.
»Als ich mit Rainer auf dem Hof des Storegården stand, glaube ich …«
»Nein, das meine ich nicht«, unterbrach sie mich. »Ich meine nicht den Zeitpunkt, an dem du auf die Idee gekommen bist, nicht diesen Männerratgeber, sondern einen Roman zu schreiben, vielmehr mit welchem Ereignis die ganze Geschichte insgesamt begonnen hat. Den absoluten Anfang sozusagen.« Dabei wusch sich Linda die Hände und trocknete sich anschließend mit einem Handtuch ab, auf dem unzählige grinsende Elche zu sehen waren. Durch das Geknuddel, das Linda mit dem bedruckten Stoff zwangsläufig veranstaltete, verzerrten sich die Gesichter der geweihtragenden Tiere zu Fratzen, die mich zu verspotten schienen: »Na, doofer Autor! Dir fällt wohl nix ein, was? Muss dir erst wieder einer von uns in die Gummistiefel kacken! Elchscheiße, Elchscheiße! Hä, hä!«
Ich wich ihren hämischen Blicken aus. Selber doofe Elche!
Ich dachte nach und sagte schließlich: »Wenn ich es mir recht überlege, ging alles mit diesem Telefonat damals im Büro in Frankfurt los.«
Linda hängte das Handtuch zurück an den Haken. Die Elche baumelten wortlos und schlaff herab und sahen dadurch ein wenig ungesund aus. Das gönnte ich ihnen.
»Na, also!«, freute sich Linda. »Ein Anfang.«
»Was für ein Anfang? Soll ich vielleicht mit Block und Stift vorm Telefon sitzen und warten, bis irgendwer anruft, der eine gute Idee für meine neue Geschichte hat?«, fragte ich verwirrt.
Linda zuckte die Achseln, faltete die Einkaufstüten ordentlich zusammen und legte sie neben die Spüle. Dann sagte sie: »Nein, natürlich sollst du nicht in der Küche sitzen und tatenlos den Hörer anstarren. Ich meine nur, du müsstest vielleicht mal etwas länger das Haus verlassen. Das Leben findet draußen statt und nicht hier drin. Du brauchst neue Ideen, und wenn die nicht zu dir kommen, was so zu sein scheint, dann musst du eben zu ihnen. Ist doch klar, oder?«
So unrecht hatte sie damit nicht, das musste ich zugeben.
Da läutete schon wieder das Telefon. In Anbetracht dessen, dass es in der ganzen letzten Woche – außer dem Gespräch mit Frau Dr.Schmidt-Heinemann von eben – nur ein einziges Mal geklingelt hatte, war das heute der reinste Callcenter-Ansturm. Dazu kam, dass der andere Anruf nicht einmal für mich gewesen war. Ein Bauer hatte mich angemotzt, und ich konnte ihn nur mit Mühe davon überzeugen, dass ich weder einen schlechten Service bot noch hinter seinem Geld her war. Der Grund dafür, dass ich seinen Traktor noch nicht repariert hatte, war schlicht derjenige, dass ich prinzipiell keine Traktoren reparierte.
Diesmal schaute ich sicherheitshalber aufs Display, bevor ich abnahm. Es war eine ellenlange Nummer, aber immerhin nicht die von Frau Dr.Schmidt-Heinemann.
Deshalb ging ich dran.
TVÅ
Die Verbindung war grottenschlecht. Es knackste, und ab und zu hatte ich den Eindruck, im Hintergrund eine ganze Horde wild plappernder Spanier zu hören, die sich redlich bemühten, das Gespräch noch schwieriger zu gestalten. Wieso eigentlich Spanier? Und wo kamen die her?
»Brettschneider?«, fragte ich in den Telefonhörer hinein und hörte meinen Namen als fernes, zeitverzögertes Echo. »Hallo? Wer ist denn da?«
»Brettschneider!«
»Brettschneider?«
»Ja, hier auch, du Tölpel.«
»Papa?«
»Stell dich doch nicht noch blöder, als du ohnehin schon bist!«, kam es durch den Äther zurück. Das war mein Vater Gerd. Unverkennbar. Renate fiel ihm ins Wort. Ich konnte nicht verstehen, was sie sagte, ahnte es aber, denn seine an sie gewandte Antwort war: »Wieso? Ich bin nicht unwirsch und schon gar nicht wie immer! Was kann ich dafür, wenn mein Sohn etwas länger braucht, um selbst einfachste Sachen zu verstehen? Außerdem ist es hier zehn Uhr morgens, und ich habe nicht mal gefrühstückt.«
»Danke, Papa, mir geht es gut, und nein, du bist absolut nicht unwirsch«, sagte ich. »Ganz im Gegenteil, du bist so liebenswert wie sonst auch.«
»Na, also. Auch Torsten findet, dass du wieder mal maßlos übertreibst!«, rief mein Vater in Richtung Renate und brachte sie damit anscheinend zum Schweigen.
»Läuft’s gut bei euch?«, wollte ich grinsend wissen.
»Klappe! Das frage ich dich. Kommst du voran?«
»Nicht so«, antwortete ich wahrheitsgemäß. Hatte er heimlich Kontakt mit meiner Agentin und sich mir ihr gegen mich verschworen?
»Schreibblockade, was?«, stichelte er.
»Sehr witzig.«
»Das trifft sich gut.«
»Was soll daran gut sein?«, fragte ich ihn leicht empört.
»Na ja, damit gibt es zwei Möglichkeiten.«
»Wofür?« Mein Vater sprach in Rätseln.
»Siehst du, genau das meine ich. Du brauchst immer etwas länger …«
»Papa!«
»Ja, ja, schon gut. Ich meine, es gibt in dieser Situation genau zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins: Ich schicke dir ein Päckchen Taschentücher.«
»Wieso das denn?«
»Dann kannst du in deinem Selbstmitleid verharren und dir ab und zu die Tränen abwischen. Oder aber …« Mein Vater legte eine Kunstpause ein.
»Oder aber was?«
»Oder Möglichkeit Nummer zwei: Komm her!«
»Wie, komm her?«
Ich hörte ein verächtliches Schnaufen am Ende der knacksenden Leitung und aufgrund der schlechten Verbindung wieder die ätherischen Spanier im Hintergrund, die lauthals lachten. Machten die sich auch über mich lustig? Belauschten die uns? Und wenn ja, woher konnten die überhaupt Deutsch sprechen?
»Mann, Torsten, hierher nach Costa Rica, meine ich«, erklärte mein alter Herr. »Es ist wirklich nett. Sonne, Meer und so weiter. Der Clubchef ist zwar etwas komisch, und kochen können die genauso wenig wie die Schweden, aber zumindest ist das Obst frischer, und es gibt keinen verrotteten Fisch in Dosen.«
»Würde ich ja gern, aber ich kann hier nicht weg. Ich muss in etwas mehr als drei Monaten mein zweites Manuskript abliefern.«
»Und, kommst du voran?«
Ich stöhnte.
»Ich habe dir doch eben erklärt, dass ich …«
»Siehste? Schon wieder!« Mein Vater lachte lauthals über meine Begriffsstutzigkeit und fuhr dann fort: »Genau das meine ich ja. Nimm dir mal ein Beispiel an Bjørn, dem alten Norweger. Der ist mehr als doppelt so alt wie du, aber immer noch auf Zack. Im Gegensatz zu dir. Junge, was du brauchst, ist ein Tapetenwechsel, etwas anderes sehen und vielleicht etwas Entspannung. Ihr Künstler seid doch so, oder? Und ob du nun in deiner Küche hockst oder in der Karibik am Strand, wo ist der Unterschied, abgesehen von fünfundzwanzig Grad mehr und einer Schicht Sonnenöl?«
»So etwas Ähnliches hat Linda vorhin auch gesagt«, gestand ich.
»Linda? Ist sie bei dir? Schnapp sie dir! Eine Klassefrau.«
»Stimmt.«
»Die will aber sicher auch lieber einen Freund, der weiß, was zu tun ist, und der sein Leben im Griff hat, als einen Jammerlappen.«
»Danke für das Kompliment und deine aufbauenden Worte. Ganz abgesehen davon: So weit sind wir noch lange nicht«, widersprach ich, auch wenn ich meinem Vater lieber eine andere Wahrheit erzählt hätte.
»So wird das auch nichts mit euch.«
»Das ist alles nicht so unkompliziert. Aber wir unternehmen viel. Heute kochen wir zum Beispiel zusammen …«
»Kochen? Super! Wie aufregend. Wart ihr schon zusammen im Bett?«
»Papa!«, rief ich entrüstet.
»Renate und ich zum Beispiel haben uns erst zwei Tage gekannt, da haben wir in der Küche nicht gekocht, sondern auf der Arbeitsplatte neben dem Herd richtig ordentlich …«
»Ja, ist gut!«, schnitt ich ihm das Wort ab. Mir stand nicht der Sinn nach Details. Seitdem mein Vater mit der gut eine halbe Generation jüngeren Renate zusammen war, glaubte er, sein zweiter Lenz sei ausgebrochen und er sei der strammste Deckhengst im Frührentnerstall. Und leider ließ er keine noch so unpassende Gelegenheit aus, diese Tatsache auch seiner Umwelt kundzutun.
»Jetzt mal echt, Torsten, ich wollte dich nur ärgern …«
»Hat geklappt. Danke.«
»Doch Taschentücher?«
Ich verdrehte die Augen.
»Außerdem ist es, glaube ich, gar nicht schlecht für Rainer, wenn du mal vorbeischaust«, fuhr mein Vater fort. In seiner Stimme schwang etwas Befremdliches mit, das ich von ihm gar nicht kannte.
»Rainer? Wieso? Was ist denn mit dem los?«, wollte ich wissen. »Ist er krank?«
»Gewissermaßen schon, aber du kennst ihn ja, das ist nicht mehr heilbar. Doch das meine ich nicht. Er hat sich die letzten drei Wochen über etwas eigenartig benommen.«
»Eigenartig?«
»Noch eigenartiger als sonst«, präzisierte mein Vater.
»Wie meinst du das?«
»Am Anfang des Urlaubs und während unserer gesamten Rundreise hat er nur Unfug gefaselt und das eine oder andere Fiasko angerichtet, zum Beispiel als er versucht hat, zu surfen, und ihn die Küstenwache retten musste. Also im Prinzip wie immer. Aber seitdem wir hier angekommen sind, hat er sich äußerlich und politisch von der Umgebung etwas sehr … wie soll ich sagen … beeinflussen lassen.«
Ich schüttelte den Kopf. Rainer studierte mittlerweile im elften Semester Sozialpädagogik und trug ständig einen ausgeleierten Bundeswehrparka. Er war liebenswert, aber vollkommen lebensfern. Ich sah ihn vor mir, wie er grinste, seine Brille mit den extrem dicken Gläsern nach oben schob und sagte: »Oberstkrass, ne?« Ging es noch eigenartiger?
»Mal ernsthaft, Papa. Kannst du mir das ein ganz klein wenig genauer erklären? Jetzt mache ich mir schon Gedanken, denn wo Rainer auftaucht, da kann es ja schnell …«, ich suchte nach einem passenden Begriff, der das chaotische Inferno der jüngsten Vergangenheit beschrieb, dessen Mitverursacher Rainer gewesen war, »… etwas ereignisreich werden.« Das war nur maßlos untertrieben, aber nicht falsch.
»Ich denke, du schaust dir das lieber selbst an. Noch ist ja nichts passiert, aber ich fürchte, er liest die falschen Bücher und sieht überall Ausgebeutete und Unterdrückte. Ihm schwebt da eher so eine oberstkrass zwanglose Gesellschaftsform und die naturmäßige Ordnung der Individuen und so vor, ne.« Er imitierte Rainer mittlerweile relativ überzeugend, was nach der wochenlangen gemeinsamen Zeit auch nicht verwunderte. »Jedenfalls«, fuhr mein Vater in seiner eigenen Stimmlage fort, »hat der einen immer größer werdenden Knall.«
»Du magst ihn sehr, nicht wahr?«
»Red doch nicht so einen Stuss!«, kam es aus dem Telefonhörer geschossen. »Ich will nur nicht schuld sein, wenn dieser verweichlichte Öko-Drogen-Fuzzi Probleme bekommt, das ist alles.«
»Aha«, gab ich zurück und dachte mir meinen Teil, denn mein Vater neigte nicht nur zu leichten Übertreibungen, sondern litt auch an einer gewissen Unfähigkeit, Gefühle auszudrücken. »Ihr kriegt das schon ohne mich hin«, erklärte ich.
»Außerdem glaube ich, etwas Ruhe und Entspannung würden dem Herrn Schriftsteller ganz guttun, oder nicht?«
Das mochte stimmen, aber ob ich in der Gesellschaft von Rainer, meinem Vater, Renate und Bjørn besonders viel Entspannung abbekommen würde, bezweifelte ich stark.
»Tut mir leid, aber ich kann nicht kommen«, sagte ich daher. »Ich denke, da müsst ihr alleine durch. Ich muss wirklich mein Buch fertig schreiben. Danke für deinen Anruf, und grüß mir die anderen. Ich melde mich die Tage mal wieder.«
»Du musst es ja wissen«, entgegnete mein Vater. »Tschüss!«
TRE
»Aber das ist doch eine tolle Idee von deinem Vater«, meinte Linda nach unserem Essen, während sie Spülmittel in die benutzte Fischpfanne spritzte. »So hättest du ein Auge auf Rainer, und du könntest endlich richtig ausspannen, und zwar in anderer Umgebung. Danach fliegen dir die Ideen für dein neues Manuskript bestimmt nur so zu. Und außerdem …« Sie zögerte und machte ein paar kreisende Bewegungen mit der Geschirrbürste, die weniger an einen Abwasch als an das konzentrierte Betätigen einer tibetanischen Gebetsmühle erinnerten. Endlich drehte sie sich um, sah mir entschlossen in die Augen und vollendete ihren Satz: »… Torsten, das geht nicht mit uns.«
Batsch! Ohrfeige.
Irgendwie war mir das Frauenglück nicht hold. Erst eine ständig unzufriedene Freundin, die mich mit meinem eigenen Therapeuten betrogen hatte, einem Hochstapler, wie sich bald herausstellte, was sie aber nicht davon abgehalten hatte, mit ihm nach Frankreich durchzubrennen.
Und jetzt das.
»Es ist Olle, oder?«, fragte ich etwas gereizt, denn ich kannte die Antwort.
»Ach, Torsten, ich sage dir das nicht, weil ich dich nicht mag, im Gegenteil! Aber das mit Olle hast du doch gewusst.«
»Na, ja, ich weiß, dass ihr mal eine Zeit lang zusammen gewesen seid …«
»Vier Jahre«, korrigierte sie mich. »Das ist mehr als nur eine Zeit lang.«
»Und ich wusste, dass es Olle noch gibt, aber nicht, dass es so ernst ist.«
Linda senkte den Blick.
»Trefft ihr euch?«, hakte ich nach.
»Nein, aber er hat mich letzte Woche angerufen«, erklärte sie. »Vielleicht fahre ich ihn mal besuchen.«
»Er meldet sich nach Monaten einmal bei dir, und schon stehst du Gewehr bei Fuß?«
»Natürlich nicht!«, wehrte sich Linda vehement.
»Sieht aber ein klein wenig danach aus«, sagte ich und nippte lässig an meinem Weinglas, bevor ich bemerkte, dass es leer war. Ich schenkte mir nach und trank.
»Nein, so ist es nicht. Wir haben zwischendurch schon ein paar Mal gemailt. Er hat sich verändert, ist sensibler geworden. Olle ist … er ist …«
»Er ist eine Arschgeige«, vollendete ich den Satz. »Er hat dich sitzen lassen und ist nach Lappland gezogen, und du warst ihm dabei vollkommen egal.«
»Das war wegen seines Kulturprojektes«, versuchte Linda ihn zu verteidigen.
»Und das ist jetzt vorbei, und nun kann er dich wieder brauchen, oder was?«
»Nein, das Projekt scheint gut zu laufen.« Linda sah mich an. »Er schlug vor, dass ich daran mitarbeiten kann. Ich soll einfach zu ihm kommen, wenn es mir zeitlich passt.«
»Nach Lappland?«, entfuhr es mir. »Und was ist mit deinem Job und deiner Wohnung?«
»Es ist ja nicht für ewig, nur ein paar Monate, bis sein Kulturprojekt abgeschlossen ist, sagt er, dann komme ich ja wieder hierher zurück«, behauptete sie und fügte leise hinzu: »Torsten, ich mag dich wirklich gern, sehr gern sogar, aber ich bin total verunsichert. Vielleicht sollte ich es mit Olle noch einmal versuchen, sonst würde ich mich immer fragen, ob ich zu früh aufgegeben habe. Ich glaube, es ist besser, wenn wir beide etwas Abstand halten.«
Spätestens in diesem Augenblick beschloss ich, nie, nie, nie wieder zu versuchen, Frauen zu verstehen.
Olle Olofsson war ein pfeifenrauchender Typ, der bei jeder Gelegenheit ein blödes Tuch mit Retromuster trug oder einen Seidenschal, den er sich kulturbetriebsaffin um den Hals schlang, um zu unterstreichen, dass er dazugehörte. Seht her, schien er allen vermitteln zu wollen, ich bin kein Mechaniker, kein Gärtner, kein simpler Angestellter – oh nein, ich mache was mit Kultur!
Ich hatte nur einmal ein Foto von ihm gesehen, als ich Linda unlängst zum Kaffeetrinken besucht hatte. Auf dem Sideboard neben dem Bilderrahmen standen Seidenblumen (wahrscheinlich aus seinen abgetragenen Kulturschals von ihm selbst gefertigt) – hätte mich das schon stutzig machen müssen? Olle jedenfalls hatte grau melierte Haare, die er sich mit Gel an den Kopf klatschte, um den Rest zu einem Pferdeschwanz zu binden. Außerdem trug er eine schwarze Intellektuellenbrille mit Horngestell, aber wahrscheinlich mit Fensterglas, weil er in Wirklichkeit gar keine Brille brauchte. Doch zusammen mit dem Halstuch wirkte das eben wesentlich kultureller.
Während ich über ihn nachdachte, beschlich mich irgendwie die Ahnung eines Gefühls, dass ich Olle möglicherweise nicht sonderlich leiden konnte. Schließlich sagte ich: »Dann ist es vielleicht wirklich besser, wenn wir uns erst mal nicht mehr sehen.« Ich gab mir die allergrößte Mühe, wahnsinnig locker und souverän rüberzukommen, auch wenn ich mir innerlich vor Verzweiflung die ganze Faust in den Mund steckte und wie wild darauf herumkaute. »Ich hoffe, dass du glücklich wirst.«
Wortlos und betreten erhoben wir uns. Ich half Linda in ihren Mantel und begleitete sie noch bis zur Tür, wo wir uns einen Augenblick zu lang anschauten.
»Schlaf gut, Torsten.«
»Du auch.«
Ich sah zu, wie sie ihren Volvo in der Einfahrt wendete und schließlich langsam davonfuhr. Der kalte Wind trieb leichten Nieselregen durch die Nacht, dennoch wartete ich, bis die Rücklichter von Lindas Auto in der Dunkelheit verschwunden waren. Dann erst schloss ich die Tür, ging in die Küche, schenkte mir Rotwein nach und setzte mich vor meinen Rechner.
Frauen sind die Meister der Sehnsucht.
Aber ich wusste, dass man Probleme systematisch abarbeiten muss. Ich stellte eine geistige Aufgabenliste auf: 1. Rasch und elegant einen ganz üblen Korb verdauen. 2. Träume komplett überarbeiten. 3. Küche aufräumen. 4. Bombenmanuskript schreiben. Eigentlich ganz einfach.
Ich nahm einen kräftigen Schluck vom fruchtigen Cabernet und dachte nach. Schließlich öffnete ich den Webbrowser, gab www.clubmuchogusto.cr ein und drückte die Enter-Taste.
FYRA
»So machen wir es.« Ich wiederholte noch mal die Abflugzeiten der Verbindung, die mich von Göteborg über Frankfurt nach San José bringen würde. »Soll ich mir die Unterlagen abholen?«, erkundigte ich mich bei der sympathischen Frau Lindström, die im Reisebüro von Leksand arbeitete.
»Nein, ich brauche bestimmt noch ein, zwei Stunden dafür. Ich wohne nicht weit entfernt von Ihnen, nur knapp zwanzig Kilometer. Es liegt quasi auf meinem Nachhauseweg. Ich werfe Ihnen die Sachen heute Abend ein. Dann bekommen Sie auch gleich die Vouchers für den Club.«
Als Deutscher aus dem Rhein-Main-Gebiet würde ich mich wohl nie daran gewöhnen, welche Distanzen man in Schweden als »nicht weit« bezeichnete, aber das kam mir natürlich entgegen. Dann konnte ich schon mal anfangen, Koffer zu packen, und vor allem musste ich mir vor der Abreise im ebenfalls nicht weit entfernten Einkaufszentrum Badesachen zulegen. Ich hatte mir aus Deutschland seinerzeit keine mitgenommen, was in Anbetracht meines aktuellen Wohnortes auch nicht sonderlich verwunderte.
»Das ist aber nett von Ihnen. Vielen Dank! Meine Kreditkartendaten für die Buchungen haben Sie ja.«
»Habe ich, Herr Brettschneider. Alles in Ordnung, und nichts zu danken. Das mit dem Apartmenthäuschen hatte ich Ihnen aber erzählt, oder?«
»Nö. Was gibt es denn?«
»Hoppla, dann habe ich das wohl verschwitzt. Die gute Nachricht ist, dass Sie zwanzig Prozent Rabatt bekommen. Klasse, oder?«
»Das ist ja dufte! Aber wo ist der Haken?«
Bei Rabatten über der Höhe eines ordinären Barzahlungsskontos gab es meiner Erfahrung nach immer einen Haken.
»Na, ja«, druckste Frau Lindström herum, »der Club ist vollkommen ausgebucht, und es ist in diesem Zeitraum nur noch ein Hüttchen frei, das sich jedoch ein ganz klein wenig außerhalb des clubüblichen Niveaus befindet.«
»Das heißt?«
»Es ist noch nicht ganz fertig renoviert.«
»Ich soll meinen gesamten Urlaub in einem unsanierten Rohbau verbringen? Wissen Sie, ich möchte mich während meines Aufenthalts wirklich entspannen und …«
»Nein, nein«, fiel mir Frau Lindström lachend ins Wort, wobei ich allerdings zu bemerken glaubte, dass ihr Lachen nicht ganz echt war. »Dem steht gar nichts im Wege. Wirklich. Alles bestens, hat mir der Clubchef persönlich versichert. Außer das mit der Toilette.«
»Was ist damit?«
»Es gibt keine.«
»Wie bitte? Und wo soll ich hingehen? In den Dschungel vielleicht?« Ich sah mich schon umgeben von farbenfrohen Pfeilgiftfröschen und beißwütigen Kriechtieren im feuchten Unterholz des costa-ricanischen Sekundärwaldes hocken.
»Nein, um Gottes willen!«, widersprach sie mindestens genauso vehement wie künstlich erheitert. »Der Hotelmanager Mister Silberman, ein sehr eloquenter Typ übrigens, hat mir persönlich versichert, dass es neben dem Apartment eine Sanitäreinheit gibt, die jedem Anspruch genügt.«
»Eine Sanitäreinheit?«, platzte es aus mir heraus. »Ein Dixi-Klo?«
»Ein was?« Ob es in Schweden keine Dixi-Klos gab?
»So ein Aufstellklo für Bauarbeiter«, erklärte ich.
»Ach so. Das kann ich Ihnen natürlich nicht sagen, aber ich bin mir sicher, dass sich Mister Silberman etwas Angemessenes hat einfallen lassen.«
Davon war ich ebenfalls überzeugt. Vielleicht ein selbst gemaltes Holzschild mit der Aufschrift »Torstens Klo«, das direkt in den Dschungel wies. Augenblicklich wurde mir klar, weshalb die Gute mir alles persönlich nach Hause bringen wollte. Das war eine Art präventive Wiedergutmachung.
»Habe ich eine Wahl?«, fragte ich.
»Nun, es ist wirklich die allerletzte Unterkunft …«
»Also nein. Okay, dann ist das eben so.«
»Wie schön!« Sie hörte sich erleichtert an. »Dann bleibt mir nur, Ihnen eine angenehme Reise und einen erholsamen Aufenthalt zu wünschen.«
Ich beendete das Telefonat und sah auf die Uhr. Vier. Ich rechnete zurück. Sechzehn minus acht macht acht. Zu früh für meinen Vater im Urlaub, aber hoffentlich spät genug für die Rezeption. Ich klingelte im Mucho Gusto durch, dem nunmehr gebuchten Club an der Karibikseite Costa Ricas. Er lag in der Nähe eines Ortes namens Santa Dolores im Landesteil Limón. Und ich hatte Glück. Eine des Englischen mehr oder weniger mächtige Dame nahm meine Nachricht entgegen und versprach, sie meinem Vater zukommen zu lassen. Das sei gar kein Problem. Ich gab ihr meine Reisedaten durch und ließ mir bei dieser Gelegenheit gleich mein Zimmer bestätigen, sicher war sicher.
Das Onlinesystem schien sogar in den Tropen gut zu funktionieren, denn sie hatte meine Buchung bereits vorliegen. Außerdem erfuhr ich, dass mich am Flughafen in San José ein Hotelshuttle nebst Fahrer abholen werde. Der Transportservice sei selbstredend inbegriffen. Da die Reisedauer inklusive Warte- und Flugzeiten etwa zwanzig Stunden betrug und der Urlaub trotz Rabattierung alles andere als günstig gewesen war, empfand ich das als angemessen, bedankte mich aber trotzdem und wünschte ihr einen guten Tag.
Danach rief ich bei Linda an. Mit einem komischen Kloß im Hals. Aber ich musste ihre Stimme unbedingt noch mal hören.
»Ich habe den Flug nach Costa Rica gebucht.«
»Gut! Du wirst sehen, dass es dich weiterbringt, wenn du etwas ausspannst. Und vielleicht auch unser Verhältnis«, fügte sie halblaut an.
Ich überhörte das geflissentlich, denn ich hatte keine Lust, über etwas zu sprechen, das nach dem Gespräch genauso unlösbar sein würde wie vorher.
»Ich wollte mich nur verabschieden.«
»Das ist nett von dir. Wann geht dein Flug?«
»Dienstag.«
»Komm mir gesund zurück und …«
Linda zögerte.
»Was?«, wollte ich wissen.
»Ach, nichts. Eine schöne Zeit, und grüß mir die anderen. Wenn du Lust hast, kannst du mir ja eine Karte schreiben. Mach’s gut.«
Sie legte auf.
Prima! Das Gespräch war so locker und luftig verlaufen wie drei Tage alter Tapetenkleister. Ich überlegte, ob ich in dieser Situation seufzen durfte, und kam zu dem Schluss: Wenn nicht jetzt, wann dann? Also gab ich einen hingebungsvollen Seufzer von mir.
Dann fuhr ich los, um mir zwei Badehosen zu kaufen. Das hatte jetzt oberste Priorität, denn sonst lief ich Gefahr, am Ende in den Tropen ganz ohne dazustehen. Kurz hatte ich überlegt, dass es doch am Flughafen auch welche geben müsse, hatte aber beschlossen, mich lieber im hiesigen und für seine Produktvielfalt berühmten Mega-Einkaufszentrum danach umzusehen; Badehosen an Flughäfen waren in der Regel überteuert und hatten furchtbare Muster.
Gegen den ungebetenen, aber dafür umso massiver vorgetragenen Ratschluss meines Vaters besaß ich noch immer meinen alten VW-Bus, den ich Lasse getauft hatte. Er hatte zwar bereits ein paar Jahre auf dem Buckel, Lackierung und Interieur waren inzwischen recht mitgenommen, und dass mir seine technischen Raffinessen immer und zu jeder Zeit treue Dienste geleistet hätten, konnte ich nun wirklich nicht behaupten. Aber er hatte mich – zumindest was die Basisfunktion »Bring mich von A nach B« anging – noch nie im Stich gelassen. Gut, der Fensterheber der Fahrertür war schon nach wenigen Kilometern verreckt, die Batterie war kaputt gewesen, er hatte einige Einschusslöcher in die Windschutzscheibe abbekommen, und der Spritverbrauch war relativ üppig. Das mit den Löchern war allerdings nicht die Schuld meines Busses gewesen. Die hatte unter anderem Bjørn mit seinem Weltkriegskarabiner da hineingeballert, als wir uns noch in einer eher frühen Kennenlernphase befunden hatten.
Und was Lasses Benzindurst betraf, hatte ich meinem Vater gegenüber gekontert: »Wenn du mal nicht mehr so gut kannst und etwas zu viel säufst, dann stecke ich dich ja auch nicht gleich ins Altenheim.« Daraufhin war er tatsächlich kurz nachdenklich geworden und argumentierte fortan nicht mehr gegen mein Vehikel, sondern stichelte nur noch, wenn ihm danach war.
Kurz und gut: Mein Auto hatte Charakter und trug deshalb auch einen Namen. Auf eine seltsame, fast magische Art passte der Name Lasse zu ihm. Und der Wagen zu mir.
Nach etwa einer halben Stunde Fahrt bogen Lasse und ich auf den weitläufigen Parkplatz eines Einkaufszentrums unweit von Leksand ein. Hier gab es alles, wenigstens wenn man den unzähligen Werbewänden von der Größe einer durchschnittlichen Einzimmerwohnung Glauben schenken wollte, die den Besucher des Konsumtempels mit ihren Botschaften fast erschlugen. Es wurden Dinge angepriesen, die ich kannte und von Zeit zu Zeit auch benötigte, wie etwa Toilettenpapier, das, wie ich durch die Werbung erfuhr, nun noch eine Lage mehr pro Blatt hatte, mehr Blätter sowieso und außerdem viel billiger und besser war als sein Vorgänger, quasi Klopapier zwei Punkt null.
Es wurden auch Dinge angepriesen, die ich zwar ebenfalls kannte, aber dafür mit Sicherheit niemals brauchen würde, wie zum Beispiel das 48-teilige Kaffeeservice namens Jakt & Nöje – »Jagd & Vergnügen« – mit aufgedruckten Elchköpfen über gekreuzten Flinten und Jagdhörnern. Mein Bedarf an diesen Tieren war nach den jüngst zurückliegenden Erlebnissen in Gödseltorp mehr als gedeckt, obwohl diese in der Regel gutmütigen Geschöpfe nichts dafür konnten. Außerdem hatte ich den blöd grinsenden Artgenossen des Kaffeeservices, die auf meinem Küchenhandtuch lebten, noch nicht verziehen, dass sie mich gestern wegen meiner Schreibblockade verspottet hatten. Ich beschloss, sie zur Strafe in die Garage zu verbannen und zu einer Tätigkeit als Öllappen zu verurteilen, sobald ich wieder daheim wäre.
Dann wurden noch Dinge beworben, von denen ich mir durchaus vorstellen konnte, sie irgendwann mal brauchen zu können, auch wenn ich bis jetzt noch nie Bedarf gehabt hatte. Dazu zählte mit Sicherheit der stark rabattierte Schneidbrenner Hellburner, welcher angeblich selbst zehn Millimeter dicken Stahl wie Butter zu durchtrennen vermochte. Mir fiel zwar ad hoc keine Anwendungsmöglichkeit ein, aber so etwas im Haus zu haben schadete ganz bestimmt nicht. Vielleicht würde mich mal jemand mit einem Panzerfahrzeug besuchen kommen, bei dem die Hecktür klemmte?
Ob es hier auch Badehosen gab?
Ich platzierte Lasse zwischen einem Volvo und dem Unterstand für die Einkaufswagen, stieg aus und überquerte den Parkplatz. Über dem Eingang des Einkaufszentrums prangte eine bunte Auflistung der einzelnen Geschäfte. Gleich sprang mir der vielversprechende Name Sports Paradise ins Auge. Im Eingangsbereich des Ladens schickte mich eine für meinen Geschmack etwas zu verhungert aussehende Blondine auf meine Nachfrage hin in den Keller zur Abteilung Water, Holiday & Fun. Sie sei sich zwar auch nicht sicher, ob es noch Badehosen gebe, sagte sie, aber wenn überhaupt, dann da. Ich bedankte mich und bahnte mir einen Weg durch Ständer und Regale mit Pudelmützen, Thermounterwäsche und den neuesten Skimodellen zur Rolltreppe, die mich ins Untergeschoss beförderte.
Kaum war ich unten angekommen, schoss ein junger Kerl von etwa Mitte zwanzig dynamisch auf mich zu.
»Hej«, grüßte er. »Alles klar? Wie kann ich dir helfen? Was suchst du? Boards oder Iceskating-Equipment?« Seine Augen funkelten umsatzlustig. Sein Mund kaute unflätig Kaugummi.
Wieso redete der mit mir, als wären wir schon mal zusammen betrunken die Treppe runtergefallen? Ich überlegte kurz, ob ich nicht einfach behaupten sollte: »Gern von jedem etwas und dazu zwei passende Badehosen«, damit dieser selbstgefällige Typ die ganzen Sachen erst mal anschleppen musste, um ihm anschließend zu eröffnen, dass ich nur die Badehosen wollte, doch das war nicht meine Art.
Also sagte ich nur: »Hej! Und: No thanx! Ich searche nur simple Badetrousers.«
Sein verwirrter Blick entlohnte mich. »Was …?«
»Badehosen«, übersetzte ich. »Ich möchte Badehosen. Zwei Stück.«
»Ach so.« Das Umsatzfunkeln war aus seinen Augen verschwunden. »Was genau?«
»Äh, Badehosen«, entgegnete ich überfordert.
»Slip, Pants, Shorts, Long, Surf, Beach?« Mein ratloses Gesicht veranlasste ihn, die Produktvielfalt und die Einsatzmöglichkeiten viertel- bis halblanger Freizeitbeinkleider etwas vereinfachter zu gruppieren: »Ich meine mehr so Sports and Activity oder mehr so Beach and Fun?«
Kurz fragte ich mich, ob in diesen Optionen ein Widerspruch verborgen war. Konnte man nicht auch am Strand sportlich sein und Spaß haben, oder durfte man, wenn man sportlich oder lustig war, erst gar nicht dahin? Anders gefragt: Musste man zwangsläufig unsportlich aussehen und traurig sein, wenn man an den Strand ging?
»Ich dachte mehr so einfach an Bade & Hose. Aber vielleicht mache ich am Strand auch mal lustigen Sport. Beach-Volleyball oder so«, wandte ich ein. »Ausschließen kann ich das nicht.«
»Aber du hast nicht vor, einen Triathlon zu absolvieren, oder?« Er betrachtete mich von Kopf bis Fuß, dann sagte er: »Nee, hast du nicht.«
Subtil vorgebrachte Komplimente gehen am tiefsten unter die Haut.
»Dann wird es eher knapp mit der Auswahl. Wir haben eigentlich nur echte Sportswear, also figurbetonte Hosen, die eng am Körper anliegen«, fuhr er mit seinen Demütigungen fort. »Aber Moment mal. Ich meine, wir haben noch ein paar Leisure-Modelle von der Sommerkollektion da. Ich bin gleich zurück. Die fallen extreme leisure aus. GrößeL dürfte gerade noch passen.«
Er wartete meine Reaktion gar nicht erst ab, sondern verschwand zwischen den Auslagen. Ich sah an mir herab. Was konnte diesen Schnösel dazu veranlasst haben, zu denken, ich würde nicht für einen Triathlon trainieren? Könnte doch gut möglich sein. Ich wusste keine Antwort darauf.
Einige Minuten später kam er mit zwei eingeschweißten Artikeln zurück, öffnete die Verpackungen und legte zwei Badehosen vor mich auf den Tisch.
»Mehr haben wir im Moment leider nicht mehr im Leisure-Bereich«, entschuldigte er sich. Er hatte allen Grund dazu. Vor mir lagen zwei halblange, weit geschnittene Badehosen. Die Qualität schien mir in Ordnung zu sein, aber das Muster …
»Meinst du das ernst? Habt ihr wirklich nichts anderes mehr im Sortiment?«
»Nein, das sind die allerletzten.«
Da hatte er recht. Diese Hosen waren das Allerletzte. Konnte ich dieses Muster riskieren?
»Ich mache dir ein Extra-Super-Mega-Sale-Pricing«, warb er um mich.