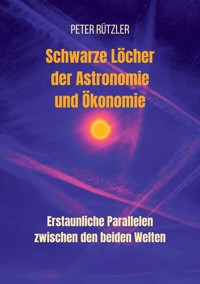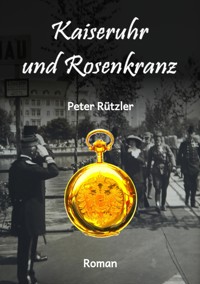
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ich sitze beim Zeitungslesen und denke, die ganze Welt geht den Bach runter. Dabei haben meine Grosseltern ein viel bewegteres Leben in sehr turbulenten Zeiten geführt. Sie hungerten im Ersten Weltkrieg, verloren ihre Existenzen während Hyperinflation und Weltwirtschaftskrise, kämpften im Ostfeldzug und gingen als Nazi ins Gefängnis. Auch persönliche Schicksalsschläge blieben ihnen nicht erspart: Todesfälle, Abtreibungen, uneheliche Kinder, schwere Krankheiten und eine Überschwemmung, bei der ihr Unternehmen buchstäblich den Bach runterging. Trotzdem haben sie allen Widrigkeiten getrotzt und sind immer wieder aufgestanden. Ich habe sie als glückliche Grosseltern erlebt. Und auch die goldene Uhr, ein Geschenk von Kaiser Karl, hat das alles unbeschadet überdauert. Es gibt nur eine Schlussfolgerung: Hör auf, über schlechte Zeiten zu jammern. Ich lebe in der besten aller Welten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Peter Rützler
Kaiseruhr und Rosenkranz
Roman
© 2024 Peter Rützler
Covergrafik:
Bild Kaiser Karl in Lochau © vorarlberg museum Bregenz
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Peter Rützler, Nadelstrasse 87, 8706 Meilen, Schweiz.
Im Gedenken an
Anna und Fritz
Adelheid und Gustav
Für meine Eltern, ohne die das Buch nie entstanden wäre
Bach runterGegenwart
«Oh nei, nicht schon wieder!», entfährt es mir beim Lesen des Artikels über die Vergabe der Fussballweltmeisterschaft. Einmal mehr wird die Weltmeisterschaft in der Wüste und im Winter stattfinden. Einmal mehr kann ich die Spiele nicht im sommerlichen Garten mit Freunden und viel Bier geniessen. Einmal mehr kämpfen die Mannschaften in einem Land, das keine Fussballtradition hat.
Saudi-Arabien wird den Zuschlag für das Jahr 2034 erhalten. Geld regiert die Welt, schlussfolgere ich. Ich verspüre ein Unwohlsein in der Magengegend, wie immer, wenn ich an das saudische Regime denke. Hat der Kronprinz nicht in der Türkei einen kritischen Journalisten entführen und anschliessend in Stücke hacken lassen? Was für eine abscheuliche und menschenverachtende Tat. Die Frauen werden in diesem erzkonservativen, von der Religion dominierten Land immer noch unterdrückt. Ohne die Zustimmung ihres Mannes oder ihres Familienoberhaupts können sie keine offizielle Entscheidung treffen. Und die Saudis spielen ein sehr schmutziges und gefährliches Spiel im Nahen Osten, wo Menschenleben generell einen tiefen Stellenwert haben.
Mein Onkel arbeitete in den 1980er Jahren als Sprengmeister in Saudi-Arabien. Er musste mit ansehen, wie einem seiner pakistanischen Mitarbeiter öffentlich die Hand abgehackt wurde, weil er des Diebstahls verdächtigt wurde. Mittelalterliche Zustände, die ich als überwunden glaubte. Wobei im Mittelalter wir Christen die Barbaren waren und die islamischen Wüstensöhne weltoffen und tolerant. Seitdem haben sich die Positionen geradezu umgekehrt.
Jedenfalls möchte ich nicht in einem mittelalterlichen Land leben. Ich weigere mich bis heute, nach Saudi-Arabien zu reisen und sei es nur für einen Urlaub. Dieses Land werde ich wohl nie zu Gesicht bekommen.
Aber die Saudis haben mit ihrem Öl viel zu viel Geld verdient. Damit kann sich das Regime alles kaufen, was es will. Seit einiger Zeit steht auch mein geliebter Fussball auf ihrer Einkaufsliste. Die dabei investierten Summen sind in den letzten Jahren exponentiell gestiegen.
Der Fussball hat seine Unschuld schon seit vielen Jahren verloren. Wie leidenschaftlich habe ich als Jugendlicher meine Lieblingsmannschaften verfolgt, mit ihnen bei Niederlagen abgrundtief gelitten und bei Siegen unbeschreibliche Freude empfunden?
Doch diese Zeiten sind endgültig vorbei. Die uferlose Kommerzialisierung des Fussballs verfolge ich mit tiefer Abscheu. Heute werden damit Milliarden, wenn nicht sogar Billiarden, umgesetzt. Wer auf und um den Rasen Erfolg hat, verdient viele Millionen. Und wer finanziert den ganzen Bling-Bling-Klamauk? Wir, die Zuschauer, die wegen des Fussballs ein bestimmtes Produkt kaufen oder immer mehr für den Fussballkonsum bezahlen. Und nun sorgen die Saudis dafür, dass noch mehr Geld in dieses höchst lukrative Geschäft gepumpt wird, das früher eine reine Freizeitbeschäftigung war und nur der Freude wegen gespielt wurde.
Der Fussball ist ein öffentliches Gut, das uns allen gehört. Wieso soll ich für dieses Allgemeingut etwas bezahlen? Nicht mit mir! Ich zahle keinen Rappen extra für Fussballübertragungen. Die Mittwochabende mit Europacup-Spielen sind aus meinem Alltag verschwunden, seit sie aus dem öffentlichen Fernsehen verbannt wurden und nur noch auf Bezahlsendern zu sehen sind.
Jetzt ist also auch die Weltmeisterschaft an der Reihe. Seit sie mehr und mehr als reine Geldmaschine missbraucht wird, verliert sie zusehends ihren Reiz. So wird mir eine meiner liebsten Freizeitbeschäftigungen Stück für Stück aus meinem Leben herausgerissen.
Mir kommt fast die Galle hoch, als ich im Zeitungsartikel auf den Namen Infantino stosse. Wie kann es sein, dass ausgerechnet ein Schweizer diese von Geldgier und Korruption angetriebenen, fanverachtenden Machenschaften als grosser Zampano dirigiert? Ist der wirklich in der Schweiz aufgewachsen?
Ich sehne mich nach den guten alten Zeiten zurück und blicke gedankenverloren auf den Zürichsee. Dieser ist so glatt wie unsere kürzlich gekauften, frisch geschliffenen Granitblöcke, die inzwischen als neue Gartentischplatten dienen. Es ist absolut windstill. Der November zeigt sein schönstes Antlitz. Die Sonne scheint mir direkt ins Gesicht. Ich schliesse die Augen und geniesse das wohltuende Aufblitzen der warmen Sonnenstrahlen in meinen Augäpfeln. Ich sitze, wie fast immer an einem späten Sonntagvormittag, auf unserer Terrasse und lese die Sonntagsausgabe der Neuen Zürcher Zeitung, den Zigarillo im Mund und die Tasse frischen Kaffee trinkbereit zu meiner Linken. Schöner und entspannter geht es kaum.
Und doch geht mir der Puls wieder hoch, als ich die Karikatur von Chappatte in der NZZ am Sonntag erblicke. Putin schaut mit seinen Generälen auf eine mit Spielzeugpanzern bestückte Landkarte der Ukraine und kommentiert beiläufig: «Ich begrüsse das Massaker der Hamas … genauso wie Israels massiven Gegenschlag.»
Besser kann man diesen empathielosen, menschenverachtenden und eiskalt berechnenden neuen Zaren des Russischen Grossreiches kaum karikieren. Jedes noch so brutale Mittel ist ihm recht, solange es ihm dient. Wie konnte dieser moderne Zar unsere friedliche Ordnung in Europa mit seinem blutigen Angriffskrieg auf die Ukraine zum Einsturz bringen? Von selbsternannten Führern, die aus ihren Zinnsoldatenspielen grauenvolle Wirklichkeit machten und Europa mit Bomben und Gemetzel überzogen, hatten wir in unserer Geschichte doch schon mehr als genug. Ich dachte, wir zivilisierten Europäer hätten das überwunden. Das sollte im Besonderen für die Russen gelten, die in der jüngeren Vergangenheit einen ausserordentlich hohen Blutzoll zahlen mussten. Putin hat mich eines Besseren belehrt.
Noch übler wird mir bei den jüngsten Auseinandersetzungen um Israel. Das sinnlose Abschlachten hunderter friedlicher Juden, ob jung oder alt, durch die Terrororganisation Hamas ist für mich an Brutalität kaum zu überbieten. Noch erbarmungsloser ist die Geiselnahme von jüdischen Zivilisten jeglicher Couleur als Kriegspfand. Da hat die Hamas noch eine Schippe draufgelegt. Kennt denn diese Spirale der Gewalt keine Grenzen?
Noch erschreckender ist aber, dass es bei uns in Europa grössere Gruppen gibt, die das abscheuliche Treiben der Hamas verteidigen und die Hamas bei grösseren Demonstrationen lautstark unterstützen. Das ist Antisemitismus in Reinkultur. Viele dieser Sympathisanten sind weder Palästinenser noch Moslems, sondern linke Intellektuelle.
Beim Weiterlesen der Zeitung stosse ich auch auf einen Artikel, der von einem sprunghaften Anstieg des Antisemitismus in der Schweiz nach dem brutalen Überfall der Hamas auf Israel berichtet. Den Judenhass kennt Europa seit Jahrhunderten, und ich liege falsch im Glauben, dass er nach der millionenfachen Judenvernichtung des Hitlerregimes keine grossen Massen mehr hinter sich scharen kann. Er kann es immer noch.
Bedauernswerte Juden bei uns und in Israel, aber auch bedauernswerte palästinensische Zivilisten, die ebenfalls nur Leid erfahren und keinen Frieden finden werden.
Hass und Wut auf Andersdenkende scheinen vollends die Oberhand zu gewinnen. Noch ganz in diesen Gedanken versunken, bleibe ich beim Interview der NZZ mit einem Soziologen hängen. Er sagt, die Spaltung der Gesellschaft werde von oben nach unten erzeugt. Polarisierungsunternehmer wie die AfD nützen aus, dass sich ein grosser Teil der Bevölkerung Mühe mit Veränderungen hat. Die AfD Strategen entwickeln gar keine Strategie, sondern warten auf das nächste Aufregerthema. Die Idee ist, die Unzufriedenheit einzusammeln und für sich auszunutzen. Politisches Wegelagerertum nennt das der Soziologe.
Ich denke an den bekanntesten «Wegelagerer»: Donald Trump, der Narzisst, der die Nation spaltet. Ich finde ihn widerlich. Da bin ich bei weitem nicht allein, auch in den USA nicht. Trotzdem wurde er wieder gewählt, und auch in Deutschland gewinnt die AfD kontinuierlich an Wählerstimmen.
Bei all den schlechten Nachrichten überkommt mich eine heftige Melancholie. Die wärmenden Sonnenstrahlen und die Aussicht auf den spiegelglatten, glitzernd schimmernden Zürichsee kommen dagegen nicht auf. Die vielen blutigen Kriege – selbst in Europa, brutale Diktatoren, polarisierende Politiker, der zunehmende Hass und die Spaltung der Gesellschaft sowie die Macht des Geldes, die alle Lebensbereiche durchdringen, lassen mich eine ernüchternde Schlussfolgerung ziehen: Die Welt verändert sich zum Schlechten hin. Sie geht buchstäblich den Bach runter!
Genau in diesem Augenblick läutet mein Telefon. Es ist meine Mutter. Ich begrüsse sie etwas schroff, da sie mich in meinen Gedanken gestört hat. Schnell beruhige ich mich aber wieder und höre ihr dann geduldig zu, was sie mir zu berichten hat. In der letzten Zeit hat ihre Redseligkeit, wohl altersbedingt, abgenommen. Dennoch dauert der Smalltalk eine ganze Weile, bis sie endlich zum Thema kommt. Das Bewertungsgutachten für das Haus ihrer Mutter sei endlich eingetroffen und wir haben nun eine Basis für den Verkauf des Hauses. Sie habe bereits mit dem einzigen möglichen potenziellen Käufer gesprochen. Er sei bereit, ab nächster Woche Verkaufsverhandlungen mit uns zu führen.
«Aber du hast hoffentlich nicht schon einen Preis genannt?», frage ich.
«Nei, nei. Die Preisverhandlung überlass ich dir», entgegnet sie mir.
Ich gebe ihr einige mögliche Daten, an welchen wir uns mit dem Kaufinteressenten treffen könnten. Sie verspricht mir, mich wieder anzurufen, sobald sie einen Termin vereinbart hat.
Endlich ist es also so weit. Meine Mutter will sich von ihrem Elternhaus trennen. Sie hatte Jahre damit gezögert, weil das Haus mit so vielen Erinnerungen verbunden war.
Ich denke an meine Oma, der das Haus fast ein ganzes Leben lang gehörte. Und plötzlich blitzt eine Szene in meinem Gedächtnis auf, bei der die hochbetagte Oma, ohne sich zu versprechen oder zu verhaspeln, ein langes Gedicht rezitiert. Sie hatte es als Zehnjährige auswendig lernen und zu einem sehr besonderen Ereignis aufsagen dürfen. Es war wohl das Ereignis ihres Lebens.
Der Kaiser kommtAnfang Juni 1917
«Mama, Mama, der Kaiser kommt!», rief die um Atem ringende Kreszentia ihrer Mutter aufgeregt von weitem zu. Sie war den ganzen Weg von der Volksschule zum Elternhaus gerannt, um der Mutter diese freudige Nachricht möglichst rasch zu überbringen. Ihre goldblonden Locken waren wild zerzaust und Schweissperlen bedeckten ihr junges, unschuldiges Gesicht. Schliesslich hatte sie die Haustüre ihres stattlichen Elternhauses erreicht, wo sie ihre Mutter erwartete.
«Wie oft hab ich dir schon gesagt, dass man in der Öffentlichkeit nicht so herumbrüllt?», entgegnete ihr die Mutter.
Emma erzog ihre Kinder mit straffer Hand und achtete darauf, dass sie sich in der Öffentlichkeit tadellos aufführten. Das kam wahrscheinlich daher, weil sie als böhmische Köchin eine Auswärtige war und aus einfachen Verhältnissen stammte. Sie wollte um jeden Preis zu den angesehenen Bürgern des Dorfs dazugehören. Deshalb hatte sie damals auch Hermann, dem äussert gut situierten Zimmermann, eine der besten Partien im Ort, geheiratet. Sie kleidete sich immer schick und genoss nichts mehr, als sich in den neuesten Roben, allen den aktuellsten Pariser Trends folgend, an der Seepromenade den Leuten zu zeigen. Die auffallenden Hüte waren ihr Markenzeichen. Sie offenbarte bei jeder sich bietenden Gelegenheit ihr kultiviertes Benehmen und liebte bei den Spaziergängen die unverbindliche Konversation mit den wichtigen Persönlichkeiten des Dorfs.
Ihre fünf Kinder mussten ihr natürlich nacheifern. Sie sollten in ihrem Leben zumindest die gleiche Stellung einnehmen, die sie nach so vielen Jahren der harten Arbeit, der Selbstbeherrschung und des Verzichts erreicht hatte. Das galt besonders für ihren ältesten Sohn Meinrad, dem sie alles zukommen liess, damit er sich bestmöglich entwickeln konnte.
Trotz all ihrer Erfolge war ihr das Glück in den letzten Jahren nicht immer hold. Ihr letztes Kind Alois kam ganzseitig gelähmt zur Welt. Selbst als Vierjähriger lag der kleine Bub meist regungslos und apathisch in seinem Kinderbett. Dieser Schicksalsschlag liess Emma noch mehr verhärten und führte bei ihr zur Erkenntnis, dass nun auch der Sex keinen Platz mehr in ihrem Leben einnehmen durfte. Ein weiteres Kind wie Alois konnte sie nicht zulassen. Ihren Mann Hermann liess sie seitdem in ihrer ureigenen Selbstdisziplin nicht mehr unter ihre Bettdecke.
Und dann war da noch dieser unsägliche Krieg, der selbst einer vermögenden Familie, wie der ihren, das Leben schwer machte. An vielen Tagen konnte sie, trotz aller Kochkunst, der Familie nichts Vernünftiges auf den Tisch servieren. Sie litten zwar nicht, wie viele andere, wirklich an Hunger. Aber diese vielen dürftigen Mahlzeiten drückten ihr, als einer nach Perfektion strebender Köchin, auf das Gemüt.
«Schnauf einmal tief durch, Zenzerl. Und dann erzähl mir in aller Ruhe und in einer normalen Lautstärke, was da mit dem Kaiser los ist.»
Kreszentia holte, wie ihr gesagt, tief Luft und begann, immer noch ganz aufgeregt, mit ihrem Bericht: «Stell dir vor, der Kaiser kommt zu uns! Der Lehrer hat uns gesagt, dass der Kaiser in zwei Wochen Lochau besucht. Er besichtigt das Strandhotel und fährt dann mit dem Schiff nach Bregenz. Der Lehrer arbeitet schon an einem Gedicht für diesen einmaligen Anlass. Morgen hat er das Gedicht fertig. Dann müssen wir es alle auswendig lerne und ihm vortrage. Die, die es am besten macht, darf es dann dem Kaiser vortrage.»
«Ach, Mama, ich will unbedingt die Auserwählte sein. Hilfst du mir dabei?»
«Aber selbstverständlich, mein Zenzerl. Warten wir auf Morgen, bis der Lehrer das Gedicht fertig hat.»
Emma war, wie ihre ganze Familie, dem Kaiser treu ergeben. Sie hatte den Habsburgern viel zu verdanken. Der Kaiserhof machte seit Jahrzehnten die böhmische Küche im ganzen Reich bekannt. Und nur deshalb war es ihr damals möglich gewesen, aus dem fernen Böhmen im schönen Lochau als Köchin Arbeit zu finden und schliesslich ihren Hermann kennenzulernen.
Mit der Krönung des neuen Kaisers Karl wurde ihre Kaisertreue noch grösser. Besonders die junge, bildhübsche und stets modisch gekleidete Kaiserin Zita hatte es ihr angetan. Immer wieder betrachtete Emma das Bild des jungen Kaiserpaars, das seit einigen Monaten im Gasthaus Wellenhof hing. Der Kaiser war in Uniform. Zita trug ein schlichtes Kleid, das ihre schlanke Figur gut in Szene setzte. Auffallend war ihr üppiger Hut mit Blumenmotiven um die Krone und auslandender Krempe, alles ganz in Weiss.
Emma las jeden Zeitungsartikel über den Kaiser und vor allem über seine Frau. Zita verkörperte alles, wonach sich Emma sehnte. Es wäre ein unvergessliches Erlebnis, ihr wahrhaftig zu begegnen.
ViehzugJuni 1880
Das war eine wahre Meisterleistung und verlangte ihnen alles ab. Giovanni hatte mit seinen beiden Brüdern Bartolo und Giuseppe die riesige Barackensiedlung in Langen am Arlberg erreicht. Sie waren nicht alleine gekommen, sondern hatten auch ihre vier Rindviecher mit dabei.
Vor mehr als zwei Wochen waren die drei mit ihrem Vieh aus Brez im Trentino aufgebrochen. Alle drei Brüder hatten Tränen in den Augen, als sie sich von ihren Eltern und ihren Geschwistern verabschiedeten. Aber es gab nun mal seit Generationen das Familiengesetz, dass die jüngeren Söhne den bäuerlichen Hof verlassen und in der Fremde ihr Glück suchen mussten. Das Anwesen warf nicht genug ab, um alle zu ernähren.
So beschlossen die drei Brüder, ihr Glück am Arlberg zu versuchen. Es war ihnen zu Ohren gekommen, dass Habsburg dort das Jahrhundertprojekt einer Eisenbahnlinie realisieren wollte. Als Trentiner gehörten sie zum Reich und rechneten sich deshalb, obschon der deutschen Sprache nicht mächtig, gute Chancen aus, für den Bahnbau rekrutiert zu werden.
Die drei Brüder waren, wie alle in der Familie, mehr mit Rindern, Fleischhandel und Metzgern bewandert. Sie verstanden sich aber auch auf die Bearbeitung von Stein und hofften, als Steinmetze Arbeit zu finden. Und tatsächlich konnten alle drei in Bozen bei einer der vielen reichsweiten Rekrutierungsstellen für den Bau der Arlbergbahn einen Vorvertrag als Steinmetze abschliessen.
Dem Vater bereitete der Abschied grosse Qualen. Werden meine Söhne bei den deutschen Landsleuten Erfolg haben? Werde ich sie je wiedersehen, dachte er betrübt. Er wollte ihnen den Einstieg in der neuen Welt so leicht wie möglich machen. So kam er auf die Idee, ihnen ein paar seiner Rinder mitzugeben, die sich beim Bahnbau sicherlich gut verwerten liessen. Dort mussten die Mäuler vieler hungriger Arbeiter gestopft werden. Als gelernte Metzger könnten die Söhne mit dem Fleischverkauf einen schönen Batzen hinzuverdienen.
So kam es, dass die drei Söhne sich mit fünf ausgewachsenen Rindern auf den beschwerlichen Weg machten. Über dreihundert Kilometer war der Weg lang, drei Pässe und vier Täler mussten bewältigt werden. Der Weg ging von Brez im Nonstal über den Passo delle Palade ins Vinschgau, dann über den Reschenpass ins Oberinntal. Von dort entlang des Stanzertals schliesslich über den Arlbergpass ins Klostertal. An dessen Anfang lag der kleine Weiler Langen, in welchem die Barackensiedlung für die Grossbaustelle der Arlbergbahn errichtet worden war.
Mehrmals waren die Brüder kurz davor, aufzugeben und wieder nach Hause zurückzukehren. Auf dem Reschenpass schneite es heftig und sie dachten, sie würden die Nacht nicht überleben. Sie bissen sich halb erfroren durch und fanden schliesslich einen Bauern, der sie freundlicherweise für zwei Tage aufnahm, damit sie ihre steifen Glieder wieder aufwärmen konnten. Kurz nach dem Arlbergpass stürzte eines der Rinder unglücklich und brach sich ein Bein. Die Brüder mussten es schweren Herzens zurücklassen.
Das einzige Glück war, dass sie zu dritt waren. Wenn einer den Mut verlor, richteten ihn die beiden anderen wieder auf. Ihre ohnehin schon starken brüderlichen Banden wurden mit diesem Gewaltmarsch noch enger.
Nun standen sie also vor der riesigen, neu errichteten Holzbarackensiedlung. Mehrere hundert Arbeiter fanden hier Platz. Die Einwohnerzahl des kleinen Bergweilers Langen hatte sich durch die Ankunft der Arbeiter vervielfacht. Glücklicherweise waren viele Arbeiter ebenfalls aus den italienischsprachigen Landen zugewandert, sodass die Brüder keine Verständigungsprobleme hatten.
Von ihnen erfuhren sie, dass in Langen gerade eine Metzgerei eröffnet worden war und brachten die vier verbliebenen Rinder dorthin. In den nächsten Wochen wurden sie allesamt geschlachtet. Der Preis für die Rinder war unerwartet hoch und verschaffte den drei ein gutes Startgeld in der Fremde. Alle Brüder halfen bei der Schlachtung mit. Besonders Bartolo, der älteste der drei, zeigte dabei sein Können als Metzgermeister. Ihm wurde daraufhin angeboten, dass er in der Metzgerei jederzeit gegen Entgelt aushelfen konnte.
Beim Bahnbau bearbeiteten und verbauten die drei Brüder unzählige Steinblöcke, die für die Abstützung der Tunnels, Viadukte, Brücken und Bahntrassen benötigt wurden. Vor allem kleideten sie in dem über zehn Kilometer langen Arlbergtunnel, der in Langen seinen Anfang nahm, mit Steinen aus. Die Arbeit war eintönig und hart, aber die Brüder konnten wegen ihrer zupackenden, gewissenhaften und freundlichen Art das Vertrauen und die Wertschätzung ihrer Kollegen und Vorgesetzten gewinnen. Sie lebten sich nach und nach in ihre neue Umgebung ein.
Bartolo verbrachte immer mehr Zeit in der Metzgerei, bis er sie schliesslich ganz übernahm. Mit ihr betrieb er auch die Kantine der Arbeitersiedlung.
Giovanni fand ein hübsches Zimmer in einem Bauernhof der Familie Ebenherr in der benachbarten Gemeinde Wald. Und vor allem verliebte er sich in Mina, die hübsche junge Tochter des Hauses. Seine anfänglich dürftigen Deutschkenntnisse erlebten damit einen deutlichen Anschub. Er fühlte sich immer wohler in seiner neuen Heimat.
Doch leider kam es, wie es kommen musste. Nach vier Jahren wurden die Bauarbeiten der Bahnstrecke beendet. Kaiser Franz Joseph eröffnete am 20. September 1884 höchstpersönlich die neue Bahnlinie. Damit verloren aber die 14‘000 Arbeiter ihre Arbeitsstelle.
Darunter waren auch Giovanni und Giuseppe. Bartolo besass die Metzgerei und hatte vor einigen Wochen den Gasthof Krone in Klösterle übernehmen können. Sein Auskommen war auch ohne die Bahnarbeit gesichert.
Die drei Brüder sassen am späten Abend im nun von Bartolo geführten Gasthof und besprachen in gedrückter Stimmung ihre Zukunft.
«Cari fratelli, ich bleib definitiv hier. Ich hab alles, was ich zum Leben brauche und fühl mich im Klostertal sehr wohl», meinte Bartolo.
Giuseppe, der jüngste der drei, entgegnete: «Du hast Fortuna gehabt, Bartolo. Ohne den Bahnbau gibt es hier nur wenige Möglichkeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, mich als Lohnbauer zu verdingen. Da hätte ich ja auch gleich bei uns in Brez bleiben können. Porca miseria! So stell ich mir meine Zukunft nicht vor. Viele Kollegen reden von Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Einige von ihnen haben sich schon auf den Weg gemacht. Ich glaub, ich werde ihnen folgen. Komm doch mit mir, Giovanni.»
Giovanni war seine Trübsal deutlich im Gesicht anzusehen. Traurig antwortete er: «Ich würd ja gerne mit dir mitkommen. Aber ich kann doch meine liebste Mina nicht verlassen. Ihr Vater erlaubt ihr nie im Leben, mit mir nach Amerika zu gehen. Mein Herz sagt mir: Ich muss hier bleiben.»
Bartolo wandte ein: «Miei cari fratelli, wir sollten alle hier bleiben. Unsere Banden sind stark. Nie waren wir voneinander getrennt. Wir konnten gemeinsam jedes noch so grosse Hindernis überwinden und werden auch dieses Mal wieder eine Lösung finden. Meine lieben Brüder: Bleiben wir doch zusammen!»
Giuseppe erwiderte: «Mein Entschluss steht fest. Ich geh nach Amerika. Du kennst mich gut, Bartolo. Ich würde als Lohnbauer nicht glücklich werden. Ich muss etwas Eigenes haben. Gib mir deinen Segen dazu.»
Nach langer Diskussion willigte Bartolo schliesslich zähneknirschend ein. So standen die beiden wenig später am neuen Bahnhof Langen, Giuseppe mit seinem Gepäck und Bartolo mit Tränen in den Augen.
Endlich gesellte sich auch Giovanni zu den beiden. Zur Überraschung seiner Brüder hatte er einen grossen Rucksack dabei. «Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Die Zukunft hier bietet mir einfach zu wenig. Ich mach es wie Giuseppe und such mein Glück in Amerika. Lieber ein gebrochenes Herz, als hier zu verkommen. Und mit meiner Mittellosigkeit werden Minas Eltern einer Heirat sowieso nie zustimmen.»
Nach einer letzten Umarmung, alle drei weinten hemmungslos, bestiegen Giovanni und Giuseppe den Zug und fuhren zum ersten Mal als Passagiere durch den Arlbergtunnel, den sie selbst mit gebaut hatten. Werde ich die beiden je wiedersehen, sinnierte Bartolo traurig.
LungenentzündungNovember 1910
Es dauerte lediglich zwei Jahre, bis Bartolo Giovanni wiedersah.
Giovanni musste wie Giuseppe einen grossen Teil seiner Ersparnisse aus der harten Arbeit am Arlberg für die Schiffspassage nach New York aufwenden. Sie schifften sich in Bremerhaven ein, dem damals bedeutendsten deutschen Auswandererhafen nach New York. Die Überfahrt auf der Werra, einem der grössten Schnelldampfer, verlief ruhig und ereignislos. Die beiden Trentiner teilten sich das Zwischendeck mit neunhundert Mitpassagieren der dritten Klasse. Die Enge war zwar unangenehm, aber Giovanni und Giuseppe hatten schon ganz andere Herausforderungen gemeistert. Nach zehn Tagen erreichten sie New York.
Die Immigration in der Empfangsstation Castle Clinton verlief erstaunlich problemlos. Als junge und gesunde Westeuropäer entsprachen sie genau den Arbeitskräften, die in Amerika benötigt wurden. Schon einige Stunden später passierten sie das Tor zur Neuen Welt.
Sie verbrachten einige Tage in New York und beobachteten mit Erstaunen und Bewunderung das ameisenhafte Treiben in der Stadt. Nie zuvor hatten sie eine so grosse Stadt gesehen. Endlose Menschenmassen schienen ziellos umherzuirren und doch einer ungreifbaren, universellen Ordnung zu gehorchen. Alles war im Aufbruch und überall wurde emsig gearbeitet, gehandelt und gebaut. Das Meer der mehrstöckigen Gebäude schien kein Ende nehmen zu wollen, die Möglichkeiten zur Entfaltung schienen grenzenlos.
Die beiden Brüder bezahlten gerne den einen Cent, um das einzigartigste Bauwerk seiner Zeit zu beschreiten: die Brooklyn-Brücke.
In der Mitte der gigantischen Brücke blieben die Brüder stehen und bestaunten von weit oben herab die einzigartigen Umrisse der riesigen Stadt.
Giuseppe drehte sich Giovanni zu und bemerkte: «Che bellezza! Kaum zu glauben, was die hier alles auf die Beine stellen. Die Brücke, eine unvergleichliche Ingenieurskunst! Dagegen sind unsere Arlbergbrücken nur Spielzeug. Hier in Amerika ist wirklich alles möglich. Auch uns steht die Neue Welt offen. Ich bereue keine Sekunde unsere Entscheidung, hierher gekommen zu sein.»
«Du hast völlig recht, Giuseppe. Wir können hier unser Glück finden. Aber mir geht die Mina einfach nicht aus dem Kopf. Ich muss jeden Tag an sie denken.»
«Fratello, das wird sich mit der Zeit bessern. Sieh dich um: Hier wimmelt es nur so von hübschen Mädchen. Da wird sich schon eine für dich finden. Credimi!»
Einige Tage später fuhren sie mit dem Zug nach Chicago, dem Zentrum der amerikanischen Fleischindustrie. Die beiden mutmassten, dass ihre Kenntnisse der Viehwirtschaft dort gefragt sein müssten. Und tatsächlich fanden sie Arbeit auf den riesigen Union Stock Yards, in denen jährlich neun Millionen Stück Vieh verarbeitet wurden.
Giuseppe zog es nach einigen Monaten weiter westwärts, nach Oklahoma, wo er sich dann endgültig in Coalgate niederliess. Er gründete eine Familie und betrieb einen gut gehenden Fleischhandel.
Giovannis Liebeskummer ebbte wider Erwarten nicht ab. Er musste Mina unbedingt wiedersehen und begab sich deswegen auf die beschwerliche Rückreise. Seine Brüder weinten beide, Giuseppe bei der Abreise in Chicago und Bartolo beim herzlichen Wiedersehen am Arlberg.
Sein Herz hüpfte überschwänglich, als er Mina zum ersten Mal wieder in seine Arme schliessen konnte. Er zog wieder in sein altes Zimmer im Haus der Ebenherrs ein. Bei den k. u. k. Staatsbahnen fand er bald eine Beschäftigung als Leiharbeiter und verdiente auch als Lohnmetzger gutes Geld, oft in Bartolos Metzgerei aushelfend. Damit war sein Lebensunterhalt gesichert. Mit dem Geld kaufte er sich nach einigen Jahren das direkt angrenzende Nachbarshaus der Ebenherrs. Es bot genügend Platz für eine grössere Familie.
Nun konnte es Johann, wie er sich nun nannte, endlich wagen, bei den Eltern Ebenherr um die Hand ihrer Tochter Mina anzuhalten. Im Jahr 1892 heirateten die beiden. Schon ein Jahr später kam Anna auf die Welt, ein Jahr später Ottilie, die leider kurz darauf verstarb. Dann erblickte Max, der Stammhalter, die Welt. Und so ging es Jahr für Jahr weiter: Josef, Hannes, Alwin, Rosa, Agathe und schliesslich, als Nachzügler, Alfred kamen hinzu.
Ein rundum zufriedener Johann betrat im November 1910 die Stube seines Hauses. Vieles hatte sich so ergeben, wie er es sich immer gewünscht hatte: Er war ein angesehenes Mitglied der Dorfgemeinschaft, seine Mina war ihm auch nach so vielen Jahren noch eine liebevolle Ehefrau und seine wachsende Kinderschar erfüllte ihn mit Stolz, mit Ausnahme vielleicht von Max, der in der Schule immer wieder durch seine Lausbubenstreiche negativ auffiel. Die Schwiegereltern hatten Johann erst kürzlich ihren Hof vermacht, so dass er nun über einen beträchtlichen Besitz verfügte.
Der Stubentisch war gedeckt, alle Kinder sassen bereits um ihn herum und in der Mitte stand der grosse eiserne Kochtopf. Es duftete nach Kartoffeleintopf mit Speck, eines seiner Leibspeisen. Er hörte Mina in der Küche hantieren.
«Mina, kumm bitte ou. I hob eu eapas Wichtigs mitsteile», sagte Johann im typischen Klostertaler Dialekt. In seiner Familie wurde nur Deutsch gesprochen. Sein Italienisch hatte er schon vor vielen Jahren ad acta gelegt und seitdem kaum mehr gesprochen.
Kurz darauf betrat Mina die Stube und Johann fuhr fort: «Heut hab ich meinen Heimatschein auf der Gemeinde abholen könne. Ich bin jetzt offiziell ein Bürger von Wald.»
Stolz zeigte er allen die Urkunde und las daraus vor: «Die Gemeinde Wald bestätigt hiermit, dass Johann Avancini in dieser Gemeinde das Heimatrecht besitzt.»
Mina nahm ihm die mit Siegel und Stempel versehene Urkunde ab und betrachtete sie eingehend. Sie freute sich sehr für ihren Mann.
Sie hustete kurz, bevor sie Johann entgegnen konnte: «Ach Johann, das sind wirklich gute Nachrichten. Mit dem sind auch alle Fragen zur Heimatzugehörigkeit unserer Kinder geklärt. Aber lass uns jetzt essen. Der Eintopf wird kalt.» Und wieder musste sie husten. Dieses Mal länger und heftiger.
Im Gegensatz zu ihrem Mann war sie selbst nicht so glücklich. Die neun Geburten, die Erziehung der acht verbliebenen Kinder und das ständige Bemühen um das Wohlergehen der grossen Familie hatten viel Kraft und Energie gekostet. In den letzten Jahren fühlte sie sich oft erschöpft und ausgebrannt. Ihr ausgemergelter Körper war ein Spiegelbild ihrer inneren Verfassung.
«Was ist mit dir, Mina? Das tönt nicht sehr gesund. Der Husten plagt dich schon seit Tagen», bemerkte Johann besorgt.
«Da ist nichts. Der Husten wird schon besser.», erwiderte sie.
«Nimm das nicht auf die leichte Schulter, Mama», meinte Anna, die älteste Tochter. «Du kannst nach dem Essen früh zu Bett gehen. Ich räum auf und kümmere mich um alles.»
Mina legte sich früh schlafen, schlief lange und verliess das Bett nicht mehr. Am nächsten Morgen hatte sie hohes Fieber und starke Gliederschmerzen. Sie hustete unaufhörlich und bekam schwer Luft. Am Abend war Mina kaum noch ansprechbar. Am nächsten Morgen kam der Arzt und stellte eine Lungenentzündung fest. Er verordnete strenge Bettruhe, warme Umschläge und Kamillentee.
Doch Minas Zustand besserte sich nicht. Und als ob sie ihr Ende spürte, rief sie in einem wachen Moment ihre älteste sechzehnjährige Tochter Anna ans Krankenbett. Sie nahm ihre Hand und hauchte ihr zu: «Liebste Anna, du musst dich um den Haushalt und deine Geschwister kümmern, wenn ich nicht mehr da bin.»
«Aber Mama, du wirst schon wieder gesund. Ruh dich aus. Dann wird es dir bald wieder besser gehen.»
Mina überlebte die folgende Nacht nicht. Am Morgen lag sie leblos in ihrem Bett. Johanns Trauer war grenzenlos. Mina hatte er alles zu verdanken. Ihretwegen war er aus Amerika zurückgekehrt und hatte hier sein Glück gefunden. Sie hatte ihm die reiche Kinderschar geschenkt, die ihm so viel Freude bereitete. Sie war immer für ihn da gewesen und hatte sich liebevoll und selbstlos um die Familie gekümmert. Er hatte nie darüber nachgedacht, wie es ohne sie sein könnte. Der plötzliche Tod seiner geliebten Mina traf ihn unerwartet und unvorbereitet.
Ach Mina, warum musstest du so früh gehen? Wie soll es jetzt nur ohne dich weitergehen, fragte er sich verzweifelt.
SchwabenlandApril 1912
«Ich will nicht weg. Ich will bei euch bleibe», schrie der elfjährige Xaver seinen Eltern zu. Ludwina, seine Mutter, versuchte ihn zu trösten.
«Luag, du bist schon ein grosser Buab. Es wird dir dort guet gehen. Du wirst immer genug zu essen haben. Die Leute werden dich guet behandle.»
Eigentlich wollte sie ihren ältesten Sohn nicht ziehen lassen. Doch die Vernunft siegte. Es gelang ihr nicht immer, die stets hungrigen Mäuler ihrer stattlichen Familie zu stopfen. Der Verdienst als besitzlose Stickerei-Akkordarbeiter reichte gerade so zum Überleben. Zum Glück konnten sie in ihrem Elternhaus wohnen. Xaver, der Älteste, ass schon fast wie ein Erwachsener. Ihn für ein halbes Jahr lang nicht füttern zu müssen, war eine grosse Erleichterung für die Familie. Ausserdem würde er mit fünfzig Mark und zwei neuen Gewändern nach Hause kommen, ein schöner Zuschuss zu ihrem kargen Auskommen.
Vater Michael entgegnete Xaver: «Auch ich bin als Buab ins Schwabenland gezogen. Es ist eine schöne Zeit gewesen und ich hab früh etwas zum Wohlergehen der Familie beigetragen. Was mir guet getan hat, wird auch dir nicht schade. Keine Widerrede, Xaver, du gehst!»
Michael war ein bescheidener, genügsamer und rechtschaffender Mann, der vor zwanzig Jahren aus dem Bregenzerwald nach Innerbraz ausgewandert war, wo er bei einem Stickereibetrieb Arbeit gefunden hatte. Kurz vor der Jahrhundertwende hatte er seine Ludwina geheiratet. Zwei Jahre später erblickte Xaver das Licht der Welt. Weitere drei Kinder vergrösserten seitdem die Familie.
Er musste sein ganzes Leben lang hart arbeiten, zeichnete sich durch grosse Disziplin aus und erzog seine Kinder mit strenger Hand. So war ihm klar, dass auch seine Söhne, wie er selbst, über den Sommer im Schwabenland bei Bauern arbeiten sollten. Diese frühe Lebensschule bereitete sie bestens auf das Erwachsenensein vor.
Da stand nun Xaver am Bahnhof Hintergasse. Er trug einen Rucksack, in dem er die wenigen Dinge verstaut hatte, die er auf die Reise mitnehmen durfte. Das Wichtigste für ihn war die Schwarz-Weiss-Fotografie der Familie: in der Mitte der hagere Vater mit ernster und zugleich stolzer Miene sowie Mutter, verschmitzt lächelnd, den kleinen Richard im Arm haltend. Er und seine beiden anderen Brüder standen auf der Seite.
Die ganze Familie hatte ihn zum Bahnhof begleitet. Alle umarmten ihn. Mutter hatte Tränen in den Augen und steckte ihm heimlich ein Päckchen zu. Es war eine fein säuberlich in Papier eingewickelte Tranche Speck.
«Für unterwegs, damit du nicht verhungerst», flüsterte sie ihm zu.
Xaver zwang sich, nicht auch in Tränen auszubrechen. Nach anfänglichem Widerstand hatte er die Entscheidung des Vaters akzeptiert. Da musst du durch, sagte er sich.
Mit lautem Getöse näherte sich der Dampfzug und Xaver stieg zögerlich und ein wenig ängstlich in den Zug nach Lindau. Der Vater rief ihm noch zu: «Mach uns keine Schand und benimm dich anständig.»
Eine grössere Gruppe Jugendlicher begrüsste ihn im Tiroler Dialekt. Er war nicht der einzige, der mit diesem Zug ins Schwabenland zog. Die Begegnung mit Altersgenossen, die sein Schicksal teilten, beruhigte ihn ein wenig. Eine ältere Dame kam auf ihn zu und fragte: «Bist du der Xaver?» Er bejahte und sie fügte bei: «Ich bin eure Reisebegleiterin. Setz dich zu den anderen und bleib bei ihnen, bis wir in Lindau aussteigen.»
Xaver fuhr zum ersten Mal mit der Eisenbahn. Schon oft hatte er die dampfenden Ungetüme beobachtet. Als kleiner Bub rannte er oft den steilen Hang zum Bahnhof Hintergasse hinauf, nur um die riesige, pechschwarze Dampflokomotive mit den fünf gekoppelten Achsen zu bestaunen, die für die Fahrt über die steilen Anstiege der Arlbergbahn eingesetzt wurde. Ihr schwarzer, mit Kohlenstaub versetzter Dampf verdunkelte für kurze Zeit den ganzen Himmel.
Der Zug fuhr erstaunlich ruhig. Er hatte sich das eher wie eine rumpelnde Fahrt auf einem Pferdefuhrwerk vorgestellt. Es roch zwar nach verbrannter Kohle, aber vom Kohlendampf war im Wagon nichts zu sehen. Das änderte sich schlagartig, als er den Kopf weit aus dem Fenster streckte, um in einer Kurve nach der Lokomotive zu sehen. Der Kohlenstaub liess ihn laut husten.
«Du bist wohl neu auf der Schwabenreise?», fragte ihn einer seiner jungen Mitfahrer.
«Jo, das erste Mal», antwortete er schüchtern. «Wie lang dauert die Reise?»
Sein Gegenüber antwortete: «Das kommt drauf an, wohin du gehst. Wo hast du deinen Einsatz?»
«Ich bin bei der Familie Kolb von Gierensberg bei Leupold. Das liegt in der Nähe von Wangen im Allgäu.»
«Da hast du Glück. Das ist nur ein Tagesmarsch von Lindau weg. Auch ich hab meine Stellung in der Nachbarschaft von Wangen. Wir beide sind schon übermorgen Abend bei unseren Bauern. Andere brauchen viel länger. Manche müssen bis nach Kempten gehen. Die haben zwei Tage länger als wir. Kannst du dir vorstellen, wie das gewesen ist, als es noch keine Eisenbahn nach Lindau gegeben hat?»
«Mein Vater ist in seiner Jugend auch im Schwabenland gewesen. Und da hat es die Arlbergbahn noch nicht gegeben. Er hat den ganzen Weg zu Fuss gehen müssen und ist für mehr als eine Woche unterwegs gewesen. Er hat mir gesagt, dass sich die Fusssohlen danach wie verbrannt angefühlt haben. Wie ist es so mit den Dienstherren im Schwabenland?»
«Das kommt drauf an. Den meisten von uns geht es gut, soweit ich weiss. Ich bin letztes Jahr mit meinem Bauern ganz zufrieden gewesen. Die Arbeitstage sind lang gewesen und ich hab wenig freie Zeit gehabt. Aber ich bin von der Familie sehr guet behandelt worden. Ich freu mich eigentlich, sie wieder zu sehen. Der Loisl, der da hinten, hat‘s letztes Jahr nicht so guet getroffen. Er ist fast jeden Tag geschlagen und immer wieder wegen Kleinigkeiten hart bestraft worden. Er hat dann nichts mehr zu essen bekommen oder hat tagelang in einem Loch schlafen müssen. Ich hoff für ihn, dass er es diesmal besser erwischt.»
«Mein Vater kennt die Familie Kolb noch aus seiner eigenen Schwabenzeit. Er hat mir versprochen, dass sie mich guet behandeln», erwiderte Xaver.
Und so kam es auch. Xaver verbrachte einen arbeitsreichen, aber angenehmen Sommer in Gierensberg. Die Familie nahm ihn freundlich auf, fast wie ein Familienmitglied. Die Kost war ausgezeichnet, die Unterbringung sehr einfach. Er musste mit zwei weiteren Kollegen im Stall neben den Kühen schlafen. Aber das machte ihm nicht viel aus. Die meiste Zeit verbrachte er ohnehin auf den Weiden, wo er die Kühe hüten musste.
Viel Arbeit gab es jeweils beim Heuen der Wiesen und bei der Ernte im Herbst. Da mussten alle richtig anpacken. Aber er liebte es, wie der ganze Bauernhof gemeinsam bis spät in die Nacht arbeitete. Nach getaner Arbeit gab es dann jeweils ein Festessen, bei dem auch ihm ein Schnäpschen nicht verwehrt wurde.
Am schlimmsten war das Heimweh. Immer wieder dachte er an seine Mutter und seine drei kleinen Brüder. Oft holte er die Fotografie seiner Familie hervor und betrachtete jedes Gesicht genau. Er wollte niemanden vergessen und sehnte den Tag herbei, an dem er wieder mit den Seinen zusammen sein würde. Da musst du durch, sagte er sich in diesen Momenten.
Er strahlte über alle Masse, als er Mitte Oktober im Bahnhof Hintergasse aus dem Zug ausstieg. Sein Lächeln war um einiges breiter als vor der Abreise. Er hatte während seiner Zeit in der Fremde einige Kilo zugelegt, die seine Wangen deutlich voller machten. Die Familie erwartete ihn bereits, und Mutter drückte ihn bei der herzlichen Begrüssung so fest, dass ihm fast die Luft wegblieb. Er empfand einen unbeschreiblichen Stolz, als er Vater die fünfzig Mark seines Lohns übergab.
Vier weitere Male verbrachte er den Sommer in Gierensberg. Ab dem dritten Mal begleitete ihn sein jüngerer Bruder Arthur. Es war eine grosse Erleichterung, einen der Seinen bei sich zu haben. Auch die beiden jüngsten Brüder gingen nach Gierensberg, aber erst nach der Zeit von Xaver.
KartoffelnOktober 1916
Eugen war sehr stolz auf sich. Er freute sich schon auf die Überraschung, die er seinen Eltern mit seinem Mitbringsel machen würde. In bester Stimmung betrat er das Haus.
Es war schon Abend geworden. Die Eltern sassen mit der kleinen Mina in der Küche. In einem grossen Kochtopf brodelte eine Suppe auf dem Holzherd. Das wird wieder die übliche, dünne Gemüsesuppe sein, dachte er, als er die Küche betrat.
«Grüess eu, luagat mol, was ich euch Feins mitgebracht hab», rief er mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Er holte den grossen, schweren Jutesack hervor, den er seit über einer Stunde auf dem Rücken trug.
Für einen Vierzehnjährigen war Eugen nicht besonders kräftig gebaut. Sicher trug auch die kriegsbedingte Magerkost dazu bei, dass sich sein Körper nicht so richtig entwickeln konnte. So war es für ihn eine enorme Anstrengung, den bleischweren Sack den weiten Weg nach Hause zu schleppen. Bei der Übergabe erwartete er von seinen Eltern eine umso grössere Anerkennung seiner Tat.
«Was um Himmels willen hast du da? Sind das Erdäpfel? Wo hast du die her?», fragte sein Vater Conrad entgeistert.
«Ein Bauer aus Hörbranz hat sie mir gegeben. Ich hab ihm auf dem Hof nur einen kleinen Gefallen mache müsse.»
Conrad schaute ihn kritisch an und erwiderte: «In diesen Zeiten der Not schenkt kein Bauer einem Lümmel wie dir einen Sack Erdäpfel. Du hast ihn geklaut!»
Der Vater stand auf und verpasste Eugen eine Ohrfeige, die es gewaschen hatte. «Bei uns wird nicht gestohlen, merk dir das! Morgen früh bringst du den Sack wieder dem Bauer zurück und entschuldigst dich. Und wo ist das Brennholz, das du eigentlich im Wald hast sammeln sollen?» Und wieder klatschte es heftig auf Eugens Backe, diesmal auf die linke.
Eugen sackte in sich zusammen und fing an zu schluchzen. «Ich wollt doch nur helfen», stammelte er. «Wir hätten damit unseren Hunger für eine ganze Weile stille könne.»
«Wir sind rechtschaffene Leute. Selbst der grösste Hunger rechtfertigt niemals Stehlen. Wenn ich dich noch einmal dabei erwische, will ich dich nicht mehr bei uns sehen.»
Eugen zog sich wimmernd vor Schmerz und Enttäuschung in sein Zimmer zurück.
Conrad bekam Selbstzweifel. Er fragte sich, ob er zu streng mit dem Buben umgegangen war. Eigentlich war er ein mitfühlender und wohlwollender Vater, der nur das Beste für seinen einzigen Sohn wollte. Doch der Diebstahl hatte ihn so in Rage gebracht, dass er sich nicht mehr unter Kontrolle hatte. Dennoch: Stehlen darf es in seiner Familie einfach nicht geben, dachte er.
Es hatte Conrad viele Jahre gekostet, um in der Dorfgemeinschaft Fuss zu fassen. Sein Leben lang fühlte er sich als Aussenseiter. Das fing schon bei seiner Geburt an. Sowohl seine Mutter als auch sein Vater waren uneheliche Kinder. Ihre beiden Familien erkannten sie deshalb nicht als vollwertige Mitglieder an.
Beiden wurde die Erbschaft verwehrt und sie mussten ihre Heimatorte verlassen. Sie zogen beide nach Villingen, wo sie sich erstmals trafen und wenig später heirateten. Vater und Mutter hatten sich wohl zu einer Art Schicksalsgemeinschaft der Verstossenen zusammengeschlossen.
Immerhin konnte Vater bei seinem Stiefvater eine Uhrmacherlehre absolvieren. Dessen Familie aus Schönwald war einer der führenden Hersteller der weithin bekannten Schwarzwald- und Kuckucksuhren.
In Villingen waren Vaters Uhrmacherkünste dann weniger gefragt. Er arbeitete in einem kleinen Schlossereibetrieb und reparierte mechanische Apparate. Dort kam auch Conrad zur Welt. Später zogen sie nach Lochau an den Bodensee, wo sein Vater eine eigene Schlosserei eröffnete. Diese hatte Conrad vor einigen Jahren übernommen.
Die Schlosserei lief anfangs so gut, dass er sich ein kleines Häuschen im Dorfzentrum kaufen konnte. Mit dem Krieg änderte sich das grundlegend. Die Leute hatten andere Probleme oder konnten sich seine Arbeit nicht mehr leisten. Manchmal führte er Reparaturen im Tausch gegen Lebensmittel aus. Ein kleiner Lichtblick in diesen düsteren Tagen.
Obschon er den grössten Teil seines Lebens in Lochau verbracht hatte, fühlte er sich nach wie vor als ein Auswärtiger. Die Leute liessen ihm das zwar nicht direkt anmerken, aber bei wichtigen Entscheidungen im Dorf war er nie dabei. Sein Freundeskreis beschränkte sich vorwiegend auf andere Auswärtige, einige Schwaben wie er. In den Augen der Einheimischen war und blieb er ein zugewanderter Schwabe. Darunter litt er sehr. Er war eigentlich ein geselliger Mann und sehnte sich danach, in den inneren Kern der Dorfgemeinschaft aufgenommen zu werden.
Deshalb war es ihm so wichtig, sich dem Dorfleben so weit wie möglich anzupassen. Nie wäre es ihm in den Sinn gekommen, gegen den Strom zu schwimmen oder grosses Aufsehen zu erregen. Niemals hätte er gegen die Dorfregeln verstossen.
Und nun hatte sein missratener Sohn gestohlen. Das konnte und durfte nicht sein. Sein Ärger darüber war grenzenlos. Die Tat musste rückgängig gemacht werden. Und Eugen musste in aller Deutlichkeit klargemacht werden, dass so etwas nie mehr vorkommen durfte.
Schon nach den beiden heftigen Ohrfeigen wusste Eugen, dass er etwas Unerhörtes getan hatte. Er konnte sich nicht daran erinnern, dass Vater ihn jemals geschlagen hatte. Die unmissverständliche Handlung seines Vaters verfehlte ihre Wirkung nicht: Eugen würde nie wieder in seinem Leben stehlen.
Und er würde, wie sein Vater, immer darauf achten, das Richtige zu tun und mit dem Strom zu schwimmen. Was für die Mehrheit gut ist, ist auch gut für ihn.
DolomitenWeihnachten 1916
«He Lulatsch, geh Schnee hole», rief ein alter Soldat seinem sehr jungen, sehr grossen und schlaksigen Kollegen zu. Der zwei Meter grosse Karl schlüpfte in seine Lederschuhe, holte den grossen Kessel, durchquerte die Kaverne, öffnete die hölzerne Behelfstüre und trat nach draussen. Ein eisiger Wind blies ihm entgegen. Es schneite immer noch und Karl versank im tiefen Schnee. Eilig füllte er den Kessel mit dem frischen Schnee und drückte ihn fest. Nach kurzer Zeit kehrte er mit dem mit Schnee gefüllten Kessel in die schützende Kaverne zurück.
Hier war es um einiges angenehmer. Schon vor Monaten hatten die Truppen hier einen gusseisernen Ofen aufgestellt, grosse Holzreserven angelegt und die Holztür verstärkt, um den Wind weitgehend abzuhalten. Das zahlte sich jetzt aus. Richtig warm wurde es zwar nicht, aber im Vergleich zu den eisigen Temperaturen draussen liess es sich hier drinnen aushalten.
Karl war mit seiner Standschützen-Kompanie zum Wachdienst auf den Monte Piano abkommandiert. Sein Zug hatte in der Felskaverne auf der Bergspitze Stellung bezogen. Zum Glück mussten sie nicht in den weitverzweigten, weiter unten gelegenen Schützengräben Dienst tun, die dem unwirtlichen Wetter viel stärker ausgesetzt waren.
Seit Tagen beobachteten sie von der Kaverne aus die gegenüberliegende Bergspitze, wo der Feind lauerte. Die Tage verliefen weitgehend ereignislos, die Italiener regten sich nicht. Vermutlich lag es am schlechten Wetter und dem vielen Schnee. Ausserdem war heute Heiligabend. Das war nicht der Moment zum gegenseitigen Abschlachten.
Sie waren eine bunt zusammengewürfelte Gruppe aus Jung und Alt. Der Älteste ging bereits gegen die sechzig Jahre zu. Mit seinen siebzehn Jahren war Karl der Jüngste. Alle waren Mitglieder derselben Schützengesellschaft in Sulzberg. Auch Karl hatte sich in diesem Frühjahr, nachdem er das Mindestalter erreicht hatte, als Mitglied eingeschrieben.
Alle Standschützen waren seit 1913 Teil des Landsturms und mussten im Kriegsfall ihre Heimat verteidigen. Karls Schützengesellschaft bildete zusammen mit allen anderen der Bodenseeregion das Standschützen-Bataillon Bregenz. Seit dem Kriegseintritt der Italiener im Mai 1915 wurde es zur Verteidigung an der Dolomitengrenze eingesetzt.
Die Standschützen hatten in der Armee einen schweren Stand, da sie über keine eigentliche militärische Ausbildung verfügten und entweder aus ganz jungen, noch nicht dienstpflichtigen oder sehr alten, ausgedienten Mitgliedern bestanden. Auch Karl wurde nur kurz in das Schiessen eingewiesen, das er ohnehin schon kannte, weil sein Vater ebenfalls Schütze war. Das eigentliche Kriegshandwerk musste er direkt an der Front lernen.
So verbrachte Karl bereits den Sommer in den Südtiroler Alpen an der Front im Grenzabschnitt des Pustertals. Die meiste Zeit wurden er und seine Kameraden für die Nachschubtransporte an Material, Kriegsgerät und Verpflegung eingesetzt. Das war eine äusserst beschwerliche Arbeit. Fast täglich mussten sie mit schwerstem Gepäck mehrere hundert Höhenmeter in teilweise unwegsamem Gelände überwinden. Einmal zogen und schoben sie eine tonnenschwere ehemalige Schiffskanone die steilen Hänge beim Toblinger Knoten hoch. Zum Dank durften sie zusehen, wie sie das erste Mal eingesetzt wurde. Angeblich wurde eine italienische Stellung am gegenüberliegenden Felsmassiv beschossen. Doch Karl sah nur Fels und Geröll, das durch das grosse Kaliber der Kanone zersplittert und in die Luft geschleudert wurde.
In intensive Kampfhandlungen wurde er nur selten verwickelt. Zwar wurde er immer wieder zum Wachdienst in den verschiedenen Gebirgsstellungen eingeteilt, doch waren diese gut geschützt, weswegen es kaum Verluste gab. Im Sommer empfand er daher den Frontdienst als Erholung von den anstrengenden Nachschubtransporten. Während der Transporte wurden sie auch mehrfach beschossen, aber insgesamt hatte seine Einheit nur vereinzelte Verluste durch Feindeinwirkung zu verzeichnen.
Das änderte sich, als der Winter näher rückte. Bereits der Herbst war nass und kalt, so dass im Gebirge früh viel Schnee fiel. Im Winter setzte sich dieses Wetter fort, und Ende Dezember lagen bereits mehrere Meter Schnee im Gebirge. Die Temperaturen fielen in diesen Höhen oft unter minus zwanzig Grad. Alle litten unter diesen mörderischen Bedingungen. Sein Zug verlor drei Kameraden in einer Lawine, fünf weitere wurden nach besonders kalten Nächten tot in ihren Schlafplätzen aufgefunden. Auch Karl schrammte mehrmals knapp am Tod vorbei. Die Versorgung wurde durch die Kälte und die Schneemassen immer schwieriger, weshalb sie zunehmend Hunger litten.
Das Leben an der unwirtlichen Front brachte selbst den jungen, kräftigen und widerstandsfähigen Karl an seine Grenzen. Wie alle seine Kameraden hätte auch er es bitter nötig gehabt, sich in der Weihnachtszeit bei seiner Familie zu erholen. Doch leider wurden er und seine Kompanie zum Wachdienst auf den Monte Piano abkommandiert. Vielleicht erhielten sie keinen Fronturlaub, weil sie als Standschützen keine richtigen Soldaten waren.
Da sassen sie nun in der Kaverne, umgeben von Schnee und Eis. Nicht weit von ihnen entfernt lag der Feind in derselben misslichen Lage eingegraben.
Alfred, der ältere Kamerad, der Karl zum Schneeholen aufgefordert hatte, stellte den Kessel auf den brennenden Ofen. Nach wenigen Minuten begann das Wasser zu kochen und Alfred goss es in eine Teekanne und fragte: «He Karl, willst du auch eine Tasse?»
«Jo gern. Es ist schon bitter, dass wir Heiligabend da verbringen müssen. Wie gern wär ich bei meinen Liebsten», klagte Karl.
Alfred setzte sich zu Karl und erwiderte: «Sei froh, dass wir da in der Wärme sitzen. Denk an die vielen Kameraden, denen es noch schlechter geht.»
«Wann können wir wieder hoam? Wann hört der Irrsinn endlich auf?»
Alfred antwortete: «Ich bin von Anfang an dabei und in den zwei Jahren hat sich nichts geändert. Wir sind immer noch in den gleichen Stellungen, mit den Italienern in Schussdistanz. Egal, was wir oder die Italiener auch versucht haben, alles ist beim Alten bliebe.»
Er fuhr fort: «Stell dir vor: In dem Frühling haben die Italiener die ganze Spitze des Col di Lana in die Luft gesprengt. Ich hab die Explosion aus der Ferne beobachten könne. So eappas hab ich noch nie gesehen: Zuerst ein lauter Knall, riesige Felsbrocken sind in die Luft geschleudert worden. Und dann eine Staubwolke, die bis zum Himmel rauf gegangen ist. Selbst von weitem habe ich die Erschütterung spüren könne. Und was ist das Ergebnis von dieser brutalen Vernichtungsaktion gewesen? Die Unsrigen sind immer noch dort, zwar jetzt auf dem Monte Sief, aber nur wenige hundert Meter vom Col di Lana weg. Alle die Mühe umsonst, viele Tote für nichts. Du siehst, der Krieg wird da nie enden. Es wär vernünftiger, wenn beide Seiten mit diesem Wahnsinn einfach aufhören würden.»
«Doch eigentlich möcht ich‘s den Italienern schon heimzahle», fügte Alfred hinzu.
Karl fragte: «Wieso heimzahle? Den Italiener goht‘s nicht besser als uns. Wir sind beide arme Teufel.»
«Das sind Verräter. Sie sind uns als Bündnispartner in den Rücken gefallen. Das untreue Pack hätte eine Vernichtung verdient. Aber so wie das da in den Bergen läuft, macht‘s einfach keinen Sinn.»
Nach einer kurzen Pause fragte Alfred: «Wieso bist du eigentlich da? Du bist doch nicht wehrpflichtig und könntest eigentlich noch dahoam sein.»
Karl dachte kurz nach und antwortete: «Schon mein Vater hat mir beigebracht, dass es unsere höchste Pflicht ist, die Unsrigen und das Vaterland zu verteidige. Drum hab ich es kaum erwarten können, diesen Worten Taten folgen zu lassen. Die Standschützen sind meine einzige Möglichkeit gewesen, sonst hätte ich noch drei Jahre warten müssen. So bin ich bei euch gelandet. Wieso bist du denn als über Fünfzigjähriger noch bei uns?»
«Wie du weisst, bin auch ich seit meiner Jugend bei den Sulzberger Schützen. Ich hab dann als Korporal in der Gebirgsinfanterie gedient und bin vor zehn Jahren ausgemustert worden. Letztes Jahr bin ich dann, wie alle Schützen, wieder eingezogen worden. Es ist schon anstrengend in meinem Alter. Aber es hat auch etwas Gutes: Ich hab schon viel erlebt und weiss, wie man den Kugeln ausweicht. Für diese eisige Berglandschaft, unser vermeintliches Vaterland, opfere ich mich sicher nicht auf.»
Dabei schaute er Karl tief in die Augen und sagte: «Heb obacht, dass du am Leben bleibst! Das ist das Einzige, was zählt.»
HausverkaufGegenwart
Mit meiner Mutter und meinem Bruder stehe ich vor dem alten Haus meiner Oma. Ich bin schon seit vielen Jahren nicht mehr hier gewesen. Das Haus ist in einem trostlosen Zustand. Der Verputz blättert an vielen Stellen herunter. An den Wänden zeigen sich erste Risse. Bei einigen Holzläden sind die Sprossen abgefallen. Der Holzbalkon des Dachgeschosses scheint zumindest noch intakt zu sein. Dasselbe gilt für das Dach.
Das Haus ist seit einigen Jahren nicht mehr bewohnt. Mutter hatte nach dem Tod meiner Oma die beiden Mieter der unteren Wohnungen behalten und das Haus notdürftig unterhalten. Nachdem auch der letzte Mieter ausgezogen war, hat Mutter nichts mehr am Haus machen lassen und es eingemottet: Strom, Wasser und Heizung wurden abgeschaltet. Seitdem darbt es in einer Art Dornröschenschlaf vor sich hin. Kein Wunder, dass es jetzt so aussieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in diesem Zustand wieder bewohnbar gemacht werden kann.
Aber darum geht es uns gar nicht. Das Haus steht mitten auf dem Gelände einer Käsefabrik, dem einst grössten Betrieb in Lochau. Meine Oma war, solange ich sie kannte, in einem ständigen Kampf mit den Inhabern. Es ging um Lärm- und Geruchsemissionen oder um Nutzungs- und Wegrechte. Alles praktische Dinge, wenn zwei Parteien in engster Nachbarschaft hausen. Erstaunlicherweise konnte Oma, trotz der mächtigen und finanzstarken Gegenpartei, einige Siege in diesen Auseinandersetzungen erringen.
Grosse Teile des Areals waren einst in Familienbesitz. Bis zur Lindauerstrasse am See reichte das Grundstück. Die industriellen Käser haben im Laufe der Zeit fast alles aufgekauft, immer dann, wenn die Familie in Not war. Umso tiefer sass der Stachel bei Oma. Sie hatte sich nie bei mir darüber beklagt, aber ich merkte ihr jeweils an, wie sehr ihr diese Geschichte des Verlusts zu Herzen ging.
Nun ist es soweit: Auch das letzte verbliebene Stückchen Land verlässt nach so vielen Jahrzehnten die Familie. Meine Mutter hat sich lange dagegen gesträubt, aber jetzt hat sie eingesehen, dass es an der Zeit ist. Wir können das Haus nicht länger vergammeln lassen. Und der Zeitpunkt ist günstig.
Die Käsefabrik wurde vor kurzem stillgelegt und die Inhaber wollen auf dem grossen Areal eine Überbauung mit luxurösen Mehrfamilienhäusern erstellen. Die Lage direkt am Bodensee ist hervorragend. Ohne die Kleine Parzelle von Omas Haus könnte das Projekt aber nicht realisiert werden.
«Hör auf zu träumen», ruft meine Mutter. «Wir sind spät dran. Die warten schon auf uns.»