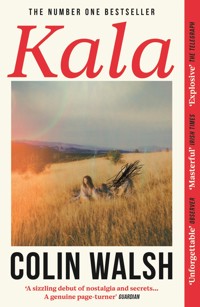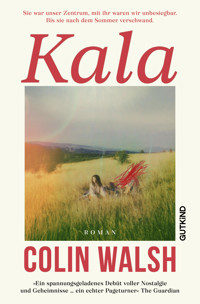
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gutkind Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Fans von Tana French und Donna Tartt werden Kala lieben – stilistisch brillant und mit einer unheimlichen Spannung, die sich langsam entfaltet.« The Guardian In der Kleinstadt Kinlough an der Westküste Irlands treffen drei alte Freunde nach Jahren wieder aufeinander. Im Sommer 2003 gehörten Helen, Joe und Mush zu einer unzertrennlichen Clique um die mutterlose und ungestüme Kala Lanann – das strahlende Zentrum ihres Universums. Bis sie kurz darauf spurlos verschwand. Jetzt, 15 Jahre später, kehrt Helen widerwillig für eine Hochzeit nach Irland zurück. Joe, mittlerweile ein berühmter Musiker, ist ebenfalls in der Stadt. Und Mush hat es nie aus Kinlough herausgeschafft. Dann werden menschliche Überreste im Wald gefunden. Als Gegenwart und Vergangenheit aufeinanderprallen, müssen sich die einstigen Freunde ihrer Schuld stellen. Welche Rolle haben sie bei Kalas Verschwinden gespielt? »Rasant und fesselnd – meisterhaft.« Irish Times »Mitreißend ... Kala macht süchtig.« Daily Telegraph
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Das Buch
In der Küstenstadt Kinlough an der Westküste Irlands treffen drei alte Freunde nach Jahren wieder aufeinander. Im Sommer 2003 gehörten Helen, Joe und Mush zu einer unzertrennlichen Clique um die mutterlose und ungestüme Kala Lanann – das strahlende Zentrum ihres Universums. Bis sie kurz darauf spurlos verschwand.
15 Jahre später kehrt Helen widerwillig für eine Hochzeit nach Irland zurück. Joe, mittlerweile ein berühmter Musiker, ist ebenfalls in der Stadt. Und Mush hat es nie aus Kinlough herausgeschafft.
Dann werden menschliche Überreste im Wald gefunden. Als Gegenwart und Vergangenheit aufeinanderprallen, müssen sich die einstigen Freunde ihrer Schuld stellen. Welche Rolle haben sie bei Kalas Verschwinden gespielt?
Der Autor
Colin Walsh stammt aus Galway und lebt in Belgien. Für sein Schreiben wurde er mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Kala ist sein erster Roman und wurde zu einem großen Bestseller.
Die Übersetzerin
Andrea O’Brien übersetzt seit vielen Jahren zeitgenössische englischsprachige Literatur und wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Bayerischen Übersetzerstipendium.
www.gutkind-verlag.de
Dieses Buch wurde mit Unterstützung von Literature Ireland veröffentlicht.
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds e. V. gefördert.
Die Originalausgabe ist erstmals 2023 unter dem Titel Kala bei Atlantic Books, London, erschienen.
ISBN978-3-98941-131-9
Copyright © 2026: Gutkind Verlag GmbH, Berlin
Copyright der Originalausgabe: Copyright © 2023 by Colin Walsh
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München, nach einer Vorlage von © Helen Crawford-White
Coverabbildung: © Hannah Shea
Autorenfoto: © Rein de Wilde
E-Book: Sandra Hacke, Dachau
Alle Rechte vorbehalten.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt ungeachtet der sämtlichen Lesegeräte keinerlei Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb sind eine Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Gutkind Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Über das Buch / Über den Autor
Impressum
Titel
Index der Hauptfiguren
Sommer 2003
Sommer 2018
Samstag
Samstagnacht
Sonntag
Montag
Dienstag
To Here Knows When
Danksagung
Navigationspunkte
Cover
Inhalt
Textbeginn
Colin Walsh
Kala
Roman
Aus dem irischen Englisch von Andrea O’Brien
Für meine Eltern
»Man blickt nicht an der Zeit entlang zurück, sondern in sie hinein und hinunter wie durch Wasser. Manchmal kommt dieses an die Oberfläche, manchmal jenes, manchmal gar nichts. Nichts geht weg.«
– Margaret Atwood, Katzenauge
»In Kyoto bin ich,
doch beim Schrei des Kuckucks,
sehn ich mich nach Kyoto.«
– Bashō
Index der Hauptfiguren
Der Ort:
Kinlough, Touristenstädtchen an Irlands Westküste
Die Gang:
Joe Brennan
Katherine »Kala« Lanann
Helen Laughlin
Aidan Lyons
Mush
Aoife Reynolds
Die Brennans (Joes Familie):
Dudley Brennan, Joes Vater
Margaret Brennan, Joes Mutter
Die Lananns (Kalas Familie):
»Mammy« Lanann, Kalas Großmutter
Die Laughlins (Helens Familie):
Rossie Laughlin, Helens Vater, bald mit Pauline Lyons verheiratet
Theresa Laughlin, Helens jüngere Schwester
Die Lyons (Aidans Familie):
Ger Lyons, Vater von Aidan und den Zwillingen, Paulines Ex-Mann
Pauline, Mutter von Aidan und den Zwillingen, bald mit Rossie Laughlin verheiratet
Donna und Marie Lyons, Aidans jüngere Schwestern, »Die Zwillinge«
Teabag Lyons, Lee Lyons und Boomerang Lyons, Aidans Cousins, Gers Neffen
Lydia, Aidans Tante, Paulines Schwester, Mushs Mutter
Mush, Cousin von Aidan, Donna und Marie, Paulines Neffe
Sommer 2003
Wir harren auf unseren Rädern, oben auf dem Hügel. Über uns der Himmel, wie grau gerührtes Eis. Unten glitzert die Stadt. Wir sind fünfzehn, es ist der Sommer unseres Lebens, logisch, dass Kinlough mit uns den Atem anhält, wir stehen unter Strom, und die Stadt pulsiert wie wir. Sie jagt mit uns durchs zuckende Zwielicht, schnurrt über die weiten Weiden, schlängelt sich durch den Fluss, wärmt sich auf Dachziegeln und Vorsprüngen, steigt mit uns empor, mit jedem Klackern höher hinauf, Sneaker schrappen übers Geröll, sehenden Auges stupsen wir die Vorderreifen über die Hügelspitze, sachte, direkt über den Rand des Abgrunds.
Wir sind die Mädchen: Kala, Aoife, Helen. Wir sind die Jungen: Aidan, Joe, Mush.
Kala ist zwischen uns. So nah, dass wir die Sommersprossen über ihrem ausgefransten Hemdkragen erkennen. Sie duftet nach Sheabutter und Räucherstäbchen, Teebaumöl und Tabak. Ein schielendes Auge schon woanders, das andere fest aufs Ziel gerichtet, da unten.
Das Ziel ist eine schmale Lücke am Fuß des Hügels. Ein Spalt zwischen zwei Häusern, durch den sich der Radweg auf die Hauptstraße ergießt. Autos flitzen und blitzen darin auf, von links nach rechts. Der Plan lautet, auf dem Rad den Abhang runter, blindlings durch den Spalt und geschmeidig und ohne Kratzer über die Hauptstraße zu rasen. Eine Prüfung der Willigen, die zeigen wird, ob wir dem Augenblick gewachsen sind. Schwer zu sagen, von wem die Idee eigentlich mal stammte, denn mittlerweile kommuniziert unsere Gruppe wie ein Starenschwarm in Formation, voll telepathisch verändert er seine Gestalt. Eins ist allerdings allen klar: Wenn wir im falschen Moment auf die Straße rausschießen, erwartet uns da unten das kreischende Chaos.
Deshalb ist es ja so aufregend.
Kala will als Erste. Hat sie gesagt. Es gibt eine schweigende Abmachung, dass sie in Wahrheit nicht allein fährt, wir machen das zusammen. So läuft das. Wir sind ein Team. Immer noch. Sie umklammert den Lenker fester, wir warten auf das Signal. Sie beißt sich auf die Unterlippe, und wir machen uns bereit. Abgewetzte Converse-Sneaker heben sich zu den oberen Pedalen. Der Himmel hält den Atem an. Kalas Vorderreifen tastet sich vor, ihr Fahrrad neigt sich zum Sturz, die Zeit dehnt sich aus und ruckelt, als wir anderen hinterherstrampeln, unter uns die Welt im Schleudergang, unsere Räder stürzen vom Gipfel ins Nichts, wo plötzlich kein Treten mehr nötig ist, allein die Schwerkraft wirkt, katapultiert uns vorwärts, reißt unter unseren Reifen die Piste auf, während wir schneller, immer schneller rasen, Verkehr lauter, Lücke breiter, Jungs kreischen, Fahrradketten knirschen, da ist Kala, sie strampelt wieder, wir alle schreien, und sie lehnt sich vor, setzt sich an die Spitze, sammelt alle Kraft zum Sprint, ihr Haar zuckt und flattert wie ein dunkles Blitzgewitter vor uns her, als die Piste jäh in die Straße mündet und alle Laute zu Lärm werden, und im Donnern dieses Augenblicks sind wir wie Gischt, die zu Ozean wird.
www.missing.ie/missing_persons/katherine-lanann/
KATHERINE »KALA« LANANN
Seit 3. November 2003 aus Kinlough vermisst
Geburtsjahr: 1988
Alter: 15
Größe: 1,65 m
Haarfarbe: Schwarz
Augenfarbe: Braun
Statur: –
Zuletzt trug sie einen langen Jagdmantel, darunter ein Army-Hemd und schwarze Jeans. Sie besaß außerdem eine auffällige Schultertasche mit der Aufschrift RATM.
Katherine »Kala« Lanann war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens fünfzehn Jahre alt. Sie verließ ihr Haus am Abend des 3. November 2003. Die Polizei geht davon aus, dass sie sich mit einer unbekannten Person verabredet hatte.
Gegen zwanzig Uhr an jenem Abend rief sie jemanden aus einer Telefonzelle im Nachbarort Carthy an. Kurz darauf wurde eine Jugendliche, auf die Kalas Beschreibung passt, dabei beobachtet, wie sie sich zur Hintertür eines Fahrzeugs der Marke Hyundai Accent oder ähnlich hinabbeugte, das Auto soll eine dunkle Farbe gehabt haben. Eine der Beschreibung entsprechende Jugendliche wurde dann noch einmal gegen Mitternacht in Kinlough gesehen. Nachdem Kala an jenem Abend nicht nach Hause zurückgekehrt war, meldete ihre besorgte Großmutter sie bei der Polizei als vermisst.
Trotz der damaligen, breit angelegten Suche durch die Gardaí und der umfangreichen Berichterstattung bleibt Katherine »Kala« Lanann bis zum heutigen Zeitpunkt verschwunden.
Wer Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle oder der zentralen Vermissten-Hotline unter 1800666111 zu melden. Sämtliche Hinweise werden vertraulich behandelt.
Diese hier aufgeführten Informationen wurden mit dem Einverständnis der Großmutter der Vermissten veröffentlicht.
Ein mit der Aging-Methode bearbeitetes Porträtfoto finden Sie auf missingkids.ie
Weitere Fotos auf www.helpfindkala.bebo.com
E-Mail: [email protected]
Sommer 2018
Freitag
Mush
Ich bin zwar schon weit über dreißig, aber wenn der Sommer über diese Stadt hereinbricht, geht mir immer noch das Herz auf. Voll der Ferien-Vibe. Steigt mir der erste Hauch von Sonnencreme und frisch gemähtem Rasen in die Nase, krieg ich gleich wieder dieses Kribbeln im Bauch. Erwischt mich immer wieder, echt wahr. Als würde ich jedes Jahr vergessen, dass dieser Duft existiert und zack! Die Welt ist wieder jung. Dann die langen Abende, das Summen der Bienen, der ganze krasse Scheiß.
Nach Ladenschluss sitze ich im Fenster des Cafés, auf dem Tresen steht ein Sechserpack Tuborg. Ich kipp mir die Dosen rein und schau zu, wie Kinlough dahinschmilzt, bis es glänzt, sich auf der Fox Street in Szene setzt, auf und ab stolziert, der Hammer. So lebendig haben die Leute das ganze Jahr nicht ausgesehen, ungelogen. Das Grinsen breiter. So ein bisschen Hitze lässt die Leute durchdrehen – schon nach einer Woche sind alle krebsrot und durchgeknallt –, aber sie scheißen drauf, weil Kinlough macht hier den Karneval, in gesättigten Farben. Mütter schieben Kinderwagen, pickelgesichtige Jungs albern rum, Mädels rauchen, glamourös, mit übertriebenen Gesten. Ein paar Monate im Jahr darf Kinlough das sein, was es immer sein wollte.
Letzten Sommer, als ich noch geraucht habe, bin ich alle paar Stunden aus dem Café, hab Mam gesagt, ich geh mir eine drehen. Aber eigentlich wollte ich nur ein bisschen Ruhe, um den Sommer zu spüren, nur einen Augenblick, um richtig einzutauchen.
Dieses Jahr ist es aussichtslos. Wenn ich kann, schaue ich aus dem Fenster, aber die Stadt macht keine Pause, es ist knallvoll. Du kannst das Geld riechen. Die Leute stürmen ins Café und rattern hysterisch ihre Bestellungen runter, Schweiß läuft ihnen übers Gesicht, kaum dass sie ins klimatisierte Innere treten. Es geht mir so auf den Sack. Mam findet es natürlich super. Sie plaudert mit den Leuten, schreit gegen die Kaffeemühle an, ein Cappuccino, ein Kompliment. Mit dem Rücken zur Kundschaft mache ich den Barista, werfe gelegentlich einen Blick auf das irre Treiben da draußen. Ich bin wie ein Hund im heißen Auto. Nicht mal tagträumen kann man, so hektisch ist es.
Und die Schlange wird immer länger, weil Mam die Babys bezirzt und den jungen Kerlen erzählt, wie stark sie aussehen – »Oh, du wirst noch ein paar Herzen brechen!«, so Blödsinn eben –, sogar die Kleinsten bringt sie zum Lachen. Beugt sich über den Tresen, während die Zwerge neben ihren Müttern mit Telleraugen zu ihr hochschauen. Immer nervt Mam rum, ich soll meine Arbeit unterbrechen und ihnen bröselige Browniestücke anbieten, aus dem kleinen Korb neben der Kasse. Wie ein Bettler aus dem Mittelalter strecke ich ihnen den Korb hin. Mam kriegt sich gar nicht mehr ein, macht ein großes Ding draus. »Das sind Mushs Brillante Brownies! Mush backt die jede Woche, für Jungs und Mädels wie euch!« Die Kinder fummeln stumm an ihren keksvollen Mündern herum, alles ist Schokolade. Dann murmeln die Mütter so Sachen wie »Was sagt man zu dem netten Mann?«, und die Kinder danken mir auf ihre typisch verstrahlte Art. Ich drehe mein Gesicht weg, damit sie es nicht sehen. Manche Mütter machen ein Riesentheater, Mushs Brillante Brownies, ist das nicht toll!, nur um zu zeigen, dass ihnen mein Gesicht nichts ausmacht. Andere wirken verschreckt, schauen mich entsetzt an, und diese Aufrichtigkeit kann ich respektieren, auch wenn ich deswegen am Hals rote Flecken kriege. Dann bedanke ich mich verschämt und kümmere mich wieder um den Kaffee, ein Handtuch über der Schulter, den Kopf gebeugt spähe ich aus dem Fenster und zähle die Stunden bis zum Ladenschluss, wenn sie sich alle endlich verpissen und ich die Anlage aufdrehen kann und mein Dosenbier am Fenster exen, der Stadt ein bisschen beim Freidrehen zusehen, abdriften in den Bierrausch wie ein Drachen, der seine Schnur kappt.
Es ist nicht leicht. Die Leute sind total aufgekratzt. Man könnte meinen, das läge am Pferderennen, wir haben Race Week, dazu gibt’s ein Festival mit Umzug, all das. Aber nee, darum geht’s nicht. Letzte Woche haben sie im Wald eine Leiche gefunden. Am See. Sterbliche Überreste, hieß es. Niemand weiß, wer es ist. Gewesen ist. Alle so: SterblicheÜberreste, flüstern sie laut genug, dass es jeder hört, tun so, als hätten sie geheime Infos.
Mam ist genauso schlimm wie alle anderen. Als Tante Pauline vorhin reinkam, hab ich zuerst gedacht, sie will über ihre bevorstehende Hochzeit sprechen. Aber das Gespräch ist rasant aus der Spur geschlittert und im Abgrund der sterblichen Überreste gelandet. Sterbliche Überreste, haben sie gemurmelt, im Chor, sich an ihren Worten gelabt, entzückt, dass endlich was los ist, über das sicher auch die Zeitungen berichten.
Die Menschen sind solche Aasgeier, echt wahr.
Alle haben sie ihre Theorie. Sogar ich. Irgendwo in einem dunklen Winkel meines Verstands hab ich sofort an Kala gedacht. Das wollte ich nicht denken, aber du kannst dich ein Leben lang daran abarbeiten, deinem Hirn vorzuschreiben, was es zu denken hat, kannst versuchen, deine Gedanken zu kontrollieren, als wärst du der scheiß Rain Man, ist alles für’n Arsch. Das Hirn macht, was es will. Die Leute sagen »Überreste«, und in meinem Kopf legt sich ein Schalter um, ich sehe Gliedmaßen im Tümpelschlamm, wie die abgerissenen Hände aus Der weiße Hai, aus denen mit klackernden Scheren lauter Krebse hervorgekrochen kommen. Nur, da sind auf einmal nicht nur Gliedmaßen, da ist Kala, sie ist meine Freundin, und wir sind wieder fünfzehn, und sie sieht mich an, als könnte ich ihr noch helfen, und es ist das nackte Grauen.
Deswegen habe ich heute den Mund gehalten, auch als Mam und Tante Pauline darüber getratscht haben. Dann haben sie rumgenervt, ich soll mir für die Hochzeit die Haare schneiden lassen. Mam meinte, ich sähe aus wie rückwärts durch die Hecke gezerrt. So lange hat sie auf mich eingeredet, bis ich irgendwann gemeint habe, ja, okay, die Spitzen schneiden, nur damit sie endlich Ruhe geben. Hab mich weggedreht und auf Sachen konzentriert, auf die ich mich freue.
Meine paar Dosen Tuborg. Hab sie den ganzen Tag kaltgestellt.
Und jetzt gibt’s hier nur noch mich und die Musikanlage. Ich hab die Kasse gemacht, den Boden gewischt, die Tische auch. Sitze schon fast an meinem Stammplatz am Fenster.
Ich staple die letzten paar Stühle, als die Türglocke klingelt und die Zwillinge reinschneien, auf ihre herrische Weise auf ihre Lieblingsbank zusteuern. Tante Pauline hat die Zwillinge nach den Osmonds benannt, Donna und Marie. Donna hat prollige kleine Zöpfe, eng am Kopf geflochten, und ihr Zickengesicht schreit: Ich bin sechzehn, die Welt ist scheiße. Marie hat sich ihr Haar zu zwei Knödeln hochgebunden und sieht aus wie Minnie Maus. Sie grinst und zeigt mir den Finger, bevor sie sich beide auf die Bank fläzen.
Ich erwidere ihren Gruß.
Als sie noch jünger waren, sind sie nach Feierabend oft ins Café gekommen, um noch eine heiße Schokolade zu trinken, aber das ist seit der Entdeckung von Eyeliner und Selbstbräuner so gut wie vorbei.
Ich hab die Maschine schon geputzt, sage ich ihnen, und staple weiter Stühle. Sie grüßen mich nicht mal, flüstern nur miteinander. Marie daddelt am Handy, Donna reißt Zuckerpäckchen auf und verteilt den Inhalt auf meinem frisch gewischten Tisch. Ich zögere kurz. »Den hatte ich gerade sauber gemacht«, sage ich dann aber doch. Donna verdreht dermaßen theatralisch die Augen, dass ich den Kopf neige, damit sie mein Grinsen nicht sieht.
Mit einem geräuschvollen Seufzen tippe ich auf den Tresen. Ich sehe sie förmlich vor mir, die schwitzenden, glänzenden Dosen, ganz hinten im Kühlschrank. Dieser kleine Augenblick des Tages gehört mir. Mir allein. Die Zwillinge sitzen auf ihrer Bank, es ist ihnen egal. So geht das nun schon eine ganze Weile mit ihnen. Sie gehen einem auf den Keks mit ihrem megamürrischen Schweigen, bis man Fragen stellt, nur um das Schweigen zu brechen, für das sie allein verantwortlich sind. Teenager.
»Und, was habt ihr so getrieben heute?«
»Ach.« Marie zuckt die Achseln und starrt aufs Handy. »Nix.«
Sie hält Donna das Display hin, und Donna lacht drauflos, klatscht sich die Hand auf den Mund.
»Oh my God«, sagt Donna, und sie kichern gemeinsam. »Oh my God.«
Ich seufze. »Heiße Schokolade?«
Donna zuckt die Achseln. »Passt.«
»Ich nehm ’nen Flat White, Mush«, sagt Marie gähnend. Ich hebe die Braue – Flat White? –, und sie erwidert den Ausdruck, ein breites, spöttisches Grinsen im Gesicht. Wieder muss ich den Kopf senken, damit sie mein Lächeln nicht sieht. Das würde sie nur anstacheln.
Also mache ich mich an die Arbeit, mahle die Bohnen, schäume die Milch, während sie sich hinter mir zusammenrotten und über das kichern, was da auf Maries Handy passiert.
Irgendein dummer Teil von mir sieht sie immer noch als Kinder. Und sie waren echt süß. Damals auch schon ein bisschen anstrengend, ja, aber man würde sie nicht eintauschen wollen. Früher war ich der coole Cousin, ich sollte immer bei ihnen übernachten. Hab ihnen Lager gebaut, Decken über den Spalt zwischen ihren Betten drapiert, der Kerker einer Hexe, in dem sie gefangen gehalten wurden. Ich hab mit ihnen Filme geschaut, die jedes Kind kennen sollte – Die Braut des Prinzen, Die Goonies, so Sachen. Auf sie aufzupassen, gab mir das Gefühl, wichtig zu sein, mehr als nur die Aushilfe in Mams Café. Donna und Marie haben mich zum Paten für ihre Firmung gewählt, ich habe sie der irisch-katholischen Tradition gemäß bei dieser Feier begleitet, sie sogar zur kleinen Party im Anschluss ins Fitz Hotel eskortiert. Eine echte Disco mit bunten Lichtern und Discokugel. Und lauter zwölfjährige Mädchen, zusammen auf der Tanzfläche, im Zuckerrausch, euphorisch in der Masse. Damals war Tante Pauline noch mit Onkel Ger verheiratet. Ich hockte still zwischen ihnen und Mam, hielt mich an meinem Pint fest, als die Zwillinge angerannt kamen und mich auf die Tanzfläche zerrten. Ich wär am liebsten im Erdboden versunken. Hielt die ganze Zeit den Kopf gesenkt. Aber die Mädchen waren begeistert, haben gejubelt und gerufen: »Mush! Mush!«, mich wie eine Trophäe ihren Freundinnen vorgeführt.
Jetzt dreht Marie gerade zwei Zigaretten, als ich ihnen die Getränke bringe.
»Eure Mutter war vorhin hier.«
Marie blickt nicht mal auf. »Pauline«, sagt sie in einem Singsang wie Dolly Partons »Jolene«.
»Hat sie gesummt?«, fragt Donna. »Neuerdings summt sie nur noch rum. Hochzeitsflattern. Putzt das Haus und lacht vor sich hin.«
»Ist doch schön, oder nicht?«, frage ich.
»Sie benimmt sich dämlich«, sagt Donna.
»Ach komm!«, sage ich. »Sie ist einfach glücklich.«
»Sie. Ist. Dämlich«, wiederholt Donna. Meine Güte ist die heute angepisst. Wenn sie so in Form ist, hat sie eine Falte zwischen den Brauen. Das fand ich schon immer süß.
»Tja«, sage ich, »nicht mehr lang, dann ist der große Tag vorbei und alles wieder normal.«
Verlegenes Schweigen. Blöder Spruch von mir, stimmt schon. Natürlich wird nichts mehr normal sein – ihre Mutter heiratet wieder. Sie und Rossie Laughlin beginnen am Montag auf dem Standesamt ihr gemeinsames Leben. Als sie letztes Jahr zusammengezogen sind, in Rossies Haus, ging es eine Weile zu wie bei den Bradys aus der Fernsehserie, zwei Familien unter einem Dach: Pauline und die Zwillinge zusammen mit Rossie und Rossies Tochter Theresa. Vorhin haben Mam und Pauline auch über Theresa geredet: »Wie alt ist sie jetzt genau? Fünfundzwanzig? Sechsundzwanzig?« – »Eine von diesen Veganern ist die.« So hat Mam das gesagt: »Eine von diesen Veganern«, als wäre Theresa eine Außerirdische. Mam hatte mich vor ein paar Monaten dazu verdonnert, Theresa beim Umzug in ihre eigene Wohnung zu helfen. Zuerst war ich total angespannt, weil ich aus meiner Komfortzone rausmusste. Aber es war echt witzig, mit Theresa abzuhängen. Eigentlich war sie für mich immer noch Helens kleine Schwester, aber in Wahrheit ist sie eine erwachsene Frau, die Hippie-Tee einschenkt und witzige Reisegeschichten erzählt und über ihre Kunstseminare redet, als hätte ich eine Ahnung davon. Ich konnte es mir nicht verkneifen, Theresa zu fragen, ob Helen wohl zur Hochzeit nach Hause kommen würde, aber sie hat nur mit den Achseln gezuckt und geschnipst – was weiß ich.
»Seid ihr bereit für Tante Paulines große Feier morgen?«, frage ich.
»Aber so was von«, sagt Donna verächtlich.
»Sie nennt es Junggesellinnenabschied«, sagt Marie.
»Jungfernabschied«, sagt Donna.
»Wir bringen Pimmel-Strohhalme mit«, sagt Marie.
Donna grunzt. Hoffentlich lassen sie das schön bleiben.
»Immer noch Schluss mit Rauchen?«
»Jepp.«
»Wird dir das nicht langweilig? Vielleicht solltest du vapen«, sagt Marie. Die Idee scheint sie zu begeistern. »Ja, geil, du solltest vapen!«
»Vaper sind Wichser«, zischt Donna.
Wow, ist die geladen, meine Fresse.
Donna war schon immer aufbrausender als Marie. Nicht so gut mit Worten, haut immer ein bisschen daneben, haarscharf vorbei, ärgert sich dann über sich selbst und lässt die Wut an anderen aus. Ich erinnere mich an einen Abend in ihrer Küche, da waren die Zwillinge noch jung und stopften sich mit Salamipizza voll. Sie waren völlig aufgedreht, weil ich zum Babysitten gekommen war. Kreischten »Fressen in die Fresse! In die Fresse!«, während sie mampften. Tante Pauline war dabei, Onkel Ger die Krawatte zu binden und mir gleichzeitig Anweisungen zu erteilen, Zähneputzen, Bettzeiten, die ganze Nummer, als Donna rief: »Schaut mich an!« Sie hielt sich eine Pizzascheibe an die Wange, es sah aus wie eine monströse Narbe. Ich wusste, dass sie es nicht böse meinte, aber es drehte mir trotzdem den Magen um, als sie mit tiefer Stimme verkündete: »Ich bin Mush! Ich bin Mush!«
Tante Pauline hat sich in Grund und Boden geschämt. »Donna, mein Schatz!«, rief sie, den Blick unweigerlich auf meine Narben gerichtet. »Das ist nicht nett.«
Onkel Ger marschierte schweigend auf Donna zu und packte sie am Schopf. Sie kreischte. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Es war furchtbar. »Was sagst du zu deinem Cousin?«, fragte Ger mit ruhiger Stimme. »’tschuldigung’tschuldigung«, jammerte Donna.
Bei dieser Erinnerung rutsche ich jetzt auf dem Stuhl herum. »Wie geht’s eurem Dad?«
»Ganz fantastisch«, sagt Marie. »Hockt bestimmt gerade besoffen in seiner Küche rum.«
»Wünschte, ich wär besoffen«, sagt Donna.
»Er ist so ein armseliger Wicht«, sagt Marie.
»Er ist einfach traurig«, sagt Donna.
»Armseliger Wicht«, wiederholt Marie mit fester Stimme. »Hockt da auf seiner Farm und versinkt im Selbstmitleid. Da würd ich nicht mal für Geld bleiben. Und wie der aussieht, der letzte Hänger.«
Ich weiß, es klingt fies, aber ich bin froh, dass Marie auf diese Weise über ihren Vater spricht. Donna empfindet noch immer eine verirrte Loyalität zu ihm, dabei ist eines klar: Onkel Ger ist ein übler Typ. Seit der Scheidung vor ein paar Jahren haust er mit seinem Neffen Teabag auf der großen Farm draußen im Warren. Mam hat sich tierisch gefreut, als Tante Pauline sich endlich von ihm getrennt hat.
»Na, ihr seid sowieso bald auf dem College«, sage ich, tappe nervös auf dem Boden rum. Ich will meine Dose. »Nur noch zwei Jahre. Danach müsst ihr nie wieder bei eurer blöden Familie leben.«
»Du bist unsere Familie«, sagt Donna. »Du bist nicht blöd.«
Jetzt sehen mich beide an. Zwischen ihnen herrscht Anspannung. Irgendwas passiert hier gleich. Keine Ahnung, was, aber auf einmal wird mir klar, dass sie die ganze Zeit darauf hingearbeitet haben.
Donna steht auf – »Ich muss pissen« – und haut ab. Das ist alles inszeniert. Marie wirft ihrer Schwester hinter meinem Rücken einen Blick zu, bevor Donna in Richtung Klo abdampft.
»Ja, witzig, dass du das erwähnst«, sagt Marie. »Ich mein, die ganze Wohnsituation. Das ist gerade echt so ein Thema. Weil, wir müssten uns gar keine Gedanken mehr machen über Mam oder Dad und so, wenn du uns Geld leihen würdest, damit wir unsere eigene Wohnung bezahlen könnten.«
Mir entfährt ein Geräusch, irgendwas zwischen Lachen und Husten. »Wenn was?«
»Genau.« Marie nickt, als hätte ich gerade einen Vorschlag gemacht. »Wir hatten uns nämlich schon gedacht, dass wir mit dir darüber sprechen könnten. Weil, wär das nicht cool, wenn Donna und ich unsere eigene Bude hätten?«
Sie sieht mich erwartungsvoll an. In diesem Moment sollte ich eigentlich gerade meine zweite Dose exen.
»Wieso wollt ihr nicht bei eurer Mam und Rossie wohnen? Mögt ihr Rossie nicht?«
»Mam mag Rossie«, erklärt Marie. »Mam mag Rossie so sehr, dass es für sie niemanden sonst mehr gibt auf der Welt. Könnten wir nicht irgendwas ausmachen mit dir und deiner Mam? Nur damit wir die Kaution zahlen können.«
Ich ziehe an meiner Lippe. »Was sagt Onkel Ger dazu?«
»Der hat nix zu sagen, der olle Alki.«
»Ja, aber …«
»Und du weißt genau, dass deine Mam uns hilft, wenn du es ihr vorschlägst.«
»Wenn ich es vorschlage?«
»Ja, ich mein, warum nicht? Willst du uns nicht helfen?«
»Was? Nein, es ist doch … klar doch. Ist nicht, weil ich das für eine schlechte Idee halte oder so was.«
»Was dann?«
Ich denke scharf nach. »Na … ihr seid noch ein bisschen jung, so. Wovon wollt ihr die Miete zahlen? Und das Essen?«
»Ja, da würde uns dein Kredit helfen.«
Ich reibe mir die Stirn. »Ach, nee … denk doch mal daran, wie aufwendig das wäre. Für deine Mam.«
Marie schnaubt. »Wohl eher aufwendig für dich.«
»Nein, nein, darum geht es nicht. Nur, ich …«
»Wenn du nicht helfen willst, sag’s einfach.«
»Nein, du hörst mir nicht zu. Ich glaube nur …«
»Weißt du was?«, sagt Marie und schiebt sich beide Zigaretten hinters Ohr. »Vergiss es. Wir dachten, du würdest es vielleicht verstehen.« Sie sammelt ihr Zeug ein.
»Ach komm, Marie!«, sage ich, als Donna vom Klo zurückkehrt.
»Er hat Nein gesagt«, verkündet Marie.
»Siehste? Wusste ich’s doch. Können wir endlich abhauen?«, fragt Donna.
»Mädels«, sage ich, während ich versuche, aus der Bank zu klettern.
»Keine Sorge, Mush«, ruft Marie an der Tür. »Wir kommen schon allein klar. Wie immer.«
»Meine Güte!«, sage ich. »Mädels!«
Marie stößt die Tür auf, die Glocke klingelt. Durch die Scheibe ruft sie: »Viel Spaß mit deinen Dosen!«
Ich wollte gerade was erwidern, keine Ahnung, was, als Donna sich umdreht und mich durch die Scheibe fixiert, während sie davonmarschieren. Und es schockiert mich. Ihr Gesicht in der Scheibe. Sie ist nicht mal wütend. Nur traurig. Ich öffne den Mund, um ihnen hinterherzurufen, aber das kann ich mir auch sparen. Sie sind schon weg.
Helen
Das Busfenster. Meine Stirn stößt gegen das Busfenster. Auf der anderen Seite der Scheibe verwandelt sich die Welt bereits in Kinlough. Das erkenne ich, weil der Himmel so komisch leuchtet, die Bäume auf einmal so fremd aussehen und es heiß in meinen Eingeweiden rumort. Bald muss ich aussteigen. Bald werde ich dort ankommen, wo ich schon bin. Kinlough.
Der Bus fährt vom Motorway runter, und wir tauchen ein in das arterielle Straßennetz, das die Stadt umgibt. Über uns neigen sich die Bäume, lassen Lichtsplitter auf die Ärmel der Fahrgäste herabfallen. Heckenbüschel bauschen sich an den Fenstern, die Straßen werden enger und dunkler und überwachsener. Hexenfinger kratzen an den Scheiben. Ich bin schon drin in den Adern dieses Viertels. Von Kala hab ich seinen Namen als Erstes gehört, sie nannte es Warren.
Ich hole mein Handy raus.
bin jetzt im warren
Nachdem ich die Nachricht mit einem Ausrufezeichen versehen habe, schicke ich sie ab, bevor ich sie wieder löschen kann.
Alle anderen im Bus schlafen. Oder tun so. Sie könnten genauso gut tot sein. Neben mir sitzt eine sabbernde Frau. Sie sieht aus wie eine Wasserleiche. Ich frage mich, ob ich den Aufwand betreiben sollte, mich zu schminken, beschließe aber, dass mir das zu übertrieben ist. Mache es trotzdem, wohl doch nicht zu übertrieben.
Theresa hat die Nachricht gelesen, aber nicht beantwortet. Ich schicke ihr ein paar aufgeregte Emojis. Vor ein paar Tagen habe ich ihr endgültig bestätigt, dass ich komme. Ich habe keinen angemessenen Grund gefunden, um nicht zur Hochzeit meines Vaters zu erscheinen, obwohl ich seit zehn Jahren nicht mehr hier war. Theresa und ich hatten über Facebook Kontakt gehalten, eine Weile jedenfalls. Mit der Zeit verstummten unsere oberflächlichen Chats, stattdessen setzte jede ein höfliches Like unter die Bilder der anderen. Diese Illusion von Kommunikation. Die Menschen haben immer schon Ausreden erfunden, um Kontakte einschlafen zu lassen – Adresse verloren, falsche Telefonnummer. Das Internet macht diese altmodischen Rechtfertigungen einfach überflüssig. Irgendwann habe ich meine Accounts gelöscht. Seitdem hat sich mein Verhältnis zu Dad und Theresa auf ein paar Mails pro Jahr reduziert. Was mir gut passt. Gestern Abend hatten Theresa und ich abgemacht, uns am Busbahnhof zu treffen. Sie freue sich auf mich, hatte sie geschrieben. Das war lieb von ihr. Ich mich auch, hab ich zurückgeschrieben. Das war lieb von mir.
Der Warren umgarnt den Bus. Bäume hat es hier immer schon gegeben. Knorrige Äste und verzerrte Fratzen lauern, harren. Die Straßen sind immer noch rumpelig, voller Steine und Schlaglöcher.
Ich wollte nie wieder zurückkehren.
***
Ich war vierzehn, als Dad uns die Nachricht überbrachte, dass wir nach Kinlough ziehen würden. Theresa und ich sollten uns nebeneinander aufs Bett setzen, das wir uns teilten, damals in der alten Wohnung in Drogheda. Irgendwo hatte er wohl gelesen, dass man es so machte, wenn man Kindern etwas Wichtiges mitzuteilen hatte. Sie auf der Bettkante versammeln. Ich hatte schon eine Weile beobachtet, wie er vor sich hin nickte, in der Wohnung auf und ab lief und wie ein Gestörter Entschlüsse fasste. Immer wieder hatte er an meine Tür geklopft, sie aber nie geöffnet, und oft hatte das Telefon geklingelt, bis spät in die Nacht hinein. Ich wusste, dass er schon wieder umziehen wollte. Theresa und ich saßen auf dem Bett und hörten ihn sagen, dass wir dringend eine Veränderung bräuchten. Theresa versuchte die ganze Zeit, Misty auf den Schoß zu nehmen, aber Misty wollte nicht, befreite sich aus ihren Armen und sprang zu Boden. Lag dort ausgestreckt wie ein Läufer mit traurigen Augen. Gelegentlich stupste ich sie mit dem Fuß an, woraufhin sie zu mir aufschaute und mit dem Schwanz auf den Teppich klopfte. Mistys Augen waren wunderbar feuchte schwarze Tümpel. Sie trösteten mich über das hinweg, was da gerade geschah, und ich war froh, sie zu haben.
Dad spulte seine größten Hits ab: Tapetenwechsel. Frischer Wind. Neuanfang. Ich hatte sie schon zigmal gehört. Aber als er sagte: »… deswegen … ziehen wir … nach Kinlough!«, und seine Stimme bei der letzten Silbe anstieg, er sie langzog und wie ein Seil des irren Optimismus über uns aufspannte, wusste ich ehrlich nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Ich blickte zu ihm auf, er hatte mich schon die ganze Zeit im Blick gehabt. Was für eine lächerliche Idee. Kinlough war ein Ausflugsziel, kein Ort, wo man wohnte. Früher sind wir regelmäßig hingefahren, vierzehn Tage Sommerurlaub, als Mam noch gut beieinander war. Pferderennen, Festivals. Versteckspielen in Caille Woods. Zuckerwatte am Straßenrand, wenn der Umzug durch die Fox Street marschierte. Mam nannte unseren jährlichen Besuch einen »netten kleinen Anker« – womit sie vermutlich meinte, dass sie in Kinlough mal kurz Atem holte, bevor sie sich wieder dem echten Leben zuwandte, das immer woanders stattfand. Egal, wo wir gerade waren, für Mam – wie für alle interessanten Menschen – fand das Leben woanders statt. Aber Dad wollte unbedingt nach Kinlough zurück. Obwohl seine Eltern schon lange tot waren, zog es ihn in seine Heimatstadt. Mam bezeichnete das immer als Symptom eines wirren Verstands. Und jedes Mal half ich Mam am Ende des Urlaubs beim Packen des Transporters, nur damit ich Dad nicht sehen musste, der schmollte, weil der Abschied gekommen war. Mam flötete mir zu: »Zwei Wochen im Jahr sind mehr als genug, stimmt’s?«
Doch als Theresa und ich auf unserem Bett saßen, konnte ich sehen, wie sehr sich Dad auf diesen Umzug freute und wie sicher er war, dass wir genauso aufgeregt sein würden, in Kinlough zu wohnen. Selbst damals fand ich es deprimierend, wenn erwachsene Männer wegen irgendwelcher Sachen so eine kindliche Aufregung empfanden. Diese Erwartung, dass die Welt ihnen tatsächlich auf halbem Weg entgegenkommt. Ich glaube, meistens stimmt es sogar. Er habe sich einen Job gesucht und uns ein Haus, sagte er. Ein echtes Haus, wo Theresa und ich eigene Betten hätten, in eigenen Zimmern. Und er kriegte sich gar nicht mehr ein. Stolz wie Oskar. »Alles unter Dach und Fach«, sagte er und rieb sich dabei den Nacken, blinzelte uns an, stammelte: »W-wir f-f-fangen n-noch mal von v-v-vorne an.«
Theresa kreischte und sprang vom Bett, um ihm um den Hals zu fallen, worauf Misty mit nervösem Kläffen reagierte, sie stellte sich auf die Hinterbeine und sprang an Theresa hoch, und so änderte sich die Atmosphäre, es herrschte Feierlaune, natürlich genau, wie Dad es gewollt hatte – der Himmel hing voller Geigen –, und er küsste Theresa auf die Stirn und nahm sie auf den Arm wie ein kleines Kind, tätschelte Misty mit der freien Hand die Ohren, und sie hatten ihren wunderbaren Fotomoment. Ich blieb sitzen und sah ihnen stumm zu. Am liebsten hätte ich ihnen mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen.
»Was ist mit meiner Schule?«, fragte ich. »Wir haben Mai. Ich habe in einem Monat Prüfungen.«
Theresa hing Dad am Hals, und er grinste sie an. »K-k-kannst du die P-P-Prüfungen nicht auch an der n-n-neuen Schule m-m-machen?« Er wuschelte mir durchs Haar, als wäre ich der Hund. »S-s-so schlau, wie du b-b-bist? Machst du mit links.«
Theresa meinte, das seien die besten Neuigkeiten der Welt, und Dad war glücklich, weil sie glücklich war, aber Theresa war nur glücklich, weil sie erst zehn war.
Ich war überhaupt nicht glücklich. Ich war vierzehn.
***
Der Busbahnhof hatte sich verändert. Früher stand hier ein großer Schuppen mit gammeligen Tauben, die von ihren verrosteten Dachbalken runterglotzten und auf den schiefen Boden kackten. Junge Typen in Hoodys rotzten zwischen ihre Sneaker in die Pfützen, und es gab eine wackelige Bretterbude, wo man beim Kippenkaufen nicht nach dem Alter gefragt wurde.
Jetzt prunkt hier ein neongreller Traum aus Glas. Über jedem Platz hängt ein Bildschirm mit den Abfahrtszeiten. Es sieht aus wie in jedem anderen Bahnhof. Dieselben Bänke wie überall, mit Metallgittern, damit dort keine obdachlosen Menschen schlafen können.
Mein Rollkoffer klackert neben mir her, bis mein Blick auf ein Plakat fällt und ich abrupt stehen bleibe. »Jungle Heart: Bringing It All Back Home.«Da ist ein Foto von Joe, noch als Teenager, der mit großen Augen in die Kamera blickt wie Bob Dylan auf dem Cover von »Bringing It All Back Home«. Ich frage mich, ob Kala das Foto geschossen hat. Das Datum auf dem Plakat verrät mir, dass das Konzert diese Woche stattfinden wird. Zum ersten Mal seit Jahren bin ich wieder hier, und Joe Brennan ist auch zurück in der Stadt. Super. Fucking Super.
Draußen ist der reinste Ofen. Kinlough im Sommer. Dicke Luft, ein süßlicher Duft.
Ich schicke eine Nachricht an Theresa: gerade gelandet!
Im Gegensatz zu Flughäfen sind Busbahnhöfe keine Horte der Glückseligkeit. Gleich auf der Straße steht an der Ecke Richtung Innenstadt ein Mensch mit dickem schwarzem Hoody, die Kapuze fest über den Schädel gezogen, trotz der Hitze oder gerade deswegen. Er steht da, als hätte ihn der Blitz getroffen. Ein versteinerter Schatten. Er gehört zur normalen Bevölkerung des Busbahnhofs. Ein lauernder Irrer.
Theresa antwortet:
irrer verkehr
kannst du zum Hogans Square kommen?
Um von dieser Straßenseite aus zum Hogan’s Square zu gelangen, muss ich an dem Verstrahlten vorbei, der mich, wie ich jetzt bemerke, schon die ganze Zeit anstarrt. Ich halte seinen Blick, dann schaue ich wieder aufs Handy. Schließlich überquere ich die Straße, damit ich nicht um ihn rumlaufen muss.
Mein Rollkoffer klappert mit den Rädern, die fast aufplatzenden Scharniere schlagen gegen meine Hacken, Leute rempeln mich an, eilen zu ihren Bussen.
Ich gehe schneller, doch dann sehe ich, dass auch der Verstrahlte die Straßenseite gewechselt hat und jetzt an der Ecke lauert, auf die ich mich zubewege. Irgendwas stimmt nicht an seiner Körperhaltung. Seine Arme stehen steif zu beiden Seiten ab. Selbst aus der Entfernung erkenne ich, dass seine Finger gekrümmt und angespannt sind. Ich checke mein Handy.
hol dich am Burrito-Imbiss ab
ganz hinten am Platz
Ich spüre seinen Blick. Stelle die üblichen Überlegungen an. Rede mir zu, sei nicht paranoid. Wechsle erneut die Straßenseite. Doch dann sehe ich im Augenwinkel, dass er dasselbe tut. Auch er wechselt die Straßenseite.
Wieder überlegen. Hat er die Hände in den Hosentaschen? Nein, sie sind draußen, er holt sich keinen runter. Hält er was in den Fingern? Eine Flasche? Ein Messer? Nein, seine Hände sind leer. Aber er hat die Finger wie Klauen gekrümmt.
Ich werde an ihm vorbeigehen. Ich werde mich nicht schon jetzt von dieser Stadt fertigmachen lassen. Das hat Kala mir beigebracht: Geh immer so, als würdest du es ernst meinen. Ich straffe die Schultern und beschleunige meinen Schritt, um selbstbewusst zu wirken, dann gehe ich wieder langsamer, um ihm zu signalisieren, dass ich ihm kein Selbstbewusstsein vorspielen muss. Ich schaue ihn nicht an. Nicht direkt. Er ist ein dunkler Fleck in meinem Augenwinkel. Ein Schatten. Nichts, was man fürchten müsste. Ich nähere mich. Meine Fingernägel graben sich in meine Handflächen. Haut über den Fingerknöcheln weiß gespannt. Ich muss an der Mauer entlangschrammen, damit ich ihn beim Vorbeigehen nicht berühre. Er steht mir voll im Weg. Nah genug, um mich anzugrabschen. Oder zu spucken. Ich warte auf sein Manöver. Das gemurmelte Wort. Zicke. Schlampe. Fotze.
Aber er sagt nichts.
Ich habe die Ecke umrundet, werfe aber erst an der nächsten Ampel einen Blick zurück, er schaut mir hinterher, die Arme immer noch ausgestreckt, also haste ich auf die Straße, um ihm zu entkommen, und die Autos hupen, weil ich nicht das Recht habe, über die Straße zu gehen, obwohl mein Körper so danach schreit, und ich laufe schneller, Blick zu Boden, nur weg vom Bahnhof, und als ich endlich wieder aufsehe, sind da Gesichter, und Stimmen wimmeln um mich herum in der Luft, Leute tummeln sich auf dem Rasen, trinken aus Dosen, essen Eis, Studierende johlen und werfen Frisbees und lärmen, daneben stehen gedrängt die Touristen, starren auf ihre Handys, völlig arglos, sehen nicht die Gefahr, die Typen mit ihren nackten Oberkörpern und schwingenden Schultern, die über den Platz stolzieren, ihre Medaillen glänzen in der Sonne, vorbei an den Büroangestellten mit ihrem toten Blick, die mit offenen Hemdkragen und gelockerten Krawatten auf Bänken über ihrem Dosenbier hängen, und ich werde mitgerissen, ich bin mittendrin, Kinlough umschäumt mich wie eine wogende See, und ich bin eine einsame Insel in der grinsenden Gischt vom Hogan’s Square.
Joe
Hogan’s Square tobt. Es ist Freitag, ich bin auf dem Weg zu Flanagan’s. Die Leute sind kurz vorm Explodieren. Sie wollen tanzen, schwitzen, ficken. Sie wollen. Du lieferst. Die Konturen des Platzes lösen sich auf, er kommt dir entgegen. Du bist der neue Mittelpunkt. Gesichter recken sich zu dir hin wie Blumen zur Sonne. Spürst ihre Energie, das erregte Zucken, wenn sie dich erkennen. Ist das Joe Brennan? Handys werden gehoben, Fotos geschossen, aber du gibst dich ahnungslos, schwebst über allem, in einer anderen Welt – The Other Place.
Heute Abend bist du zum ersten Mal ohne die Armschlinge unterwegs. Dein Ellbogen war noch empfindlich, als du in der Küche den Gips aufgeschnitten hast, die Haut darunter wie eine fleckige Korsage. Aber morgen kannst du wieder Gitarre spielen, wenn du den Arm jetzt nicht zu sehr beanspruchst. Ganz sicher. Mit dem Ellbogen konntest du zwar nicht trainieren, aber du hast gesehen, wie die Mädels da drüben deine Brustmuskeln bewundert haben, deine Tattoos.
Du hörst den Lärm im Flanagan’s, bevor du die Straße überquert hast. Musik dröhnt, Bohrer brummen, Nägel werden in Bretter gehämmert. Du hast es so gewollt. Offiziell wird die Venue erst nächste Woche eröffnet, aber du willst den Buzz schon jetzt, deswegen stehen die Türen weit offen, und die Musik dringt nach draußen, die Leute können schon mal einen Blick hinter die Kulissen werfen auf die magische Show, die du Kinlough bescheren wirst. Es gibt ein Schaufenster zur Straße mit einer kleinen Bar, die jetzt schon Pints to go verkauft. Vor der Rezession war das Flanagan’s eine Legende unter den Bars. Jetzt bist du eingeflogen, um den Laden mit deinem Geld wieder neu zu beleben. Ein spektakulärer Relaunch. Junge aus dem Ort kommt groß raus. Die Plakate mit dem Programm hängen schon in den Fenstern – Solo Acoustic Shows ab morgen Abend. »Bringing It All Back Home.« Alle sollen es wissen. Heute Abend geht es darum, sich sehen zu lassen, das Personal zu begrüßen, ein paar Fotos für ihre Social-Media-Kanäle und deine.
Bleibst stehen, damit ein paar Mädels Selfies mit dir machen können. Ohmygod, ohmygod, ohmygod. Sagst ihnen, sie sollen brav sein und schlenderst zwischen den im Stau stehenden Autos hindurch über die Straße, spürst förmlich, wie sie hinter ihren Windschutzscheiben große Augen machen, als sie dich erkennen.
Im Flanagan’s wimmelt’s wie im Bienenstock. Du bleibst an der Tür stehen, atmest den Augenblick. Die Sägespäne auf dem Boden. Die unbehandelten Holztische. Kerle mit Hipsterbärten hängen ein altes Fahrrad auf, hoch über der Bar. Mehrere Projektoren stehen bereit, Exploitation-Filme aus den Siebzigern flimmern über die Wände. Tätowierte Mädchen an der Bar stopfen Kerzen in leere Weinflaschen. In der Ecke, wo die Gesellschaftsspiele stehen, bemalen Kerle in Oliver-Twist-Kostümen die Wand mit Figuren aus Bosco und The Morbegs. In der Fotokabine poliert jemand den Sitz. Duggan steht mit einem Notizblock hinterm Tresen und macht Inventur. Nickst ihm zu und schlenderst auf die Bühne, schlüpfst hinter das DJ-Pult neben der PA-Anlage. Regelst langsam die Lautstärke runter, damit die Leute es nicht mitkriegen. Da ist ein Mikro. Schaltest es ein, die Lautsprecherboxen knacksen. Alle Gesichter drehen sich zu dir. Die Erkenntnis geht wie eine Welle durchs Publikum. Lachst ins Mikro. »’n Abend, Jungs und Mädels. Ich wollte nur kurz Hi sagen. Ihr macht einen fantastischen Job. Das wird fucking awesome! Ich lege hier erst mal ein paar Tunes auf und begrüß euch dann alle persönlich. Hoffentlich seid ihr so begeistert von diesem neuen Abenteuer wie ich. Alles klar? Alles klar!«
Ein paar Leute applaudieren, während du deinen Laptop einstöpselst, Spotify anklickst und die Playlist startest, die du den ganzen Nachmittag über zusammengestellt hast.
Gehst die Sache langsam an. Schön geschmeidig hochkochen. »Our Theme« von Barry White und Glodean. Die Synths plätschern gemächlich dahin, und als Barrys Gesang durch die Boxen röhrt, klirren die Flaschen an der Bar. Die Leute arbeiten jetzt irgendwie konzentrierter. Spannung liegt in der Luft. Dieser Laden ist ein Universum, und du hältst es in der Hand. Spürst die Blicke des Personals. Machst auf abwesend, als würdest du den Horizont betrachten, als wärst du die Musik. Die Miene von Bob Dylan. Ein Visionär, der ins Mystische starrt. Früher Abend noch und so süß. Die Luft knistert. Schießt in der Kabine ein Foto von der Bühne. Flaschen und Körper leuchten warm und verschwommen im Hintergrund. Fummelst mit den Filtern rum, dann postest du das Ding auf Insta, Hashtag Our Theme x. Schon nach zehn Sekunden das erste Like von Theresa. Und von Mush. Stierst aufs Handy, bis du 100 Likes hast. Unter dreißig Sekunden. Gut.
»Lonely Disco Dancer« von Dee Dee Bridgewater. Die Leute machen ihre Arbeit, aber sie wippen zur Musik. Die Tattoo-Girls lächeln dir zu, während sie sich in den Hüften wiegen. Das ist der Vibe, den du haben willst, wenn der Typ nächste Woche fürs Interview hier aufkreuzt. Ein Porträt im Rolling Stone, zehn Jahre The Other Place. Der Text soll mehrere Orte in Kinlough abdecken. Porträt des Künstlers als Einheimischer. Seit fünf Jahren lebst du in L. A., alle sechs Monate jettest du mal kurz nach Kinlough. Hier hast du den Heimvorteil. Kannst es fühlen, tief in dir drin. Du bist gelandet. Du bist hier.
Duggan, an der Bar, poliert die Gläser.
»Rattenscharfe Bräute heute Abend«, sagt er mit Blick auf die Mädchen. »Was kriegst du? Immer noch Omabier?«
Du nickst, und Duggan holt ein alkoholfreies Paulaner aus der Kühlung, schüttelt den Kopf, als es beim Öffnen klickt und zischt. »Traurig, wenn ein Junge aus Kinlough während der Race Week keinen echten Drink bekommt.«
»Tja, damit musst du wohl leben.«
Duggan ist einer von denen, die Kinlough nie verlassen haben und der sich nur über seine Beziehung zu dieser Stadt definiert. Er ist eine große Nummer hier, hat über die Jahre mehrere Bars gemanagt, weswegen er glaubt, er kann mit dir auf Augenhöhe kommunizieren. »Das Zeug ist wie Bier mit ’nem Kondom drüber«, sagt er.
Ignorierst ihn. Du hast ihm die Sache mit deinem Ellbogen schon erklärt, die Prellung, die Schmerzmittel. Kannst erst wieder Alkohol trinken, wenn alles ausgeheilt ist. Das ist noch nicht mal gelogen. Aber Kinlough ist nicht L. A., wenn die Leute hier sehen, dass du keinen Alkohol trinkst, werden sie sofort misstrauisch. Irgendwas in ihrem Blick verschließt sich.
Sagst, du musst kurz raus an die Luft. Isaac Hayes’ »Walk On By« groovt durch den Raum, die 12-Inch-Single-Version.
»Passt«, sagt Duggan, während er ein Tattoo-Girl fixiert, das sich über den Tresen beugt, um den Rahmen eines Fotos neben dem Spiegel gerade zu rücken. Darauf bist du mit deiner ersten Band zu sehen. Du mit Mush und Aidan, schmal, rote Wangen, Gitarrenkoffer an der Seite. Ihr macht auf cool, die Arme verschränkt späht ihr in die Kamera, in Sonnenlicht gebadet, das durch die Fontäne im Brunnen auf dem Hogan’s Square strömt.
Immer, wenn ihr freitags endlich aus der Schule kamt, hatte schon jemand zuvor Fairy Spülmittel reingekippt. Ihr standet an der Bushaltestelle rum, darauf bedacht, ja nicht auf die vielen Mädchen zu reagieren. Schließlich hattet ihr mit vierzehn schon ein halbes Leben Erfahrung darin, nicht mit Mädchen im gleichen Alter zu reden. Ihr wart alle zusammen auf der Grundschule gewesen, Mädchen und Jungen gemischt, bis man euch vor der Kommunion mit sieben Jahren trennte. Dann hat man die Jungs auf die St. Judes verfrachtet, eine Jungenschule, nur ein paar Meter entfernt, aber so gut wie auf einem anderen Planeten. An der Jungenschule war alles anders, da galten neue Regeln, und ihr musstet sie über Nacht lernen. Wie man fluchte und rotzte und rangelte. Wie man jemanden in Grund und Boden starrte, zutrat, ohne am Fuß gepackt zu werden, jemandem an seinem Geburtstag eine Abreibung verpasste, ohne ihm wehzutun. Das hat euch zusammengeschweißt, dich, Mush und Aidan, euch stärker gemacht wie bei zusammengebundenen Stöcken, dass keiner unter Druck zerbrach. Auf der Grundschule warst du der König gewesen. Musstest nicht kämpfen, um dich zu behaupten, so wie alle anderen, weil du der Beste im Football warst und der Schlauste im Unterricht. Jetzt warst du vierzehn und auf der weiterführenden Schule, St. Simon’s, auch nur für Jungen, deine Haare hingen dir strähnig ins Gesicht, und deine Stimme war schon tiefer. Es wurde gemunkelt, dass die Mädchen total auf die Jungs von St. Simon’s standen, denn auf die kam man nur mit Aufnahmeprüfung. »Nur die Besten gehen auf die St. Simon’s«, hatte Dad oft gesagt. Du und Mush wart richtig geschockt, als ihr gemerkt habt, dass das Schulleben auf St. Simon’s nichts mit California High School oder Buffy oder Dawson’sCreek gemein hatte. Auch hier gab’s wieder nur einen Haufen stinkender Kerle.
Freitags seid ihr jedenfalls nach der Schule rüber zum Hogan’s Square gelatscht und habt cool getan, um die Bräute von St. Anne’s zu beeindrucken. Und du wusstest, dass auch Mush gut aussah – die anderen Mams haben ständig darüber geredet. Er hatte lockiges Haar und ein »Boyband-Gesicht«, wie Mam es nannte. Ihr habt euch betont lässig ans Geländer gelehnt, und Aidan hat versucht, Mush den Schaum vom Brunnen in die Haare zu schmieren, worauf Mush und Aidan sich in den Schwitzkasten genommen haben und der ganze Platz ihnen dabei zugeschaut hat, und du, du hast gelacht und sie an ihren Ranzen gezogen, bis sie auf die Nase fielen, und wenn die Mädels von St. Anne’s rüberschauten, habt ihr noch lauter rumgejuxt und gerangelt, im Bus, bis nach Hause, wo ihr eure Ranzen unter die Treppe geschleudert habt, dann raus aus den Uniformen, rein die Jogginghose, Essen verschlungen, was auch immer Mam euch hingestellt hatte – den Mund verbrannt, mit der Hand gefächelt, wie die Hunde gehechelt –, schnell wieder raus zum Köpfen und Kicken zwischen den alten Toren auf dem Taylor’s Schulhof. Noch nicht lange her, da hättet ihr Soldaten gespielt, wärt auf dem Schulgelände rumgerannt, hättet euch hinter den Klassen-Containern verschanzt, euch gegenseitig abgeknallt. Mush konnte das immer voll genial, hat getan, als würde er an einer Maschinengewehr-Salve krepieren, sich gekrümmt und gewunden, bevor er zu Boden ging. Doch jetzt wart ihr zu alt für so was. Nach dem Fußball, wieder zu Hause, tischte euch Mam den Freitagsklassiker auf: Chicken Nuggets mit Pommes und ganz viel Spezialsoße. »Woher weißt du eigentlich immer genau, wann wir wieder nach Hause kommen?«, fragte Aidan, worauf Mam lachte und meinte, das sei weibliche Intuition. »Das ist wunderbar, Margaret«, sagte Aidan dann, die Arme verschränkt wie ein Erwachsener. Solche Sachen sagte er gern zu deiner Mam, um dich zu ärgern. Nach dem Klassiker gab es eine riesige Balgerei im Wohnzimmer, bis euch schlecht war, danach Nintendo, Chips und Schokolade und lautstarke Verarsche. Wenn Dad dann mit einer Schachtel Magnum Mandel zur Tür reinkam, musstet ihr erst mal eine Runde mit ihm Armdrücken, bevor er euch das Eis überreichte. Er verlor gern absichtlich und rief dann: »Das ist Polizeigewalt«, was die Jungs zum Schießen fanden, weil Dad dabei noch seine Polizeiuniform trug. Danach hat er sich in seinen Sessel verzogen, mit der Zeitung geraschelt und ist irgendwann eingeschlafen. Gegen zehn hat er Aidan nach Hause gefahren.
Manchmal seid ihr danach noch hochgegangen, nur du und Mush, um ein bisschen zu quatschen.
Immer, wenn es sich so ergab – das Quatschen – geschah es mit einer gewissen Heimlichkeit. Das war unbekanntes Territorium. Quatschen war Mädchensache. Aber mit Mush war das anders. Er quatschte gern mit dir. Er wusste eine Menge über Filme, viel mehr als du. Seine Mam ließ ihn alles schauen. Er nahm die abgefahrensten Sachen aus dem Fernsehen auf, die ihr euch dann ansaht, wenn du bei ihm übernachtetest, über dem Café seiner Mam. Sachen mit Möpsen drin und alles. Meist habt ihr die Filme gar nicht verstanden, aber ihr habt sie trotzdem geschaut und dabei gewusst, dass sie größer waren als Kinlough – ein Teil dieser anderen Welt, The Other Place, realer und viel romantischer als das Leben –, und gelegentlich hallte der Film noch im Zimmer nach, wie ein Echo der Zukunft, dann saßt ihr am Fenster in der Wohnung seiner Mam und habt schweigend auf die Fox Street runtergeschaut.
Da saßt ihr auch, als du ihm das erste Mal von dem Mädchen erzählt hast.
Zuerst hast du sie an der Bushaltestelle am Hogan’s Square gesehen. Manchmal auch auf der Fox Street. Da stand sie und starrte vor sich hin, wie mitten im Soundtrack. Wilde schwarze Mähne, ein lässiger Schatten um den Mund. Ihre Brauen – großes Kino. The Other Place. Mush wusste gleich, von wem die Rede war. Meinte, sie würde manchmal mit ihrer Freundin, so ’ner lauten Blonden, in Mams Café aufkreuzen. Einen ganzen Samstag hast du dort auf sie gewartet, so getan, als würdest du ein Buch lesen, aber sie ist nicht aufgetaucht.
Jeden Freitag nach der Schule dieses schwindelige Gefühl und die Hoffnung, ihr an der Bushaltestelle zu begegnen. Dieser Moment, als du endlich den Mut aufbrachtest, dich am Geländer neben sie zu stellen, sie mit Musik aus ihrem Discman auf den Ohren. Der Tag, als du dich im Bus fast neben sie setztest.
Du hast ihr ungestüme Gedichte geschrieben, Songtexte, hast dir Momente mit ihr erträumt, Szenen aus dem Fernsehen und den Musikvideos. Hast ins Tagebuch geschrieben, Sachen wie »Egal, wo ich stehe, ich bin ein Ufer, das sie überschwemmt«, die hast du Mush laut vorgelesen, und er hat die Augen geschlossen, weise den Kopf gewiegt und mit schmerzverzückter Miene gemurmelt: »Das knallt einem voll ins Herz, Mann. Wie Michael Corleone, nachdem er in Sizilien Apollonia kennengelernt hatte und dann abhauen musste, weil er McCluskey und Sollozza getötet hatte, und sie dann hochgejagt wird von den Barzinis, und Michael nie drüber wegkommt, und dann der Pate wird.« Mushs Hirnwindungen liefen rückwärts. Aber deswegen konnte man mit ihm quatschen – in ihm steckte auch was von dieser anderen Welt, The Other Place.
Als du ihm erzähltest, dass du noch einen Song über sie geschrieben hattest, war er ganz aufgeregt und wollte ihn unbedingt hören. Zuerst hast du dich geziert, aber am Ende hast du es natürlich doch gemacht. Ihr würdet berühmt werden, irgendwann. In den Biografien würden sie Fotos von deinen handgeschriebenen Songtexten veröffentlichen, und du und das Mädchen, aus euch würde eines dieser legendären Paare werden, Symbolfiguren der wahren Liebe. John und Yoko, Sid und Nancy.
Wie oft hat Mush dir freitags den Ellbogen in die Rippen gestoßen, du solltest zu ihr rübergehen und sie fragen, was sie gerade hört. Aber du warst immer zu nervös. Einmal hast du dir eingebildet, sie würde dich anschauen, und da haben dir die Wangen gebrannt, während Aidan wie ein Idiot rumgefetzt ist, die Hände geballt, er wollte Mush über die Birne knubbeln. Mush hat Aidan mit Absicht provoziert, um ihn abzulenken, damit du ganz geschmeidig mit ihr reden könntest. Aber du hast dich nicht getraut. Keine Eier. Mush hat dich nie damit aufgezogen, ein Blick genügte, um dir zu zeigen, dass er verstand. Das war so geil an Mush. Da war eine bestimmte Melodie, eine bestimmte Filmszene, und mit einem Blick war klar, dass ihr dasselbe dachtet. So einen Freund hat man nur einmal im Leben. Und Mush war deiner.
***
Hey Mann
was geht ab?
fertig im Café?
Yo Mann
super busy lol
kommst noch flanagans?
Chill hier draußen
Mush antwortet nicht. Seit deiner Rückkehr wolltest du dich mit ihm treffen. Schon seit drei Wochen. Liest deine Nachricht noch mal. Chill. Klingt wie jemand aus L. A. Du siehst es regelrecht vor dir, wie Mush die Augen verdreht.
Gegenüber, auf dem Hogan’s Square, herrscht der normale Wahnsinn, die Leute trinken, liegen im Gras, erhaschen die letzten Sonnenstrahlen. Dass du mit deinem Drink vor Flanagan’s stehst, ist kein großes Ding, überhaupt nicht. Dein Bier ist alkoholfrei, also trinkst du nicht mal richtig. Das hast du so entschieden, und wo läge das Problem, wenn du wieder trinken würdest und dies hier ein echtes Bier wäre? Du bist ein erwachsener Mann. Es ist Race Week. Du brauchst keine Erlaubnis. Du arbeitest. Wer arbeitet, kann auch trinken. Du bist ein Rockstar, verdammte Scheiße.
Schießt ein Foto vom Pint und postest es auf Insta, als jemand ruft: »Hey, Sexy!« Die Zwillinge überqueren den Rasen. »Krieg ich ’n Schluck?«, ruft Marie. Donna schlappt wie ein depressiver Schatten neben ihr her.
Marie ist ein echter Flirt. Sie hat schon immer gerne geredet, aber jetzt ist jeder Satz aufgeladen und sie erwartet, dass du den Ball zurückspielst. Gerade willst du ihr eine Antwort zurufen, hast die Stimme schon erhoben, als es dir kalt ums Herz flattert. Flüchtig betrachtet könnte man meinen, das sei Theresa, die da an den Zwillingen vorbei über den Hogan’s Square läuft. Fast könnte sie es sein, ein Teil von ihr ist da. Aber irgendwas stimmt nicht, ihre Haltung, ihre Frisur, die Ausstrahlung. Sie hat den Rücken gestrafft und funkelt in die Gegend, getrieben, einen Rollkoffer in der Hand.
Es ist Helen.
Am liebsten hättest du dich schnell nach drinnen verzogen, bevor sie dich sieht.
Marie umarmt dich sanft. »Geht’s dir gut?« Das macht sie jedes Mal, wenn sie dich sieht, seit deiner Rückkehr. Donna hält sich wie immer mit misstrauischer Miene im Hintergrund. »Was macht der Ellbogen?«
»Dem geht’s blendend.« Rascher Blick über die Schulter, über den Platz. Helen steht noch da. Handy in den Fingern, schaut sich um. Du musst verschwinden.
»Ist es nicht schwierig, damit Gitarre zu spielen?«, fragt Marie, während sie deine blauen Flecken berührt. Sie steht dicht vor dir. »Sieht aus wie ein geiles Armband. Könnte glatt eins von deinen Tattoos sein.«
Als sie dir einen gefährlichen Blick zuwirft, schnaubt Donna hinter ihr verächtlich. »Meine Fresse.«
Mush hat dir mal gesagt, er sei überzeugt, dass Donna irgendwann an tödlicher Langeweile sterben würde.
Marie macht ein Selfie mit dir für ihre Instagram-Story. Du grinst automatisch. In deinem Kopf ist Lärm. Der Platz, das schrille Crescendo von Isaac Hayes in der Bar hinter dir, das laute Geschnatter der Leute um dich rum.
Helen, noch immer dahinten. Helen, in Kinlough.