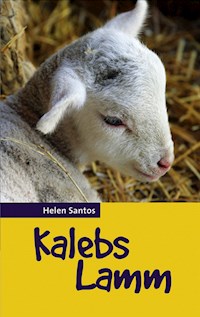
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibellesebund
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kaleb, der Hirtenjunge, hasst die Schafe. Erst als er ein Lamm vor dem sicheren Tod rettet, gewinnt dieses seine Liebe. Damit ändert sich Kalebs Einstellung von Grund auf. Und eines Tages rettet ihm das Lamm das Leben. Die Geschichte spielt in der Zeit, als das jüdische Volk in Ägypten wohnt und der Pharao sich weigert, es ziehen zu lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helen Santos
Kalebs Lamm
Impressum
Originaltitel: »Caleb’s Lamb«
Erschienen bei: Scripture Union (Bibellesebund), London
© 1984 by Helen Santos
Deutsch von Wolfgang Steinseifer
© 1985 der deutschsprachigen Ausgabe by Verlag Bibellesebund, Winterthur
6. Auflage 2013
© 2019 der E-Book-Ausgabe
Bibellesebund Verlag, Marienheide
https://shop.bibellesebund.de/
Covergestaltung: Georg Design, Münster.
ISBN 978-3-95568-318-4
Hinweise des Verlags
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf - auch teilweise - nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des Textes kommen.
Noch mehr E-Books des Bibellesebundes finden Sie auf
https://ebooks.bibellesebund.de
Inhalt
Titel
Impressum
Das verlorene Schaf
Das Lamm
Ascher kann so gut erzählen
Kalebs Lamm
Im Schurgehege
Durchs dunkle Tal
Hirten berichten am Lagerfeuer
Endlich wieder zu Hause
Der Pharao lässt nicht mit sich reden
Das Opfer für Ascher und Kaleb
Ein schwerer Entschluss
Das verlorene Schaf
Es war vor langer, langer Zeit im Land Gosen im Reich Ägypten. Ein Junge schlief tief und fest am Fuß eines Dornbaums. Um sich vor wilden Tieren zu schützen, hatte er sich mit ein paar abgerissenen Zweigen zugedeckt. Und um sich warm zu halten, hatte er sich unter dem abgewetzten Mantel seines Vaters so eng wie möglich zusammengerollt.
Seit über einer Stunde stand die Sonne am Himmel. Doch der Junge hatte mehr als die halbe Nacht wach gelegen und sich gefürchtet. Nun konnte das helle Licht ihn nicht in seinem Schlaf stören.
Hoch oben auf einem Ast des Dornbaums saß ein Geier. Er drehte den Kopf hin und her, während er mal mit dem einen Auge, dann mit dem anderen den Jungen unter sich beobachtete. Er hüpfte unruhig auf seinem Ast herum und versuchte neugierig, das Bündel am Fuß des Baums besser zu sehen. Schließlich stieß er ein durchdringendes Krächzen aus, von dem der Junge erwachte.
Der Mantel wurde zurückgeschlagen, und ein dunkler Lockenkopf erschien. Schläfrige Augen öffneten sich unwillig und weiteten sich angstvoll, als der Junge sich erinnerte, wo er sich befand und dass er allein war.
Er setzte sich auf, lehnte sich mit dem Rücken an den Baumstamm und schlang zitternd den Mantel wieder um seine Schultern. Die Sonne hatte noch nicht ihre wärmende Kraft entfaltet. Der Frühling war jung und die Luft schneidend kalt.
Kaleb, so hieß der Junge, trug eine Schaffell-Jacke über seinem Gewand und darüber den Mantel, der seinem Vater gehörte. Doch der Boden war ebenso kalt, wie er hart war.
Kalebs braune Augen blickten zum Geier hinauf. Das musste ein schlechtes Vorzeichen sein, dass ausgerechnet ein solcher Vogel dasaß und ihn anstarrte. Sein langer Schnabel diente zum Hacken und Reißen. Die krummen, langen Klauen, die sich jetzt an den Ast klammerten, konnten sich genauso fest in ein verletztes Tier krallen. Die scharfen, tückischen Augen schienen gierig zu lauern.
Kaleb sprang plötzlich zornig auf. Er fuhr mit den Armen durch die Luft und rief dem Geier zu: »Weg da! Scher dich fort! Starr mich nicht so an!« Doch der Geier starrte noch neugieriger und ohne das geringste Anzeichen von Furcht.
Es war Kalebs schlechtes Gewissen, das ihn so wütend auf den Geier reagieren ließ. Seit er erwacht war, bedrängten ihn die Erinnerungen an den gestrigen Tag – an den Zorn seines Vaters, an seinen eigenen Ärger, an das verlorene Mutterschaf …
Oh, wie er die Schafe hasste! Diese dummen Tiere. Wussten sie denn noch immer nicht, dass sie nur bei der Herde sicher waren, weil da der Hirte auf sie achtgab? Wussten sie noch immer nicht, dass sie abends in den Pferch gehörten?
Offenbar nicht, sonst würden sie ja nicht einfach davonlaufen und sich verirren!
Ascher, Kalebs Vater, hatte gesagt: »Das Mutterschaf da wird bald lammen. Es kann jeden Tag losgehen. Lass es nicht aus den Augen! Es wird allein losziehen, um sich ein abgelegenes Plätzchen zu suchen und dort sein Lamm zur Welt zu bringen. Pass auf es auf und hol es zurück, wenn es sich davonstiehlt!«
Kaleb hatte aufgepasst. Wirklich! Stunde um Stunde hatte er auf das Schaf achtgegeben, bis ihm die Augen von der grellen Sonne wehgetan hatten und er vom angestrengten Starren auf den braunen, wolligen Rumpf ganz benommen und müde geworden war.
Nur einen kurzen Augenblick hatte er es nicht beobachtet. Es hatte bei anderen Schafen gestanden und zufrieden am frischen Frühlingsgras geknabbert. Und dann war die Eidechse zwischen den Steinen hervorgeschossen, eine kleine Eidechse mit goldenen Augen; ein Tier, bei dessen Anblick es Kaleb in den Fingern juckte und sein Herz höher schlug …
Jetzt verharrte sie reglos wie die Steine selbst – eine leichte Beute. Kaleb spannte seine Hände; aber blitzschnell war sie verschwunden, sobald sich sein Schatten bewegt hatte. Kaleb hob einen Stein nach dem anderen auf, vom zuckenden Eidechsenschwanz fortgelockt. Da! Da war sie wieder, den Kopf emporgereckt, regungslos, wunderschön.
Nur ein Augenblick schien vergangen zu sein. Doch als Kaleb sich an das Schaf erinnerte und zu der Stelle hinüberschaute, an der er es zum letzten Mal gesehen hatte, waren die anderen noch da und grasten. Aber das braune mit den prall hervorstehenden Seiten war verschwunden.
Kaleb kämpfte die aufsteigende Panik nieder. Er wusste, dass er das Schaf finden musste, und zwar schnell. Doch er durfte nicht herumrennen, sonst merkte sein Vater, was geschehen war. Sehr weit konnte es noch nicht gekommen sein. Vielleicht hatte es sich zu einer Gruppe bei seinem Vater gesellt. Die Herde graste über eine weite Weidefläche verstreut, und manche Mutterschafe hatten schon ihre Lämmer neben sich.
Aber wie sollte er aus der Ferne wissen, welches das Schaf war, das er suchte? Es gab viele braune Schafe in der Herde, wie es auch graue, weiße und gefleckte gab. Sein Vater behauptete, jedes einzelne unterscheide sich von allen anderen; doch für Kaleb sahen alle gleich aus.
Wie zornig er auf das braune Mutterschaf war! Und wie zornig auf seinen Vater. Wie konnte er ununterbrochen aufpassen, wenn ihm der Kopf wehtat und die Augen tränten? Kaleb wusste, er hätte auf der Stelle zu seinem Vater laufen und ihm das Unglück erzählen sollen. Aber er tat es nicht. Er schämte sich viel zu sehr und war viel zu zornig.
Noch am Morgen hatte ihm Ascher eingeschärft, wie wichtig es sei, Mutterschafe, die bald lammten, besonders gut im Auge zu behalten. Er hatte nicht viele Worte gemacht. Hirten reden gewöhnlich nicht viel, stattdessen singen sie ihren Schafen oft etwas vor. Aber gerade weil sein Vater ein schweigsamer Mann war, war das, was er sagte, umso wichtiger und unbedingt zu befolgen.
Dreimal hatte er Kaleb ermahnt, dieses eine Mutterschaf nur ja nicht aus den Augen zu lassen. Wie konnte Kaleb da jetzt zu seinem Vater gehen und ihm berichten, dass das Tier davongelaufen war?
Nein, Kaleb wollte noch etwas warten. Sicher würde das Schaf vor Einbruch der Dunkelheit mit einem Lamm zur Herde zurückkehren. Dann brauchte sein Vater gar nicht zu erfahren, was geschehen war. Doch Stunde um Stunde war vergangen, und es war nicht zurückgekommen. Und mit jeder Stunde war es schwerer geworden, dem Vater etwas zu sagen. Ascher wäre am Anfang gewiss zornig gewesen, aber nun würde er sicher noch zorniger sein.
Für den Rest des Tages bewachte Kaleb treu die übrigen Schafe und hoffte verzweifelt auf das Wunder, dass das braune Schaf mit einem Lamm an der Seite zurückgetrottet kommen würde.
Einen Augenblick lang hatte er sich überlegt, zum Gott seines Vaters zu beten. Ascher betete jeden Abend und jeden Morgen. Er hatte Kaleb erzählt, dass Gott alles hörte und sah – nicht nur das, was sie sagten und taten, sondern sogar alles, was sie tief innen im Herzen dachten. Mit diesem Gott konnte Kaleb ebenso wenig reden wie mit seinem Vater. Dazu war er zu zornig und schämte sich zu sehr.
Es war ein schrecklicher Tag. Kalebs Miene wurde immer finsterer, und in seinem Inneren brannte die Schuld wie ein Feuer. Wie gern wäre er zu seinem Vater gelaufen und hätte ihm sein Versagen bekannt. Doch stets hielt ihn etwas davor zurück – die Hoffnung, dass das Schaf zurückkehren würde, und die Angst vor dem Zorn seines Vaters.
Als die Dunkelheit hereinbrach und Ascher die Schafe zählte, während sie sich in den Pferch drängten, bemerkte er sofort das Fehlen des braunen Mutterschafes. In diesem Augenblick wünschte Kaleb, die Erde würde sich öffnen und ihn verschlingen – doch sie tat es nicht.
Mit hängendem Kopf stammelte er: »Es ist nicht meine Schuld. Ich habe sie nur einen winzigen Moment aus den Augen gelassen.«
»Ist es etwa meine Schuld?«, fragte der Hirte. »Oder Saras Schuld? Sie ist nur ein dummes Tier, aber uns hat sie vertraut, dass wir sie beschützen!«
Kaleb konnte nicht antworten. Der Schmerz in der Stimme seines Vaters grub sich tief in seine Seele. Ascher hatte ihm vertraut, wie Sara den Menschen vertraut und von ihnen Schutz erwartet hatte. Kaleb biss sich auf die Lippen und hasste Sara noch mehr.
»Du musst sie suchen!«, sagte sein Vater.
»Gewiss! Gleich bei Sonnenaufgang, das verspreche ich dir«, antwortete Kaleb eifrig.
»Morgen ist es zu spät. Du musst sie jetzt suchen.«
»Aber es ist schon dunkel. Da kann ich sie nicht mehr sehen.«
»Sie wird deine Stimme hören, und du hörst ihre Stimme, wenn sie in Not ist und um Hilfe schreit.«
Kaleb fürchtete sich vor der Dunkelheit. »Bitte, schick mich nicht fort!«, bat er.
Aber sein Vater schien ihn nicht zu hören. »Sieh in den Dornbüschen nach. Such zwischen den Felsen und in den Bodensenken. Sie wird ihr Lamm bei sich haben. Zu deinem Schutz hast du deine Schleuder bei dir – und unseren Gott. Du wirst nie ein guter Hirte werden, wenn du nicht lernst, deine Schafe wichtiger zu nehmen als dich selbst.«
Diese Worte klangen Kaleb in den Ohren und brannten in seiner Seele, während er ein flaches Gerstenbrot einsteckte, sich den Mantel seines Vaters überwarf und loszog.
Zuerst war er gelaufen und immer wieder über den Mantel gestolpert, bis er die Enden um seine Schultern geschlungen hatte. Doch er wurde bald müde und konnte kaum die Augen offen und die Beine in Bewegung halten.
Der Vollmond ließ um ihn herum gespenstische Schatten wachsen. Dornsträucher reckten riesige zupackende Krallen empor, Felsblöcke wurden zu unergründlichen Höhlen. Alles sah übergroß und unheimlich aus. Nichts erinnerte an die Weidefläche bei Tageslicht. Kaleb hatte Angst.
Wieder und wieder rief der Junge, so laut er konnte, Saras Namen und horchte angestrengt auf eine Antwort. Doch alles blieb still, und bald flößte ihm sogar seine eigene Stimme in dieser Wildnis Furcht ein.
Dann kam er zu dem Dornbaum, wo er sich niederließ und sein Brot aß. Er war müde und durchgefroren und wollte ein wenig rasten und sich ausruhen. Während er aß, drangen die Geräusche der Wüste an sein Ohr: Kratzen, Rascheln, kleine Mäuse, die hin und her huschten, Skorpione, größere Tiere, vielleicht …
Ein Zittern überlief Kaleb. Sein Herz schlug so schnell und laut, dass es fast die Nachtgeräusche übertönte. Und was war mit den bösen Geistern? Die sahen ihn bestimmt hier. Würden sie nicht kommen und ihn verschlingen?
Kaleb sprang auf, raffte hastig ein paar abgebrochene Zweige von einem Busch zusammen und deckte sich damit zu. Er fürchtete sich viel zu sehr, um jetzt noch weiterzugehen. Schlangen, Schakale, Löwen … Die schlimmsten Bilder schwirrten ihm im Kopf herum.
Er erinnerte sich an die Worte seines Vaters: »Zu deinem Schutz hast du unseren Gott«, und ihn tröstete der Gedanke, dass der Gott, dessen heiliger Name niemals ausgesprochen werden durfte, gerade jetzt über ihm wachte und seine Angst verstand.
Kaleb zog sich den Mantel seines Vaters bis über den Kopf und rollte sich so nah wie möglich am Stamm des Dornbaums zusammen. Da blieb er, bis der Geier ihn mit seinem durchdringenden Schrei weckte.
Das Lamm
Kaleb war jetzt hellwach und dachte mit Schaudern daran, wie oft er schwarze Vögel wie diesen gesehen hatte. Sie standen auf einem verendeten Tier und rissen mit dem Schnabel verwesendes Fleisch von dem Kadaver. Geier waren Aasfresser.
»Sie erfüllen eine wichtige Aufgabe«, hatte der Vater gesagt, als Kaleb in einen Ruf des Erschreckens und des Abscheus ausgebrochen war, als er das erste Mal einen Geier sah. »Sie sorgen dafür, dass keine toten Tiere herumliegen.«
Doch auch Ascher mochte die Geier nicht. Zu oft griffen sie lammende Schafe an, wenn sie gerade besonders wehrlos waren. Sie töteten sogar Lämmer, noch bevor diese zum ersten Mal auf ihren Beinen gestanden hatten. Wenn so etwas nun Sara und ihrem Lamm zugestoßen war? Kaleb lief es kalt den Rücken hinunter. Er musste es so schnell wie möglich herausfinden.
Er war hungrig. Aber er hatte schon das ganze Brot gegessen, so brauchte er jetzt keine Zeit für das Frühstück zu verschwenden. Bevor er aufbrach, wiederholte er die Gebete, die sein Vater jeden Morgen sprach, und fügte dann noch ein eigenes an: »Bitte, lass mich Sara schnell finden! Und bitte, gib, dass es ihr gut geht!«
Nun fühlte er sich etwas besser, zog sich den Mantel fest um die Schultern und machte sich auf den Weg zu einer mit Felsbrocken übersäten Anhöhe, wo Dornbüsche und wilde Blumen fast wie Silber in der Sonne glänzten. Dies war eine gute Stelle für ein Mutterschaf, das ein Versteck suchte, um dort sein Lamm zur Welt zu bringen. Dort musste Sara sein.
Der Geier krächzte heiser, breitete seine starken Flügel aus und erhob sich in die Luft. Sein Schatten streifte Kaleb, als er ihn überflog. Er kam vor Kaleb auf der Anhöhe an, ließ sich auf einem Felsen nieder und putzte sich mit dem Schnabel das Gefieder. Der Geier war das einzige Lebewesen, das Kaleb weit und breit entdecken konnte, und trotz seines Gebets ließ Kaleb den Mut sinken. Wollte Gott ihm durch diesen Geier sagen, dass er zu spät gekommen sei?
Bald hatte er die Antwort. Er kletterte über die Felsen und folgte einer Spur von eingetrocknetem Schafskot. Da erblickte er plötzlich auf der Erde Reste eines braunen Wollbündels. Das war Sara. Sie war tot. Eine schwarze Fliegenwolke zeigte an, dass andere Tiere bereits ihren Hunger an ihr gestillt hatten. Kaleb blieb wie angewurzelt stehen.
Der Tod war etwas Schreckliches. Kaleb konnte sich nicht daran gewöhnen, obwohl er ihm ständig auf die eine oder andere Weise begegnete: in den Geschichten, die sein Vater erzählte; in dem, was die Frauen im Dorf erzählten und flüsterten; in der Herde selbst, wo Schafe aus allen möglichen Gründen starben – gewöhnlich ganz plötzlich.





























