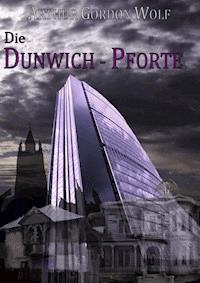Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
"Seit langem habe ich nicht eine solche fesselnde, verwirrende und super spannende Geschichte gelesen." [Lesermeinung] "Keine Seite Langeweile - im Gegenteil: Je mehr man liest, umso weiter zieht einen KALLIOPE in seinen - pardon: ihren - Bann. Von mir eine klare Leseempfehlung." [Lesermeinung] KALLIOPE ist ein Thriller über die geheimnisvollen Mechanismen des Schreibens, über fiktive Menschen, die plötzlich zum Leben erwachen, über den schmalen Grat zwischen Wirklichkeit und Imagination. Ein blutiges Katz-und-Maus-Spiel zwischen Wupper und Rhein. Inhalt: Markus Reuther, ein Wuppertaler Krimi-Autor, hat Probleme mit seinem aktuellen Roman. Seine Protagonistin weigert sich plötzlich, mit ihm zu "sprechen". Hilflos muss er mit ansehen, wie sie von einer Katastrophe in die nächste stolpert. Dabei hat er keine Ahnung, was als nächstes geschieht. Liegt es vielleicht daran, dass es niemanden gibt, der ihn zum Schreiben drängt? Würde die Kommunikation mit seinen fiktiven Charakteren besser laufen, wenn von außen ein wenig mehr Druck auf ihn ausgeübt würde? Dummerweise erzählt er einer Zufallsbekanntschaft in einem Klub von seinen Nöten. Von diesem Zeitpunkt an nimmt sein beschaulicher Alltag eine radikale Wendung. Es beginnt alles ganz harmlos. Reuther erhält mysteriöse Emails von einem Fan, der sich selbst nur als ›K‹ bezeichnet. "Schreibe immer! Tag und Nacht. Und fürchte den Zorn der Götter!" lautet die sich immer wiederholende Botschaft. Nur das Gefasel eines verrückten Lesers oder doch eine ernst zu nehmende Drohung? Für Reuther ist alles nur ein alberner Scherz. Seine selbsternannte Muse hat jedoch gerade erst damit begonnen, ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Alle Freunde und Bekannten des Autors schweben plötzlich in tödlicher Gefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kalliope
Arthur Gordon Wolf
Kalliope (griechisch Καλλιόπη Kalliopç ‚ die Schönstimmige, lateinisch Calliope; Betonung im Deutschen auf dem i: Kalliope – im Griechischen auf dem o: Kalliope) ist eine der neun Töchter des Zeus und der Mnemosyne. Sie ist die Muse der epischen Dichtung, der Wissenschaft, der Philosophie und des Saitenspiels sowie die Muse des Epos und der Elegie. Mit Apollo hat sie die Söhne Orpheus und Linos. Kalliope ist die älteste und weiseste der neun klassischen Musen und war deswegen die Richterin im Streit zwischen Aphrodite und Persephone über den Adonis. Ihr Attribut ist die Schreibtafel. (Quelle: Wikipedia)
für meine Mutter (1937 - 2016)
„Sei vorsichtig mit deinen Wünschen, sie könnten in Erfüllung gehen.“
(Asiatisches Sprichwort)
Impressum
Deutsche Erstausgabe Copyright Gesamtausgabe © 2016 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Mark Freier Lektorat: Astrid Pfister
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2016) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-177-6
Sie lesen gern spannende Bücher? Dann folgen Sie dem LUZIFER Verlag aufFacebook | Twitter | Pinterest
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen und senden Ihnen kostenlos einen korrigierten Titel.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
HINWEIS
Ich habe mir – was die Örtlichkeiten rund um Wuppertal und Düsseldorf betrifft – einige Freiheiten genommen. Während manche Schauplätze möglichst genau dargestellt wurden, zuweilen vielleicht mit winzigen Änderungen versehen, sind andere hingegen frei erfunden. Der in der Region kundige Leser wird bestimmt schnell erkennen, was in welchem Fall zutreffend ist.
Die Handlung und alle Personen sind natürlich ebenfalls frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden und realen Personen wäre rein zufällig.
Kapitel 1
Grelle Lichter. Ein endlos pulsierendes Band jagte ihr entgegen. Stechend, aggressiv, unerbittlich.
Begleitet wurden die Lichter von dem stetig an- und abschwellenden Dröhnen unzähliger Motoren.
Nora kniff die Augen zusammen, um die Straße vor sich besser erkennen zu können. Wann war es eigentlich dunkel geworden? Nervös fuhr sie sich mit Daumen und Zeigefinger über die Nasenwurzel. Die Sicht verbesserte sich dadurch jedoch überhaupt nicht.
Sie versuchte sich daran zu erinnern, wie lange sie nun schon diese gewundene Küstenstraße entlangfuhr. Zwei Stunden? Drei?
'Verdammt!', dachte sie. 'Die Zeit ist mir vollkommen entglitten.' Sie seufzte. 'Wie so vieles andere in meinem so erbärmlichen Leben auch.
An der nächsten Ausfahrt setzte sie spontan den Blinker, denn sie brauchte dringend etwas Abwechslung. Und deutlich weniger Gegenverkehr.
Die Ortsnamen auf den Schildern sagten ihr überhaupt nichts. Sie wusste nicht einmal, in welchem Bundesstaat sie sich gerade befand. Hatte sie die Grenze von Kalifornien vielleicht schon längst hinter sich gelassen? Sie entschied sich nun für eine Strecke in nördlicher Richtung.
Die Straße führte in langen Serpentinen hinauf in die Berge. Dahinter erstreckte sich eine Hochebene aus staubigen Feldern und Weiden. Nirgendwo zeigte sich der Umriss eines Hauses. Im Dämmerlicht der hereinbrechenden Nacht konnte sie nicht einmal Unterstände für Vieh erkennen. Die windschiefen Pfähle der Stacheldrahtzäune waren der einzige Hinweis auf menschliche Besiedlung.
Einen Vorteil hatte die Einöde allerdings: Die schmerzenden Gegenlichter waren fast vollkommen verschwunden. Nur ganz selten kam ihr einmal ein Wagen entgegen. Meist handelte es sich dabei um verbeulte Pick-ups mit Holz oder Maschinenteilen auf der Ladefläche. Ansonsten war es um sie herum so dunkel, dass sie sogar einige Sterne durch die Windschutzscheibe hindurch funkeln sehen konnte.
Nora atmete tief durch. Sie spürte, wie mit jedem Kilometer ein Teil der Anspannung von ihr abfiel. Die Einsamkeit umhüllte sie wie ein schützender Mantel.
Die Straße überquerte einen unbeschrankten Bahnübergang und folgte von nun an der etwas höher gelegenen Trasse in östlicher Richtung.
'Wahrscheinlich längst stillgelegt', dachte Nora. Die Gegend sah nicht gerade danach aus, als ob hier ein großer Bedarf an Personen- oder Gütertransporten bestünde.
Sie wollte gerade damit beginnen, über ihre nächsten Schritte nachzugrübeln, als sie die Lichter im Rückspiegel bemerkte. Die Scheinwerfer eines Autos!
Da Nora auf den lang gezogenen Strecken bislang nichts aufgefallen war, musste der Wagen deutlich schneller als ihr alter Pontiac fahren. Oder war er aus einem Seitenweg an der Bahnüberquerung gekommen? Vergeblich bemühte sie sich, das Bild des Übergangs erneut vor ihrem geistigen Auge wachzurufen. 'Hatte es nicht eine schmale Schotterpiste oberhalb der Gleise gegeben?'
Die Lichter im Rückspiegel wurden nun größer. Sie fingen langsam an, sie zu blenden. Nora kippte den Spiegel in die Anti-Blend-Stellung und presste ihren Rücken fester gegen den Sitz. Gleichzeitig drückte sie das Gaspedal weiter durch. Der V6-Motor des 1987er Bonneville hustete leicht, gehorchte dann aber ihrem Befehl. Für einige Zeit verschwanden die fremden Scheinwerfer in einer Wolke aus aufgewirbeltem Staub.
Warum ließ sie den Kerl hinter sich, der es scheinbar so eilig hatte, nicht einfach überholen? Wahrscheinlich war es nur ein Farmer, der den Zaun seiner Weide repariert hatte. Ein staubiger müder Mann, der sich nach Heim und Frau zurücksehnte.
'Und wenn nicht?', schoss es ihr durch den Kopf. 'Was, wenn der Wagen ihr schon die ganze Zeit über gefolgt war und erst jetzt seine Scheinwerfer eingeschaltet hatte? Auf der Interstate war der Verkehr viel zu dicht gewesen; einen möglichen Verfolger hätte sie dort niemals bemerkt. Was, wenn sich der Wagen schon seit San Diego an ihre Fersen geheftet hatte? Konnte es sein, dass ihre Flucht nur eine Farce gewesen war? Ein taktischer Schachzug, bei dem ihr der Gegner einfach nur jede Menge Leine gab?'
Der Gedanke traf sie wie ein Faustschlag in die Magengrube. Spielten sie nur ein abgekartetes Spiel mit ihr?
Sie trat das Gaspedal bis zum Boden durch.
'Dann wollen wir doch mal sehen, wie lang eure verdammte Leine ist! Kommt doch und holt mich!'
Die Tachonadel zuckte über die Hundert hinweg. Kleinere Schlaglöcher ließen den Wagen nun gefährlich nahe an den unbefestigten Seitenstreifen springen. Noras Griff um das Lenkrad wurde fester. Sie musste sich unglaublich konzentrieren; bei zu starkem Gegenlenken würde der Bonneville schnell ins Schleudern geraten können.
Ihr Blick wanderte nun ständig zwischen Rückspiegel, Tacho und Straße hin und her. Wie es aussah, wurden die Lichter des Verfolgers nicht größer. Ein Grund zur Entwarnung bestand dennoch nicht, denn die beiden glühenden Punkte wurden auch nicht kleiner. Sie konnte es nicht fassen. Trotz des mörderischen Tempos hielt das fremde Auto einen gleichbleibenden Abstand zu ihr.
Ein anderes Licht lenkte jetzt plötzlich ihre Aufmerksamkeit auf sich.
„Verdammt!“ Ihr Schrei übertönte das Röhren des Motors.
„VERDAMMT! VERDAMMT! VERDAMMT!!!“
Wie lange brannte diese kleine rote Lampe schon? In den vergangenen Stunden war ihr einfach zu viel durch den Kopf gegangen; an so triviale Dinge wie Tanken hatte sie natürlich nicht gedacht.
Unsinnigerweise tippte sie mit dem Finger gegen die Tankuhr. Der Zeiger blieb unbeweglich auf dem großen 'E' liegen.
'Na, wunderbar!'
Für wie lange würde der Sprit wohl noch reichen? Sie starrte angestrengt nach draußen, doch außer kargen Weiden und knorrigen Kreosotbüschen konnte sie nichts erkennen.
'Und wenn schon!', dachte sie. Augenblicklich hatte sie ganz andere Probleme. Denn selbst wenn direkt vor ihr ein riesiges EXXON-Schild aufgetaucht wäre, was hätte sie tun sollen? Anhalten und tanken? Sollte sie ihre freundlichen Verfolger vielleicht freundlich darum bitten, in der Zwischenzeit eine Zigarette zu rauchen? Na, vielen Dank auch!
Nora blickte wieder in den Rückspiegel. Waren die Lichter nicht etwas größer geworden? Sie jagte jetzt mit hundertzehn Meilen durch die Einöde, aber das fremde Auto klebte trotzdem wie eine Klette an ihr. Frustriert schlug sie gegen das Lenkrad. Was sie jetzt dringend benötigte, war keine Tankstelle, sondern eine tiefe Höhle, in der sie sich mit ihrem Bonneville verkriechen konnte.
'Wunderbares Timing, Cookie!', hörte sie im Geiste die Stimme ihres Vaters. 'Ohne Sprit mitten im Nirgendwo.' Wie immer hatte ihr alter Herr recht. Die größte Höhle im Umkreis von hundert Meilen dürfte der Bau eines Präriehundes sein.
Nach einer Weile zweigte ein schmaler Schotterweg von der Hauptstraße ab. Im Licht der Scheinwerfer konnte Nora ein windschiefes Holzschild ausmachen. TUCKER hatte jemand mit ungelenken, weißen Pinselstrichen darauf gemalt.
Für einige Sekunden spielte sie mit dem Gedanken, dem Schild zu folgen. Angesichts des Zustandes der Straße würde sie aber dann deutlich langsamer fahren müssen. Ihr Verfolger könnte so möglicherweise schneller zu ihr aufschließen. Wahrscheinlich besaß der Wagen hinter ihr einen Allrad-Antrieb, wodurch er ihrem Bonneville eindeutig überlegen wäre. Außerdem hatte sie keine Ahnung, wohin diese Schotterpiste überhaupt führte. Vielleicht war dieser 'Tucker' ja schon vor Jahrzehnten in eine weniger staubige Gegend umgezogen.
'Vergiss' es!', sagte sie sich. Die Nebenstraße war ganz sicher eine Sackgasse, die an einer halb verfallenen Farm endete. Dort wäre sie so hilflos wie die sprichwörtliche Ente im Fass.
'NO WAY!'
Nora raste also weiter über die Hauptstraße. So einfach würde sie es ihren Gegnern bestimmt nicht machen. 'Kommt und holt mich doch!', dachte sie todesverachtend. Sie hatte längst den Punkt der reinen Angst überschritten. An ihre Stelle war nun eine schon unheimliche Gleichgültigkeit getreten. Was nützte es denn schon, sich wegen unabänderlicher Dinge verrückt zu machen? Die Vergangenheit ließ sich sowieso nicht mehr ändern. Und was geschehen würde, würde eben geschehen. Wenn das Schicksal, Karma oder wie immer man es nennen wollte, vorgesehen hatte, dass sie den morgigen Tag nicht mehr erlebte, konnte sie wohl kaum etwas dagegen tun. Sie stieß ein leises Schnauben aus.
Nirgendwo stand allerdings geschrieben, dass man jenen 'höheren Mächten' auch noch behilflich sein musste. Vielleicht gab es ja auch alternative Handlungsabläufe. Vielleicht besaß jedes Individuum doch die Möglichkeit, seine Geschicke bis zu einem gewissen Grad selbst mitzubestimmen. Sie würde jedenfalls nicht einfach so die Hände in den Schoß legen und demütig auf ihr Ende warten.
'Das verdammte Karma wird sich schon anstrengen müssen, um meinen Arsch zu bekommen.'
Nora blickte wieder in den Rückspiegel und blinzelte. Etwas stimmte hier nicht. Die Lichter waren plötzlich verschwunden. Hatten die Mistkerle ihre Scheinwerfer etwa wieder ausgeschaltet?
Obwohl sie sich der Gefahr durchaus bewusst war, drosselte sie ihre Geschwindigkeit. Nun konnte sie auch einen längeren Seitenblick riskieren, ohne befürchten zu müssen, gleich im Graben zu landen.
Hinter ihr und links war alles in vollkommene Dunkelheit gehüllt; rechts erspähte sie jedoch einen schwachen zittrigen Lichtstrahl, der sich immer weiter von ihr entfernte. Sie trat die Bremse so fest durch, dass sich der Wagen nun doch leicht querstellte und der Motor augenblicklich erstarb.
Ungläubig starrte sie auf den gelblichen Schimmer. Ihr Verfolger war tatsächlich auf den Nebenweg abgebogen.
„Verdammter Tucker!“ Ihr Fluch hallte laut im Inneren des Wagens wider. Warum war ihr der Kerl nur mit derart halsbrecherischem Tempo gefolgt? Hatte er etwa vergessen, die Kartoffeln vom Feuer zu nehmen? Oder war es in dieser Gegend vollkommen normal, nächtliche Jagden auf Durchreisende zu veranstalten?
Nora betrachtete ihre Hände, die noch immer das Lenkrad fest umklammert hielten. Als sie die Finger löste, durchfuhr sie ein heftiges Zittern. Schmerzhaft jagte das Adrenalin durch jede Faser ihres Körpers.
'Das zum Thema coole Gleichgültigkeit', dachte sie. Der blöde Hinterwäldler-Pick-up hatte sie in eine bibbernde Parkinson-Patientin verwandelt.
„Scheiß Rednecks!“
Sie spähte nach vorne über die endlose Prärie. Da das Standlicht kaum weiter als zehn Meter reichte, konnte sie die Landschaft allerdings nur erahnen.
'Na wunderbar!', dachte sie. Ein Problem war gelöst, das andere aber bestand nach wie vor. Im Tank befand sich nur noch ein Schnapsglas Sprit und die nächste menschliche Siedlung lag wahrscheinlich irgendwo am Yukon. Nora seufzte. Sie drehte den Zündschlüssel und legte den Gang ein. Langsam tuckerte sie weiter. Vielleicht hatte sie ja Glück. Vielleicht befand sich hinter dem nächsten Hügel ja eine Tankstelle … eine Tankstelle mit angeschlossenem Motel. Ähnlich dringend wie Benzin benötigte sie nämlich ein paar Stunden Schlaf. Sie musste endlich einmal zur Ruhe kommen. Im Augenblick drohte ihr der Kopf zu platzen von all den verrückten Vorfällen, deren Zeuge sie seit letztem Dienstag geworden war. Konnte es wirklich sein, dass seitdem erst fünf Tage vergangen waren? 'Und dass ich noch immer lebe?'
Sie schüttelte unwirsch den Kopf. Zumindest gab es eine Sache, die durchaus ihre positiven Seiten besaß. Es war eine wirklich fette Beute, die sie am Haken hatte. Zur Freude bestand jedoch kein Anlass, denn noch musste sie das zappelnde Ding erst einmal sicher an Land bringen. Leichter gesagt als getan. Es gab dort draußen eine Menge Leute, die ihr den Fang streitig machen wollten. Lauter blutgierige Haie.
Ein leises Kichern entrang sich ihrer Kehle. 'Die alte Parkinson-Frau und das Meer'.
'Nein!' Das schiefe Grinsen wich mit einem Mal ernster Entschlossenheit. Sie würde alles dafür tun, damit ihre Geschichte kein derart tragisches Ende nähme.
Verdammt, einmal in ihrem Leben hatte doch wohl auch Nora Phyllis Bolden Anspruch auf ein winziges Stückchen vom großen Kuchen des Lebens.
Sie schaltete in den zweiten Gang und versuchte das rote Lämpchen einfach zu ignorieren.
Sollen die Haie nur kommen. Sie würde ihren Fang und ihr eigenes Leben mit allen Mitteln verteidigen.
„Passt nur auf, damit ihr euch nicht die Zähne an mir ausbeißt!“, murmelte sie. „Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber die Tochter meiner Mutter kann ein verdammt zähes Miststück sein.“
Sie schaltete in den vierten Gang und trat das Gaspedal bis zum Anschlag durch. Sie war das Warten so leid; wenn ihr Weg auf dieser endlosen staubigen Straße sein Ende finden würde, dann sollte es zumindest mit dröhnendem Motor geschehen.
Kapitel 2
Reuther stöhnte. Zum wiederholten Mal las er die letzten Zeilen des Kapitels, doch der Text weigerte sich einfach, zu ihm zu sprechen. Der Text? Es war eher Nora P. Bolden, die ihm plötzlich ohne jede Vorwarnung die kalte Schulter zeigte. Er hatte sich längst an ihre Marotten gewöhnt, doch dieses Mal dauerte ihre Schmollphase allerdings schon über drei Wochen.
„Blöde Tussi!“
Entnervt klappte er den Laptop zu und starrte auf den geschlossenen Rollladen vor seinem Fenster. An einigen Stellen lagen die Lamellen nicht genau aufeinander und ließen helle Lichtstreifen hindurch. Staubflusen schwebten wie winzige Planeten im Zimmer herum.
Was treibe ich hier nur? Diese Frage stellte er sich in letzter Zeit immer öfter. Draußen war ein warmer Juni-Tag und er hockte hier in seinem abgedunkelten Büro und wartete darauf, dass eine imaginäre Frau endlich wieder mit ihm sprach. Wie blöd konnte man eigentlich sein? Niemand zwang ihn schließlich dazu, diese vertrackten Geschichten zu schreiben. Keine Menschenseele. Am allerwenigsten eine gewisse Nora Bolden.
„Miststück!“
Was fuhr die dumme Kuh auch mit leerem Tank durch halb Amerika! Es geschah ihr doch ganz recht, wenn sie irgendwo in der Pampa stecken blieb. Was ging ihn das an? Sollte sie doch selbst sehen, wie sie aus diesem Schlamassel wieder herauskam. Er war doch nicht ihr Kindermädchen oder gar ihr Schutzengel. Oh nein! Er war nur ein nüchterner Beobachter.
Die Sache hatte nur einen Haken: Nora verriet ihm nichts mehr von ihren Plänen. Und seit über drei Wochen raste sie nun schon durch die nächtliche Prärie. Mit weniger als einem Schnapsglas Benzin im Tank.
Er fuhr sich mit den Händen durch sein lichtes Haar. Das, was nur recht wohlwollende Freunde noch als Frisur bezeichneten, geriet dabei endgültig aus der Form.
„Arrogante Zicke!“
Er musste plötzlich über sich selbst lachen. Ein gutes Zeichen, wie er fand. Die Tatsache, dass er fortwährend seine Romanheldin beschimpfte, sprach ebenfalls für ihn. Nur richtige Autoren konnten wohl so abgedreht sein, sich mit erfundenen Personen zu streiten.
Richtige Autoren schreiben aber mindestens zehn Seiten pro Tag. UND ZWAR JEDEN TAG!
Der Gedanke versetzte seiner auflodernden Hybris einen empfindlichen Dämpfer. Okay. Wenn er ein richtiger Autor war, dann ging Bushido locker als Integrations-Rapper durch. An dieser Tatsache änderten auch seine zwei bereits publizierten Romane nichts. Das Taschenbuch von Tote Tauben hatte sich bislang unglaubliche achttausend Mal verkauft. Für seinen kleinen Stammverlag Cornells, der zuvor nur durch Neuübersetzungen der Werke von Cornell Woolrichs und einiger unbekannter französischer Autoren in Erscheinung getreten war, bedeutete eine solche Auflage schon einen Bestseller.
Ein Jahr später war Bluternte erschienen und das Buch war bei den Lesern sogar noch besser angekommen. Wenn man den Zahlen der Großhändler vertrauen konnte, dann waren bereits über elftausend Exemplare über die diversen physischen und virtuellen Ladentheken gewandert. Die Verkäufe derjeweiligen eBooks überstiegen die der gedruckten Bücher nun schon um ein mehrfaches. Reuther hasste diese elektronischen Dateien, die meist auf hässlichen Plastik-Readern oder Smartphones gelesen wurden.
Dreihundert schwer erarbeitete Seiten auf nur wenige Kilobyte zusammengeschrumpft. Im Grunde war er mehr ein Leser als ein Autor. Er liebte das Layout eines gedruckten Buches, das Cover, die Typografie, die Bindung. Neben dem Schriftsteller machten sich eine Menge Leute Gedanken darüber, wie man den Inhalt eines Romans am besten zur Geltung bringen konnte. Bei richtig guten Büchern spürte man diesen Enthusiasmus und die Mühe in jedem noch so kleinen Detail.
Wie er es genoss, ein neues Buch aufzuschlagen, die noch leicht aneinanderklebenden Seiten zu enthüllen, ihren Duft einzusaugen und mit den Fingern über das noch jungfräuliche Papier zu streichen. Ein gedrucktes Buch war einfach ein Erlebnis für alle Sinne. Da konnten die klinisch-anonymen eBooks nicht mithalten, so praktisch und platzsparend sie auch sein mochten.
Trotz seiner anachronistischen Gefühle verschloss Reuther allerdings nicht die Augen vor den Entwicklungen medialer Kommunikation. Warum auch? Die Textdateien seiner Romane mochten vielleicht ästhetisch unakzeptabel sein, sie brachten ihm aber nun einmal deutlich mehr ein als die Printausgaben. Der Verlag musste dafür schließlich keine Druckerei bemühen und Lagerkosten fielen auch weg. Der Versand erfolgte über Glasfaserkabel binnen Sekunden. Mit nur einem Mausklick. Jämmerlich profan, aber durchaus profitabel. Auch wenn er es öffentlich niemals zugab (auch nicht seinen Freunden gegenüber), so setzten sich seine Einnahmen mittlerweile zu fast drei Vierteln aus dem Verkauf von eBooks zusammen. Und der Markt wuchs weiterhin rasant.
Reuther stand auf und zog den Rollladen nach oben. Augenblicklich wurde das Zimmer in gleißendes Sonnenlicht getaucht. Als sich seine Augen endlich an die Helligkeit gewöhnt hatten, betrachtete er nachdenklich die Rhododendren-Büsche und die blühenden Robinien im Garten. Feinster englischer Rasen umgab die Bäume wie ein weicher Teppich. Da das Grundstück nach etwa fünfzig Metern steil abfiel, konnte er die Straße von hier aus nicht einsehen; stattdessen wanderte sein Blick hinüber zum Scharpenacken, dessen sanft gewellte Wiesen in der Sommerhitze zu vibrieren schienen.
Das Haus thronte auf den Südhöhen Wuppertals. Vom Fenster des Büros hatte man einen Blick nach Südosten in Richtung Beyenburg und Remlingrade. So weit das Auge reichte, gab es nur Grün.
Mein kleiner Park. So hatte Reuthers Vater es oft liebevoll genannt. Bei dem Gedanken musste er seufzen, denn sein alter Herr war nun schon seit fünf Jahren tot. Reuther Senior hatte eine florierende Werkzeugfabrik in Cronenberg besessen. Mit nur zwei recht einfachen aber funktionalen Zangen war es der Firma gelungen, in den Weltmarkt vorzudringen. Selbst in China kannte man seine Werkzeuge Made in Germany.
Mit sechzig hatte Herbert Reuther plötzlich beschlossen, ein neues Leben zu beginnen. Er verkaufte die Firma zu einem überaus lukrativen Preis, nahm sich eine dreißig Jahre jüngere Geliebte und jettete mit ihr fortan kreuz und quer über alle Kontinente. Der Traum vom sorglosen Globetrotter währte allerdings nicht lange. Denn keine zwei Jahre später kam er bei einem Tauchgang vor der nordaustralischen Küste mit einer Würfelqualle in Kontakt. Es gelang noch, ihn aus dem Wasser zu bergen, doch alle Hilfsmaßnahmen waren vergeblich. Lange bevor ein Notarzt eintraf, starb Herbert Reuther an akutem Kreislaufversagen. Da Reuthers Lebensgefährtin testamentarisch nicht bedacht worden war und seine Frau schon kurz nach der Geburt ihres einzigen Kindes verstorben war, ging das Gesamtvermögen an seinen Sohn über. Von heute auf morgen war Markus Reuther um sechzehn Millionen Euro reicher, die Familienvilla, die beiden Mietshäuser und ein ansehnliches Aktienpaket nicht mitgerechnet. Mit nicht einmal dreißig Jahren musste er sich fortan um Geld keine Sorgen mehr machen. Mehr aus Routine als aus Notwendigkeit schloss er sein BWL-Studium in Köln ab und kehrte kurz darauf nach Wuppertal zurück. Mit seinem Bachelor in der Tasche wollte er sich eigentlich einen Job als Unternehmensberater suchen, richtige Lust auf das neue Betätigungsfeld verspürte er jedoch nicht. Sechs Monate lang lebte er einfach in den Tag hinein, ohne irgendeinen Rhythmus und ohne Ziel.
Markus Reuther stand kurz davor, ein reicher aber apathischer Messie zu werden, als er eines Tages eher durch Zufall auf ein altes Schreibheft mit Geschichten aus seiner Jugend stieß. Mit sechzehn hatte es ihm großen Spaß gemacht, verrückte, bizarre oder unheimliche Ereignisse zu erfinden und aufzuschreiben. Ein Großteil der Storys (mit so vielsagenden Titeln wie Erdbeer-Regen oder Der achtbeinige Hund meiner Nachbarin) war nur drei oder vier Seiten lang. Flüchtig hingeworfene Skizzen, die ausschließlich auf den Knall-Effekt am Ende setzten. Die Texte strotzten nur so vor orthografischen und grammatikalischen Fehlern und doch besaßen sie einen überraschenden Charme; eine düster-morbide Atmosphäre, die ihn gefangen nahm.
An jenem Tag las er das Heft in einem Rutsch durch, danach begann er direkt von Neuem. Wer war nur dieser seltsame Sechzehnjährige gewesen? Und warum hatte er mit dem Schreiben irgendwann aufgehört?
Die Antwort auf die letzte Frage fiel leicht. Schreiben war uncool. Nur einige kichernde Teenie-Girls hatten damals noch Tagebuch geführt oder etwas in die Poesie-Bücher ihrer Freundinnen gekritzelt. Niemand schrieb jedoch Geschichten. Und außerdem gab es Sachen wie Schule, MTV, Computer, Fußball und richtige Mädchen. Da blieb einfach keine Zeit mehr für künstlerisches Gestammel. Er lebte in der schnelllebigen Zeit von E-Mails und SMS. Es wurde nicht mehr geschrieben, sondern ausschließlich gechattet und gesimst. 160 Zeichen mussten dafür reichen. Warum noch schwülstig „Ich liebe dich“ schreiben, wenn es mit „143“ auch erledigt war. Seit dieser kurzen Phase der Verwirrung hatte Reuther nie wieder einen längeren Text verfasst, Referate und die Bachelor-Thesis über Integrate Social Media Marketing und Media Law einmal ausgenommen.
Viele Jahre später nahm die fast doppelt so alte erwachsene Version von Markus Reuther das Heft mit in sein vernachlässigtes Büro und las es zum dritten Mal. Es war etwas in diesen kurzen Texten, das ihn unruhig werden ließ. Etwas lag hinter den ungelenken mit Kugelschreiber gekrakelten Zeilen. Oder vielleicht auch eher dazwischen.
Ein merkwürdiges ungewohntes Gefühl. Neugier! Es interessierte ihn tatsächlich, was mit diesen erfundenen Menschen geschah, so verrückt und unmöglich die Situationen auch sein mochten. Gleichzeitig schlich sich eine weitere Empfindung in sein Unterbewusstsein: die Faszination vor dem Grauen. Reuther war alles andere als ein mutiger Mann, dunkle Gassen mied er ebenso wie große Höhen oder Börsenspekulationen. Der Anblick einer kleinen Kakerlake konnte bei ihm einen spontanen Fluchtreflex auslösen. Trotzdem gab es in seinem Inneren eine Vorliebe für unheimliche düster-morbide Szenarien. Er liebte es einfach, sich zu gruseln. Jedenfalls solange für ihn dabei keinerlei wirkliche Gefahr bestand. Sein Faible für klassische und auch moderne Horror-Filme war daher durchaus verständlich. Man zuckte erschrocken zusammen, wenn plötzlich ein Wahnsinniger oder ein Monster aus seinem Versteck hervorschoss; gleichzeitig saß man aber im weich gepolsterten Sitz eines Kinos oder auf dem heimischen Sofa, wohl wissend, dass die tödliche Gefahr nur den Figuren einer erfundenen Geschichte drohte. Filme boten die einmalige Chance, Ängste gefahrlos erleben zu können, ähnlich wie Erzählungen und Romane dieses Genres. Die literarische Form besaß sogar noch einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Film: Wenn der Autor nicht all zu viele Informationen vorgab, konnte sich der Leser sein ganz persönliches Monster basteln. Das, was sich nur im Kopf des Lesers abspielte, war nicht selten weitaus unheimlicher als der eigentliche Text. Ein Grund dafür, warum Romanverfilmungen oft so große Enttäuschung hervorriefen. SO habe ich es mir aber nicht vorgestellt!, lautete dann stets die einhellige Kritik.
Reuther fand nicht nur erneut Spaß am Bücherlesen, er entdeckte auch eine neue alte Liebe für das eigene Fabulieren. Am folgenden Tag setzte er sich wieder an den Schreibtisch, klappte seinen Laptop auf und schrieb die ersten Sätze von dem, was später einmal mit Tote Tauben betitelt sein würde.
„Dahlmeyer hasste Tauben! Diese dreckigen ewig gurrenden Ratten der Lüfte. Er hasste ihr Aussehen und ihre torkelnden Bewegungen. Er hasste ihren Gestank und vor allem den ätzenden Dreck, den sie auf Dächern, Fensterbänken und Autos hinterließen.
Noch viel mehr aber hasste er Judith Krämer. Seine Ex.“
Bereits vier Monate später war sein erster Roman fertig. Anfangs wusste Reuther gar nicht, was er mit dem Manuskript anfangen sollte. Er hatte das Buch eigentlich nur für sich geschrieben, aus reiner Neugier heraus, wie sich diese Geschichte wohl entwickeln würde. Die 293 Seiten waren irgendwie ein intimes Zwiegespräch zwischen ihm und seinem Unterbewusstsein. Es war ursprünglich gar nicht für fremde Augen und Ohren gedacht gewesen. Aus diesem Grund kam er nicht einmal auf die Idee, den Text auszudrucken. Für einige weitere Monate versteckte sich sein Debüt deshalb als unscheinbare Datei auf der Festplatte des Computers.
Text1 hatte er sie betitelt. Schlicht, beinahe schon abwertend. Warum aber hatte er die 1 hinzugefügt? Beabsichtigte er etwa, noch weitere Texte zu verfassen? War dies vielleicht erst der Anfang? Er hatte ehrlich gesagt nicht den geringsten Schimmer.
Irgendwann aber öffnete Reuther Text1 erneut und begann mit einer sorgfältigen Überarbeitung und Korrektur. Nach Abschluss seines Lektorats verfasste er ein dreiseitiges Exposé und verschickte es auf gut Glück an zehn geeignet scheinende Verlage, die er aus dem Netz herausgesucht hatte. Wie zu erwarten, erhielt er bald darauf acht vorgedruckte Absagen. Zwei der Verlage reagierten überhaupt nicht.
Aber Reuthers Ehrgeiz war nun geweckt worden. Er wählte einige neue Verlage aus, dieses Mal auch kleinere Unternehmen mit einer Backlist von nur einem Dutzend Titel, und versuchte abermals sein Glück.
Viele Wochen vergingen, aber nichts geschah. Er hatte die ganze Angelegenheit beinahe schon vergessen, als eines Tages plötzlich ein Brief mit einem seltsamen roten Logo eintraf. Das weiße Konterfei eines Mannes mit Fedora, unterlegt von einem blutigen Klecks. Darunter ein schräger Schriftzug: Cornells. Der Verlag zeigte tatsächlich Interesse an seinem Roman und bat um die Zusendung des gesamten Manuskripts. Noch immer war Reuther weit davon entfernt, in Jubelschreie auszubrechen, aber als er einige Zeit später wirklich einen Buchvertrag unterschrieb, musste er sich eingestehen, die Bühne der Literatur betreten zu haben.
Er wandte sich nun vom Fenster mit all seinen sommerlichen Verlockungen ab und schlurfte nachdenklich zurück zu seinem Arbeitsplatz. Hinter dem Stuhl blieb er stehen und fixierte den flachen schwarzen Kasten auf dem Tisch. Wie ein düsteres Menetekel thronte das Ding vor ihm.
Schwarz, dachte er. Genau so sieht deine Zukunft als Autor aus.
Als Cornells ihn ein halbes Jahr später aufforderte, einen Nachfolger zu schreiben, hatte er sofort ein mulmiges Gefühl bekommen. Ideen mochte er zwar haben, doch wie sollte er erneut derart viele Seiten füllen? Reuther war kein Freund von detailreichen Konzepten. Er verspürte weder die Lust, noch verfügte er über die Ausdauer und Disziplin, jeden Handlungsstrang einer Erzählung minutiös auszuarbeiten. Tote Tauben war einfach so geschehen. Es war irgendwie auf wundersame Weise während des Schreibens entstanden. Eine verblüffende mysteriöse Evolution. Er bezweifelte, ob man einen derart nebulösen Vorgang bewusst steuern konnte.
Nichtsdestotrotz hatte er sich hingesetzt und mit dem Schreiben eines zweiten Teils begonnen. Bluternte nahm einen in jeder Hinsicht unerwarteten Verlauf. Ganz langsam entwickelte sich eine weitere Geschichte, die jedoch mehr und mehr von seiner Grundidee abwich. Der Roman begann ein merkwürdiges Eigenleben zu entwickeln; ständig gab es Wendungen, die er so gar nicht vorgesehen hatte.
Auf der einen Seite erwiesen sich seine Befürchtungen als vollkommen unbegründet, denn Reuther verzweifelte nicht vor einem leeren Bildschirm. Es wollte sich aber auch partout keinerlei Routine einstellen. Ganz im Gegenteil. Das einzige routinemäßige Ritual bestand in seinem Tagesablauf. Jeden Morgen um halb acht setzte er sich mit einer Kanne Kaffee und ausreichend Zigaretten vor den Laptop und hoffte auf Inspiration. Gegen dreizehn Uhr machte er sich für gewöhnlich eine Kleinigkeit zu essen oder fuhr zu seinem Lieblingsitaliener in die Stadt. Von fünfzehn bis achtzehn Uhr arbeitete er dann erneut am Computer. Den Abend verbrachte er meist mit Lesen, Fernsehen oder dem Treffen mit Freunden.
Rituale und Routinen waren gut für das Schreiben, hatte er einmal irgendwo gelesen. Sie erforderten Disziplin, und Disziplin war wiederum eine notwendige Voraussetzung für Ausdauer.
Bluternte verlangte ihm diesbezüglich allerdings ein schon fast unerträgliches Maß ab. Bis zum Schluss blieb der Roman ein Phantom, ein scheues Gespenst, das sich niemals mehr als um zwei weitere Seiten vor ihm enthüllte. Zu seinem maßlosen Erstaunen beeinflusste dieses zähe Ringen allerdings nicht seinen Stil. Das fertige Buch las sich, als ob er es innerhalb von drei Wochen einfach so hingeschrieben hätte. Den Lesern gefiel es jedenfalls noch besser als sein Erstling. Bingo! Reuther umklammerte die Stuhllehne, bis sich seine Finger wie Klauen in die Polsterung bohrten.
Bingo?
Er stieß ein kurzes Lachen aus, das aufgrund seines Zigarettenkonsums eher wie ein rasselndesHusten klang. Nichts war hier Bingo. Überhaupt nichts. Wenn Bluternte sich wie ein scheues Gespenst gebärdet hatte, dann war sein neues Buch ein … ein …
„Miststück!“, fauchte er in die Stille hinein. „Ein arrogantes kleines Miststück!“
Von Anfang an war die Figur der Nora Bolden ein nicht zu entschlüsselndes Geheimnis für ihn gewesen. Nie tat sie das, was man von ihr erwartete oder verlangte. Schließlich war er es doch, der sie ins Leben gerufen hatte. Er war Noras Schöpfer, der jeden ihrer Wege, ja, sogar jeden ihrer Gedanken bestimmte.
Oder etwa nicht?
Die junge Dame benahm sich nämlich so, als ob alles nur nach IHREM Kopf liefe. Sie missachtete nicht nur fortwährend seine Lenkungsversuche, sie dachte auch nicht im Traum daran, ihm mitzuteilen, welche Entscheidung ihr stattdessen in den Sinn gekommen war. Sie machte es einfach. Und er hechelte ihr von Seite zu Seite hinterher.
Reuther tat das, was er immer machte, wenn er nervös, verärgert oder frustriert war: Er zog sein schmales Silberetui aus der Tasche und zündete sich eine Selbstgedrehte an. Dann sog er tief den Rauch in seine Lungen und hielt ihn für eine kleine Ewigkeit dort fest. Wie ein bizarrer Nikotin-Apnoetaucher schlenderte er schließlich zurück zum Fenster und blinzelte in die Sonne.
Als er stoßweise wieder ausatmete, überzog sich die grelle Außenwelt mit einem angenehm grauen Nebel. Schon viel besser.
Ganz allmählich wurde der Garten dunkler, bis er sich schließlich in eine nächtliche Prärielandschaft verwandelt hatte. Reuther starrte nun mit Noras Augen durch die mit Insekten verschmierte Windschutzscheibe, aber alles, was er sah, war eine staubige Einöde.
Was zum Teufel hast du hier nur verloren?
Seit nunmehr dreiundzwanzig Tagen stellte er sich immer und immer wieder die gleiche Frage. Aber das eingebildete Miststück antwortete ihm einfach nicht. Es war nicht nur ihre spontane Entscheidung, die Interstate zu verlassen, es war die gesamte Szene, die ihm missfiel. Angefangen bei der gescheiterten Entführung am Busbahnhof, über den Geldkoffer, bis hin zu Noras kopfloser Flucht, machte alles einen merkwürdigen Déjà-vu-Eindruck auf ihn. Es wirkte wie ein alter Hollywoodschinken, den er so oder so ähnlich schon dutzende Male gesehen hatte. Reuther stutzte plötzlich.
Psycho!, schoss es ihm auf einmal durch den Kopf. Die ganze Flucht mit dem Wagen war doch beinahe eine 1:1-Kopie der Eröffnungssequenz aus Hitchcocks berühmtem Thriller.
Na vielen Dank auch, Miss Bolden!, dachte er. Was für eine gelungene Hommage an den Alt-Meister.
Er gönnte sich einen erneuten Apnoe-Zug, ließ den Rauch aber dieses Mal mit einem aggressiven Zischen in einer dichten Wolke entweichen.
Eines schwor er sich jetzt schon: Sollte Nora auf die Idee kommen, in einem Motel abzusteigen (sofern sie überhaupt jemals wieder geruhte, mit ihm zu sprechen oder etwas anderes tat, als sinnlos in der Gegend herumzufahren), so würde er das gesamte Manuskript in denAltpapiercontainerbefördern. Sechsundneunzig hart erkämpfte Seiten hin oder her. Markus Reuther mochte sich als so Einiges betrachten, als einen fantasielosen faulen Autor, einen Chaoten, vielleicht sogar als einen naiven Opportunisten, aber als Plagiator wollte er sich auf keinen Fall beschimpfen lassen.
Möglicherweise bin ich aber auch etwas ganz anderes. Ein vollkommen durchgeknallter Irrer, der reif für die Anstalt ist.
Welcher halbwegs normale Mensch stritt sich schon mit imaginären Figuren oder ärgerte sich über deren Verhalten? Okay, vielleicht World-Of-Warcraft-Spieler, Harry Potter-Fans und Serien-Nerds von The Big Bang Theory einmal ausgenommen. Wenn man es nüchtern betrachtete, dann war er verrückter als ein jodelndes Eichhörnchen.
Es war allerdings kein Jodeln, sondern die Klänge einer Panflöte, die Reuther schließlich aus seinen Gedanken rissen. Ennio Morricone. Cockeyes Song aus Sergio Leones Es war einmal in Ameríka. Er liebte alles, was Morricone und Leone jemals fabriziert hatten und die Resultate ihrer Zusammenarbeit waren Meisterwerke für die Ewigkeit. Kein Wunder also, dass er den Klingelton seines Handys entsprechend ausgewählt hatte.
Er folgte der vertrauten Melodie hinaus auf den Korridor. Eine genaue Ortung fiel ihm jedoch schwer. Die Panflöte klang recht dumpf, als wenn sie hinter einer Zwischenwand eingemauert wäre.
Reuther seufzte. Er besaß zwar eines dieser Alleskönner-Smartphones, benutzte es jedoch nur höchst selten. Die Schar seiner Freunde war begrenzt und Internet-Recherchen ließen sich viel bequemer von zu Hause aus am Laptop erledigen. Blieben also nur die zehn Milliarden Apps, die man dem kleinen Kasten hinzufügen konnte. Doch auf die meist falsche Wetterprognose konnte er gerne verzichten; da schaute er lieber morgens aus dem Fenster. Eine Uhr trug er bereits am Handgelenk und Spiele jedweder Art hatten schon vor Jahren jeglichen Reiz für ihn verloren. Man konnte sich mittlerweile per SIRI sogar mit seinem iPhone unterhalten, doch leider verriet ihm das elektronische Wunderwerk trotzdem nie, wo es sich gerade befand. Trotz GPS und all dem übrigen Schnickschnack.
Er blieb kurz stehen. Die Panflöte wurde jetzt zunehmend lauter. Immerhin war es ihm nach unzähligen Versuchen gelungen, einen aufsteigenden Klingelton auszuwählen. Wo hatte er das blöde Ding nur wieder liegen gelassen?
An der Garderobe wurde er schließlich fündig. Natürlich versteckte sich das iPhone an einem der üblichen Orte: in der Innentasche seines Jacketts. Er zog es heraus und warf einen prüfenden Blick auf das Display. Das schielende Gesicht eines fülligen Mittdreißigers mit schlecht verheilter Akne und rotblonder Jesusfrisur grinste ihm entgegen. Sein alter Kumpel Schotti, wer sonst?
Reuther drückte auf Annehmen und sagte: „Na, altes Haus. Was …?“
Weiter kam er nicht.
„Meine Güte! Du klingst so weit entfernt. Aus welchem Kellerloch hab ich dich denn soeben gezogen?“, dröhnte es ihm entgegen. „Gräbst du gerade auf deinem Herrensitz nach Schätzen deiner Vorfahren oder schachtest du einen Brunnen aus, um noch unabhängiger von uns Normalos hier draußen zu werden?“
„Nein, ich … ich musste nur erst das blöde Telefon suchen. Ich …“
„Is ja mal wieder typisch! Andere Leute tragen ihr Handy immer bei sich, weißt du? Das ist recht nützlich, wenn man mal angerufen wird, verstehste? Ein Griff und – Schwupps! – ist man dran!“
Ich WILL aber gar nicht immer sofort dran sein, dachte Reuther. Stattdessen sagte er: „Keine schlechte Idee. Werde ich mir für die Zukunft wohl merken müssen. Und was verschafft mir die Ehre deines Anrufs, abgesehen von nützlichen Tipps zur Lebensführung?“
„Was? Ach so, ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob du Lust hast, dich heute Mittag mit mir zum Mampfen zu treffen.“
Zum Mampfen treffen bedeutete bei Schotti stets ein üppiges Gelage in einem Restaurant seiner Wahl. Wenn es jedoch ums Bezahlen ging, durfte dafür gerne sein jeweiliger Gast einspringen. Reuther kannte das füllige Unikum mit der dröhnenden Lache schon seit der Schulzeit, und an dessen chronischem Geldmangel hatte sich bis zum heutigen Tage nichts geändert.
Er schaute kurz auf seine Uhr. Zwanzig nach elf. „Okay. Und wo gedachte der Herr, zu dinieren?“
„Was hältst du von der Orangerie? Man hat ne nette Aussicht von dort oben.“
Reuther musste grinsen. Sein Freund war nicht gerade ein Fan von Dönerbuden oder Fast-Food-Ketten. Die Orangerie war ein bekanntes Café und Restaurant auf den Wuppertaler Höhen in unmittelbarer Nachbarschaft des Botanischen Gartens. Da dort auch mediterrane Küche angeboten wurde, fiel ihm die Entscheidung nicht schwer. Kluger Schachzug, Schotti!
„Einverstanden. Und wann?“
„Sagen wir in einer Stunde, okay? Ich bin grad noch in Essen bei einem wahnsinnig interessanten Schulrenovierungsprojekt, aber bis dahin dürfte ich's schaffen.“
Schotti, der mit richtigem Namen Thorsten Stern hieß, war als Freelance Journalist für diverse kleinere Zeitungen tätig. Nachdem sein ehemaliger Arbeitgeber, Der Velberter Bote, vor drei Jahren Konkurs hatte anmelden müssen, tingelte Stern zwischen verschiedenen Redaktionen hin und her. Die Zeiten waren alles andere als rosig und die wenigen Aufträge, die er überhaupt ergattern konnte, reichten gerade mal aus, um die Kosten für sein Auto zu decken. Der Rest wurde vom ALG II übernommen. Schotti hasste den Ausdruck Hartz IV, aber wie immer man es auch bezeichnete, ohne Stütze kam er einfach nicht über die Runden.
„Einverstanden“, sagte Reuther. „Dann bis um halb eins in der Orangerie.“
„See you later, Alligator.“
„After awhile, Crocodile“, antwortete er automatisch, aber Stern hatte bereits aufgelegt.
Reuther schüttelte lächelnd den Kopf. Diese blöden uralten Sprüche schienen zwischen ihnen beiden einfach nicht auszusterben. In Schottis Gegenwart erlebte er stets ein beinahe schon unheimliches Zeitphänomen. Sie trafen sich recht unregelmäßig, vielleicht sechs- oder acht Mal im Jahr. Bei dem unsteten Lebenswandel seines Freundes konnte es sogar vorkommen, dass länger als ein Vierteljahr Funkstille zwischen ihnen herrschte. Telefone funktionierten natürlich in zwei Richtungen, doch da Reuther nur in äußersten Notfällen zum Handy griff, fielen ihm die langen Pausen immer erst dann auf, wenn Schotti sich plötzlich wieder einmal bei ihm meldete. Dann konnte es allerdings geschehen, dass sie zwei oder drei Stunden quatschten, oder dass sein Kumpel ihn in einer Woche gleich über ein dutzend Mal kontaktierte. Zu jeder Tages- und Nachtzeit wohlgemerkt. Und jedes Mal stürzte er dabei irgendwie durch einen Zeittunnel, der ihn wieder fünfzehn oder sechzehn Jahre alt werden ließ. Sie waren beide älter geworden, gar keine Frage, aber Thorsten hatte sich etwas Jugendliches, Kindliches, ja sogar verrückt Revoltierendes bewahrt, das aus irgendeinem Grund ungemein ansteckend wirkte. Oft überraschte er ihn mit derart albernen Ideen, wie sie nur ein Teenager aushecken konnte. Klingeltürchen spielen. Oder täuschend echt kopierte Strafzettel hinter die Windschutzscheiben von Falschparkern stecken.
Manchmal reichte auch nur sein dröhnendes Lachen aus, das wild und hemmungslos durch jeden noch so noblen Saal hallte, um das feste Korsett gesellschaftlicher Konventionen zu sprengen und vornehme Zurückhaltung augenblicklich in ausgelassene Heiterkeit zu verwandeln. Sein alter Schulkamerad besaß die seltene Gabe, jeden in seiner Umgebung sofort alterslos werden zu lassen. Zumindest diejenigen, die sich dafür empfänglich zeigten.
Reuther ging zurück in sein Büro, wo er etwas in einen blauen Briefumschlag steckte. Dann warf er sich das helle Leinenjackett über, ließ Handy und Umschlag in der Innentasche verschwinden und fischte anschließend die Autoschlüssel von der Ablage.
Ready to go!
Er fuhr einen zwölf Jahre alten Golf IV in Blaumetallic. Angesichts seines Bankkontos hätte er sich zwar auch einen Porsche oder Ferrari leisten können, doch er machte sich nichts aus protzigen Nobelkarossen. Hauptsächlich nutzte er den Wagen für Fahrten in die Stadt, zum Einkaufen, für Restaurantbesuche oder um sich mit Freunden zu treffen. Nur zu Lesungen fuhr er gelegentlich etwas weiter. Was sollte er da mit einem Auto jenseits der hunderttausend Euro-Schallmauer? Abgesehen davon, dass diese Designer-Unikate kaum mehr als zwei Personen Ballast zuließen (und vielleicht noch ein Gepäckstück von der Größe eines platt gedrückten Chihuahuas), gelangte man mit ihnen letztendlich auch nur von Punkt A nach Punkt B. Dabei war es noch nicht einmal sicher, ob sie ihr Ziel schneller erreichten, als sein alter Golf. Auf der A46 kannte er nämlich keinen einzigen Abschnitt, auf dem man längere Zeit gefahrlos über zweihundert km/h rasen konnte. Fünfhundert PS bei Baustellen-Schikanen im zäh fließenden Verkehr waren nämlich ähnlich sinnvoll wie ein SUV auf der Teerstraße. Für ihn waren das nur dekadente Status-Symbole ohne Sinn und Verstand.
Als Reuther den Zündschlüssel drehte und der Vierzylinder wie immer gehorsam ansprang, zeigte sich ein zufriedenes Lächeln auf seinen Lippen. Seine Dekadenz bestand darin, keinem Chef und keiner Firma hörig sein zu müssen und seinen Tagesablauf selbst bestimmen zu können. Das übertrumpfte selbst eine ganze Flotte aus Ferraris.
Kapitel 3
Die kurze Fahrt ins Tal hinunter und durch Elberfeld hindurch verlief ohne große Behinderungen. Noch, dachte er. Noch hatte man die B7 nicht auch gesperrt, um das Großbauprojekt Döppersberg zeitlich schneller über die Bühne zu bekommen. Die Stadt plante nämlich, die Talachse für ganze drei Jahre stillzulegen, damit der Hauptbahnhof gründlich renoviert und mit einer Einkaufs-Mall versehen werden konnte. Zusätzlich waren ein neuer Busbahnhof sowie die Tieferlegung der Bundesallee geplant. Neben den sowieso schon zu erwartenden Verkehrsproblemen hatten Neuplanungen und Bauverzögerungen die Kosten bereits deutlich in die Höhe schießen lassen. Im Vergleich zum Berliner Flughafen-Debakel waren dies zwar nur Peanuts, ein gelungenes Projekt sah jedoch anders aus.
Reuther seufzte erleichtert, als er zum Botanischen Garten abbog. Gut, dass er nur recht selten diese Strecke fahren musste.
Der Parkplatz an der Elisenhöhe war um diese Zeit nur zu einem Drittel belegt und so konnte er sich eine große Lücke am oberen Ende aussuchen. Als er ausstieg, raubte ihm die Hitze fast den Atem. Derart hohe Temperaturen im Juni waren kein gutes Omen. Meist folgte darauf nämlich ein verregneter und viel zu kühler Sommer. Das zum Thema Klimaerwärmung.
Er zog sich das Jackett aus und warf es sich locker über die Schulter. Als leidgeprüfter Wuppertaler musste man halt nehmen, was man kriegen konnte.Reuther war viel zu früh, deshalb schlenderte er gemächlich den Weg durch die Wiesen des Hardt-Parks hinauf. Bis zu den Sommerferien dauerte es noch mehr als drei Wochen; daher sah er nur einige Mütter mit kleinen Kindern, die es sich auf dem Grün bequem gemacht hatten. Eine Gruppe Studenten schwänzte gerade offenbar ihre Vorlesungen, um die Zeit sinnvoller mit Frisbee werfen und Volleyball spielen zu verbringen. Ansonsten döste der Park nahezu verlassen im heißen Licht der Mittagssonne vor sich hin.
Er hatte beinahe die Anhöhe mit den Gewächshäusern und dem dahinter liegenden Elisenturm erreicht, als ein bunter Fleck seine Aufmerksamkeit erregte. Auf einer der oberen Wiesen stand ein Mädchen oder eine junge Frau, die genau in seine Richtung schaute. Bewunderte sie etwa den Ausblick auf den Park? Er wollte schon weitergehen, als ihm etwas Sonderbares an der Spaziergängerin auffiel. Es war ihre Kleidung! Die Unbekannte trug einen weiten fliederfarbenen Rüschenrock und eine hellgrüne Bluse. Um ihre Hüften wand sich eine breite gelbe Schärpe, die im Sonnenlicht zu glühen schien. Reuther blinzelte mehrmals. Aufgrund der Entfernung konnte er keine Details ausmachen, doch er hatte plötzlich das seltsame Gefühl, auf ein Bild von Monet zu starren. Ein lebendes Gemälde. Die Frau dort oben trug Kleider, die vielleicht das letzte Mal Ende des 19. Jahrhunderts in Mode gewesen waren.
Es dauerte weitere fünf Sekunden, bis der Groschen endlich bei ihm fiel. Als Teilzeit-Eremit verschlief er so manchen Trend. Jugendliche kommunizierten mittlerweile in einer ihm unbekannten Sprache und machten noch kryptischere Handzeichen; wie sollte er da wissen, was gerade modisch angesagt war? Auf Messen und diversen Cons waren ihm durchaus schon ähnlich gekleidete Mädchen in kitschig bunten Kleidern oder Schuluniformen mit puppenhaften Gesichtern und riesig geschminkten Augen begegnet. Verrückte Fans dieser unsäglichen Manga-Comic-Welle, die schon seit Jahren über Europa hinwegschwappte. Es machte ganz den Anschein, als ob sich dort oben eine Variante dieser Manga-Girls verlaufen hätte.
Er blinzelte erneut und beschattete dann die Augen mit der Hand, um besser sehen zu können, doch das seltsam gekleidete Mädchen war plötzlich verschwunden.
Verwirrt suchte Reuther nun alle Wiesen oberhalb seines Standpunktes ab, aber bis auf die frisbeespielenden Studenten und die Mütter mit Kindern befand sich weit und breit keine Menschenseele auf dem Parkgelände.
Hatte sich die Unbekannte vielleicht hingekauert? Nein, entschied er. Da das Gras überall kurz geschnitten war, hätte er auch problemlos einen liegenden Körper entdeckt. Vor allem, wenn er in derart auffällige Farben gehüllt war. Er überdachte seine Augen nun mit beiden Händen; dasResultat blieb aber dasselbe. Wie war es dem Manga-Girl nur so schnell gelungen, von dort zu flüchten? Die nächste Baumgruppe, die Sichtschutz bot, lag mindestens hundert Meter von der Stelle entfernt. Unmöglich, dachte er. Hundert Meter in drei Sekunden einen schrägen Hang hinauflaufen? Selbst eine Top-Athletin mit Laufdress und Cross-Schuhen hätte dafür mindestens die vierfache Zeit benötigt. Es war einfach verrückt. Miss Manga hatte zu allem Überfluss aber noch einen weiten Rüschenrock getragen. Und Laufschuhe mit grober Offroad-Sohle hätten zu ihrem Outfit ohnehin nicht gepasst.
Er starrte noch eine ganze Weile auf die verlassene Wiese, so als müsse das Mädchen jeden Augenblick wieder auftauchen, doch der obere Teil des Parks verharrte in Totenstarre. Er sah immer noch ein impressionistisches Gemälde vor sich. Es lebte allerdings nicht mehr. Bezeichneten die Franzosen Stillleben daher als Nature morte, als abgestorbene/erloschene Natur?
Erst jetzt wurde ihm bewusst, welch merkwürdigen Eindruck er wohl auf andere Leute machen musste. Ein Typ, der derart auffällig die Parkanlagen beobachtete, wurde sehr leicht als Spanner eingestuft. Unsicher schaute er sich um, aber niemand schien Notiz von ihm genommen zu haben.
Glück gehabt.
Angesichts verschärfter Stalking-Gesetze geriet man heutzutage schneller in Erklärungsnot, als man Romanrecherche sagen konnte. Nach einem letzten Blick über die Anlagen setzte er seinen Weg fort. Vielleicht hab ich's mir ja nur eingebildet, dachte er. Möglicherweise war es nur eine farbige Brechung des Sonnenlichts gewesen. Eine optische Täuschung, die ein seltsames Prismahervorgerufen hatte.
Ein Prisma, das einen fliederfarbenen Rock mit gelber Schärpe und eine hellgrüne Bluse herbeizaubern konnte?
Das aufgeregte Kläffen eines Hundes riss ihn aus seinen Grübeleien. Ein kleiner Mops, der sich angesichts des Sommertages wohl für einen Husky hielt und wie wild an der Leine seines Frauchens zerrte, hechelte ihm entgegen. Reuther wich dem Gespann in weitem Bogen aus und folgte schließlich dem Weg entlang der Wasserbecken hinauf zur Anhöhe.
Als er in der Orangerie eintraf, war es etwa halb eins. Perfektes Timing. Schnell musterte er die wenigen besetzten Tische, aber das vertraute Gesicht seines Freundes konnte er nicht unter den Gästen entdecken. Dies überraschte ihn allerdings nicht wirklich, denn Schotti war nicht gerade für seine Pünktlichkeit bekannt.
Reuther durchquerte das Restaurant und suchte sich einen Platz auf der angrenzenden Terrasse. Unter dem kühlenden Schatten zweier quadratischer Baldachine boten zahlreiche Tische ein reizvolles Panorama mit Ausblick auf den Botanischen Garten. Er setzte sich allerdings so, dass er stattdessen den Durchgang gut im Blick hatte. Mit dem angebauten Wintergarten strahlte die ehemalige Villa ein angenehm warmes Rot aus. Die hohen bleigefassten Glastore wurden von Klinker mit Jugendstil-Ornamenten umrahmt. Über der Orangerie ragte ein flaches weißes Dach, das dem Fries eines griechischen Tempels nachempfunden war. Reuther drehte sich halb in seinem Stuhl herum und atmete einmal tief durch. Ein schwacher Orchideenduft hing in der Luft. Inmitten des Grüns, in dem sogar einige kleinere Palmen nicht fehlten, konnte man vorzüglich entspannen. Er musste schmunzeln. Besonders an einem solch heißen Tag wie heute war der Treffpunkt perfekt gewählt.
Thorsten Stern mochte vielleicht die eine oder andere Macke haben, in Sachen Restaurants besaß er jedenfalls ein unschlagbares Gespür.
Als eine Kellnerin vor seinem Tisch erschien, bestellte er sich zum Auftakt erst einmal eine große Apfelschorle. Er streckte die Beine genießerisch aus, holte sein Silberetui hervor und zündete sich eine Selbstgedrehte an. Nicht zuletzt deshalb hatte er sich für die Terrasse entschieden; in einem Land, in dem öffentliches Rauchen mittlerweile kriminalisiert und sogar aus den Kneipen verbannt worden war, galt es jeden noch halbwegs legalen Ort zu nutzen. Reuther nahm einen seiner Tieftaucher-Züge und schloss genießerisch die Augen. So ließ es sich aushalten! Es waren kleine unscheinbare Momente wie diese, die tatsächliche Lebensqualität bedeuteten. Kein schnöder Mammon. Kein …
„Entschuldigen Sie, aber wären Sie bitte so freundlich, ihre Zigarette auszumachen? Der Rauch stört meine empfindliche Nase.“ Die tiefe Stimme besaß etwas widerlich Oberlehrerhaftes. Da machte es jemandem offenbar großen Spaß, andere zurechtzuweisen. Genervt stieß Reuther zuerst eine blaue Wolke aus und öffnete dann die Augen.
„Hör mal gut zu, Freundchen“, begann er in scharfem Ton. „Wenn du glaubst, du …“ Das breite Grinsen seines Gegenüber irritierte ihn. Der Nörgler sah außerdem nicht gerade wie ein Studienrat aus. Eher wie ein 1,75m großer stark untersetzter Big Lebowski aus Unterbarmen. Er trug ausgebeulte sandfarbene Cargohosen und ein weites Hemd mit Karomuster. Sein schulterlanges rotblondes Haar hing ihm in dicken Strähnen ins Gesicht und überdeckte teilweise eine Sonnenbrille im 50er Jahre Retro-Look. Big-Blues-Brother-Lebowski im Karo-Look. Karos waren schon immer sein Markenzeichen gewesen, weshalb man ihm in der Schule auch diesen besonderen Spitznamen verpasst hatte. Ein Schotte, der sein Clanmuster stets über der Gürtellinie trug.
Hätte es noch einen Zweifel an der Identität des Dicken gegeben, so wurden die letzten Bedenken nun durch sein dröhnendes Gelächter ausgelöscht. Niemand lachte derart ungehemmt in der Öffentlichkeit wie Thorsten Schotti Stern.
„Blödmann“, kommentierte Reuther das Auftreten seines Freundes.
„Ich freue mich auch, dich zu sehen“, sagte sein alter Schulfreund, der immer noch Mühe hatte, ein Kichern zu unterdrücken. „Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen! Hach, immer wieder schön, jemanden auf den Arm zu nehmen. Von null auf hundertachtzig in zwei Sekunden.“
Stern zog geräuschvoll einen Stuhl zurück und nahm ihm gegenüber Platz. „Hast du schon was bestellt?“
„Nein, nur eine Schorle.“
Wie aufs Stichwort erschien jetzt die Kellnerin mit seinem Getränk.
„Du trinkst an einem so schönen Tag Wasser mit Geschmack?“ Stern verzog angewidert das Gesicht. Er wartete ab, bis die junge Dame das Glas abgestellt hatte, und sagte dann: „Für mich bitte eine Hopfen-Kaltschale vom Fass.“
Die Bedienung war offenbar derartige Bezeichnungen gewohnt. „Sehr gern, der Herr. Da hätten wir Warsteiner oder Frankenheim Alt.“
„Ein Warsteiner wäre perfekt.“
Er schob sich die Sonnenbrille in die Stirn und blickte dann verträumt den schlanken Beinen der Angestellten hinterher. Durch ihren wiegenden Gang pendelte die weiße mit Spitze verzierte Schleife der Schürze hin und her und betonte dabei aufreizend die Rundungen, die sich unter dem engen Rock abzeichneten.
„Vergiss es“, murmelte Reuther. „Die spielt in einer ganz anderen Liga. Außerdem könntest du fast ihr Vater sein.“
„Das sagt gerade der Richtige.“ Stern kratzte sich achtlos über einen Pickel auf seiner Wange. Seine teigige Haut war von den Narben einer nur schlecht verheilten Akne überzogen. Die kleinen Gesichtskrater verliehen ihm trotz seiner äußeren Teddybär-Erscheinung etwas brutal Verwegenes. Sterns Vorliebe für alles Süße sorgte jedoch auch für jede Menge neuer Pickel, denen er ständig blutig zu Leibe rückte.
„Ich steh halt auf Uniformen jeglicher Art. Ist ja wohl kein Verbrechen, oder?“
Ein feucht glänzender roter Fleck verriet, dass er soeben erneut einen Feind besiegt hatte. Obwohl Reuther diese unappetitliche Marotte seit Langem kannte, studierte er lieber die Mauerverzierungen der Orangerie. Die nächste Frage zwang ihn allerdings dazu, die Freskenbewunderung abrupt zu beenden.
„Wie läuft's eigentlich mit euch? Mit Evie und dir?“
Ein weiteres von Schottis zahllosen Talenten bestand darin, wie ein Trüffelschwein zielsicher auch jedes noch so kleine Fettnäpfchen zu entdecken. Ähnlich dem Borstenvieh kannte auch er keinerlei Scham und genoss es geradezu, sich in allen Schlammpfützen zu suhlen.
„Evie?“ Reuther tat so, als müsste er erst einmal nachdenken, von wem überhaupt die Rede war. „Eher durchwachsen würde ich sagen.“
„Durchwachsen? Was soll das denn heißen?“
„Nun ja, wir haben momentan eine kleine Pause eingelegt.“
Stern schnaufte. „Oh, Mann! Wem machst du hier eigentlich was vor? Eine Pause einlegen heißt doch nichts anderes, als dass es aus ist. Vorbei! Adios muchachos!“
„So eindeutig würde ich die Sache aber nicht sehen. Ich …“
„Wie lange dauert eure kleine Pause denn schon an?“, unterbrach er Reuthers Erklärungsversuche.
„Zwei Monate. Oder vielleicht auch drei. Keine Ahnung. Ich führe nicht Buch darüber.“
„Oder vielleicht auch schon vier?“ Er schob sich die Sonnenbrille auf die Nasenspitze und fixierte seinen Tischnachbarn über den Rand hinweg. „Und wie oft habt ihr seitdem schon miteinander telefoniert?“
„Du kennst mich doch“, sagte Reuther. „Ich hab's nicht so mit Anrufen …“
Stern schüttelte heftig den Kopf. Einige seiner schweißverklebten Haarsträhnen wirbelten dabei um ihn herum wie die Schlangen eines Gorgonenhauptes. „Du bist echt ein hoffnungsloser Fall, Marky-Boy! Du verbarrikadierst dich dort oben in deiner Luxus-Villa, schreibst deine komischen Geschichten und lässt in der Zwischenzeit das Leben einfach so an dir vorüberziehen. Mein Gott, wenn ich deine Kohle hätte, ich wär' ständig unterwegs! Heute New York, morgen Hawaii. Und ständig die schärfsten Weiber um mich herum, verstehst du?“
Reuther gönnte sich erst einmal einen großen Schluck Schorle, bevor er antwortete: „Da du gerade davon sprichst, wie sieht eigentlich dein Harem aktuell aus?“
„Kann mich nicht beschweren.“ Er hielt kurz inne, als sein Bier gebracht wurde. Während die Bedienung das Glas abstellte, verschlang Schotti den schlanken Körper der Frau mit seinen Blicken. „Na, hast du gesehen?“, grinste er, nachdem sie wieder alleine waren.
„Was?“
„Was? Na, wie tief sie sich zu mir hinabgebeugt hat und wie extra-langsam sie das Bier auf den Tisch gestellt hat, natürlich! Die Tussi steht auf mich.“
Nun war es an Reuther, die Augen zu verdrehen. „Na aber sicher doch. Das war ja direkt peinlich, wie sie sich dir an den Hals geworfen hat. Das grenzte schon an sexuelle Belästigung.“
Sterns Grinsen wurde deutlich schmaler. Offenbar war er sich unsicher darüber, ob ihn sein Freund gerade verulkte.
„Wie dem auch sei“, sagte er schließlich, „richtige Männer leben nicht nur allein von Luft und Liebe.“ Mit diesen Worten nahm er sich die Menükarte und begann sie eingehend zu studieren. Reuther folgte seinem Beispiel. Ihre Unterhaltung würde wohl bis zur Bestellung ruhen müssen, denn Thorsten Stern gehörte zu den Leuten, die das Speisenangebot eines Restaurants mit ähnlich heiligem Ernst begutachteten wie ein Börsenmakler das Wall-Street-Journal.
Die Wahl fiel schließlich auf eine Gurken-Limonenrahm-Suppe und glasierte Perlhuhnbrust, während Reuther sich für Schweinemedaillons auf Violett-Kartoffelpürree, Pak-Choi und Malzbier-Jus entschied.
„Was? Heute kein italienisches Gericht?“, wunderte sich Stern. „Du wirst doch dem Land, wo die Zitronen blüh'n, nicht etwa untreu werden?“
„Keine Angst“, sagte Reuther, „aber wer ständig glücklich sein möchte, muss sich eben oft verändern.“
„Behauptet wer? Lady Gaga?“
„Nein, Konfuzius.“
„Ach, komm mir nicht mit den ollen Japanern. Davon abgesehen bist du so veränderlich wie das Gesetz der Schwerkraft.“
„Was die Schwerkraft betrifft, dürftest du mir ja einiges voraushaben“, meinte Reuther schmunzelnd. „Tja, zugegeben … ich bin wohl tatsächlich etwas … nun ja … also ein Gewohnheitstier. Aber jeder fängt doch mal klein an, oder etwa nicht? Und Konfuzius war übrigens Chinese.“
Während des Essens plauderten sie über verschiedene Dinge, wie Euro-Rettungspakete, Edward Snowden, das Tripple des 1. FC Bayern und die letzte Folge von Game of Thrones. Stern berichtete von dem stressigen Alltag eines Journalisten auf Abruf und von seiner Hoffnung, bei der Essener Lokalredaktion der NRZ endlich mal wieder eine Festanstellung zu bekommen.
„Hey, das wär ja klasse“, sagte Reuther. „Hast du denn schon was Konkretes gehört?“
Stern schüttelte sein Gorgonen-Haupt. „Nee, noch nicht, aber ein Vögelchen hat mir was gezwitschert.“
„Dann drück ich dir mal fest die Daumen.“
„Wird schon.“ Stern wickelte sein letztes Fleischstück mit der Gabel geschickt in ein Pak-Choi-Blatt und wischte damit den Teller sauber. Noch genüsslich kauend, winkte er nach der Kellnerin. Da er die Geste in etwa so zurückhaltend wie ein Ertrinkender mit Epilepsie ausführte, wurde die Bedienung schnell auf ihn aufmerksam.
„Ja bitte, der Herr?“
„Haben sie Caffè in ghiaccio?“
Die junge Frau schaute ihn nur fragend an.
„Gesüßter Kaffee über Eiswürfeln serviert“, erklärte Stern daraufhin.
„Bedauere, mein Herr. Wir haben nur Espresso, Cappuccino, Caffè Latte …“
„Schade“, unterbrach er ihre Aufzählung. „Dann nehme ich eben einen Espresso. Einen doppelten, bitte.“ Er warf seinem Tischnachbarn einen Blick zu. „Für dich auch?“
Reuther schüttelte den Kopf und wies auf sein fast leeres Glas. „Ich hätte aber gerne noch eine Schorle.“
Als die Kellnerin wieder verschwunden war, schüttelte Reuther lächelnd den Kopf. „Du mit deinen extravaganten Sonderwünschen. Caffè in was war das da eben?“
„Caffè in ghiaccio“, entgegnete Stern. „Was soll denn daran extravagant sein? Das Rezept kommt ursprünglich aus Spanien, hat sich dann aber auch in Süditalien durchgesetzt. In Salento vor allem.“
„Salento?“, fragte Reuther.
„Die Gegend, die den Absatz von Italiens Stiefel formt.“ Stern machte eine abwertende Geste. „Wie auch immer, es ist letztendlich nur ein Kaffee, der eiskalt in einem Glas und nicht in einer Tasse getrunken wird. Statt der Eiswürfel kann man natürlich auch feinen Eisschnee verwenden.“ „Natürlich.“
„Verfeinert wird das Ganze noch mit einer grünen Zitronenscheibe oder Pfefferminz.“
„Was auch sonst.“
Stern schob sich die Sonnenbrille weit auf die Nasenspitze und betrachtete seinen Freund argwöhnisch. „Ich habe das dumpfe Gefühl, das du dich über mich lustig machst, Marky-Boy.“
„Ich?“ Reuther riss die Augen weit auf, konnte dabei jedoch ein Grinsen nicht unterdrücken. „Niemals! Du kennst mich doch!“
„Eben!“
„Na, jetzt hast du mich aber schwer getroffen“, erwiderte Reuther. „Ich dachte doch nur …“
„Ja? Was bitte schön dachtest du denn?“
„Nun …“ Reuther zögerte. „Dass deine Ansprüche zuweilen vielleicht nicht ganz konform gehen mit deinen … nun ja, mit deinen Lebensumständen.“
Stern drückte sich seine Blues Brothers-Brille wieder zurück auf die Nasenwurzel. „Und was genau willst du mir damit sagen? Dass ich meinen guten Geschmack auf dem Altar des Kapitalismus opfern soll? Dass ich besser nur Brot und Wasser trinke und mich in Sackleinen kleide, nur weil ich momentan eine kleine finanzielle Durststrecke durchmachen muss?“
Sein Freund schüttelte energisch den Kopf. „Nein, natürlich nicht!“
Auch wenn die kleine finanzielle Durststrecke jetzt schon länger als drei Jahre andauerte und Stern selbst in der Zeit davor alles andere als umsichtig mit seinem Geld umgegangen war, verzichtete Reuther auf eine dementsprechende Bemerkung. Schotti war halt Schotti. „Nein, so habe ich das nicht gemeint“, beteuerte er. „Es ist nur …“
„Jahaah?“
„Nun ja, ich finde nur, man kann auch sehr gut zurechtkommen, ohne besonderen Luxus.“
Stern stieß einen tiefen Seufzer aus. „Sagt Mr. Eremit höchstpersönlich. Weißt du, Marky, es gibt aber noch einige Leute, die diesen Luxus, wie du es bezeichnest, als durchaus angenehm und notwendig betrachten und die in diesen vielleicht unnützen Dingen den wahren Sinn des Lebens sehen. Schau dir doch mal die Welt an! Überall nur Hass, Gier, Blut und Tod. Da braucht es einfach winzige Oasen der Freude, an denen man sich für einige Minuten aus diesem ganzen Mist zurückziehen kann.“
„Unter diesem Aspekt habe ich die Sache bislang noch gar nicht betrachtet“, gestand Reuther. „Da könnte tatsächlich etwas Wahres dran sein.“
„Könnte!“, schnaubte Stern. „Probier's doch einfach mal selbst aus! Ich meine jetzt nicht gleich sechs Wochen Bahamas oder einen Privatjet … nein, Luxus muss wohl dosiert genossen werden. Zuweilen genügt eine teure Zigarre oder ein fünfzigjähriger Brandy.“
„Oder ein Mittagessen auf der schattigen Terrasse der Orangerie“, warf Reuther ein.
Sein Freund nickte grinsend. „Genau. So was solltest du viel öfter mal machen!“
„Ist notiert.“
Als die Bedienung die Getränke brachte, begann Stern augenblicklich mit seiner Espresso-Zeremonie. Reuther zählte mindestens fünf gehäufte Löffel Zucker, die sein Freund nach und nach in der kleinen Tasse verschwinden ließ. Dann rührte er die schwarze Flüssigkeit in schon beinahe hypnotisch langsamen Kreisbewegungen um.
„Genau so muss ein Espresso sein“, murmelte er dabei. „Heiß wie Lava und süß wie die Liebe.“
Reuther grinste. „Oh, der Herr durcheilt den Weltenraum heute auf Pegasus' Rücken? Welch seltene Gnade für uns Sterbliche!“
Stern antwortete nicht; stattdessen nahm er einen großen Schluck Espresso und schloss dabei genießerisch die Augen.
„Apropos“, fuhr Reuther im Plauderton fort, „schreibst du eigentlich noch?“
Stern setzte die fast leere Tasse ab und sagte: „Wann immer man meine Dienste verlangt. Sei es für den Kaninchenzüchterverein, bei Verkehrsunfällen oder Schulsanierungen, der rasende Reporter Thorsten Stern ist stets zur Stelle.“
„Nein, nicht dein Journalistenzeug. Du weißt genau, was ich meine. Freie Sachen.“
„Ach, du sprichst von belletristischem Zeugs, von den Sachen, mit denen du dein Geld verdienst?“
Reuther nickte nur stumm.