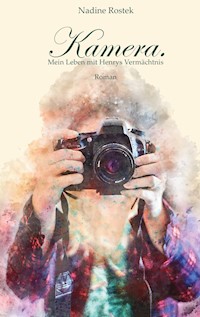
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Auf unerwartete Weise kommt der fünfzehnjährige Max an eine Kamera, die ein gut verborgenes Geheimnis hütet. Mit seiner besten Freundin Merle versucht er, sich den immer neuen Herausforderungen zu stellen, die sie mit sich bringt. Als auch noch ein kleines Mädchen verschwindet und Max diesen mysteriösen Fremden ins Visier nimmt, spitzt sich die Lage drastisch zu. Wird er es schaffen, den Fall mit Hilfe seiner Kamera aufzuklären?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meinen heimlichen Helden! Glaube an dich und deine Fähigkeiten. Und sei stolz auf dich. Ich bin es auch.
Inhaltsverzeichnis
Veränderungen
Das große Schweigen
Das Objektiv
Die Entdeckung
Die Neue
Von Herbstgefühlen und fliegenden Drachen
Der kann mir nix
Sind alle Nachbarn verrückt?
Wo kommen all die Kinder hin?
Feuerbälle und Glitzerstaub
Abwärts
Der Schlüssel
Schlaf Dämon, schlaf!
Wie kann das sein?
Ich werde dich vermissen
Aber es stimmt wirklich!
Wenn ich dich in die Finger kriege!
Mitten in der Nacht
Das Foto
Endlich Hilfe
Aus und vorbei
Der wahre Alptraum
Nur die Wurst hat zwei
Veränderungen
Seine Zeit nahte mit großen Schritten heran, er war gealtert, gebrechlich. Er musste sie endlich weitergeben, es nicht länger hinauszögern. Sein Körper hatte anderes mit ihm vor.
Die Knochen schmerzten ihn, seine Gehweise glich einem Balanceakt, einem Drahtseilakt in hundert Metern Höhe. Mit jeder Falte, die hinzukam, jedem Zahn, den er verlor, zeigte sich das Alter in allen Fasern seines Körpers.
Er hatte einen seiner klaren Momente, saß in einem zu winzigen Zimmer, starrte die kahle Wand an. Nicht ein Bild zierte sie, kein bisschen Farbe war aufgebracht. Sie sah nackt, kühl, alt aus. Sie entsprach genau seinen Empfindungen, spiegelte seine Gefühle wider.
Draußen verwandelten sich die Blätter an den Bäumen, zogen ihre buntesten Kleider an. Die Welt rüstete sich sorgfältig für die Farbenpracht des Herbstes. In seinem Inneren sah es grau aus. Ausgeblichen, trist. Die letzte Farbschicht lag lange zurück. Mit Wehmut erinnerte er sich an bessere Zeiten.
Er hatte mit diesem Leben abgeschlossen, es gab nichts mehr zu erledigen. Nur an wenigen Tagen bekam er Besuch, der den Namen im Grunde nicht verdiente, der zu kurz blieb, ihn abfertigte, wie ein Schaffner den Zug. Denn er ähnelte nicht mehr dem Mann aus der Vergangenheit, mittlerweile galt er als zu alt, zu kauzig, zu sonderbar.
Sein Körper hatte sich verändert, verlangsamt, ließ ihn kraftlos zurück. Früher sprang er die 100 Sprünge mit dem Seil in unter einer Minute. Heute war seine Zeit gekommen. In jeder schmerzenden Bewegung lag der Abschied. In der Krümmung seines einst so stahlharten Rückens das Lebewohl. Er bereitete sich vor. Innerlich wie äußerlich.
Alles war abgearbeitet und gesagt. Er hielt die Veränderungen nicht mehr auf. Sobald er aufbrach, seine letzte Reise antrat, kamen sie unweigerlich für seinen Urenkel ins Rollen.
Er hätte ihn gerne davor geschützet, ihm warnend zur Seite gestanden, doch spielte sein Geist gegen die Regeln, die er einst für sich aufgestellt hatte, ließ ihn im Stich, wenn er ihn dringend benötigte.
Er kaufte sie in den Jahren, in der seine Füße ihn problemlos von einem Ort zum nächsten trugen und er Pläne schmiedete. Zu einer Zeit, in der vieles besser lief, in der er träumte, reiste, die große, weite Welt sah. Alles wollte er festhalten, einfangen und für die Ewigkeit konservieren.
Es kam anders.
Er kaufte sich in einem kleinen Laden, betrieben durch einen älteren runzligen Herrn, dieses Zubehör. Der Verkäufer schwatzte es ihm förmlich auf. Damit trat er eine Kette an Ereignissen los, die er nicht vorhergesehen hatte. Für ihn zählte zu der Zeit nur, dass er es für einen Preis erhalten hatte, der deutlich unter dem Wert lag. Was darauf folgte, versetzte ihn umso mehr in Überraschung. Er begriff erst im Laufe der darauffolgenden Wochen, was er sich angeschafft hatte. Es dauerte ein ganzes Jahrzehnt, zu verstehen, was sich dadurch veränderte.
Er konnte nicht benennen, woher die Veränderung kam, er atmete sie ein wie Luft. Sie durchfuhr ihn so unvermeidbar, wie der Winter auf den Herbst folgte, verdrängte sein Innerstes, schlug Wurzeln in ihm.
Befremdlich fühlte es sich an, irgendwie beängstigend. Keinem vermochte er es je zu zeigen. Niemandem zu erklären. Bis jetzt.
Gleichwohl traute er dem eigenen dementen Geist nicht. Nachts beschlichen ihn dunkle Vorahnungen, tagsüber bekam er sie dagegen nie zu fassen. Je kränker das Alter ihn werden ließ, je weniger sein Verstand in der Realität weilte, desto seltener bedachte er seinen Fund.
Am schwierigsten blieb es, mit gebeugtem Rücken die allerletzten Stufen zu erklimmen. Alles, was er sich vorgenommen hatte, hatte er in die Wege geleitet, hoffte er zumindest. An diesem Abend kämmte er ein letztes Mal sein schütteres Haar, zog sein bestes Sakko an, rückte die zittrig gebundene Krawatte zurecht und setzte sich in seinen Lieblingssessel, er war bereit.
Stunden später betrat die Nachtschwester das Zimmer, um nach ihm zu sehen, doch da weilte er schon nicht mehr unter den Lebenden.
***
Ihre Zeit lief ebenfalls ab. Sie hörte ihren eigenen Herzschlag, wie das Ticken einer Uhr, die ihr vor Augen führte, wie kurz ihr restliches Leben wäre. Sie wünschte sich zurück, zu allem, was sie kannte, das ihr vertraut war, doch es funktionierte nicht.
Ihre Beine rührten sich nicht von der Stelle. Nichts an ihr bewegte sich. Mehrfach hatte sie versucht, sich auszustrecken, um zu ertasten, was sie in unmittelbarer Nähe umgab, doch ihre Arme hafteten samt ihres Pullovers wie festgetackert am Untergrund. Nicht einen Millimeter rührte sie sich von dem dreckigen Stück Boden, auf dem sie lag.
Ihr Hinterhaupt lag auf Beton gebettet. Eine Kante drückte ihr in die Haut. Sie hinterließ einen dumpfen Schmerz. Mit der Zeit war er in ein Kribbeln übergegangen. Jegliches Bewusstsein für ihren eigenen Körper hatte sie verloren. Ihre gesamten Wahrnehmungen waren verblichen wie die Jeans, die sie trug.
Einzig die in ihr verborgenen Gefühle blieben ihr. Versiegelt, in ihr eingesperrt. Die eisige, körperlose, heraufkriechende Angst, die sie ausfüllte, wie das Blut, das durch ihre Adern rauschte. Die wie wild kämpfte, vor allem gegen die unbändige Sehnsucht nach dem Zuhause, was sie schmerzlich vermisste.
Sie siechte dahin an diesem dunklen, feuchten, stickigen, verlassenen Ort. Sie roch den Moder, die Fäulnis und ihren Urin. Eine Lache hatte sich mitten zwischen ihren Beinen gebildet. Ein See, der sich weiter ausbreitete, sich in ihre Klamotten fraß. Sie schämte sich, versuchte, wiederholt wegzurücken, wollte es nicht wahrhaben. Das sie in ihren eigenen Ausscheidungen lag.
Verschleppt an einen ihr unbekannten Ort, erinnerte sie sich weder wann, noch wie sie hierher verfrachtet worden war. Sie wollte hier weg. Das war das Einzige, dessen sie sich sicher war.
Ihr Zeitgefühl hatte kurz aus der Ferne gewunken und war verschwunden. Tag oder Nacht? Hier unten zählte das nicht. Es herrschte generelle Dunkelheit. Fünf Sekunden, fünf Stunden, fünf Wochen, die Zeitspannen dehnten sich aus wie gefrorenes Wasser. Ihre Kehle brannte, ihre Zunge vertrocknete, schmirgelte wie Schleifpapier die Innenseite ihrer Wangen. Der Durst überlagerte ihre Angst. Wahnwitzig und alles verzehrend.
Ihr Entführer kam nur in weiten Abständen, um ihr einen winzigen Schluck Flüssigkeit zu reichen. Noch seltener erhielt sie von ihm ein altes, hartes Stückchen Brot. Sie blieb sich selbst überlassen. Lag isoliert und verloren in der Schwärze ihres grausamen Gefängnisses.
Er betrat oft den Raum, in welchem er sie gefangen hielt. Häufig gab er sich ihr nicht zu erkennen. War einfach da. Sie hörte das geisterhafte Klappern eines Schlüssels, das darauffolgende Scheppern einer Tür. Jedes Härchen auf ihrem Körper stellte sich auf, wenn er sich dicht in ihrer Nähe aufhielt, sie beobachtete, neben ihr kauerte. Unsichtbar.
Doch sie vermochte nichts dagegen auszurichten. Sie war gefangen in ihrer Starre. Ihr blieb einzig der Blick an die Decke, die sich schwer erkennbar über ihr zeigte und sie regelrecht zu erdrücken versuchte, mit jedem Augenaufschlag.
Harter, kalter Beton drückte sich in ihren Rücken, hinterließ Spuren. Von unten kroch langsam Feuchtigkeit in die zwei Schichten ihrer Anziehsachen und ließ sie frösteln. Gänsehaut überzog ihren Körper. Sie verstand nicht, was mit ihr geschah. Die Realität lähmte sie, die Zeit stand still und sie mit ihr.
Jeder Versuch, sich in der Finsternis zu orientieren, scheiterte. Es gab nichts zu sehen, ihr Blickfeld blieb eingeschränkt. Von der einen Kante der Decke zur anderen.
Sie hatte sich angewöhnt, ihre Augen den Großteil der Zeit verschlossen zu halten. Die Dunkelheit und der kahle Beton, den sie erblickte, sobald sie sie öffnete, ließen sie jedes Mal erneut erschauern. Das ersparte sie sich, indem sie sich hinter ihren brennenden Lidern eine heile Welt herbeisehnte, in der sie morgens mit einem Lächeln im Gesicht am Frühstückstisch saß. Im Kreise derer, die sie liebte und momentan so schmerzlich vermisste. In ihrem Traum führte sie unschuldig und rein ihr Leben, war frei. Sie träumte von einer Welt, in der sie nicht von der Umwelt abgeschnitten in einem Loch lag.
Doch gänzlich verlassen lag sie nicht in ihrem Gefängnis, rechts von ihr jaulte regelmäßig etwas auf. Dazwischen gab das Tier ein Knurren von sich, alles durchdringend und gefährlich. Sie sah jedoch nichts, hörte nur und erahnte, wie der Hund, keinen Meter von ihr entfernt, dieselben Qualen erlitt wie sie. Das Klirren seiner Kette verriet es ihr.
In ihren Gedanken kam er zu ihr, kuschelte sich an ihren ausgekühlten Körper. Sie stellte sich bildlich vor, wie streichelzart sich sein Fell sich unter ihren Fingern anfühlte, wenn er sich wärmend und beschützend an sie schmiegte. In ihren Träumen fletschte er wiederholt die Zähne, sobald ihr Peiniger auftauchte, zerriss sein Fleisch. Doch schon wenige Sekunden später kam ihre Angst zurück, vor dem Brummen, das aus den Tiefen seiner Kehle zu kommen schien. Sie wünschte, sie wäre daheim, in ihrem warmen Bett, wachte behütet am nächsten Tag auf. Nichts von all dem hier geschah, es war nur ein viel zu realistischer Alptraum. Doch so jung sie war, sie hatte längst begriffen, dass es für sie keinen Ausweg gab. Es war vorbei.
***
Unterdessen schnüffelte er am Boden. Der Geruch nach Ammoniak drang in seine feine Nase, ließ ihn unter Strom stehen. Tagelang hing er schon an seinen kalten, schweren Fesseln. Ohne Fressen, mit kaum einem Tropfen Wasser. Er war entkräftet, ausgehungert. Wollte Fleisch zwischen seinen kräftigen Zähnen. Zubeißen.
Hilflos riss er an der Kette, doch sie blieb festgezogen und er hing gefangen an ihr. Ohne die geringste Chance, sich zu befreien.
Das große Schweigen
Er fuhr zusammen, setzte sich schlagartig auf und fragte sich, was ihn aus dem Schlaf gerissen hatte. Erst vor einem kurzen Moment war er eingeschlafen, zumindest ließen das seine enorm schweren Augenlider vermuten. Er kämpfte damit sie geöffnet zu halten. Müde gähnend fuhr er sich durchs Gesicht. Erst sechs Uhr am frühen Morgen. Der Wecker auf seinem Nachttisch verhöhnte ihn.
Mit geschlossenen Augen sank er in seine weichen Kissen zurück, roch den Duft nach frischer Bettwäsche, kühl und samtig berührte sie seine Haut. Er hatte keine Lust aufzustehen, es war Wochenende, für ihn mitten in der Nacht. Er wollte ausschlafen, den Sonntag gemütlich angehen. Kraftlos drehte er sich auf die Seite, zog seine Decke hoch zum Kinn und schob den linken Arm unter das Kopfkissen.
Er hatte sich gedanklich darauf eingestellt, mindestens zwei weitere Stunden zu schlafen, da hörte er seine Mutter im Flur flüstern: »Wann?«
Ihre Stimme überschlug sich: »Und wie?« Eine kurze Pause der Stille trat ein.
»Kann man irgendwas für dich tun, benötigst du Hilfe?« Die Sätze drangen durch das Mauerwerk gedämpft zu ihm. Er reckte den Kopf hin zu seiner Zimmertür, um sie hoffentlich besser zu hören: »Wenn du möchtest, können wir gern vorbeikommen, sag einfach Bescheid.«
Wieder ein Moment des Schweigens. Die Schritte seiner Mutter entfernten sich von ihm, ihre Stimme klang leiser. Er strengte sich an, sie weiterhin zu hören.
»Nein, ich wecke ihn nicht, am Sonntag soll er in Ruhe ausschlafen. Es verändert sich dadurch nicht. Ich sage es ihm, wenn er aufgestanden ist. Das ist früh genug«, vernahm er ihre Stimme mit Nachdruck. Sie hatte längst entschieden, wie sie es handhaben würde. Allerdings bildete er sich keinen Reim darauf, worum es inhaltlich bei dem Telefonat drehte.
In der Ruhe des Morgens hörte er, wie seine Mutter sich vorsichtig fortbewegte.
»Ja, du auch. Bis dann.« Eine Tür schloss sich.
Die Stille im Anschluss dröhnte in seinen Ohren. Irgendetwas war geschehen, das hatte er mitbekommen. Langsam schwang er die Beine aus dem Bett, setzte sich auf und beugte sich nach unten über die Bettkante, um seine Socken zu suchen. Die Temperatur in seinem Zimmer stand in Konkurrenz mit dem Kühlschrank, seine Finger zitterten beim Anziehen.
Er liebte zwar den Übergang von der warmen Jahreszeit zur kalten, wenn die Luft aufklarte, die Welt sich wandelte, dieser Sommer jedoch war so aufregend und packend wie der Höhepunkt eines fesselnden Buches. Er konnte sich nicht vorstellen, wie ihm der Herbst mehr zu bieten hätte. Im Moment erschien er ihm nur unheilvoll.
In den Sommerferien hatte er die meiste Zeit mit seiner besten Freundin Merle am See verbracht. Gemeinsam feierten sie ihren 15. Geburtstag, wodurch sie endlich genauso alt war wie er.
Sie waren durch die Gegend gezogen. Beide hatten ihre Kameras ständig im Anschlag. Auf der Suche nach Motiven an den unmöglichsten Orten. Na ja, er besaß keinen eigenen Fotoapparat. Ihm blieb nur die integrierte Kamera in seinem Handy. Er beschwerte sich nicht, das war durchaus ok. Technisch anspruchsvolle Bilder lichtete er damit aber nicht ab. Zu Weihnachten wünschte er sich deshalb eine Spiegelreflexkamera. Bis dahin zog der Herbst mit all seinen bunten Tagen schrecklich langsam an ihm und seiner Handykamera vorbei.
Nach drei vergeblichen Anläufen quälte er sich endlich in seine Socken. Er suchte den rotschwarz-karierten Pullover, den er gestern unachtsam in die Ecke gepfeffert hatte, und griff ihn sich. Er drückte die Klinke seiner Zimmertür herunter, zwang den linken Arm in den langen Ärmel, zog sich im Flur den Rest des Oberteils über den Kopf und schob umständlich den anderen Arm auch noch hinein.
In der gesamten Wohnung vernahm man nicht ein Geräusch. Nur in der Küche hörte er seine Mutter leise mit der Kaffeemaschine hantieren.
»Mama, ist alles ok?«, lautlos öffnete er die Tür und huschte vorsichtig hindurch. Charlotte jonglierte mit den Filtertüten und der Kaffeedose.
Vor Schreck verstreute seine Mutter Kaffeepulver auf der Arbeitsfläche. Sie drehte sich zu ihm um: »Max, du bist ja wach!« Sie legte ihre Stirn in runzelige Falten und musterte ihn skeptisch, wie er übermüdet und schlaff an die Tür gelehnt stand. Seine blonden Haare hingen ihm wuschelig ins Gesicht, er schob sie gähnend zur Seite. Seine Mutter sagte regelmäßig, er hätte einen riesigen Mund – passt mehr rein beim Essen, war jedes Mal seine verbitterte Reaktion darauf. Auch sonst nahm er den Mund gerne zu voll, zumindest seinen Eltern gegenüber verhielt er sich frech und aufsässig wie ein Kleinkind. Bei anderen benahm er sich hingegen zurück und bekam oft den Mund nicht auf.
»Ich hoffe, das Klingeln des Telefons hat dich nicht geweckt?«, fragte sie ihn schuldbewusst, wendete ihm den Rücken zu und lief zum Spülbecken hinüber, um Wasser in die vor ihr stehende Kanne zu füllen.
»Ich hab dich reden hören«, gab er zu.
»Das war deine Oma«, ihre Miene spiegelte Kummer wider. In ihrem schlabberigen Schlafanzug, nur dicke Wollsocken an den Füßen, mit einem Pferdeschwanz, für den sie vermutlich nie zu alt wurde, stand sie zusammengesunken an der Arbeitsfläche. Die Kaffeekanne hielt sie noch in der Hand.
»Lass uns kurz drüben hinsetzen«, sagte sie, stellte endlich die Kanne ab, strich ihm kaum wahrnehmbar über den Rücken und schob sich an ihm vorbei, um ins Wohnzimmer zu gelangen.
»Wieso? Ist irgendwas los?«, Unruhe keimte in ihm auf, er rechnete mit allem.
Wenn sie verlangte, dass er mitkam, sich mit ihr hinsetzte, gab es entweder eine Zurechtweisung in Hamlet-Länge oder es war etwas passiert.
Er folgte ihr mit hängenden Schultern ins Wohnzimmer. Unter seinen Füßen bollerte die Bodenheizung, es war mollig warm. Ein krasser Kontrast zu dem Gefühl, was sich in ihm ausbreitete. Kälte nistete sich in ihm ein, ließ sich wie Schneeflocken auf seinen Knochen nieder, durchdrang sie, traf ihn mitten ins Herz. Ihn fröstelte es, weshalb er die Arme um sich schlang, sich tiefer in den Pullover verkroch und hoffte, dass die Wärme an seinen Fußsohlen, es bis hinauf zu seinem Herzen schaffte.
Kaum hatte er sich gesetzt, die Beine an sich gezogen, hörte er sie sagen: »Henry ist heute Nacht gestorben.«
Sie strich sich eine lose Strähne aus dem Gesicht, versuchte sie nestelnd wieder in das Haargummi zu schieben. Ihre gesamte Haltung war kraftlos. Jegliche Körperspannung war von ihr abgefallen, wie die Blätter von den Bäumen.
Auch Max sank in sich zusammen, wie eine Luftmatratze, deren Ventil man geöffnet hatte.
»Uropa ist tot? Aber«, seine Stimme klang heiser. Er brach ab und versuchte, den Kloß, der sich in seinem Hals gebildet hatte, hinunterzuschlucken. »Wir haben doch gerade erst seine Sachen ins Heim gebracht?« Tief im Magen rumorte es, eine Welle der Übelkeit erfasste ihn.
Zuletzt hatte er viel zu selten Zeit mit seinem Uropa verbracht, obwohl er ihm als kleiner Junge sehr nahe gestanden hatte. Jeden Sonntag hatten sie gemeinsam gegessen. Er war von ihm verwöhnt und auf Händen getragen worden.
Seine Mutter hatte ständig gesagt, Henry wäre von Generation zu Generation weicher geworden. Oma Gaby ließ er die volle Härte seiner Strenge zuteilwerden. Charlotte erblickte das Licht der Welt und Henry verhätschelte seine Enkelin, wo es nur möglich war. Max hingegen setzte allem die Krone auf, endlich ein Junge. Man hatte nur auf ihn gewartet. Nach zwei Mädchen war er das, was sich seine Urgroßeltern ein Leben lang erhofften.
Bilder des gestrigen Besuchs schossen ihm durch den Kopf. Erst hatten sie in Henrys alter Wohnung Sachen herausgesucht, die er dringend benötigte. Im Anschluss hatten sie den Kram zu ihm ins Heim gebracht. In die Seniorenresidenz. Eine nette Wortwahl für die Angehörigen. Damit es weniger wie Endstation klang. Dort war sein Uropa vor Kurzem hingezogen, nachdem er allein zuhause wiederholt gestürzt war. Das sei das Beste für ihn, hatte Gaby beschlossen. Henry hingegen war alles gleichgültig.
Max erinnerte sich, wie sein Uropa ihm gestern die Schulter getätschelt hatte, es war eine vertraute Handbewegung wie früher. Er war auf klapprigen Beinen zu seinem Schrank gestakst, hatte ihn geöffnet und Max eine Tasche unter die Nase gehalten. Man hatte ihm angesehen, wie wackelig sein Stand mittlerweile war, wie schwer es ihm fiel, sich zu bücken.
Eine große, schwarze Nylontasche mit grünen Nähten hatte er vor Max Gesicht hin und her geschwenkt. Sie enthielt Henrys alte Kamera. Im Laufe der Jahre hatte er sie häufiger gesehen, so dass sie ihm bekannt war.
»Die bekommst du, wenn ich irgendwann nicht mehr bin. Das sollte sicherlich nicht mehr lang dauern«, hatte er gesagt und scheinbar wissend gelächelt.
Seine Mutter holte Max in die Gegenwart zurück.
»Uropa hatte einen Schlaganfall«, sagte sie.
»Schon wieder?«, Entsetzen zeichnete sich auf seinem Gesicht ab.
»Ja«, antwortete sie knapp, derweil senkte sie den Blick, es fiel ihr schwer, ihn anzusehen, »nur diesmal konnten sie ihm leider nicht mehr helfen.«
Ungefähr ein Jahr war es her, seit sich Henry von seinem ersten Schlaganfall erholt hatte. In Folge dessen war er ständig gestürzt, hatte sich verschiedenste Prellungen, Schürfwunden und blaue Flecke geholt. Obwohl Max sicher war, dass Henry es so gewollt hätte, war er nicht bereit, sich zu dieser Zeit schon endgültig von ihm zu verabschieden.
Sie hatten erst vor kurzem seinen fünfundneunzigsten Geburtstag gefeiert. Und alle hatten Witze gerissen, er könne mit etwas Glück das Altern von Jopie Heesters erreichen. Der verstarb mit 108 Jahren.
Damit war es aus dem Nichts heraus schlagartig vorbei, gänzlich unvermittelt, wie Henry es sich zuletzt gewünscht hatte. »Ich möchte nicht mehr«, das hatte er regelmäßig wiederholt und Max dadurch einen heftigen Stich in die Magengrube versetzt.
Zuerst wurden seine Augen feucht, dann seine Wangen. Krampfhaft versuchte er, die Tränen zurückzuhalten, doch sie ließen sich nicht aufhalten. Sein Stiefvater sagte immer, richtige Männer weinen nicht. Aber in diesem Augenblick war ihm das komplett egal. Er schätzte, wenn jemand gestorben war, dürften sogar »richtige Männer« mal heulen.
Seine Mutter strich im sachte über den Kopf, zupfte an seinen Haaren herum. Gedanklich war sie aber nicht bei ihm, sondern in ihrer eigenen Welt gefangen.
»Aua, lass das!«, er schob unsanft ihre Hand beiseite.
»Oh, entschuldige«, sagte sie. Sie sah ihn nachdenklich an. »Ich frage mich, wie es deiner Oma momentan geht, ich mein«, sie hielt inne und seufzte schwer, »es ist schwierig, wenn man seinen Opa oder Uropa verliert, aber ein Elternteil ist doch etwas anderes.«
Er wunderte sich, wieso seine Mutter trotz solcher Gedanken ruhig und besonnen blieb: »Mama, warum weinst du eigentlich gar nicht?«
»Ach Schatz, das kommt sicherlich noch, ich fühle mich einfach überfahren. Damit hat ja keiner von uns gerechnet.« Sie schielte ständig zur Wohnzimmertür hinüber und spielte an dem Reißverschluss ihres Oberteils: »Außerdem muss ich mich um Emil kümmern. Der wacht garantiert jeden Moment auf und ich habe keine Ahnung, wie ich ihm das schonend beibringen soll. Er hat doch noch nie erlebt, dass jemand aus seiner Familie gestorben ist.«
Sie räusperte sich. Ihr saß offenbar etwas im Hals fest, was dort nicht hingehörte. »Er ist so klein, er wird das gar nicht richtig verstehen.«
Sie hatte sich um Emil zu kümmern, was sonst? Das nicht vorhandene Feingefühl seiner Mutter ärgerte ihn. Ständig drehte sich alles um seinen Bruder, das kam ihm unfair vor. Sie schien gar nicht zu interessieren, wie er mit der mit Henrys Tod zurechtkam. Die Einsamkeit bohrte einen fiesen Stachel in sein Herz. Aber auch diesmal fraß er seinen Kummer in sich hinein, statt sich jemandem anzuvertrauen.
Früher gab es nur sie beide. Keinen nervigen Bruder, der alle Aufmerksamkeit für sich beanspruchte, oder einen Stiefvater, mit dem er sich regelmäßig in den Haaren lag. Sie zwei gegen den Rest der Welt, das hatte sie ihm ständig zugeflüstert, wenn sich wieder alles gegen ihn verschworen hatte und sein Frust sich übermächtig anstaute. Sie waren ein eingespieltes Team, doch damit war es jetzt vorbei.
Draußen auf dem Flur hörte er Emil mit nackten Füßen ins Schlafzimmer tapsen, kurz darauf folgte das ihm vertraute Quengeln, wo denn Mama sei. Prompt drehte sie sich um, tätschelte ihm im Vorbeigehen wie einem Tier den Kopf und lief hinüber zu seinem Bruder, um ihn zu beruhigen.
Er war zwar zu alt, um seine Mutter ständig bei sich zu haben, dennoch kam er sich wie ein kleines Kind vor, das sich auf der Ladefläche eines fahrenden Autos festklammerte, um bei dem hohen Tempo nicht hinunterzufallen. Sie sollte ihn nur ins sichere Auto holen, neben sich auf den Beifahrersitz, ihn umarmen. Und bemerken, wie es in ihm drin aussah.
Oft fühlte er sich im Stich gelassen, saß allein in seinem Zimmer, zog sich von allen zurück. Dann erinnerte er sich an die Zeit in ihrer alten Wohnung. Sonntagmorgens war er zu seiner Mutter unter die Decke gekrochen, sie frühstückten gemütlich im Bett und schauten Kinderfilme.
Tja, da stand er, von ihr achtlos in der Küche zurückgelassen, voller Traurigkeit, so verloren, wie lange nicht mehr. Während jetzt Emil zu ihr und Bjarne ins Bett kroch, dort quasi seinen Platz einnahm.
Mit hängenden Schultern tapste er in sein Zimmer, verdunkelte mit den Rollos den Raum und legte sich auf sein Bett. Er sehnte sich danach, sich zu verkriechen. Mit Kopfhörern auf den Ohren traurige Musik anzuschalten, sich die Decke über den Kopf zu ziehen, die Welt einfach auszublenden.
Ihm war alles zu viel — das Licht zu hell, die Geräusche um ihn herum zu lärmerfüllt, die Gedanken zu durcheinander. Er fühlte sich hilflos und verloren.
Seine Mutter kam im Laufe des Tages mehrmals nach ihm sehen, doch jedes Mal, wenn sie das Zimmer betrat, verscheuchte er sie mit einer Handbewegung wie eine lästige Fliege. Selbst mit ihr zu reden, war ihm zu anstrengend und viel zu kraftraubend.
Später am Mittag zwang sie ihn, sich doch aufzuraffen. Sie planten, zu seinen Großeltern zu fahren. Gemischte Gefühle kamen in ihm auf. Einerseits wünschte er sich, seine Oma zu sehen, andererseits hatte er Angst davor. Er ertrug es nicht, wenn sie deprimiert wäre.
Er mochte niemanden um sich haben, der womöglich weinte. Ihm dadurch die ganze Zeit einen Spiegel vorhielt und überdeutlich zeigte, wie es in ihm selbst aussah. Es schmerzte ihn auch ohne die Erinnerung daran genug.
Bjarne und Emil merkte man nicht an, was geschehen war. Sie waren die Einzigen in der Familie, die sich so normal wie immer verhielten. Zumindest es soweit es die gesamten Umstände hergaben.
Emil begriff mit seinen fünf Jahren gar nicht, was los war. Er hatte Uropa Henry in all der Zeit nie besser kennengelernt, nicht so gut wie Max.
Die Begegnungen zwischen den beiden waren flüchtiger Natur. Sie trafen stundenweise aufeinander, wenn sie Henry zu dritt oder zu viert besucht hatten. Mehr nicht. Er hatte keine Ahnung, wie viel wertvolle Zeit mit Henry er dadurch verpasst hatte.
Bjarne hatte an diesem Tag mit seiner stoischen Art die Ruhe weg. Seine Mutter witzelte stets, er wäre ein Eisberg, versenkte gänzlich ohne Gefühle jedes Schiff. Doch dem war nicht so. Wenn es darauf ankam, war er sogar sehr gefühlvoll. Seine Möglichkeiten, es zu zeigen, waren nur etwas begrenzt. Deshalb hatte es ihn nicht gewundert, dass Bjarne ihm heute früh schlicht auf den Rücken geklopft hatte. Das war seine Art der Anteilnahme. Damit hatte er mehr ausgerückt, als manch anderer mit einer Umarmung und tröstenden Worten. Entsprechend viel bedeutete es ihm.
»Stark sein!«, hatte Bjarne gesagt und war rausgegangen. Tür auf, Rückenklopfer, Tür wieder zu. Das beschrieb ihn am besten.
Auf der Fahrt zu seinen Großeltern erdrückte ihn die Stille im Auto. Keiner sprach, alle waren angespannt, starrten vor sich hin. Nicht mal das Radio dudelte im Hintergrund. Sogar Emil, der sonst auf längeren Strecken nörgelte, ihm wäre langweilig, sagte nicht einen Ton, rührte sich kaum und schaute die gesamte Fahrt aus dem Fenster.
Sie fuhren eine Weile an Feldern und Waldstücken entlang, bis das Stadtbild Berlins die ländliche Gegend ablöste.
Draußen zogen die Häuser an ihm vorbei. Hier eine Ampel, da eine Kreuzung. Ein Spätkauf, ein Bäcker, dazwischen ein Altbau. Die Fassaden sahen alle entseelt und grau aus. Die Bäume hatten hier weitgehend ihr Blätterkleid abgeworfen. Trüb und matschig lag es auf den Bürgersteigen. Die Stadt spiegelte wider, wie es in seinem Inneren aussah.
Bei seinen Großeltern angekommen entstand keine bessere Stimmung. Sie weinten, redeten und wieder flossen Tränen. Der Nachmittag zog sich endlos in die Länge. Wie ein Faden, den man an dem eben erst gekauften Oberteil entdeckte. An dem man zupfte, um ihn zu entfernen, der aber kein Ende fand. Bis er das neue Teil schließlich ruinierte.
Wenn Max auf die Uhr sah, waren erst ein paar Minuten vergangen. Die Stunden flossen breiartig dahin. Derweil sah er gemeinsame Augenblicke mit Henry vor seinem geistigen Auge aufblitzen. Wie sein Uropa an Weihnachten neben ihm auf dem Sofa gesessen hatte. Oder damals, wo er ihm eines Sonntags, als sie mal wieder zum Mittagessen zu Besuch waren, einen Pokal schenkte für den weltbesten Esser. Alles Mögliche und Unmögliche kam ihm in den Sinn. Was ihn aber am meisten belastete, war der kurze Abschied gestern beim Verlassen des Heims. Hätte er in die Zukunft sehen können, was die darauffolgende Nacht mit sich brächte, hätte er sich besser von Henry verabschiedet. Ihn fester gedrückt, länger und intensiver umarmt. Ihn sich bis aufs kleinste Detail eingeprägt. Seinen Geruch, das Kräuseln seiner Stirn, wenn er einen Witz erzählte, die Sanftheit seiner Stimme, sobald er mit Emil sprach. Henrys Lächeln kam ihm in den Sinn. Etwas, das er nie wieder sah.
Ihm schoss eine Erinnerung durch den Kopf. An das, was Henry gesagt hatte. Er wolle, ihm seine Kamera vermachen, wenn er nicht mehr wäre. Die Tasche, mit Henrys wertvollstem Besitz. Er hatte sie gehütet wie ein Drache seinen Schatz.
Er hatte Max etwas hinterlassen, ihm, den er so abgöttisch geliebt hatte. Ständig hatte Henry von dem Fotoapparat geredet. Von all den Fotos, die er geknipst hatte. Es traf ihn mitten ins Herz, von ihm ausgewählt worden zu sein, dass er sie ausgerechnet ihm vermachte.
Es war seinem Uropa scheinbar wichtig, dass er die Kamera an ihn weiterreichte. Für ihn ließ sich nicht benennen, warum das so war. Doch er beschloss, alles dafür zutun, um Henry diesen letzten Willen zu erfüllen.
Er sah von einem zum anderen, von Oma Gaby zu seinem Opa Fritz, seiner Mutter, Bjarne. Emil spielte in einer Ecke und baute etwas aus Legosteinen. Er hatte nicht ein einziges Mal aufgeblickt, seit sie bei ihren Großeltern waren.
Max saß im Kreise seine Familie, seiner Vertrauten. Trotzdem traute er sich nicht, das Thema anzusprechen, erschien es ihm doch so unpassend, wo Henry erst letzte Nacht gestorben war.
Er drückte sich weiter in die Sofaecke, zog die Beine zu sich heran, beobachtete das Geschehen aus der Ferne. Er saß die Zeit ab. Zwischendurch versuchte er, dem Gespräch zwischen seiner Mutter und seiner Oma zu folgen, hörte aber nur Gesprächsfetzen heraus.
Er wollte anonym beerdigt werden. Bei seiner Frau. Keine Ahnung, wann. Kosten sind gedeckt. Heimzimmer leerräumen. Dabei hatten sie es erst vor zwei Tagen fertig eingerichtet.
Tief in Max Magen lag ein riesiger Steinkoloss. Die rauen Kanten hinterließen ein kratziges Gefühl im Hals. Der Stein drückte ihm in die Brust, raubte ihm die Luft zum Atmen.
Am späten Nachmittag traten sie endlich den Heimweg an. Wieder schwiegen sie die gesamte Fahrt über. Die Dämmerung brach herein. Der Himmel war seit dem Morgen nicht aufgeklart. Dicke Regenwolken verdunkelten zusätzlich den hereinbrechenden Abend. Schwarz und unheilvoll. Das Wetter passte zu seiner Stimmung.
Die Lichter der Häuser rauschten an ihm vorbei. Beleuchtete Wohnzimmer und Küchen hinter Fenstern mit dicken Vorhängen. Familien, die zusammensaßen und gemeinsam den Tag ausklingen ließen. Sie sperrten die Welt aus und schufen Erinnerungen. Er wurde in seinem Sitz immer kleiner, die Enge in seiner Brust dafür umso größer.
Die folgenden Tage zogen an ihm vorüber. Das Wetter besserte sich nicht, die Wolken ließen einen Regenschauer los, die einer Arche bedurft hätten. Er blieb dadurch ans Haus gefesselt. Das ständige Gewitter erlaubte es nicht, sich draußen etwas abzulenken. Es war ihm gerade recht, hatte er darauf im Grunde doch gar keine Lust. Das Wetter lieferte ihm nur die passende Ausrede.
Seine Mutter kam regelmäßig in sein Zimmer geschneit. Sie hielt ihn auf dem Laufenden, wie der Stand hinsichtlich der Beerdigung war oder wie weit das Leeren des Heimzimmers und der alten Wohnung voranschritt. Er hörte nur mit halbem Ohr hin, nickte brav, als folgte er ihren Worten tatsächlich. Das Einzige, was er jedoch im Kopf hatte, war die Kamera und Henrys damit verbundener letzter Wunsch.
Merle rief ihn an, um sich nach ihm zu erkundigen, doch er hatte keine Lust zu telefonieren. Drei Tage in Folge mied er sie in der Schule. Er vermisste sie, zog sich aber lieber zurück statt mit jemandem zu sprechen. Nachmittags stand sie einfach in seiner Tür und platzte herein. Er war erleichtert. Nach der Zeit ohne sie wünschte er sich dringend ihre Gesellschaft, um nicht allein zu sein. Seine beste Freundin kam genau zum richtigen Zeitpunkt.
»Ey, du Pflaume. Du hättest ruhig mit mir reden können!«, raunzte sie ihn an, war dabei aber dennoch am Lächeln. »Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was mit dir los ist. Warum du in der Schule in jeder Pause spurlos verschwunden bist. Wenigstens nach dem Unterricht hättest du kurz zu mir kommen können.« Ihr betroffener Blick zeigte ihm, dass sein Verhalten sie verletzt hatte. Er hatte ihr damit vor den Kopf gestoßen.
Schuldbewusst rang er mit den Händen. Ihm war klar, dass sie recht hatte. Die vergangenen Tage stand er neben sich, hatte nicht wie er selbst gehandelt. Wie fremdgesteuert war er durch die Gegend gerannt. Getrieben von dem Gedanken an Henrys letzte Worte. Was um ihn herum geschah, hatte er ausgeblendet. Nichts war zu ihm durchgedrungen.
»Sorry«, er senkte den Blick und rieb sich den Nacken.
Merle hatte immer Verständnis für ihn. Vor allem bei familiären Problemen. Sie hatte selbst keine Bilderbuchfamilie. Ihr Erzeuger kam eines Abends einfach nicht mehr nach Hause. Zuvor hatte es viel Streit zwischen ihm und ihrer Mutter gegeben. Merle war zu dem Zeitpunkt erst vier Jahre alt. Seitdem hatte sie ihn nie wieder gesehen und im Grunde auch kein gutes Wort mehr für ihn übrig.
Max Vater hatte ebenfalls über eine gewisse Zeit den Kontakt zu ihm abgebrochen. Er erinnerte sich nur vage an diese Episode seines Lebens. Seine Mutter hatte ihm vor einigen Jahren erklärt, wie es dazu kam. Seitdem hatte er Verständnis dafür, warum Werner aus seiner Sicht nicht anders konnte, als diesen Schritt zu gehen. Wie schwer ihm das alles gefallen war.
Mittlerweile hatten sein Vater und er allerdings ein sehr liebevolles und inniges Verhältnis. Obwohl er in einer anderen Stadt lebte, spielte er in Max Leben eine große Rolle. Er konnte sich auf ihn verlassen. Jederzeit das Telefon in die Hand nehmen und ihn anrufen, wenn er jemanden zum Reden brauchte.
Im Gegensatz zu Merle, ihr blieb nur ihre Mutter. Umso wichtiger war Max für sie. Er hatte hingegen zumindest zwei Anlaufpunkte. Mit Bjarne waren es sogar drei. Falls der überhaupt zählte. Verlegen sah er zu ihr hinüber. Er hatte sich schäbig benommen. Selbst wenn er sich in seinem Kummer nicht anders zu helfen wusste, hätte er sie zumindest mit einbeziehen können. Sie schlösse ihn garantiert nicht aus in so einer Situation.
Doch Merle schien nicht verärgert. Im Gegenteil, er meinte Verständnis in ihren blauen Augen zu entdecken.
»Schon ok. Deine Mutter hat mir am Telefon gesagt, was los ist. Tut mir echt leid, man«, sie setzte sich neben ihn auf sein Bett und legte einen Arm um ihn. Mit der anderen Hand strich sie sich den braunen Pony aus der Stirn und sah ihn an.
Diese kleine Geste war es, die ihm den Trost spendete, den er die ganze Zeit über vermisst hatte. Ihm war gar nicht bewusst gewesen, wie dringend er Merle um sich haben wollte.





























