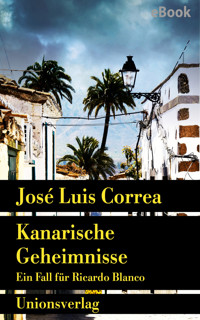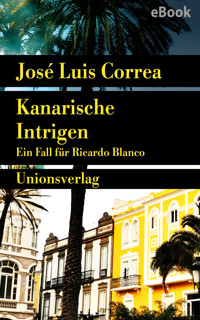
4,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Privatdetektiv Ricardo Blanco wäre gern Humphrey Bogart, oder zumindest Hercule Poirot. Andererseits wäre Poirot wohl unter der kanarischen Sonne von Las Palmas, wo Blanco ermittelt, nach zwei Stunden eingegangen. Seine Überlegungen zu wetterfesten Detektiven werden von einer jungen Frau unterbrochen, die ihn mit einem neuen Fall beauftragt. Ihr Verlobter soll Selbstmord begangen haben, aber sie ist überzeugt: Es war ein Verbrechen. Blancos Nachforschungen führen ihn in die exklusiven Kreise der High-Society, auf Jachtausflüge und Cocktailpartys. Doch der schöne Schein trügt, und die schicken Damen und Herren scheinen alle ein falsches Spiel zu spielen. Nur – wer von ihnen würde morden, um zu gewinnen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch
Während der Privatdetektiv Ricardo Blanco noch überlegt, wie lange sein Vorbild Hercule Poirot unter der kanarischen Sonne durchhalten würde, beauftragt ihn eine junge Frau, im vermeintlichen Selbstmord ihres reichen Verlobten zu ermitteln. In der High-Society von Las Palmas spielen alle ein falsches Spiel, nur – wer würde morden, um zu gewinnen?
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
José Luis Correa (*1962) ist Professor für Sprach- und Literaturwissenschaft an der Universität von Las Palmas. Für seine Romane erhielt er u. a. den Premio Benito Pérez Armas und den Premio Vargas Llosa. Seine Kriminalromane um den Ermittler Ricardo Blanco wurden in mehrere Sprachen übersetzt.
Zur Webseite von José Luis Correa.
Verena Kilchling (*1977) studierte in Düsseldorf Literaturübersetzen und überträgt seither Romane und Kurzgeschichten aus dem Englischen und Spanischen.
Zur Webseite von Verena Kilchling.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
José Luis Correa
Kanarische Intrigen
Ein Fall für Ricardo Blanco
Aus dem Spanischen von Verena Kilchling
Ricardo Blanco, Privatdetektiv auf Gran Canaria (1)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2003 bei Alba Editorial, Barcelona.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2006 unter dem Titel Drei Wochen im November im Unionsverlag, Zürich.
Originaltitel: Quince días de noviembre
© by José Luis Correa 2003
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Stadt – imageBROKER.com GmbH & Co. KG; Himmel – Tetra Images (beides Alamy Stock Foto)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-30445-1
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 17.05.2024, 12:26h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
KANARISCHE INTRIGEN
1 – Sie hieß María Arancha und war, wie sollte …2 – Während ich mich am nächsten Morgen rasierte …3 – Ich muss zugeben, dass ich etwas nervös war …4 – Die nächsten Tage verbrachte ich damit, Fotoalben zu …5 – Selten zuvor hatte ich eine solche Nacht erlebt …6 – Den Sonntag verbrachte ich damit, mir wie ein …7 – Als Inés mich am nächsten Morgen durch die …8 – Ich schaute auf einen Höflichkeitsbesuch bei meinem Freund …9 – Der Alte kauerte wie immer neben dem Boot …10 – Die folgende Nacht verbrachte ich in Schlaflosigkeit …11 – Pablo Bosch sagte später vor Inspector Álvarez aus …EpilogMehr über dieses Buch
Über José Luis Correa
Über Verena Kilchling
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von José Luis Correa
Zum Thema Spanien
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Insel
Für Mario, dem ich viel verdanke.
»… die Gewissheit, dass der Preis für einen guten Ruf
immer das Schweigen ist. Oder der Tod.«
Carmen Posadas, Kleine Infamien
1
Sie hieß María Arancha und war, wie sollte es auch anders sein, ein Snob. Als ich sie letztes Jahr im November durch meine Bürotür kommen sah, fiel mir als Erstes die Mutlosigkeit in ihren mahagonifarbenen Augen auf. Das und die Tatsache, dass ihre Lippen sich den ganzen Nachmittag weigerten, auch nur einmal zu lächeln. Sie kam auf Empfehlung eines Verwandten: »Mein Onkel Lorenzo hat mir von Ihnen erzählt, er sagte, Sie seien schnell und einigermaßen diskret, hätten einen guten Ruf und in zehn Jahren nur einen einzigen Fall verloren, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich auch sonst niemanden, an den ich mich wenden könnte.« Ich wusste ihre Offenheit zu schätzen, wenn wir in Zukunft Seite an Seite kämpften, war es besser, nichts für die Aasgeier übrig zu lassen.
»Dann ist Lorenzo Manrique also Ihr Onkel?«
»Ja, mein leiblicher. Er ist der ältere Bruder meines Vaters.«
»Und wie geht es ihm so? Hat er die Ratten inzwischen vom Schiff gejagt?«
Ich erinnerte mich noch gut an Lorenzo Manrique, einen Mann, mit dem es das Schicksal gut gemeint hatte. Er hatte mich damals für den Wahlkampf 96 engagiert, weil er einem seiner Gesinnungsgenossen der Nationalistischen Partei, einem gewissen Tomás Sarmiento, nicht recht über den Weg traute. Er war davon überzeugt, dass Sarmiento mit der Opposition liebäugelte, sich in den Reihen einer anderen politischen Gruppierung zu profilieren versuchte und vorhatte, mehrere Parteifreunde mit hinüberzuziehen. Manrique, ein Opportunist der übelsten Sorte, witterte Verrat von allen Seiten, vielleicht weil er selber mehr als einen Parteifreund – ich glaube nicht, dass er echte Freunde hatte – aus Eigennutz im Straßengraben zurückgelassen hatte. In diesem Fall hatte ihn sein Instinkt jedoch nicht getrogen: Nachdem wir ihn zwei Monate lang beschattet hatten, erwischten wir Sarmiento eines Abends dabei, wie er in einem japanischen Restaurant mit der Crème de la Crème der Volkspartei zusammensaß und mit Sake auf »den Beginn einer wunderbaren Freundschaft« anstieß, genau wie Humphrey Bogart mit Claude Rains, nur lange nicht so stilvoll. Danach suchte die ganze Gesellschaft nämlich noch ein Bordell in der Nähe der Tankstelle von Molowni auf, aber das band ich María Arancha Manrique natürlich nicht auf die Nase, so etwas würde ein Snob wie sie nicht verstehen.
María Arancha setzte sich ans andere Ufer meines Schreibtischs, legte die Arme über Kreuz auf die Knie und erzählte mir ganz ohne Eile, indem sie sich in jedes auch noch so kleine Detail vertiefte und sich an den pikanteren Stellen ihres Berichts räusperte, um ihre Verlegenheit zu überspielen – erzählte sie mir also, warum um Himmels willen sie einen Privatdetektiv engagieren wollte: weil jemand Toñuco Camember umgebracht hatte. »Mit diesem Namen«, dachte ich, »ist es das Geringste, was ihm passieren konnte.« Dieser Gedanke schien sich deutlich auf meinem Gesicht abzuzeichnen, denn María Arancha rutschte unbehaglich auf ihrem Sessel herum und stieß ein erneutes, beinahe unhörbares Räuspern aus: »Es stimmt, Señor Blanco, ich schwöre es.«
»Dann ist das aber ein Fall für die Polizei.«
»Die Polizei glaubt, dass es Selbstmord war.«
»Und Sie teilen diese Auffassung offensichtlich nicht.«
»Nein. Toñuco hätte alles sein können, nur kein Selbstmörder. Er lebte gerne und vor allem gut.«
»Standen Sie ihm sehr nahe?«
»Wir wollten im Frühling heiraten.«
»Caramba, das tut mir unendlich leid für Sie.«
Die Polizei hatte den Fall tatsächlich nach ihrer ganz eigenen Logik gelöst: Es kommt aus der Kuh, es ist weiß und es wird in Flaschen abgefüllt, also ist es Milch. Wie ich später erfuhr, fand man Toñuco Camember – allein bei der Erinnerung an seinen Namen drehte sich mir der Magen um – stocksteif und mit einem Einschussloch an der rechten Seite des Kopfes am Schreibtisch in seiner Anwaltskanzlei. Um das Loch herum, durch das die Kugel eingedrungen war, befanden sich natürlich noch Reste von Schießpulver. Wie ich herausfand, war der Bursche Rechtshänder, und so bekam ich keine Gelegenheit, María Arancha zu beeindrucken, indem ich ihr die Unmöglichkeit eines Selbstmordes mit der falschen Hand auseinander setzte. Es hatte also alles seine Richtigkeit. Zumindest auf den ersten Blick.
Doch nicht immer ist alles so, wie es auf den ersten Blick scheint. Für diese Wahrheit braucht man keine Bücher, es ist eine unentrinnbare Wahrheit, die einem in Fleisch und Blut übergeht, eine feste Gewissheit, zu der man durch Erfahrung gelangt. Ich wurde nun schon seit einigen Jahren in dieser Gewissheit immer wieder bestätigt. Genau genommen seit jenem Abend, als Miguel Moyano, mein Geschäftspartner und Freund, die absurde Idee hatte, mit seinem Geld und meiner Freizeit eine Firma zu gründen, und ich ihm antwortete: »Einverstanden, warum machen wir nicht eine Detektei auf?«, und er mit vor Malt-Whisky glänzenden Augen zustimmte: »Au ja, das könnte lustig werden, ein Moyano, der auf Sam Spade macht.« Meine diversen abgebrochenen Studiengänge, die ich wie Heiligenbildchen gesammelt hatte – Ingenieurwissenschaft, Jura, Psychologie an der Fernuni –, erwiesen sich daraufhin bald als nützlich. Ich begann mich auf meine Intuition zu verlassen und vor allem auf ein Bündnis mit dem Glück, das seinen Teil der Abmachung seither strikt eingehalten hat.
Es ist also wie gesagt nicht immer alles so, wie es auf den ersten Blick aussieht, und so gab es in der Kopie, die ich mir vom Bericht des mit dem Fall Camember beauftragten Inspector Álvarez besorgt hatte, etwas, das keinen Sinn ergab. Ich brauchte einige Stunden, bis ich es sah. Ich wusste, dass ein Detail auf den Fotos nicht stimmte, vor allem auf einem Foto, auf dem der Verstorbene von vorne zu sehen war und auf dem ihm der Kopf auf die linke Schulter hing, während der Arm der gleichen Seite schlaff herunterbaumelte und der rechte Arm mit der offenen Handfläche nach unten auf seinem Schoß lag. Ich habe mich nie an den Tod gewöhnen können. Nicht dass ich schon besonders oft eine Leiche gesehen hätte, leblose Materie, die zurückgelassene Hülle von jemandem, der früher einmal Arzt war, oder Stewardess oder Mutter oder Sohn oder Auftragsmörder. Doch die wenigen Male, die ich mich dem Tod gegenübersah, blieb mir immer ein säuerlicher Geschmack im Magen zurück und ein unerklärliches Schuldgefühl in der Brust, so als hätte einer wie ich jeden Einzelnen dieser Unglücklichen irgendwie retten können.
Der Anblick von Camember – María Arancha erklärte mir, dass der Name tatsächlich auf »r« endete und nicht etwa auf »t« und dass er rein gar nichts mit der Käseregion in der Normandie zu tun hatte – war entmutigend. Nachdem mir die Manrique einige der vielen Talente Toñucos eher oberflächlich, wie ich vermutete, beschrieben hatte, hörte er auf, ein anonymes, fremdes Wesen für mich zu sein, und ich begann mich zu fragen, wie ein solcher Lebemann – in meinem Stadtviertel hätten wir ihn einen waschechten Weiberhelden genannt – als dieses leblose Stück Fleisch hatte enden können. Ich fing an das Foto genauestens unter die Lupe zu nehmen. Die Gegenstände, die auf dem Schreibtisch lagen. Die Anordnung der Bibliothek, die hinter dem Toten zu sehen war. Die brennende Stehlampe neben ihm. Nichts ließ darauf schließen, dass es kein normaler Tag in der Routine eines Winkeladvokaten gewesen war. Alles sah irgendwie nach nutzlosem Geburtstagsgeschenk aus: eine Zigarrenkiste aus Zedernholz, ein Feuerzeug in Form einer Golftasche, ein silbernes Kugelschreiberset, ein offenes Etui mit einem sauberen, unbenutzten Tintenfass und eine makellose, glatte, schwarze Schreibfeder. Das einzig Natürliche, das Einzige, was nicht nach italienischer Einrichtungszeitschrift aussah, war ein schiefer Stapel mit CDs, mit denen sich der Mann zweifellos die Arbeitsstunden versüßt hatte. Da keine Stereoanlage zu sehen war, vermutete ich, dass Camember genau wie ich seinen Computer nicht nur zum Arbeiten verwendete, sondern auch dazu, sich Michael Bolton oder Mariah Carey anzuhören oder auf was Snobs eben sonst so abfahren.
Ich betrachtete noch einmal gründlich die Leiche. Die Position des Kopfes war keineswegs ungewöhnlich. Nach einem aus so kurzer Entfernung abgefeuerten Schuss konnte der Kopf in jede beliebige Richtung gefallen sein. Es konnte sogar sein, dass er einige Male hin- und hergependelt war, jeder weiß, wie sich ein Schädel – sogar der eines Schwachkopfs wie Toñuco Camember – bei einem solchen Knall verhält. Nein, es war nicht der Kopf. Es waren die Arme. Oder besser gesagt der rechte Arm, mit dem angeblich der Schuss abgegeben worden war. Der rechte Arm von Camember war nämlich ganz zahm und sah nicht so aus, als hätte er seinem Besitzer gerade die Rübe weggepustet. Er war leicht auf die Innenseite seines Oberschenkels gestützt, mit der Handfläche nach unten, eine Haltung, die jemand einnimmt, der sich schutzlos und allein gelassen fühlt. Wenn dies der Tatarm gewesen wäre, hätte er genau wie der andere Arm aussehen müssen, vor Scham über die begangene Tat völlig entkräftet. Man schießt sich nicht in den Kopf, stirbt, lässt die Pistole fallen und legt sich den Arm hinterher wieder auf den Schoß. Wäre die Waffe noch zwischen seinen Fingern gewesen, hätte man vielleicht an einen letzten Akt der Reue denken können. Doch die Waffe lag auf dem Boden unter seinem Stuhl und der Arm in seltsamer Symmetrie dazu auf dem Körper des Toten. Unmöglich. Jemand musste diesen Arm dort hingelegt haben. Jemand, der beschlossen hatte, dass Toñuco es nicht mehr verdiente, zu leben. Jemand, der eine grausame Kaltblütigkeit besaß. Eine nicht mehr zu kontrollierende Wut verspürte. Oder grässliche Angst.
Ich sagte María Arancha damals noch nichts von meinem Verdacht, aber der Fall begann mich zu interessieren. Ich rief sie also an und sagte ihr zu. »Heißt das, dass Sie mir glauben?«, fragte ihre Stimme am anderen Ende der Leitung. »Das heißt nur, dass ich die Summe, die Sie mir dafür zahlen werden, gut gebrauchen kann«, antwortete ihr meine Stimme. »Kommen Sie morgen hierher, dann besprechen wir alles Weitere!«
An jenem Abend vertiefte ich meine Nachforschungen beim Inspector, mal sehen, was ich Álvarez aus der Nase ziehen konnte. Ich lud ihn auf einen Drink in die Bar Deenfrente ein, die direkt unter dem Polizeipräsidium liegt, und ertrug dort eine ganze Weile sein Gequassel. Er sprach über die gute alte Zeit, als er noch glücklich und zufrieden in San Mateo lebte, wo so wenig passierte, dass die Polizeiwache nur aus dem Revier und einem Aufenthaltsraum bestand, wo Gefangene und Wärter gemeinsam Fußballspiele im Fernsehen ansahen oder Karten spielten. »Das war ein Leben, Ricardo, bei meiner Mutter, das Schlimmste, um das wir uns kümmern mussten, war ein gelegentlicher Streit unter Nachbarn, eine kleinere Gaunerei, die geplünderte Kasse in einem Fitnessstudio oder Schülerbanden, die ihre Klassenkameraden einschüchterten, solche Dinge eben, aber heutzutage, Scheiße noch mal, da gibt es kein Halten mehr, mit diesen ganzen Koreanern, Russen und Arabern, die auf Frachtschiffen hier anrücken und sich gegenseitig umbringen, und dann erst die Selbstmorde, wir riechen ja schon nach den Toten, und das den ganzen verdammten Tag lang.« Álvarez erzählte mir, dass Camember beileibe kein Einzelfall war, es musste wohl am Klima liegen, bei dieser Hitze erwachten die Instinkte in den Menschen, und sie bekamen plötzlich Lust, sich von einem Dachboden zu stürzen oder sich in der Badewanne die Pulsadern aufzuschlitzen oder sich zu erschießen. Obwohl er es in diesem Fall wirklich nicht verstehen konnte: »Der Kerl hatte doch alles, einen Wahnsinnsjob, Geld wie Heu, ein Ferienhaus in Tafira und eine Freundin … Hast du die gesehen, Ricardo? Die ist zum Anbeißen, Herrgott, was für ein Weib!«
Álvarez’ Ungeschliffenheit grenzte wirklich an Beleidigung. Er wusste genau, wie der Hase lief, und war unbeirrbar die Karriereleiter hochgeklettert, bis er dort ankam, wo er jetzt war. Hinter seinem taktlosen Benehmen verbarg sich jedoch ein ehrlicher, wenn auch etwas begriffsstutziger Beamter, der von einer weniger ungerechten Welt träumte und an den man sich vertrauensvoll wenden konnte, wenn man in der Patsche steckte. Zu allem Überfluss war er auch noch ein großer Simenon-Fan und platzte immer dann, wenn man es am allerwenigsten erwartete, mit Sprüchen heraus wie: »Was wohl mein geschätzter Kommissar Maigret in dieser Situation getan hätte?«, oder: »Wie würde mein lieber Kollege aus Frankreich wohl entscheiden?« Wenn in jedem von uns zwei Personen gleichzeitig stecken, dann konnten die beiden Álvarez unterschiedlicher nicht sein.
Ich versuchte wieder zu dem Thema zurückzukehren, das mich hergeführt hatte: »Also, wenn der Typ doch so glücklich war, warum hat er sich dann umgebracht?«
»Was weiß denn ich? Vielleicht so eine Laune.«
»Scheiße, Álvarez, ich habe auch manchmal Launen, aber ich rasiere mir dann allerhöchstens mal den Kopf oder betrinke mich sinnlos.«
»Da bin ich voll und ganz deiner Meinung, aber ich kann dir nun mal keinen anderen Grund nennen, weil ich keinen finde.«
»Hatte er Spielschulden? Nahm er Drogen? Hat ihn jemand erpresst?«
»Gar nichts. Der Typ war ein Arschloch, aber er war sauber.«
»Und trotzdem glauben Sie immer noch, dass er Selbstmord begangen hat.«
»Solange ich nichts anderes weiß, muss ich davon ausgehen.«
2
Während ich mich am nächsten Morgen rasierte, dachte ich noch einmal über das Gespräch mit dem Polizisten nach. Der Tag brach grau und ungemütlich an, und es lag eine bleierne Novemberschwere in der Luft. Der Tag brach grau an, und ich schnitt mich wieder einmal beim Rasieren, weil ich schon wieder vergessen hatte, neue Birnen für die Lampe zu kaufen. Das Blut an meinem Adamsapfel erinnerte mich an den Anblick des runden, versengten Einschusslochs im Kopf des Snobs Toñuco, und im dampfbewölkten Spiegelbild erschien mir plötzlich das feuerrote Haar von María Arancha Manrique. Ich stoppte die Blutung, wie es mir mein Großvater beigebracht hatte, indem ich mit Spucke Klopapierstückchen auf die betroffenen Stellen klebte. Aber der wie eine Glasscherbe an meinem Adamsapfel kratzende Schweiß würde mich für den Rest des Tages schmerzvoll an meine morgendliche Ungeschicklichkeit erinnern.
Bevor ich morgens nicht mehrere Tassen starken schwarzen Kaffee getrunken habe, bin ich nur ein halber Mensch. Muss irgendetwas mit dem Blutdruck zu tun haben. Oder vielmehr mit dem fehlenden Blutdruck. An diesem Donnerstag wurde ich an der Bar eines Cafés in San Bernardo zum ganzen Menschen, während ich die Zeitung las und den Stammgästen dabei zuhörte, wie sie über Politik plauderten, über den guten Bürgermeister, den wir gerade hatten, »den besten seit Juanito Rodríguez Doreste, keine Schweinereien mehr auf der Straße, keine Fensterwäscher an den Ampeln, die Stadtteile Vegueta und Las Canteras schön wie der junge Frühling, also ein Bürgermeister, sage ich euch, schade nur, dass er ein Rechter ist.« Eines der Mitglieder jener Gesellschaft, ein Kerl, den alle El Zambo nannten, vermutlich, weil er so x-beinig daherwatschelte, las eine Schlagzeile vor, die der Unterhaltung neuen Zündstoff gab: »Hier steht, dass ein Typ gerade eine Milliarde Peseten mit einem Dauerlos im Lotto gewonnen hat. Schöne Scheiße. Also mir wären dreißig oder vierzig Millionen lieber. Mit vierzig kommt man noch unbemerkt davon. Wenn man mehr gewinnt, riskiert man jedes Mal die eigene Haut, wenn man nur auf die Straße geht. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute dann plötzlich anfangen dich zu hassen, dich zu beneiden, dich zu verabscheuen oder, was noch schlimmer ist, dich abgöttisch zu lieben. Eine Menge Typen, die jederzeit bereit wären, dir ein Messer in den Rücken zu rammen und dich um die Ecke zu bringen. Nein danke, der Herr, den ihr vor euch seht, zieht es vor, ein armer Schlucker zu bleiben.« – »Ach, scher dich doch zum Teufel«, antwortete ihm ein anderer mit schmutzigen Zähnen und gelblichen Fingern, offensichtlich die Folgeerscheinungen lebenslangen Konsums billigen Tabaks, »mit einer Milliarde Peseten engagiere ich mir ein halbes Dutzend Bodyguards, und dann ist Schluss mit der Angst.« – »Und wenn du dir ein halbes Polizeipräsidium kaufst«, schaltete sich ein Bier trinkender Albino ein, dem ein Arm fehlte, was er anscheinend einem Arbeitsunfall im Sägewerk seines Vaters zu verdanken hatte, »wirst du dich trotzdem immer misstrauisch umsehen. Ich stimme El Zambo zu: Zu viel Geld bringt nur Probleme.«
Die Angelegenheit artete in eine lebhafte Diskussion aus, in die sich nach und nach auch die an den unteren Tischen sitzenden Stammgäste einschalteten. Eine Diskussion darüber, welche Summe viel und welche zu viel war, wenn es um Geld ging. Eine Diskussion, die sich, je hitziger sie wurde, immer mehr in einen Wettbewerb der Illusionen verwandelte, in dem es darum ging, wer die kühnsten Zukunftsträume hegte und wer was mit seinem Millionengewinn machen würde. Ich verlor schnell das Interesse daran. Aber die Tatsache, dass sich so viele Menschen versammelten, sobald sie leicht verdientes Geld witterten, erinnerte mich an Camember.
Ich musste zuallererst herausfinden, wem sein Tod Vorteile brachte. Diesen Punkt hatte die Polizei vernachlässigt, wozu sollte sie sich auch die Mühe machen, zu überlegen, wem die Tat nützte, wenn man sich genauso gut darauf einigen konnte, dass es Selbstmord war. Ich verließ also das Café und machte mich auf den Weg ins Büro, mit dem Vorhaben, mich mit María Arancha bei unserer heutigen Verabredung über dieses und einige andere Themen zu unterhalten. Vorher notierte ich mir die Frage auf einer Serviette, weil diese Sache mit dem Notizbuch in der Brusttasche eines karierten Jacketts mit Flicken an den Ellenbogen doch eher was fürs Kino oder für Kriminalromane ist, wo die Detektive immer ein kariertes Jackett mit Ellenbogenflicken tragen, aber ich würde wirklich gerne mal sehen, wie Marlowe auf Gran Canaria in dieser Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit seinen Ermittlungen nachgeht, oder Poirot, meine Güte, Poirot, der würde schon am ersten Tag seiner Nachforschungen die Krätze kriegen. Ja, ich weiß, dass das nicht professionell ist und kein ordentlicher Detektiv so etwas tun würde, das hat mir mein Geschäftspartner auch schon gesagt, aber ich notiere einfach das, was mich gerade beschäftigt, auf dem erstbesten Stück Papier, das mir in die Hände fällt. Nehmen wir beispielsweise den Fall der Witwe Carrasco, deren eigene Söhne, mögen sie in der Hölle schmoren, sie entmündigen wollten, um vorzeitig das Erbe einzustreichen. Ich hatte die Überlegungen, die mich schließlich – ich hoffe, Sie verzeihen mir das Eigenlob – auf des Rätsels Lösung brachten, auf dem Toilettenpapier des Hotels Reina Isabel notiert, auf dessen hochherrschaftlichem Lokus mir ein Licht aufgegangen war.
Es war nämlich so, dass Martín Carrasco, der älteste Sohn, den Familienschmuck durchbrachte, indem er sich mit abgetakelten Nutten in Hochzeitssuiten vergnügte. Der Schwachkopf verpfändete die Schmuckstücke in einer elenden Absteige in Guanarteme, wo man ihm eine lächerliche Summe für eine Kamee bot, die er am richtigen Ort für mehr als zwei Millionen Peseten hätte verkaufen können. Ein Anruf bei seiner Frau mit dem sachdienlichen Hinweis, sie könne ihren Mann an jenem Abend in einem bestimmten Hotelzimmer abholen, genügte, um die Sache auffliegen zu lassen. Doña Perfecta – so hieß die Frau von Martín, wohl eine Huldigung ihrer Eltern an Don Benito Pérez Galdós – positionierte sich vor der Tür, klopfte, und behauptete auf Nachfrage, sie sei das Zimmermädchen, woraufhin man ihr aufmachte.
Vor ihr stand eine zärtliche kleine Mulattin, die mit üppigen Reizen, dafür umso spärlicherer Kleidung und einem Daiquiri ausgestattet war, und dahinter der dümmlich vor sich hin grinsende Schwächling von Carrasco; also zieht Doña Perfecta einen Aschenbecher aus Lemanit aus der Tasche, ein Andenken aus Mexico City, und fängt an, mit geschlossenen Augen in alle Richtungen um sich zu schlagen und dabei stammelnd »Schlaaampe« und »Ausgebuuurt von Ehemann« und »Was für eine Schaaande« zu kreischen, während weißlicher Geifer ihren Mund verunstaltet. Der Sicherheitsdienst des Reina Isabel musste schließlich sogar die Strandpolizei von Las Canteras rufen, weil er nicht alleine mit ihr fertig wurde, und nach einem Schlagabtausch, bei dem der untreue Ehemann mehrere Zähne verlor und die zwei Beamten sich zahlreiche Verletzungen zuzogen, endete die Angelegenheit auf der Polizeiwache. Als dort der ganze Betrug ans Licht kam, versuchte sich Martín Carrasco aus der Affäre zu ziehen, indem er reuevoll Rotz und Wasser heulte und die Schuld auf seine zwei Brüder abwälzte, ihnen sogar vorwarf, sie hätten seine arme Mutter mit einem Hexengebräu zu vergiften versucht.
Nach dem Frühstück stieß ich auf der Straße mit Rafael, dem Autowäscher, zusammen und bat ihn, in den nächsten Tagen die Augen offen zu halten, vielleicht erfuhr er ja irgendetwas Interessantes. Rafael war nun schon seit einigen Jahren mein Informant. Der Mann hatte alles gehabt und dann alles verloren, weil er sich mit einem durchtriebenen Weibsstück aus dem Süden eingelassen hatte, das ihm erst das Herz brach und ihn dann um sein Haus, sein Auto, seinen Garagenstellplatz und sogar eine monatliche Unterhaltszahlung für ihr lasterhaftes Leben erleichterte. Um der Frau aus dem Süden keinen roten Heller mehr überlassen zu müssen, zog es Rafael vor, zahlungsunfähig zu bleiben, also gab er seine Arbeit als Geschäftsführer einer Reederei auf und fing an auf dem Parkplatz an der Alameda de Colón Autofenster zu putzen. Er verdiente viertausend Peseten am Tag, aß in einer Kneipe in San Antonio, wo das Tagesmenü nur zweihundert Peseten kostet, und schlief jede Nacht im Obdachlosenhospiz. So blieb ihm gerade genug, um zu überleben und seiner Schlampe von Exfrau nie wieder auch nur einen Céntimo zahlen zu müssen. Er war blitzgescheit und war mir umso nützlicher, als er nicht zu viel trank, es sei denn, die Unión Deportiva hatte gerade ein Spiel gewonnen, denn dann verschwand er für zwei lange Tage und kehrte mit einem äußeren Erscheinungsbild und einem Mundgeruch zurück, dass es einem die Schuhe auszog. Er war immer auf der Hut, und ich muss gestehen, dass er mir in mehr als einem verzwickten Fall die Kastanien aus dem Feuer geholt hat.
Die Geschäftsräume des Detektivbüros Blanco & Moyano befinden sich mitten in der Calle Triana in einem zweistöckigen Altbau, den wir uns mit einem Architekturbüro, einer Schneiderei und einer alten Dame teilen, deren Wohnung der Arche Noah immer ähnlicher wird, so viele seltsame Tiere, wie sie dort hält. Unser Verhältnis zu den Nachbarn ist ganz erträglich, mit Ausnahme von Frau Noah vielleicht, die behauptet, dass ihre Leguane jedes Mal fast einen Herzinfarkt kriegen, wenn bei uns jemand klingelt. Nach meinem Gespräch mit Rafael kaufte ich mir am Kiosk noch Zigarren und eine Ausgabe der El País, bevor ich das Büro betrat. Dort empfing mich unsere Sekretärin Inés, die Miguel Moyano von seinem früheren Arbeitsplatz mitgebracht hatte, mit einem verschmitzten Lächeln und der samtigen Stimme einer zweitklassigen Schauspielerin: »Du wirst in deinem Büro schon erwartet, Ricardo, es scheint äußerst wichtig zu sein.« Über Inés lässt sich immerhin sagen, dass sie ordentlich und effizient ist, Eigenschaften, die für einen schlampigen und chaotischen privaten Ermittler einem Geschenk des Himmels gleichkommen. Als Moyano sie zum ersten Mal mit ins Büro brachte und mein überraschtes Gesicht sah, kam er mir schnell zuvor: »Ich weiß, dass sie nicht besonders hübsch ist, Ricardillo, aber damit musst du dich abfinden, die hat nämlich meine Frau ausgesucht, damit du, wie sie sagt, nicht den lieben langen Tag herumstreunst, sondern dich auf die Arbeit konzentrierst, wenn man das, was du tust, überhaupt als Arbeit bezeichnen kann.« Ich betrat also mein Büro, und wer da saß und mit sorgenvollem Gesicht auf mich wartete, war keine andere als María Arancha, die zu früh zu unserer Verabredung gekommen war.
»Entschuldigen Sie bitte, dass ich zu früh gekommen bin, aber ich hatte alle meine Termine für heute Morgen erledigt und wollte die Wartezeit nicht auf der Straße verbringen. In diesem Viertel kenne ich viele Leute, und unter den gegebenen Umständen habe ich keine Lust, jemanden zu treffen.«
»Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Señorita, das verstehe ich. Außerdem mag ich pünktliche Menschen.«
»Ich auch.«
»Darf ich fragen, als was Sie arbeiten?«
»Ich führe eine Unternehmensberatung.«
»Sie helfen also den Leuten bei der Buchhaltung?«
»Nicht nur bei der Buchhaltung. Wir kümmern uns natürlich um die Konten unserer Kunden, aber wir beraten sie auch in steuerlichen und juristischen Fragen.«
»Und damit lässt sich Geld verdienen?«
»Stellen Sie am ersten Tag immer so viele Fragen?«
Es war eine diskrete Art, mir zu verstehen zu geben, dass mich das nichts anging, also strich ich die Segel und navigierte stattdessen zu dem Thema, das uns eigentlich beschäftigte, jedoch nicht, ohne vorher bemerkt zu haben, wie hübsch die Manrique so früh am Morgen war. Man sagt ja, dass die Seele der Rothaarigen unaufhörlich brennt und dass ihr Haar deshalb auf diese Weise leuchtet. Doch María Arancha stand die Trauer ins Gesicht geschrieben. Ich weiß nicht, wie sehr sie ihren Verlobten geliebt hatte, aber es stand fest, dass ihr sein Tod ziemlich nahe gegangen war. Ich bot ihr eine Tasse Kaffee und eine Zigarette an, doch sie lehnte beides freundlich ab. Sie war gekommen, um über Camember zu reden, und hatte nicht vor, eine persönliche Beziehung zu mir aufzubauen. Zumindest dachte ich das damals.
Ich zündete mir eine Zigarette an, fuhr den Computer hoch und legte, mehr aus Gewohnheit als aus irgendeinem anderen Grund, eine CD ein, woraufhin Ellas schwarze Stimme, was für ein Zufall, zu Klavierbegleitung Black Coffee anstimmte. María Arancha schien sich zu entspannen, und ich hatte sogar den Eindruck, dass sie lächelte, ein bitteres Lächeln zwar, aber sie lächelte, um dann wieder über Nichtigkeiten zu plaudern: »Also, Ricardo – darf ich Sie Ricardo nennen? –, bei dieser Musik komme ich mir vor wie in einem Schwarzweißfilm mit Bogart und der Bacall« – inzwischen sang die Fitzgerald dreisterweise I Cried For You –, »einem Film voller unterdrückter Leidenschaft, hören Sie das? Ich habe um dich geweint, nun ist es an dir, um mich zu weinen … Als Onkel Lorenzo mir einen Detektiv vorschlug, fand ich das lächerlich und irgendwie anachronistisch, nicht wahr? So nach dem Motto: Harter Kerl hilft Frau aus der Not, und am Ende verlieben sie sich ineinander, doch die Liebe bleibt unerfüllt, denn in Wahrheit ist sie die Mörderin, es ist alles genau wie im Film, ein Büro mit Blick auf die Hauptstraße, Ledersessel, Tabakgeruch, klassische Bilder an der Wand, eine Sekretärin, die gewissermaßen ein wenig naiv und mit Sicherheit in Sie verliebt ist.«
Ich unterbrach sie mit einer schwachen Handbewegung: »Langsam, langsam, Sie sollten nicht alles glauben, was Sie so aufschnappen, die Wirklichkeit hat nämlich nicht das Geringste mit der Filmwelt zu tun, obwohl, jetzt, wo ich darüber nachdenke, könnten Sie, María Arancha, problemlos für Lauren Bacall durchgehen, diese kupferfarbenen langen Haare, diese zierliche Figur, die sanften Hände, nein, ernsthaft, ich übertreibe nicht, es stimmt, hören Sie, sogar Ella stimmt mir zu« – es lief gerade My Melancholy Baby –, »aber was den guten Humphrey angeht, kann ich leider nur davon träumen, auch nur einen Hauch von Ähnlichkeit mit ihm zu haben, obwohl wir beide rauchen wie ein Schlot, aber da hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf, ich habe weder seinen niedergeschlagenen Blick noch seine durchdringende Stimme, außerdem vertrage ich pro Abend nicht mehr als einen Whisky, der bekommt mir nämlich ganz und gar nicht; im Übrigen habe ich nicht vor, Sie zu ohrfeigen, selbst wenn Sie sich noch so unverschämt benehmen, und ich werde auch nicht versuchen, Ihnen in einem unachtsamen Moment einen Kuss zu stehlen; das hier ist ein Auftrag wie jeder andere, versuchen Sie sich also vorzustellen, ich wäre Ihr Arzt oder Ihr … Was machen Sie noch mal beruflich …? Genau, stellen Sie sich vor, ich wäre Ihr Unternehmensberater.«
Die Manrique machte nun einen etwas besänftigten Eindruck, weil sie wahrscheinlich dachte, ein Typ wie ich sei völlig harmlos. Sie konnte ja nicht wissen, dass das Teil einer Strategie war, die sie dazu bewegen sollte, sich mir anzuvertrauen. Prompt fing sie an, mir von ihrer Beziehung mit Camember zu erzählen. Sie hatte ihn auf einer Silvesterparty im Segelklub kennen gelernt, und in jener Nacht war er wie der vollendete Gentleman aufgetreten, in seinem weißen Smoking und mit seinem Champagnerglas in der Hand. Das mit dem Smoking verlangte schon Mut, denn nicht jeder schafft es, in Weiß distinguiert auszusehen. Man läuft allzu leicht Gefahr, für den Kellner gehalten zu werden, doch Toñuco stellte sich tapfer dieser Herausforderung. Er näherte sich ihr nach dem Glockenläuten um Mitternacht, sprach sie flüsternd an und summte ihr einen »Krismes«-Song – so sprach María Arancha es aus – von Bing Crosby ins Ohr (viel zu guter Geschmack für einen Snob). Dann forderte er sie auf, mit ihm zu Ojalá que llueva café