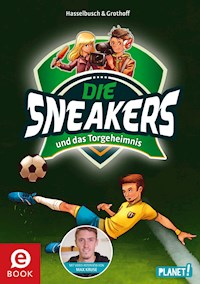3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
»Die Luft fühlte sich warm an und schmeckte nach Freiheit.« Laue Sommernächte, Tapas im Park und Tortilla um Mitternacht: Alexandra kommt ins Träumen, als sich ihre Tochter Lou nach dem Abitur auf ein Auslandsjahr in Madrid vorbereitet. Vor vielen Jahren hat auch Alexandra als Au-pair dort gearbeitet und die süße Freiheit kennengelernt - aber dann eine bittere Erfahrung gemacht. Nun steht Lou vor einem großen Abenteuer und Alexandra fällt es schwer, loszulassen. Auch aus Angst vor dem, was nun unweigerlich folgt: die leeren vier Wände, die Veränderung als Paar, die Lous Auszug mit sich bringt. Mit vielem hätte Alexandra gerechnet. Nur nicht mit dem unerwarteten Neuanfang, der plötzlich möglich wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Ähnliche
Über das Buch
Alexandra Lindow hat eigentlich alles, wovon sie immer geträumt hat. Ihre zauberhafte und sehr eigenwillige Tochter Lou, ihren Mann Markus, der sie immer unterstützt hat, und einen tollen Job. Doch als Lou in ihre Fußstapfen tritt und ihr Auslandsjahr ebenfalls in Madrid verbringen will, gerät Alex in Panik. Denn sie verbindet nicht nur Freiheit und Abenteuer mit ihrer Zeit als Au-pair, sondern auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung.
Und auch die Aussicht, plötzlich wieder mit Markus allein zu leben, versetzt ihr einen Stich. Denn wo ist diese unverwechselbare Liebe geblieben, die sie so lange miteinander geteilt haben? Ist der alte Funke noch da – oder ist es Zeit für einen Neuanfang?
Für Linda und Mats, die hoffentlich die Welt erobern werden. Und für meinen Vater, der für mich die Welt bedeutet hat.
¡De Madrid al cielo! Nach Madrid ist nur der Himmel schöner.(Spanisches Sprichwort)
Alex
September 1989
Krampfhaft klammerte sich seine Hand an dem Serrano-Bocadillo fest, bevor er mich ganz loslassen musste. Mein Vater Helge führte eine Art Triathlon vor: am Café con leche nippen, nervös an der Zigarette ziehen, am Schinkenbaguette knabbern. Wir saßen an einem kleinen Tisch auf dem Platz vor der Bar im Herzen von Madrid. Es war September, die Luft roch nach Oliven und Staub, war südländisch warm und schmeckte nach Freiheit. So ganz anders als zu Hause.
Im Auto hatte mich mein Vater die knapp 2200 Kilometer von Hamburg hierher in Spaniens Hauptstadt chauffiert.
»Ich möchte nicht so gern, dass du hinfliegst«, hatte er gesagt.
»Weil DU Flugangst hast?«, hatte ich stirnrunzelnd gefragt?
»Ich doch nicht!«, war seine Antwort gewesen. Ich grinste. Für einen Mann vom Format meines Vaters ein bisschen inkonsequent. Er hatte selbst die halbe Welt bereist, per Auto und Schiff, sorgte sich aber um sein Nesthäkchen wie an dem Tag, als ich zum ersten Mal allein zur Schule gegangen war.
Ich, Alexandra – Alex – Lindow, war neunzehn Jahre alt, hatte mein Abi gerade in der Tasche und würde in einer Stunde meinen neuen Job antreten: als Au-pair-Mädchen in einer Familie etwas außerhalb von Madrid. Wohlhabende Leute, die in einer Art Siedlung mit Pool und Tennisplatz wohnten.
Mein Vater sah unauffällig einer Spanierin mit langen, dunklen Haaren nach, Typ Gabriela Sabatini. An seiner fast aufgerauchten Overstolz zündete er sich eine neue an.
Mir war klar, dass er sich vor Ort davon überzeugen wollte, wo ich unterkäme.
»Warum tust du dir das an, dich um ein schreiendes Baby zu kümmern?«, startete er einen letzten Versuch, mich von meinem Vorhaben abzubringen. Würde ich auch nur kurz »Piep« sagen, würde er mich, ohne zu zögern, ins Auto verfrachten, die Strecke zurückfahren und meiner Mutter sagen: »Da isse wieder!«
So wie damals, als er mich zur Grundschule hätte bringen sollen. Ich hatte allerdings kurz geschnieft, woraufhin mein Vater mich zu der Wäscherei gefahren hatte, in der meine Mutter gerade Laken plättete, und ihr erklärt hatte: »Es ging nicht, sie wollte nicht!«
»Papa, hier schreit vielleicht ein Baby rum, zu Hause schreit ein Erwachsener rum, wenn ich nicht sofort das Fernsehprogramm wechsle.« Diesmal lächelte er. Jetzt würde er meine Mutter dressieren müssen, andauernd nach der Fernbedienung zu suchen. Ich wünschte mir glühend, dass es irgendwann möglich sein würde, die Flimmerkiste per Gedankenübertragung zum Wechseln des Senders zu bewegen.
Ich nahm noch einen letzten Schluck von meinem frisch gepressten Orangensaft. Das war für mich der Inbegriff Spaniens. Der Duft und Geschmack von Zitrusfrüchten. Die Form, die Farbe. Wenn dir der Saft auf der Zunge dieses unbezahlbare Urlaubsgefühl bescherte. Durch die Fensterscheibe beobachtete ich, wie der Mann hinter der Bar mit drei Orangen jonglierte. Er hielt sie geschickt in der Luft.
»La cuenta, por favor.« Mein Vater bestellte kurz darauf schweren Herzens die Rechnung, legte die Summe samt großzügigem Trinkgeld auf den Tisch, strich mir liebevoll über die Wange und steckte mir zeitgleich ein paar Scheine in die Jackentasche.
»Kannste dir ’n Eis von gönnen, ins Bernabéu-Stadion zum Fußball gehen und auch mal nach einer Telefonzelle suchen.«
»Ihr ruft doch eh schon zweimal in der Woche bei der Gastfamilie an, haben wir doch besprochen.«
»Ja, ich mein ja nur, falls was ist!«
»Was soll denn sein?«
»Heimweh vielleicht! Oder wenn dich jemand ärgert. Ein Junge oder so.«
Dass ich nicht lachte. Ihn anrufen, damit er dann käme und den Jungen vor die Tür setzte. Das hatte er einmal mit einem Freund von mir gemacht. Er hatte mein Zimmer geradezu gestürmt. Meinem Vater war es zu ruhig hinter der Tür gewesen, hatte er später ohne jedes schlechte Gewissen erklärt. Es hätte ja auch etwas passiert sein können. Als er uns gemeinsam auf meinem Bett sitzen gesehen hatte, hatte er meinem Freund unmissverständlich klargemacht, dass es Zeit sei zu gehen. Das nahm der wörtlich und kam nie wieder.
Es war in etwa das Peinlichste, was mir bei meinen ersten Annäherungsversuchen passiert ist. Okay, bis auf den Umstand, dass meine Mutter meine beste Freundin zu sich zitiert und sie gelöchert hat, ob ich denn eigentlich schon, äh, also, ja, äh, Kontakt hätte, also, ob ich gewisse Gelüste verspüren würde, was das männliche Geschlecht beträfe?
Meine Freundin hatte keck geantwortet: »Ob Alex schon Sex hatte? Fragen Sie sie doch selbst!«
Danach war bei uns in der Bude richtig Rambazamba gewesen. In Jungs-Angelegenheiten kannten meine Eltern einfach keinen Spaß.
Ich hingegen wollte endlich Spaß haben und mich aus dem häuslichen Glaskasten befreien. Nicht mehr so eingeengt sein. Endlich dieses Gefühl loswerden, dass ich sowieso niemals einen Mann finden würde, dass eine normale Beziehung für mich einfach nicht vorgesehen zu sein schien.
»Hast du denn auch zu Hause angerufen, wenn dir in deinen zwei Jahren in Mexiko ein Mädchen zu nahegekommen ist?«, fragte ich meinen Vater.
»Natürlich nicht.«
»Siehste!«
Auch da lächelte er. Die südländische Sonne machte ihn irgendwie sanfter. Als würde er hierhergehören und in Hamburg nur so eine Art Pflicht erfüllen. In diesem Moment fühlte ich mich ihm sehr verbunden. Wir sahen uns mit unseren blauen Augen nicht nur verdammt ähnlich, offenbar empfanden wir auch gleich. Ich merkte schon jetzt, wie viel freier ich mich fühlte. Ich fand diese Stadt einfach nur irre.
»Vielleicht kannst du dir ja die Haare wachsen lassen, auch wenn Mama findet, dass dir das nicht steht.«
Da sagte er was. Jahrelang nun schon trug ich meine Haare kurz, weil meine Mutter der Meinung war, etwas anderes sähe bei mir nicht gut aus.
Sie fand auch, es gehöre sich nicht, Leuten einfach nur »Hallo« zu sagen, ohne ihnen die Hand zu geben. Oder einen kurzen Rock zu tragen, Fan einer Rockband zu sein, oder, Gott bewahre, einen Jungen bei sich übernachten zu lassen.
»Vielleicht versuch ich’s mal mit den Haaren.«
»Aber nicht, dass dann alle Spanier bei dir Schlange stehen.«
Obwohl ich ihm gern gesagt hätte, dass ich jetzt erwachsen bin und mir Schlange stehende Spanier durchaus gut vorstellen konnte, hielt ich mich zurück.
Stattdessen entgegnete ich: »Wohl kaum, ich renn doch eh die ganze Zeit mit dem Baby rum. Wer will schon eine so junge Mutter?«
Entsetzt blickte mein Vater mich an, in seinem Kopf startete ein unsittliches Kopfkino. Meine Mutter war mit zwanzig schwanger geworden.
»Keine Sorge, Papa! Wollen wir los?«
Ich stand auf, er folgte mir zögerlich.
»Und wenn du die alle nicht verstehst hier, dann kannst du natürlich auch zurück.«
»Das wäre bitter, denn das würde bedeuten, dass du als Spanisch-Lehrer komplett versagt hättest.«
Das Argument musste er gelten lassen.
»Dir wird’s hier sehr gefallen. Du hast das in dir, Stüpken«, sagte er und stupste meine Nase, wie er es immer gemacht hatte, als ich ein Kind gewesen war. Manchmal glaubte ich, in seinem Inneren schlugen zwei Herzen. Es gab den weltoffenen, charmanten, witzigen Mann, der in seiner Zeit im Ausland nichts hatte anbrennen lassen und mein Abenteuer am liebsten miterlebt hätte. Aber auf der anderen Seite auch den strengen Vater, der seine Tochter vor all dem bewahren wollte, was er selbst angestellt hatte. Im Grunde genommen wollte er mich beschützen und zwar vor Typen wie sich selbst. Wie sollte man da noch durchblicken und seinen eigenen Weg finden? Dieses Unternehmen würde ich jetzt angehen, eigenständig, unabhängig, keinesfalls fremdbestimmt, und selbstverständlich würde ich mindestens dreimal pro Woche nach einer Telefonzelle in Madrid fahnden, um Rapport zu erstatten.
Mein Vater merkte, dass er all sein Pulver verschossen hatte, öffnete die Beifahrertür, schob mich sanft hinein, setzte sich hinters Steuer, drehte Karel Gotts »Einmal um die ganze Welt« auf, zündete sich eine Zigarette an und fuhr mich in mein neues Leben.
Alex
Juni 2019
Dafür sollten selbst meine Mathe-Kenntnisse ausreichen. Meine Tochter Lou hat recht. Sie ist achtzehn. Zahlen kann man sich nicht schönreden. Obwohl ich sowohl bei der Geburt als auch bei der letzten Geburtstagsparty dabei war, ist mir bis eben nicht bewusst gewesen, dass es wirklich schon so weit ist.
Gedankenverloren rühre ich im Topf mit dem Risotto. Offenbar habe ich nicht nur verdrängt, dass dringend die Spülmaschine in unserer Hamburger Wohnung repariert werden muss und ich immer noch keine Patientenverfügung habe, sondern auch die Tatsache, dass meine Tochter jetzt quasi erwachsen ist.
Als Lou plötzlich sagt: »Nächste Woche ist Abi-Verleihung, dann jobbe ich ein bisschen, danach fliege ich mit Paula und Lily für zwei Wochen auf eine griechische Insel, und dann geh ich ins Ausland!«, reißt sie mir unsanft den Verdrängungsschleier vom Gesicht.
»Aber Griechenland ist doch schon genügend Ausland, oder nicht?«, werfe ich ein und weiß sofort, dass das eine unpassende Bemerkung ist. Lous Augenrollen ist der Beweis dafür.
»Wohin würdest du denn gern gehen?«, hake ich etwas neutraler nach. Wenn ich zu ablehnend wirke, macht sie gleich komplett dicht. Zimmertür zuschlagen, ins Bett, beleidigt. Diese Reaktion versuche ich diesmal möglichst zu vermeiden.
»Wieso würde?«, fragt Lou, nimmt sich einen Schokoriegel aus dem Kühlschrank und beißt genüsslich hinein.
»Wir essen gleich!«, sage ich und erschrecke vor meiner eigenen Stimme, die wie die meiner Mutter klingt. Hoffentlich erteilt diese Stimme meiner Tochter nicht gleich auch noch Stubenarrest.
»Super!«, findet Lou und stopft einen zweiten Riegel hinterher. »Was gibt es denn Leckeres?«
»Limetten-Risotto!«
»Oh, das hatten wir schon lange nicht mehr! Kriegst du das noch hin?« Die Frage kommt von meinem Mann und macht mich irgendwie fuchsig. Markus steht in der Küchentür und blickt in unsere Richtung.
»Wieso sollte ich das nicht mehr hinkriegen?«, sage ich leicht gereizt.
»Na ja, weil du mal gesagt hast, dass es wichtig ist, den richtigen Punkt beim Glasieren von Schalotten und Reis zu erwischen, bevor man mit dem Wein ablöscht.«
»Ja, das richtige Timing ist wichtig, wie immer im Leben! Aber das verlernt man ja nicht.«
Hoffentlich klinge ich nicht so zickig wie die Alarmglocke in meinem Kopf es andeutet. Ich sollte meinen Ton unter Kontrolle bekommen. Schließlich bete ich das auch meinen Kursteilnehmern immer vor: Das Auftreten ist die halbe Miete. Eine zu schrille, grelle Stimme, und man sitzt schnell auf der Straße. Gerade bin ich von einem viertägigen Präsentations-Seminar in Süddeutschland zurückgekehrt. Die Agentur, die mir die Jobs vermittelt, schickt mich in ganz Deutschland herum. Ich bin also quasi Profi im Beherrschen meiner Tonlage – zumindest theoretisch.
»Mensch, Mama, chill mal und mach Papa nicht so an.« Lou kennt jede kleine Nuance meiner Stimme.
»Was? Nein, mach ich gar nicht. Deckt doch mal den Tisch, bitte!«
Während ich durch die Weltgeschichte reise und andere Leute schule, arbeitet Markus von zu Hause aus. Grob gesagt, macht er Berechnungen für Autokonstruktionen – eher Teilzeit, damit er sich um Lou kümmern kann, wenn ich unterwegs bin. Wir sind mit dem Modell immer ganz gut gefahren.
Als wir kurz darauf am Tisch sitzen, pulen die beiden kommentarlos die teils angekokelten Schalotten aus dem Essen. Lou und Markus werfen sich unauffällig einen Blick zu.
»Nehmt halt mehr Salat!«, schlage ich vor und würde eigentlich am liebsten laut loslachen. So wie Markus vor etlichen Jahren, als er einen Anzug anprobiert hatte und ich fragte, ob er sicher sei, dass er ihm passt. Markus, als er »Natürlich, was denkst du denn?« meinte, aus der Umkleidekabine trat, und mir als Erstes der Hosenknopf um die Ohren flog. Da haben wir uns halb kaputtgelacht.
Meine Gedanken kreisen um so viele Dinge. Um meinen anstehenden 50. Geburtstag, die zusätzliche Nacht in Bayern, Lous Abi, ihre Pläne.
»Sag mal, Lolli, was genau meintest du eben mit dem Ausland?« Demonstrativ nehme ich mir eine zweite Portion Risotto. Die Limetten-Zesten bringen eine herrliche Frische ins Gericht und übertünchen das Angebrannte. Das rede ich mir zumindest ein.
»Dass ich für ein Jahr Au-pair mache. In Spanien, Madrid. Also, in der Familie, in der du auch warst.«
Dieser Treffer saß. So muss sich ein Boxer fühlen, der ungedeckt einen linken Haken verpasst bekommt.
»Wie bitte? Seit wann das denn? Also, davon wusste ich ja gar nichts.«
Mir wird plötzlich ganz heiß, längst verdrängte Erinnerungen gesellen sich zum Schweißausbruch.
»Ach so, du warst ja auf Geschäftsreise. Da hab ich wohl vergessen, dir das zu sagen«, erklärt Lou schulterzuckend. »Papa wusste es aber.«
»Ehrlich, du wusstest das?« Verständnislos sehe ich Markus an. Wieso hat er mir denn nichts davon erzählt?
»Ich dachte, du wärst auch auf dem Laufenden. Aber ist doch gut, dass sie das macht und hier mal rauskommt«, findet Markus.
Prinzipiell stimmt das natürlich, nach dem Abi wollte ich ja auch so schnell wie möglich weg.
»Das ist richtig«, gebe ich zu. »Aber ich bin jetzt schon ein bisschen durcheinander. Hast du wirklich gerade gesagt, du gehst in die Familie, in der ich auch war?«
»Ja!« Lou nickt. »Cool, oder? Ich habe den Jungen, Jaime, auf den du früher aufgepasst hast, bei Facebook gefunden und gleich mal angeschrieben. Er hat jetzt selbst ein Kind. Er hat sich auch an dich erinnert. Sein Vater Juan auch. Ich soll dich schön grüßen.«
All diese Informationen prasseln wie piksende Kieselsteine auf mich ein. Lous Plan klingt wie in Stein gemeißelt und scheint noch uneinnehmbarer als Fort Knox.
»Und das hast du alles verabredet, ohne mich zu fragen, ob ich das in Ordnung finde? Spinnst du? Das kannst du vergessen.«
Leichte Panik steigt in mir auf. Ich muss mich beruhigen, was sollen meine Tochter und mein Mann von mir denken, wenn ich so eine Szene mache.
»Ja, warum denn nicht? Was ist daran schlimm? Du hast doch immer gesagt, ich soll mir was organisieren und viele Erfahrungen sammeln, über den Tellerrand blicken, bla, bla. Was stört dich daran?«
»Warum machst du nicht einen Sprachkurs? Oder du schreibst dich dort an der Uni ein, oder noch besser in Salamanca, das ist eine super Uni-Stadt.«
»Hä?« Lou stößt einen Laut aus, den ich überhaupt nicht mag. Dieses dümmliche »Hä«.
»Was hast du jetzt auf einmal gegen Madrid?«
»Nichts!«, gebe ich einsilbig zurück und versuche, mich zu beruhigen.
»Für Nichts klingst du aber ziemlich aufgebracht«, merkt Markus an, was mich noch mehr auf die Palme bringt.
»Du weißt doch gar nicht, ach, egal«, breche ich ab.
»Was weiß ich nicht?«, will er wissen.
»Gar nichts. Nein, egal, ist ja schon gut.« Ich bete zu Gott, dass niemand meiner Kursteilnehmer jemals so ein elendiges Gestammel von mir miterleben muss. In was für eine Situation haben wir uns hier hineinmanövriert? Dabei wollte ich nur in Ruhe nach Hause kommen und Risotto essen.
»Ich habe auch das Gefühl, dass ich nicht alles weiß. Aber die Dame redet ja nur noch, wann es ihr passt.« Markus knallt seine Gabel neben den Teller. Der Appetit ist ihm offenbar vergangen.
»Mann, was nervt ihr denn jetzt so rum, es geht doch um mich. Ich fand es voll krass, dass die mich haben wollen, ich dachte, du freust dich auch, und jetzt stresst du so rum. Wieso?«
Lous Stimme überschlägt sich, gleich fängt sie an zu weinen. Bitte nicht. Mein armes, süßes Kind. Sie kann doch gar nichts dafür. Woher soll sie auch wissen, warum ich mir solche Sorgen mache? Das wollte ich ihr doch alles ersparen. Wäre ich nur nicht so unvorbereitet in diese Neuigkeit hineingeschlittert.
Lou und Markus starren ins Leere. Ich muss die Situation retten, ich habe überreagiert.
»Möchtest du eigentlich vor deinem Abiball noch zum Friseur?«
Betretenes Schweigen.
»Du wolltest doch so gern eine Flechtfrisur haben. Vielleicht komme ich dann mit.« Ich gebe mein Bestes und schaue auf die sehr langen, braunen Haare meiner Tochter, doch sie reagiert nicht.
»Wir können auch zusammen nach einem Kleid gucken.«
»Mann, Mama, was soll der Scheiß? Erst machst du hier wegen Spanien ’ne Riesenwelle, und dann tust du als wäre nix! Was soll das?«
»Sie lenkt wieder ab. Kriegsschauplatzverlagerung!«, merkt Markus in seiner pragmatischen Art an.
»Ja, okay, ist ja gut. Also, dann geh eben nach Madrid. Von mir aus.«
»Erklär doch wenigstens, was du daran blöd findest«, bittet Lou immer noch aufgebracht.
»Gar nichts. Ich dachte eben, Au-pair sei out, weil es so viele andere Möglichkeiten gibt.«
Ich höre selbst, wie lahm diese Ausrede klingt, die Wahrheit sagen kann ich aber auch nicht.
»Ich dachte, du findest eine WG besser?«
»Mal sehen, was sich da ergibt. Ich wollte ja ein bisschen bleiben. Also, auf jeden Fall will ich es länger aushalten als du damals.«
Dieser Seitenhieb sitzt.
Ich hatte Lou mal erzählt, dass ich nicht das ganze Jahr geblieben, sondern früher wieder nach Hause gekommen bin.
»Das wird ja nicht so schwierig, bei irgendwas länger am Ball zu bleiben als ich!«, gebe ich zu und ernte ein erleichtertes Seufzen meines Mannes. Er hasst Auseinandersetzungen, vor allem, wenn ich impulsiv und argumentativ schwach auf der Brust bin, wie er es nennt. Meine Selbstironie mag er dafür umso lieber.
»Na, dann hätten wir das ja!«, sagt er und greift wieder zur Gabel.
»Gibt’s Nachtisch?«, fragt er, als er in dem angebrannten Reis herumstochert. »Vielleicht Crème brûlée?« Seine Grübchen blitzen kurz auf. Die vorwitzigen Dinger sind mir schon lange nicht mehr aufgefallen.
Ich stehe auf und suche in der Kühltruhe nach etwas, das noch nicht seit Lous Einschulung abgelaufen ist. Die Stimmung ist gerade noch so zu retten gewesen. Bis Lou noch einen obendrauf packt.
»Opa hat gesagt, er würde mich hinfahren.«
Mir fällt die Eispackung aus der Hand. »Das fehlt gerade noch!«
Markus
Silvester 1999
Meine Rettung näherte sich stolpernd, mit zwei Bechern in den Händen und einer zerrissenen Plastiktüte auf dem Kopf. Kurz zuvor war ich noch der Meinung gewesen, dass Champagner in Hamburg zum Jahrtausendwechsel eine reine Schnapsidee gewesen war. Als sie auf mich zukam, brachte eine Baumwurzel an der Alster sie aus dem Gleichgewicht und ich fing sie auf, bevor sie in den Matsch fallen konnte.
»Ich schlag dir einen Deal vor«, eröffnete die Frau mit den angeklatschten blonden Haaren das Gespräch. »Du gibst mir deine Mütze und ich dir einen der beiden Becher hier!«
Ihr Lächeln war spitzbübisch. Verspielt fuhr sie sich durch die nicht vorhandenen Löckchen.
»Du könntest dann diese megaschicke Plastiktüte haben!«, neckte sie mich, reichte mir einen halb vollen Becher und zog mir die schwarze Mütze vom Kopf.
Es regnete. Das neue Jahr war eine gute Stunde alt, und die Raketen schossen unbeirrt über der Außenalster in den 2000er-Himmel. Um uns herum waren viele Menschen, denen das Wetter auch nichts auszumachen schien. Wer würde sich den Jahrtausend-Wechsel von ein paar Tropfen Wasser verderben lassen? Wir standen schräg gegenüber vom »Hotel Atlantic«.
Der Boden war uneben und sumpfig, ich hätte normale Turnschuhe anziehen sollen, und nicht diese uncoolen, overdresseden, braunen Budapester. Mein Freund Daniel hatte behauptet, wir müssten uns schick machen, wenn wir in der Großstadt feiern gehen wollten. Hoffentlich würden ihr die Schuhe nicht gleich auffallen.
»Nimm die Plastiktüte und schnür sie dir um deine Dinger da unten, dann kannst du sie auch noch zu deiner Konfirmation anziehen«, sagte sie. Ich schätzte, dass ihre Konfirmation, ähnlich wie meine, etwa ihr halbes Leben lang zurückliegen müsste. 31 war ich, sie vielleicht ein wenig jünger.
»Gut, komm doch auch. Aber bitte genau so, wie du jetzt bist.« Ich deutete auf meine Mütze auf ihrem Kopf.
»Wie sieht sie aus?«, wollte sie wissen und drehte sich leicht nach links und rechts.
»Nach ’ner Plastiktüte kann es ja nur aufwärtsgehen!«, antwortete ich ehrlich.
»Na, du traust dich was!«, meinte sie lachend und tippte mit ihrem Plastikbecher meinen an.
»Feliz año nuevo!«, sagte sie und gab mir einen Kuss auf den Mund.
Und sie traute sich erst.
»Dir auch«, erwiderte ich und fragte mich, ob mir schon jemals eine so direkte Frau begegnet war. Wir nahmen jeder einen Schluck. Das Gesöff schmeckte süß und eher nach Silvester 1981.
»Wie weit bist du hergelaufen auf diesen braven Schuhen?«, wollte sie wissen.
»Genau 221 Kilometer gefahren, aus Wolfsburg.«
»VW oder VfL?«
»Beides«, gab ich zurück.
»Fan?«
»Na ja, statt eines VW hätte ich schon gern was anderes, sportlicher vielleicht, aber verrat’s niemandem, sonst bin ich meinen Job los.«
»Vertickst du die Karren oder hockste im Büro?«
»Im Grunde beides«, erklärte ich.
»Und wie lange bleibst du hier?«
»Die Frage ist eher, wo ich bleibe, um ehrlich zu sein«, gestand ich ihr. Ich hoffte, es klang nicht zu aufdringlich und nicht nach Silvester-Resterampe-Anmache. »Ich habe da nämlich ein Problem«, wagte ich mich weiter vor.
»Komm, hast du Lust auf was zu essen? Wir könnten zur Langen Reihe gehen.«
Ich hatte keine Ahnung, was die Lange Reihe war, aber ich wäre in diesem Moment auch zum Kurzen Kreis oder zum Breiten Dreieck gegangen. Ich hatte eh nichts anderes vor.
»Gern, ich habe bisher nur den Hafen und die Alster gesehen. Und meinen Kumpel von hinten.«
Wir gingen an den feinen Damen und Herren vorbei, die vor dem »Hotel Atlantic« standen, in Anzug und Abendkleid. Durfte man eine waschechte Hamburgerin wohl fragen, ob Udo Lindenberg tatsächlich in diesem Hotel wohnte, oder hielt sie einen dann womöglich für einen Volltrottel? Außerdem wusste ich ja noch nicht einmal, ob sie eine echte Hamburgerin war.
»Ja, er wohnt hier wirklich!«, sagte sie plötzlich. Ich nickte, und wir gingen einvernehmlich schweigend weiter.
Sie griff nach meiner Hand. Das war schön, aber auch überraschend.
Man musste ihr zugutehalten, dass sie ganz schön getankt hatte, aber irgendwie kam ich mir bei ihrem Tempo wie ein Dorfdepp vor, im Grunde wie der spießige VW-Fahrer, der ich ja auch war.
»Das ist sie. Da hinten um die Ecke wohne ich«, sagte sie und zeigte irgendwo ins Nirgendwo.
Die Lange Reihe entpuppte sich als eine Straße, die sich nicht ganz entscheiden konnte, ob sie hipp oder alternativ sein wollte. Genau das machte ihren Charme aus. Viele Restaurants, Ateliers, beleuchtete, moderne Läden, urige Kneipen. Sie deutete nickend auf ein portugiesisches Café im Souterrain. Die Theke war mit Luftschlangen dekoriert, Glitzerkonfetti war zwischen Natas und Käsebrötchen verstreut. An einem Tisch saß eine Gruppe älterer Leute mit bunten Partyhüten auf dem Kopf. Sie sangen lauthals Schlager mit. Der portugiesische Wirt stellte sich als João vor und zuckte nur lachend mit den Schultern.
»Wir können nachher auch andere Musik anmachen«, schlug er vor, weil er befürchtete, wir könnten Hals über Kopf den Laden verlassen.
»Kein Problem«, sagte ich. »Was möchtest du?«, fragte ich meine Begleitung.
»Wein«, schrie sie und versuchte Patrick Lindners »Wir sind stark genug« und »Schuld war nur diese Nacht« von der Münchner Freiheit zu übertönen.
Sie zog ihren Mantel aus, unter dem ein knappes, schwarzes Kleid zum Vorschein kam.
João brachte uns einen Galão, einen Wein und dazu zwei Vanilletörtchen aufs Haus. Bei der Lautstärke war eine Unterhaltung allerdings schwierig.
»Jetzt wollte ich dir meine intimsten Geheimnisse zuraunen, aber gegen Roland Kaiser anzuschreien ist irgendwie nicht so sexy, oder?«, schrie sie mir ins Ohr.
»Waaaas?«, brüllte ich zurück. »Du findest Roland Kaiser sexy?«
Sie nickte.
»Sein Hintern ist echt knackig, aber erzähl es niemandem!«, rief sie in dem Moment, als es still wurde, weil João Roland gegen eine neue CD austauschte.
»Respekt, ich weiß nach dreißig Minuten nicht mal, wie du heißt, aber auf was für Hintern du stehst!«
Sie errötete nicht mal. Von Sekunde zu Sekunde wurde sie betrunkener, was gewiss auch an dem Sekt lag, den uns eine der älteren Damen vom Nebentisch spendiert hatte.
»Wollen wir deinen mal antesten?«, rief sie mir zu, und ließ offen, was genau sie damit meinte. Ich merkte es schnell.
Sie bat mich zum Neujahrstanz und ließ sich schnell in meine Arme sinken, obwohl der Marianne-Rosenberg-Rhythmus eher zu wildem Gezappel gepasst hätte.
»Er kommt aus Wolfsburg«, schrie sie dem tanzenden Rentner neben uns zu.
Der grinste und führte seine Partnerin geschickt an einem Tisch vorbei.
»Dass jemand Wolfgang Wolf heißt und in Wolfsburg Trainer ist, kann doch auch nicht wahr sein, oder?«, rief er mir zu.
Meine Tanzpartnerin hörte es.
»Heißt der echt so?« Ich nickte.
»Wir waren mal im Urlaub in Schweden, da hieß einer Sven Svensson und wohnte in der Svenssonsgatan«, fügte ich hinzu.
»Jetzt weiß ich, wie halb Skandinavien heißt, aber deinen Namen kenn ich noch nicht!«, gab sie zurück.
»Ich bin Markus, zahle mit D-Mark und lade dich natürlich ein.«
»Das hatte ich auch nicht anders erwartet, schließlich darfst du bei mir übernachten!«, gab sie keck zurück und drückte sich noch etwas enger an mich.
»Darf ich das?« Das ging ja schneller als ein neues Paar Socken zu kaufen.
»Du hast doch gesagt, dass du nicht weißt, wo du schlafen sollst, oder?«
Wo sie recht hatte. Mein Wolfsburger Freund Daniel hatte mich in diese Situation hineinmanövriert. Diese ganze Hamburg-Reise war seine Idee gewesen. Er wollte endlich mal richtig feiern, nachdem er sich laut eigener Aussage »jahrelang für sein Studium krumm gemacht« hatte. Dazu fiel mir nur ein, dass ich ihn häufiger in Fötus-stellung in seinem Bett angetroffen hatte als an der Uni, was in gewisser Weise auch eine Art »krumm machen« gewesen war.
Er hatte in Hamburg auf das große Abenteuer gehofft. Kaum hatten wir unser mehr als dubioses Doppelzimmer auf St. Pauli bezogen, stürzten wir uns am Hamburger Berg ins Getümmel. In einer Kneipe hatte ich an der Theke zwei Bier bestellt, da lag bereits eine fremde Schönheit im Glitzerfummel in Daniels Armen.
»Das ist Heike aus Leipzig«, raunte Daniel mir zu. »Und sorry, Markus, aber ich werde die Nacht heute nicht mit dir verbringen.« Er zwinkerte mir verschwörerisch zu.
Das gönnte ich ihm von Herzen, schließlich war es nicht immer ein Vergnügen, die Nacht mit mir zu verbringen. Gewühle, Geschnarche; ich zitiere aus dem langen Beschwerdekatalog meiner Exfreundin.
»Hast du was dagegen, wenn ich sie mit auf unser Zimmer nehme?«, fragte Daniel rein pro forma, bevor er beschloss, Heike aus Leipzig schon in der Ecke der Kneipe bettfertig zu machen.
»Mach du nur!«, sagte ich und gab ihm grünes Licht. Dass ich damit die Nacht durchmachen musste, wurde mir erst später klar. Die Hotels in Hamburg waren komplett ausgebucht. Welch Wunder an Silvester zur Jahrtausendwende. Ich schlenderte allein durch die Stadt und beobachtete die ausgelassenen Leute. Einsame Wölfe aus Wolfsburg – wie ich – waren wenige unterwegs.
Ich wünschte mich kurz in meine Stammkneipe zurück, aber wirklich nur kurz. Meine Ex konnte ich mir besser in einer fremden Stadt aus dem Kopf pusten lassen, das hatte ich zumindest gehofft. Daher hatte ich Daniels Idee auch begeistert zugestimmt.
Durch die Schanze wanderte ich in Richtung Schlump. Vor einer Pinte angekommen ging das Feuerwerk los. Mit mir völlig unbekannten Menschen stieß ich dort aufs neue Jahr an. Zu allem Überfluss fing es auch noch an zu regnen, doch das machte jetzt auch keinen Unterschied mehr. Irgendwann kam ich an der Außenalster beim »Hotel Atlantic« an. Kurz überlegte ich, ob ich dort nach einem Zimmer fragen sollte, als mir eine Frau mit einer Plastiktüte auf dem Kopf entgegenstolperte.
»Ja, das weiß ich wirklich nicht. Mein Freund, mit dem ich hergekommen bin, hat sich eine Sächsin geangelt.«
»Eine Angelsächsin?«, hakte meine Zufallsbekanntschaft leicht lallend nach. Sie hatte meine hinteren Körperzonen inzwischen derart intensiv inspiziert, dass sie gut und gerne eine Doktorarbeit darüber würde schreiben können.
»Ich hatte schon überlegt durchzumachen«, erzählte ich ihr von meinen vagen Plänen.
»Das kannst du auch bei mir.« Sie gab alles, um geheimnisvoll, verführerisch und mysteriös zu wirken. In gewisser Weise war das rührend.
»Hängen bei dir keine Sachsen rum?«, wollte ich wissen.
»Nee, nur meine Mitbewohnerin. Aber sie ist nicht da, weil ihr Vater ins Krankenhaus gekommen ist. Vorhin. Deswegen musste sie an der Alster auch so schnell los. Ein Wunder, dass ihre Mutter in der Aufregung überhaupt ihr neues Handy bedienen konnte.«
»Das mit dem Vater tut mir leid. Etwas sehr Schlimmes?«
»Weiß ich nicht genau. Sie ist sofort los. Bestimmt irgendwas wegen der vielen Qualmerei.«
»Deswegen warst du allein mit zwei Plastikbechern unterwegs?«, fragte ich.
»Ja, aber dann kamst ja du. Hoffentlich nicht das letzte Mal heute Nacht.«
Ich überhörte die Bemerkung galant. Wenn sie in dieser Geschwindigkeit weiter Wein und Sekt tankte, würde sie höchstens noch bis zu ihrem Bettvorleger kommen.
»Bist du mit deinem VW da?«, fragte sie noch.
»Nein. Wir sind mit der Bahn gekommen«, gab ich zurück.
»Aber du arbeitest doch bei VW?« Sie hatte inzwischen einen Pegel erreicht, der das logische Denken außer Betrieb gesetzt hatte.
»Na ja, wenn du in einem Jeansladen arbeitest, kannst du ja trotzdem in einem schwarzen Wollkleid Silvester feiern, oder?«
Sie starrte mich entgeistert an.
»Ich arbeite in keinem Jeansladen.«
»Ich glaube, du gehörst ins Bett«, stellte ich fest.
»Genau, das sag ich ja«, meinte sie. »Wir nehmen den Nachtbus.«
Kurze Zeit später hatte sich der Bus durch die Straßen gekämpft, in denen immer noch geböllert wurde. Tonnen an Raketen- und Knaller-Resten lagen auf den Bürgersteigen und in den Rinnsteinen. Immerhin hatte es aufgehört zu regnen. Wir bogen in eine kleine, ruhige Straße ab. Schöne Altbauten ragten neben hohen Erlen in den Nachthimmel. Die Lady hatte sich bei mir untergehakt.
Mein Gewissen klopfte an und beschwerte sich, dass ich das Mädchen nur ausnutzen würde.
Ich nahm ihr den Schlüssel aus der zittrigen Hand und öffnete die Wohnungstür.
»Da ist das Bad, und da ist mein Zimmer.«
»Also ist das das Zimmer deiner Mitbewohnerin?« Ich deutete auf eine Tür. Sie nickte.
»Ihr Vater ist im Krankenhaus. Bringst du mich ins Bett?« Ich half ihr, das schwarze Kleid auszuziehen, warf einen nicht ganz kavaliersmäßigen Blick auf ihre rosafarbenen Dessous und deckte sie zu. Dann stand ich von der Bettkante auf. Sie sagte noch, sie habe sich das irgendwie anders vorgestellt. Ich strich ihr kurz über die verschwitzte Stirn, machte das Licht aus und sah mich in der Wohnung um. Im Wohnzimmer gab es zwei Sessel, aber keine Couch. Ich hätte mich auf den Dielenfußboden legen können. Die Schulter der Frau im Nebenzimmer war gewiss weicher. Dann tat ich etwas, was ziemlich dreist, aber meiner Müdigkeit geschuldet war. Ich ging in das Zimmer der Mitbewohnerin, zog die Gardine zu, mich aus und legte mich in die grau-weiß karierte Bettwäsche.
Mein Handy piepste: »Hey, Prost Neujahr. Alles okay bei dir? Daniel.« Immerhin war ihm aufgefallen, dass er eigentlich noch jemanden im Schlepptau hatte. Ich tippte eine Nachricht und war froh, dass ich die kleinen Tasten einigermaßen traf.
»Bn untrgkommn. Sie heißt …«
Ja, wie hieß sie eigentlich? Am Klingelschild hatte »Lindow« gestanden. Aber ihren Vornamen hatte sie mir tatsächlich nicht verraten.
»Duhu?« Die Tür öffnete sich langsam, und die etwas verwuschelte Gastgeberin erschien im Türrahmen.
»Du kannst auch zu mir kommen!«, sagte sie. Im Leben hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass sie sich noch einmal in die Senkrechte würde befördern können.
»Das ist wirklich lieb von dir, auch dass ich hier sein kann. Aber lass uns lieber schlafen, okay? Gute Nacht.«
»Schade«, meinte sie und tapste wieder zurück in ihr Zimmer. Die Frau hatte Stehvermögen, stellte ich grinsend fest. Dieser Abend war ganz anders verlaufen, als ich es mir ausgemalt hatte. Während Daniel sich durch unsere angemieteten Hotelbettlaken kämpfte, nahm ich das Angebot, das sich mir präsentierte, nicht an. Von einer Dame, die ehrgeizig am Ball blieb. Denn kurz darauf ging die Zimmertür wieder auf.
Lou
Juni 2019
Der Reißverschluss klemmt. Der verdammte, verschissene Reißverschluss des sauteuren Hosenanzugs.
»Macht ja nichts. Ist ja nur meine Abifeier!«, schreie ich und bin kurz davor, mir die ganze Klamotte in Fetzen vom Körper zu reißen.
»Okay«, höre ich meine Mutter mantramäßig wiederholen. »Wir flippen nicht aus, wir haben alles im Griff.«
Sie ist in mein Zimmer geeilt und zieht sich noch schnell ein weinrotes Seidenkleid über den Kopf. Ohne Reißverschluss. Ich fühle mich provoziert.
Gleich gibt sie bestimmt diese Besserwisser-Sprüche von sich: »Habe ich dir doch gesagt, dass du den Reißverschluss noch einmal bei plus 18,5 Grad mit linksdrehenden Meeresalgen einfetten musst«, oder irgend so was Schwachsinniges. Zum Glück sagt sie nichts dergleichen.
»Ich raste aus!«, kündige ich stattdessen an.
»Ja, kannst du gerne, morgen zum Beispiel. Heute nicht. Heute kriegen wir das Ding einfach zu.«
Vorsichtig ziehe ich die eine Seite des Anzugs straff, während meine Mutter am Reißverschluss herumzuppelt. Ich spüre, dass das böse enden wird.
»Neein, das geht kaputt, so geht das nicht!«, schreie ich hysterisch. Dabei hasse ich die hyperventilierenden Mädchen aus meiner Stufe. Die schon Schnappatmung kriegen, wenn der Kajalstift mal verschmiert ist. Ich habe mein Abi in der Tasche, will bald in Spanien mit einem Kind und Windeln jonglieren und danach in Amsterdam Psychologie studieren. Von Letzterem weiß Mama noch nichts. Die Sache mit Madrid hat sie ja schon komplett aus dem Konzept gebracht. Ähnlich wie mich der klemmende Reißverschluss.
»Können wir helfen?« Mein Vater und mein Opa stecken ihre Köpfe zur Tür hinein.
»Ja, Papa!«, sagt meine Mutter mit sehr ironischem Unterton. »Du könntest mal eben mit einem Kreuzstich den Hosenanzug deiner Enkelin retten.
»Eine meiner einfachsten Übungen«, erwidert er. »Ist das stricken, häkeln oder backen?«
»Opa! Mann, ey! Nervt nicht.«
Die Lage ist ernst, und das merkt jetzt auch meine Familie.
»Zeig mal!« Papa schaut meiner Mutter über die Schulter, die immer noch versucht, den Schließer über die eine verdrehte Zacke zu ziehen.
»Oh nein!«, sagt meine Mutter und stöhnt auf. Wenn das passiert ist, was ich gerade befürchte, dann kann ich mich auf der Stelle begraben.
»Hast du nicht noch dieses hübsche Kleid, das du zur Einschulung getragen hast?«, fragt Papa und versucht ein schiefes Grinsen.
»Nicht euer Ernst!«, rufe ich. Oh doch, der Reißverschluss ist hin.
»Hol mal bitte Mama«, scheucht meine Mutter Opa in Richtung Wohnzimmer. Aber Oma habe ich schon seit einer Stunde nicht mehr gesehen.
»Sie ist noch beim Friseur«, erklärt er.
»War sie da nicht erst vorgestern?«
»Ja, natürlich!«, antwortet er und zuckt mit den Schultern. »Den Friseur sieht sie öfter als mich. Während er ihr die Haare legt, liege ich auf der Couch. Ist mir nur recht. Soll ich was machen?«
»Ja, mach die Zigarette aus. Bitte!« Mich nervt der Gestank. Ich finde das Verhalten meines Großvaters gemeingefährlich. Dass Opa Mama früher durchgehend in der Wohnung und im Auto vollgequalmt hat, finde ich einen echten Skandal. Dafür würde ich ihn heute wegen Kindesmisshandlung anzeigen!
»Ich war ja auf dem Balkon«, verteidigt Opa sich. »Dann habt ihr so geschrien, da musste ich doch kommen.«
»Markus, du musst zu deiner Freundin!« Mama wirft Papa verschwörerische Blicke zu.
»Zu wem?« Er schaltet nicht gleich. Dabei weiß ja sogar ich, wen Mama meint. Sie wohnt direkt unter uns und ist die neugierigste Nachbarin zwischen Eppendorf und der Elfenbeinküste: Beate Hoffmann. Sie hat ein Auge auf meinen Vater geworfen, lauert ihm sogar im Treppenhaus auf, was dieser hartnäckig ignoriert. Kein Wunder, sie ist eine graue Maus, die mit Ende fünfzig noch bei ihrer Mutter wohnt. Beate Hoffmann ist so unsexy wie eine schimmlige Scheibe Knäckebrot. Gegen sie ist selbst ihre eigene Mutter ein sambatanzendes Kurvenwunder.
»Du weißt, wen ich meine. Sie soll ihre Nähmaschine anwerfen und den Reißverschluss austauschen. Wir brauchen den Anzug in …«, Mama blickt auf die Uhr in meinem Zimmer, »… exakt acht Minuten.«
Papa verdreht die Augen und hofft, dass ich es nicht bemerke.
»Geh du doch runter!«, schlägt mein Vater vor.
»Dann kann Lou das gute Stück nicht vor der Rente anziehen. Für mich rührt sie doch keinen Finger.«
»Das stimmt, Papa, sie kann Mama nicht ab.«
»Was? So schlimm?«, fragt meine Mutter und wirkt tatsächlich etwas gekränkt.
»Hast du doch selbst gesagt«, schnauze ich meine Mutter an. »Was soll das jetzt. Wir müssen gleich los. Oder soll ich nackt gehen?«
»Auf keinen Fall!«, ruft Papa, winkt mir zu, den weinrotweiß gestreiften Anzug auszuziehen. Opa dreht sich um. Mich in Unterwäsche zu sehen, würde ihm wahrscheinlich einen weiteren Herzinfarkt bescheren.
»Sonst kauf ich ihr einfach einen neuen«, schlägt er vor. »Wo ist der hier denn her? Von C&A? Dann geh ich schnell rüber.«
Mama und ich verdrehen die Augen.
»Papa, C&A gibt es hier schon etwa seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr.«
»Opa, das hab ich im Internet bestellt, das kannst du nicht mal eben neu kaufen. Das kriegt die Hoffmann nie hin.«
»Die Hoffmann kriegt alles hin. Die hängt an der Nadel«, spricht Mama mir Mut zu. Finde ich nett von ihr, dass sie das Positive an Beate Hoffmann betont, denn die lästert, wo und wann es nur geht, über meine berufstätige, viel reisende Mutter.
Das hat mich früher echt auf die Palme gebracht. Meine Mutter kann zwar nerven wie ein ganzer Mückenschwarm, aber niemand darf sie so unverschämt und unbegründet beleidigen.