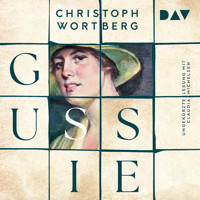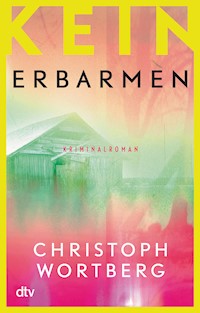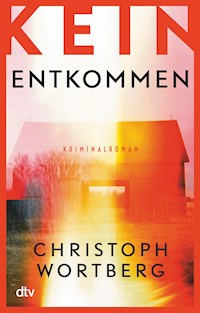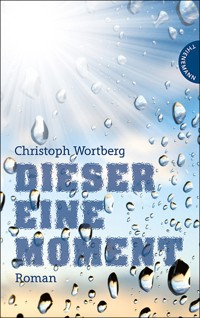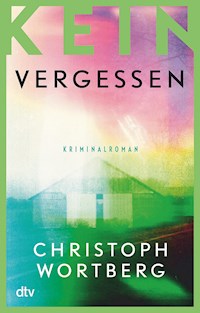
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Trauma-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Katja Sands zweiter Fall ist Spannung pur Die Münchner Hauptkommissarin Katja Sand und ihr Assistent Rudi Dorfmüller ermitteln im Fall der ermordeten Rentnerin Selma Kiefer. Der Körper der ehemaligen OP-Schwester wurde postmortal grausam verstümmelt. Nach vierzig Ehejahren hat sie sich von ihrem gewalttätigen Ehemann Josef scheiden lassen und ihn wegen Körperverletzung angezeigt. Hat ihr Exmann sie ermordet, um einer drohenden Verurteilung zu entgehen? Katja bittet den Psychoanalytiker Dr. Alexander Hanning um Hilfe. Hanning schließt auf einen Täter mit einem gestörten Verhältnis zu seinem Körper und seiner Sexualität. Seine Analyse führt Katja zu dem kürzlich entlassenen Serienmörder Franz Bichler. Der Mord an Selma Kiefer gleicht bis ins Detail den von ihm verübten Taten. Hat er seine Serie wieder aufgenommen? Der ehemalige Kinderchirurg Professor Thomas Goldt wird ermordet aufgefunden, auf die gleiche Art geschändet wie Selma Kiefer. Aber als Mann passt er nicht in Bichlers Mordmuster. Auf der Suche nach einer Verbindung zwischen den Morden stößt Katja auf einen Abgrund aus ärztlicher Selbstherrlichkeit. Und plötzlich ergeben die Verstümmelungen der beiden Toten einen ganz neuen, grausamen Sinn.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
CHRISTOPHWORTBERG
KEIN VERGESSEN
Katja Sands zweiter Fall
Kriminalroman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
Robert Frost:Stopping by Woods
on a Snowy Evening
Erster TeilER
All die Jahre, in denen alles wie hinter einem Schleier lag. Als wären deine Augen seit dem ersten Tag deines Lebens mit Trübheit überzogen. Mit deinen winzigen Händen hast du versucht, sie aus deinen Augen herauszureiben, und sie nur tiefer hineingerieben. Also hast du damit aufgehört. Hast still und reglos in deiner Wiege gelegen und deine übrigen Sinne geschärft. Dein Hören, dein Riechen, dein Schmecken. Alles wurde überdeutlich, jeden Tag ein wenig mehr. Die Stimmen deiner Eltern, wenn sie dir Kindergeschichten vorlasen, der Geruch ihrer Körper, wenn sie dich in ihren Armen wiegten, der Geschmack ihrer Küsse, wenn sie dich in dein Gitterbett legten und dir eine gute Nacht wünschten. Ihre Stimmen klangen trügerisch, ihr Geruch war vergiftet, ihre Küsse schmeckten nach Verrat.
Du hättest so gerne erfahren, wo das alles herkam und was es bedeutete, aber du hast keine Erklärung bekommen. Nicht damals, nicht später. Deine Eltern haben dich alleingelassen mit deinen nicht gestellten Fragen. Die Welt hat dich alleingelassen.
Dann hast du die Narbe entdeckt. Oberhalb deiner Scham. Eine winzige gerötete Linie, verhärtete Haut, die Finger deiner Kinderhand strichen darüber hinweg, ein Gebirge aus verwachsenem Gewebe, wenige Zentimeter lang, jede Berührung wie ein kleiner elektrischer Schlag.
Was ist das, hast du deine Mutter gefragt, was hab ich da? Nichts, hat sie gesagt, gar nichts. Bloß ein Messer, mit dem du dich geritzt hast. Ein dummer Unfall. Du hast ihr geglaubt. Und es vergessen.
Du bist größer geworden. Dein Körper ist gewachsen, du kamst in die Schule. Und immer hast du versucht, deiner Verlassenheit zu entkommen, deine Einsamkeit zu vergessen, dein Anderssein zu unterdrücken. Die wenigen Freunde, die du gewinnen konntest, galten dir als Beweis, dass du nicht allein warst. Du dachtest: Alles ist gut. Was hättest du auch sonst denken sollen?
Hier und da gab es noch immer diese Momente der Fremdheit, diese überwältigenden Augenblicke des Verlorenseins. Aber das waren nur kurze, schmerzhafte Stiche in deiner Brust, dann war es wieder vorbei.
Du hast dir eingeredet, ein Kind unter anderen Kindern zu sein, fröhlich und ausgelassen wie sie. Du hast dich ihnen angepasst, bist unsichtbar geworden zwischen ihnen, hast dich unter ihnen aufgelöst.
Aber dann begann dich dieser Albtraum aus dem Schlaf zu reißen, einmal, zweimal, immer wieder und immer derselbe.
Du liegst auf einem Bett mit Rollen, dein Körper ist festgeschnallt, deine Hände ertasten kaltes Metall. Du weißt nicht, wie alt du bist, drei Monate oder sechs Jahre, du bist Neugeborenes und kleines Kind zugleich.
Sie schieben dich durch einen Flur. Ihre Gesichter sind hinter Masken verborgen, ihre Körper stecken in grünen Kitteln. Sie starren dich an. Du weichst ihren Blicken aus, versuchst dich mit den Augen an den Leuchtstoffröhren über dir festzuhalten. Das Licht blendet dich, dir wird schwindlig. Ihre Schritte auf dem Linoleumboden verursachen ein quietschendes Geräusch, genau wie die Rollen unter deinem Bett.
Du wirst in einen Aufzug geschoben. Die Wände sind mit matt schimmernden Metallplatten verkleidet. Du kannst das Schließen der Türen hören, ein leichter Ruck, dann geht es abwärts, ein Stockwerk, vielleicht zwei, hinunter in die Hölle.
Ein Raum, der mehr ein Saal ist, gleißend hell, das Licht brennt dir weiße Flecken in die Augen. Du liegst jetzt auf einem stählernen Tisch. Ihre Hände auf deinem Körper, eine Nadel, die dir in den Arm sticht, eine transparente Kunststoffmaske, die dir auf Mund und Nase gepresst wird. Dein hilfloser Versuch, das Atmen einzustellen, um nicht einzuatmen, was da durch einen Schlauch in die Maske strömt. Aber dein Atemreflex ist stärker als dein Wille. Also atmest du doch ein, wieder und immer wieder, bis das grelle Licht und die gekachelten Wände eins werden, bis sich die Gesichter über dir auflösen, ineinander verschwimmen, bis alles verschwimmt und du das Bewusstsein verlierst.
Das denkst du jedenfalls. Aber dann begreifst du, dass du gar nicht bewusstlos bist. Du hast einfach nur deinen Körper verlassen. Du schwebst jetzt über ihnen, schaust verwundert auf sie herab, wie sie über dich gebeugt dastehen mit ihren Masken und den grünen Kitteln, sie streichen eine rostrote Flüssigkeit auf deinen entblößten Bauch. Du siehst das alles, aber du fühlst nichts.
Die Klinge eines Skalpells blitzt auf, schneidet dich in zwei Teile. Stählerne Spreizer ziehen dein klaffendes Inneres auseinander, Klammern auf blutenden Gefäßen.
Du betrachtest das Massaker unter dir, als hätte es nichts mit dir zu tun. Du bist ganz nah und unendlich weit entfernt, kein Du mehr und also kein Ich, nur stummes Staunen.
Das Skalpell tanzt über das rote Schlachtfeld, bis es sein Ziel erreicht hat. Zwei, drei präzise Schnitte, dann ist es vorbei. Eine Zange fährt in dich hinein, sucht Halt in deinem blutigen Leib, findet, was sie gesucht hat, und zieht es langsam heraus. Du starrst auf das, was die Zange aus dir herausgezogen hat, und weißt: Das da, dieses blutende kleine Etwas aus Fleisch, Knorpel, Gewebe, das bin ich. Alles, was ich je war und je hätte werden können.
Auch wenn du nicht verstehen kannst, was da gerade mit dir passiert, ist dir in diesem Moment eines ganz klar: dass du ab jetzt eine offene Wunde sein wirst, für immer zerschnitten, auf ewig verstümmelt.
Im selben Moment verwandelt sich deine Fühllosigkeit in Schmerz und Trauer, die du nicht abstreifen kannst. Tief, brennend und alles verzehrend. Du reißt deinen Mund auf. Du schreist, wie du noch nie geschrien hast. Aber dein Schrei bleibt stumm, verhallt ungehört in dieser Hölle aus Blut und Licht und glänzendem Metall.
Jedes Mal an dieser Stelle des Traumes bist du aufgewacht, schweißnass und verwirrt. Der Schmerz, die Zange, dein Schrei. Du wusstest nicht, was das Skalpell aus dir herausgeschnitten hat, was die Zange ins gleißende Licht befördert hat, du wusstest nur: Es gibt mich nicht mehr.
1
Vor ein paar Tagen hat es geschneit. München liegt unter einer weißen Hülle. Die Gehsteige freigekehrt, mit Split bestreut. Die großen Straßen in der Innenstadt geräumt, der Schnee an den Rändern zu Haufen zusammengeschoben. Weiter draußen, in den Villengegenden der Wohlhabenden, in Bogenhausen, Grünwald oder Harlaching, bedeckt der Schnee noch immer den Asphalt, knirscht unter den Reifen der Autos oder den Sohlen der Anwohner, die ihre Hunde ausführen. Der Winter ist da.
Der Altbau, in dem Katja Sand mit ihrer Tochter Jenny lebt, liegt in der Sternstraße im Lehel, zwischen Prinzregentenstraße und Julianstraße. Weite Räume, hohe Decken, weiß lackierte Kassettentüren. Ein honigfarbener Parkettboden, der knarzt, wenn man darübergeht. Ein Geräusch, das sich nach zu Hause anhört.
Das Lehel ist eine teure Gegend. Wer hier lebt, hat es geschafft. Seit dem Tod ihres Vaters gehört das Haus Katjas Mutter. Mit ihrem Gehalt als Hauptkommissarin bei der Münchner Mordkommission könnte Katja sich eine solche Wohnung sonst niemals leisten.
Sie liegen zusammen auf dem Sofa im Wohnzimmer, unter einer Wolldecke, warm und behaglich. Katja und Jenny, eine Mutter und ihre fünfzehnjährige Tochter. Der Fernseher läuft, sie schauen gemeinsam eine Serie. Sonntagabend, der Ausklang eines gemeinsam verbrachten Wochenendes.
Katja schließt die Augen, lässt sich davontreiben, die Stimmen der Schauspieler im Fernseher sind jetzt ganz weit weg. Jennys Kopf in ihrer Armbeuge, der Duft ihrer Haare, jung und frisch, sie würde am liebsten ewig so liegen bleiben.
Ein Summen vom Couchtisch holt sie zurück in die Wirklichkeit. Jennys Hand schnellt unter der Decke hervor, aber ihr Arm ist zu kurz. Sie muss sich aufrichten, um das Handy zu erreichen. Ihr Ellenbogen presst sich schmerzhaft in die Rippen ihrer Mutter, Katja schreit leise auf.
»Entschuldige, Mama.«
»Nichts passiert«, sagt Katja. »Alles gut.«
Sie erhascht einen Blick auf das Display. Eine WhatsApp-Nachricht. Der Name des Absenders versetzt ihr einen Stich: Nichts ist gut!
Jenny legt das Smartphone zurück auf den Couchtisch, schaut hinüber zum Fernseher. Sie wirkt aufgewühlt, will sich aber nichts anmerken lassen. Eine belanglose Unterbrechung, nichts weiter. Keine Erklärung, kein Kommentar. Als wäre alles wie vorher, die Decke warm und behaglich über sie gebreitet. Aber die Innigkeit zwischen ihnen ist verschwunden. Wie weggeblasen, von einer Sekunde zur anderen.
»Alles okay?«, fragt Katja.
»Alles super«, sagt Jenny.
Eine Lüge. Katja kann es spüren.
»Was ist los mit dir?«
»Nichts.«
»Jetzt komm schon.«
»Können wir bitte weiterschauen?«
»Wer war denn das?«
»Niemand!«
Katja weiß, dass es besser ist, nicht weiter darauf herumzureiten. Die letzten Monate waren nicht leicht. Was passiert ist, hat ihnen beiden wehgetan. Aufgebrochene Wunden, Vertrauen, das sich in Fremdheit verwandelte. Es hat lange gedauert, zu ihrer alten Verbundenheit zurückzufinden, noch immer ist sie zerbrechlich.
Jetzt kann von Verbundenheit keine Rede mehr sein. Sie liegen da, unter der Wolldecke, starren schweigend auf die bewegten Bilder vor sich.
Die Schauspieler gehen Katja auf die Nerven. Puppenhafte Bewegungen, aufgesagte Dialoge, die Kulissen wie aus Pappe. Eine künstliche Handlung in einer künstlichen Welt.
Als endlich der Abspann läuft, drückt sie auf den roten Knopf der Fernbedienung. Schweigen macht sich zwischen ihnen breit, lähmende Sprachlosigkeit.
Das Warten auf das Zerplatzen des Knotens, denkt Katja, genau wie in einem Verhör. So wie sie es gelernt hat. Erst auf der Polizeischule, später im Job. Die Situation kontrollieren, ohne dass der Verdächtige es merkt. Geduldig sein, den längeren Atem haben. Abwarten, bis das Gegenüber die Stille nicht mehr erträgt.
Sie muss nicht lange warten.
Jenny löst sich aus ihrer Umarmung und setzt sich auf. »Das war Papa«, sagt sie leise.
Papa! Ein Wort, an das Katja sich nicht gewöhnen kann. Jedes Kind hat ein Recht auf seinen Vater. Für Jenny gab es keinen. Fünfzehn Jahre lang musste sie auf ihn warten. Immer wieder ist Katja ihren drängenden Fragen ausgewichen. Bis die Fragen seltener wurden und schließlich ganz aufhörten.
Sie hat sich den Grund für ihr Ausweichen schöngeredet. Sie wollte Jenny vor der Wahrheit beschützen und hat doch nur sich selbst beschützt. Ein Verschweigen, das eine Lüge war. Das Märchen vom unbekannten Vater. Bis schließlich alles aufgeflogen ist.
Katjas Mutter war mit Jenny für ein paar Tage an den Gardasee gefahren. Das Delfino in Sirmione. Dasselbe Hotel, in dem Katja und sie früher ihre Urlaube verbracht hatten. Maria und Luigi, Spaghetti Vongole oder selbst gemachte Gnocchi. Rund geschliffene Kiesel am Strand, das Zirpen der Grillen im Gras. Der junge Francesco aus Parma, seine Hand auf ihrer Brust, ihr erster Kuss.
Jahre danach war Katja mit Peter da gewesen. Ihre große Liebe, der Traum einer gemeinsamen Zukunft. Aber alles war anders gekommen als geplant, der Traum war zerplatzt. Keine Hochzeit, keine gemeinsame Familie, kein gemeinsames Haus. Schwanger mit Jenny, hatte Katja sich von ihm getrennt. Überraschend und ohne jede Erklärung.
Und dann, fünfzehn Jahre später, auf der Terrasse des Delfino, hat Luigi sich bei Jenny nach Peter erkundigt. Völlig arglos, im Glauben, dass Katja ihn damals geheiratet hat. Plötzlich war da dieser Name. Und mit dem Namen tauchte der so schmerzlich vermisste Vater wie aus dem Nichts auf. Jenny löcherte ihre Großmutter so lange, bis sie das Geheimnis preisgab: Peter Schäfer, ein ehemaliger Kollege von Mama, Mordermittler wie sie, der damals München verlassen hatte und jetzt in Augsburg lebte.
Jenny war heimlich aus dem Delfino verschwunden und mit dem Zug nach Augsburg gefahren, um ihren Vater kennenzulernen. Katja hatte versucht, das Treffen zu verhindern. Und sich am Ende neben Jenny auf der Terrasse von Peters Haus wiedergefunden, während seine Frau Alina Pflaumenkuchen servierte und ihre beiden kleinen Kinder im Pool plantschten.
Peter hatte Jenny zu einem gemeinsamen Urlaub nach Südfrankreich eingeladen. Das Ferienhaus seiner Schwiegereltern in der Nähe von Nizza. Jenny war begeistert gewesen, aber die Sache war schiefgelaufen. Weinend hatte sie ihre Mutter in München angerufen. Katja war zu ihr geflogen, mit einem Mietwagen waren sie nach Spanien weitergefahren.
Eine Mutter und ihre Tochter, zwei Wochen in den Pyrenäen, sie waren sich so nahegekommen wie selten zuvor. Der Versuch, die Vergangenheit von ihren Schatten zu befreien. Das Glück in Jennys Augen, die endlich einen Vater hatte, die Stiche in Katjas Brust.
»Was wollte er denn?«, fragt sie mit derselben gespielten Beiläufigkeit, mit der sie in Verhören Tatverdächtige aus der Reserve lockt. Sie hasst sich dafür. Das hier ist ihre Tochter.
»Er will wissen, ob ich schon mit dir geredet habe«, sagt Jenny.
»Worüber?«
Jenny weicht ihrem Blick aus, schaut auf ihre Hände. Dasselbe Muster wie in Katjas Verhören. Der Wunsch, sich zu erleichtern, die Angst vor den Konsequenzen.
»Worüber?«, wiederholt Katja ihre Frage.
»Weihnachten«, sagt Jenny.
Katja ist verblüfft. »Er will wissen, ob du schon mit mir über Weihnachten geredet hast?«
»Ja.«
»Wie kommt er denn darauf?«
Jenny zögert mit der Antwort. »Er hat mich vor ein paar Tagen angerufen.«
»Und?«
»Wir haben gequatscht. Über Alina und die Kinder. Wie’s ihnen geht und so. Belangloses Zeug. Was man eben so redet am Telefon.«
»Ein Vater und seine Tochter«, entfährt es Katja. Unkontrolliert, ohne vorher zu überlegen. Sie merkt, dass sie bitter klingt. Der Neid auf eine Vertrautheit, von der sie ausgeschlossen ist.
»Bist du eifersüchtig, Mama?«
Ja, bin ich, denkt Katja. Jenny braucht einen Vater, aber Katja gönnt ihn ihr nicht. Nicht diesen Vater, den sie mehr geliebt hat als jeden anderen Mann. Was sie nie zugeben würde.
Also fragt sie: »Worauf sollte ich eifersüchtig sein?«
»Dass ich mit ihm telefoniere. Dass wir quatschen, miteinander reden. Dass er mir was bedeutet.«
»Ich dachte, wir hätten das längst geklärt.«
»Dachte ich auch.«
Nichts ist geklärt, denkt Katja. Alles läuft in die falsche Richtung. Ich kenne die richtige und biege trotzdem immer wieder falsch ab. Von einer Sackgasse in die nächste.
Sie weiß, dass es besser wäre, nicht weiterzubohren, aber das kann sie nicht.
»Und das war alles?«, fragt sie.
Jenny zögert mit der Antwort.
»Also nicht alles«, sagt Katja.
»Nein«, sagt Jenny. »Es ging um Heiligabend. Er würde sich freuen, wenn wir ihn und Alina und die Kinder besuchen würden, du und ich.«
»Er will Weihnachten mit uns feiern?«
»Es war nur ein Vorschlag, nicht mehr. Einfach so eine Idee.«
Einfach so eine Idee, denkt Katja. Der Gedanke ist ihr so vollkommen fremd, dass sie nicht weiß, was sie dazu sagen soll. Das Schlimme daran: Wahrscheinlich hat Peter sich nichts dabei gedacht. Oder, schlimmer noch: Er hat nur an sich gedacht. Telefoniert mit Jenny und stellt sich vor, wie er den Weihnachtsmann spielt, für seine zwei kleinen Kinder und die neue große Tochter.
Seine Frau weiß bestimmt noch gar nichts davon. Vielleicht plant er, sie damit zu überraschen, ohne jede Rücksicht auf ihre Gefühle oder die von Katja. Kann sein, dass er einen auf moralisch macht: Sie gehört zu mir, Schatz, wie die beiden Kleinen, sie ist meine Tochter. Oder er appelliert an ihre Großzügigkeit: Weihnachten ist nur einmal im Jahr, Liebes!
Peter Schäfer, der schon immer alle begeistert hat, die er begeistern wollte. Der Menschen fangen kann wie kein zweiter. Und sie dann für seine Zwecke benutzt.
Katja unterdrückt den Groll, der in ihr aufsteigt. Wer seinem Kind jahrelang den eigenen Vater verschweigt, hat kein Recht darauf, sich einzumischen.
»Und was sagst du dazu?«, fragt sie.
»Weiß nicht«, sagt Jenny. Und nach einer kurzen Pause: »Außerdem sind wir ja beide eingeladen.«
Sie will nicht zwischen Peter und mir stehen, denkt Katja, ich soll ihr die Entscheidung abnehmen.
Heiligabend war immer ein Tag nur für sie beide. Selbst Katjas Mutter muss sich schon seit Jahren mit einem Weihnachtsessen am ersten Feiertag abfinden. Heute ist der dritte Advent. Wenn sie Peters Vorschlag zustimmt, wird Jenny die Tage zählen, wenn sie ablehnt, wird das ganze Fest versaut sein. »Ich finde, das kommt alles ganz schön plötzlich«, sagt sie. »Und ziemlich spät.«
»Du willst also nicht«, erwidert Jenny.
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Das musst du nicht sagen, das merke ich auch so.«
Katja fühlt sich in der Falle. Ein dunkler See voller Strudel und Untiefen, und sie schwimmt mit Ausflüchten und Halbwahrheiten auf der Oberfläche herum. Versteckt sich hinter ihrer Direktheit, spielt Offenheit vor und hütet doch nur ihr Geheimnis. Die Grenze, die keiner überschreiten darf, nicht mal sie selbst.
»Ich hab nicht Nein gesagt.«
»Aber gemeint.«
Jenny hat sich zu ihr umgedreht, funkelt sie wütend an, ihr Gesicht keinen Meter von Katjas entfernt. Ihre grünen Augen, das lange braune Haar. Ihre klaren Züge, die nichts verstecken können. Im Gegensatz zu Katja, die gelernt hat, zu verbergen, was sie fühlt. Die ihren Job nicht machen könnte, wenn es anders wäre.
Auf dem Esstisch die Schale mit den Vanillekipferln, die sie am Nachmittag gemeinsam gebacken haben. Daneben der Adventskranz mit den drei brennenden Kerzen, die vierte noch unberührt. Alles war gut. Die Harmonie eines späten Sonntagabends im Dezember. Sie hat sich gefühlt wie damals, als Jenny noch klein war und es nur sie beide auf der Welt gab, eine Mutter und ihre Tochter, eine glückliche kleine Familie. Jetzt ist Peter dazugekommen.
Auch wenn er eine eigene Familie hat, kommt es ihr vor, als würde er ständig dabei sein, auch jetzt. Als würde er zwischen ihr und Jenny sitzen, auf dem skandinavischen Sofa, das sie im Internet ersteigert und neu bezogen hat, unter seinen Füßen der Kelim, den sie von einer Urlaubsreise mitgebracht hat, um die Hälfte heruntergehandelt in einem Basar im tunesischen Sousse. Jenny trug an dem Tag ihr Lieblingskleid aus gestreifter Baumwolle, weiß und blau, ein dreijähriges Kind, das immer alles anfassen wollte, die Haare von der Sonne ausgebleicht.
»Wir müssen uns deswegen nicht streiten«, sagt Katja und fühlt sich plötzlich müde und ausgelaugt. Sie will doch nur, dass Jenny glücklich ist, nicht mehr und nicht weniger. Sie hat geglaubt, die Sache mit Peter würde sich schon irgendwie regeln. Aber sie hat sich nicht geregelt. Er steht zwischen ihnen, die ganze Zeit, und sie kann ihrer Tochter nicht erklären, warum er zwischen ihnen steht, weil das alles zerstören würde.
»Du weichst mir aus«, sagt Jenny, »immer weichst du mir aus.«
»Das stimmt nicht.«
»Doch, Mama. Seit ich denken kann.«
»Ich möchte nur ein bisschen Zeit, um drüber nachzudenken. Heiligabend ist doch nicht irgendein Tag.«
»Und schon wieder eine Ausrede«, sagt Jenny traurig. Von Wut keine Spur mehr.
»Es ist eine Menge passiert im letzten halben Jahr.«
»Oma hat kein Problem damit. Und Papa auch nicht.«
»Dann bin ich wohl die Einzige.«
Wieder so ein falscher Satz, auch wenn er stimmt. Ein Satz, der sich nach Selbstmitleid anhört, obwohl er nicht so gemeint ist. Katja bereut ihn sofort.
»Jetzt hör mal zu«, sagt Jenny, und die Wut kehrt in ihr Gesicht zurück. »Du hast mir fünfzehn Jahre lang verschwiegen, wer mein Vater ist. Du hast ihn einfach verlassen, ohne jeden Grund. Aus deinem Leben geworfen, von einem Tag zum anderen. Und ich war in deinem Bauch und konnte nichts dagegen machen. Und dann war ich auf der Welt, und er durfte keinen Kontakt mit mir haben und ich nicht mit ihm. Was nicht schwer war, weil ich ja gar nichts von ihm wusste. Weil du es so wolltest. Und Oma hast du gezwungen, dieses verdammte Spiel mitzuspielen.«
»Ich weiß, dass ich Fehler gemacht hab.«
»Fehler? Das waren keine Fehler, Mama, du hast es komplett versaut. Mein ganzes Leben!«
Ein Urteil, das sich wie eine Hinrichtung anfühlt. Das alles zwischen ihnen infrage stellt. Nicht nur eine Entscheidung war falsch, alle waren falsch. Nicht nur ein Teil ist schiefgelaufen, alles ist schiefgelaufen.
»Ich verstehe ja, dass du sauer bist, aber es fällt mir nicht leicht, mit all dem klarzukommen.«
Jenny springt auf, außer sich, den angespannten Körper merkwürdig verdreht. »Merkst du eigentlich, was du da tust? Es geht hier nicht um dich, kapierst du das nicht? Es geht um mich!«
»Ja, ich weiß.«
»Und um Papa. Um ein kleines bisschen Normalität. Mehr nicht. Aber selbst dieses kleine bisschen ist schon zu viel für dich.«
Sag’s ihr, denkt Katja, jetzt und hier. Sag ihr, was wirklich passiert ist damals, na los, erzähl ihr einfach die ganze Geschichte.
Aber das tut sie nicht. Schweigt stattdessen und ballt die Hände unter der Decke zu Fäusten. Und lässt diesen kostbaren Moment vollkommener Aufrichtigkeit ungenutzt verstreichen, wie sie schon so oft ähnliche Momente ungenutzt hat verstreichen lassen.
»Du lebst gar nicht mit mir zusammen, Mama, du lebst nur in dir selbst«, sagt Jenny in die Stille zwischen ihnen. Kein Angriff mehr, eher eine nüchterne Feststellung. »In dich zurückgezogen. Versteckt. Wie in einem Schneckenhaus.«
Katja spürt ihr Gesicht entgleisen, ihre Wangen, den Mund. In ihrer Brust ein unerträglicher Druck. Sie beneidet Jenny um ihre einfachen, klaren Gedanken, die den Dingen um so vieles näherkommen als die hohlen Phrasen, mit denen sie ihr die Welt zu erklären versucht.
»Schlaf gut, Mama«, sagt Jenny.
»Bleib hier. Bitte!«
»Ich hab morgen ’ne Matheklausur.«
»Also gut«, sagt Katja und merkt, wie ihre Stimme im Hals kratzt. »Heiligabend in Augsburg. Du und ich und Papa mit seiner Familie.«
Jenny schaut sie an, die Augenbrauen zusammengezogen, ein stummes Mustern, ihre Miene enttäuscht. »Du verstehst überhaupt nicht, was ich dir sage, oder?«
Mehr als du ahnst, denkt Katja, und viel mehr, als mir lieb ist.
Wieder ist da dieses Schweigen zwischen ihnen, ein tiefer Graben voller Verletzungen. All die Missverständnisse, das Unausgesprochene. Aber auch der gemeinsame Wunsch, dass alles gut wird.
»Hat eine ziemlich dicke Schale«, sagt Katja.
»Was?«
»Das Schneckenhaus, in dem ich lebe.«
»Jeder lebt in einem«, sagt Jenny, die Lippen zu einem kaum merklichen Lächeln verzogen. Ein Friedensangebot.
»Du auch?«, fragt Katja.
»Ich bin deine Tochter. Wo sollte ich sonst leben?«
»Komm her«, sagt Katja und streckt ihre Arme aus.
Jenny zögert. »Eins muss klar sein«, sagt sie. »Papa gehört jetzt dazu.«
»Ich weiß«, sagt Katja.
»Du musst das akzeptieren, ich kann nicht die ganze Zeit darum kämpfen.«
»Ich geb mir Mühe, das verspreche ich dir.«
Jenny beugt sich zu ihr herunter und umarmt sie. Und Katja hält sie fest, die Nase vergraben in ihren Haaren, sie weiß, dass sie zu fest zudrückt, aber sie kann nicht anders. Sie schließt die Augen. Der Duft nach Jugend, das Gefühl, ihre Tochter nie wieder loslassen zu wollen. Bis sie ein Handy klingeln hört und alles wieder vorbei ist.
»Das ist deins«, sagt Jenny und löst sich aus der Umarmung.
»Lass es klingeln«, sagt Katja.
»Ich wette, das ist Rudi.«
»Und wenn schon.«
»Es ist nach elf, Mama. Der würde nicht anrufen, wenn’s nicht dringend wäre.«
»Seit wann entscheidet mein Assistent, was dringend ist?«
»Mach schon, es liegt auf dem Esstisch.«
Katja schlägt die Decke zurück, schält sich aus den Sofakissen, geht rüber zum Tisch. Sie schaut auf das Display, verzieht das Gesicht.
»Wette gewonnen«, sagt Jenny grinsend.
»Die hätte jeder gewonnen«, sagt Katja und nimmt das Gespräch entgegen.
»Was willst du?«, fragt sie gereizt in ihr Handy.
»Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.«
Dorfmüller liebt es, ab und zu den Scherzbold zu spielen. Heute scheint einer dieser Tage zu sein.
»Rufst du mich mitten in der Nacht an, um mir Reime aufzusagen?«
»Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür.«
»Lass das Gesülze, Rudi!«
»Ich bin das Christkind. Ich stehe vor deiner Tür und mein Wagen im Halteverbot.«
Doch nicht einer dieser Tage!
»Willst du damit sagen …?«
»Von wollen kann nicht die Rede sein. Bleibt mir bloß nichts anderes übrig.«
»Scheiße!«, sagt Katja.
»Ganz deiner Meinung«, sagt Dorfmüller.
2
Dorfmüllers goldfarbener 77er Granada mit dem schwarzen Vinyldach steht mit laufendem Motor in zweiter Reihe, die Warnblinkanlage ist eingeschaltet. Katja schiebt sich zwischen zwei parkenden Autos hindurch auf die Beifahrerseite, steigt ein.
»Da bist du ja«, sagt er, seine fast zwei Meter Körpergröße hinter dem Lenkrad zusammengefaltet.
»Da bin ich«, sagt sie und schlägt die Tür zu. Und verzieht im selben Moment angewidert das Gesicht. Im Wagen herrscht eine unerträgliche Hitze, Dorfmüller hat die Heizung voll aufgedreht. Dazu ein penetranter Geruch, der ihr den Atem verschlägt. Irgendwas zwischen Waschmittel und verdorbenem Obst. »Was zum Teufel ist das?«
»Lavendel-Limone«, sagt Dorfmüller und deutet auf den Duftbaum an seinem Rückspiegel. »Wollte mal was Neues ausprobieren.«
»Auf meine Kosten?«
»Ist noch immer mein Wagen.«
»Kein Grund, mich zu foltern.«
»Jetzt bleib auf dem Teppich. Entspann dich.«
Rudi und seine Duftbäume! Pfirsich-Sherry, Orange-Myrrhe. Er bezieht sie aus dem Ausland. Woher genau, verrät er nicht. Ist auch besser so, denkt Katja. Würde sie den Hersteller kennen, würde sie dem Spuk sofort ein Ende bereiten.
Er schaltet die Warnblinkanlage aus und fährt los. Katja kurbelt die Scheibe herunter, hält die Nase in den Wind, atmet tief durch.
»Und schön wieder hochkurbeln«, sagt Dorfmüller. »Aber ganz schnell!«
»Nix da«, erwidert Katja. »Das Fenster bleibt offen.«
»Soll ich mir den Tod holen? Draußen ist es unter null!«
»Nicht mein Problem.«
»Wie gesagt: mein Wagen.«
»Dann häng das Scheißding ab.«
»Ich denke nicht dran.«
»Und ich denke nicht dran, freiwillig zu ersticken.«
»Das ist Erpressung!«
»Überlebensinstinkt, nichts weiter.«
Der Fahrtwind fährt ihr durch die Haare, die Kälte kriecht ihr in den Körper. Sie wünscht sich zurück in die Behaglichkeit ihrer Wohnung, Jenny und sie, aneinandergeschmiegt unter einer Wolldecke.
Nachgeben kommt nicht infrage. Sie schaut zu Dorfmüller hinüber. Er scheint das genauso zu sehen. Unbeholfen klemmt er seine Oberschenkel unter das Lenkrad, der Granada gerät ins Schlingern. Was ihn nicht im Mindesten zu stören scheint. Die Lippen zu einem schmalen Strich zusammengepresst, steuert er den Wagen jetzt nur mit den Knien, während seine riesigen Hände nach dem Reißverschluss seines Parkas greifen. Ein Bundeswehrmodell mit kleinen Deutschlandfahnen auf den Ärmeln, das er trägt, seit Katja ihn kennt, tagaus, tagein, im Winter wie im Sommer. Was daran liegt, dass er ständig friert. In jeder Jahreszeit.
»Willst du uns umbringen?«, fragt Katja.
»Ich will nicht umgebracht werden«, sagt Dorfmüller. »Nicht in meinem eigenen Auto, nicht von dir, und heute Nacht schon gar nicht!«
Seine Augen wandern zwischen Straße und Reißverschluss hin und her, bis er die Metallkrampen endlich in den Schieber eingefädelt hat und ihn zornig nach oben zieht. Bis zum Kinn. Dann legt er die Hände zurück aufs Lenkrad. Der Granada stabilisiert sich.
Katja hat gewonnen, das Gesicht ihres Assistenten bleibt grimmig. Wenn einer stur ist, dann Dorfmüller. Vor mehr als zwei Jahren hat er sich von Einbruch/Diebstahl in die Mordkommission versetzen lassen. So skeptisch sie ihm gegenüber anfangs war, so wenig kann sie sich inzwischen ihre Arbeit ohne ihn vorstellen.
Sie schaut hinaus in die Nacht. Wenn man der Wettervorhersage glaubt, wird der Schnee nicht lange liegen bleiben. Temperaturen um die fünf Grad, Regen statt Sonne, grauer Himmel statt weiße Weihnachten.
Dorfmüller sagt auch weiterhin kein Wort.
»Bist du jetzt beleidigt?«, fragt Katja.
Die Frage ist überflüssig, natürlich ist er beleidigt.
»Bitte«, sagt sie, »dann musst du eben beleidigt sein.«
Das fahle Licht der Straßenlaternen streicht über den goldfarbenen Granada, die Straßen sind leer, nur vereinzelt kommen ihnen Autos entgegen. Scheinwerfer, die im Vorbeifahren über Dorfmüllers scharf geschnittenen Kopf huschen. Die lichten Stellen unter seinen braunen Haaren, obwohl er erst Anfang dreißig ist, in seinem Gesicht noch immer dieser eingeschnappte Ausdruck.
Die Kälte im Wagen ist inzwischen unerträglich. Also gut, denkt Katja, Kompromiss. Sie kurbelt die Scheibe nach oben, aber nicht ganz. Offen genug, um nicht zu erfrieren, geschlossen genug, um nicht zu ersticken.
»Wo müssen wir hin?«, fragt sie.
»Pasing«, sagt Dorfmüller.
»Was ist passiert?«
»Die in der Zentrale haben gesagt, wir sollen uns warm anziehen.«
»Ich bin warm angezogen. Genau wie du.«
»Die beiden Kollegen von der Streife, die als Erste am Tatort waren, haben gesagt, sie hätten so was noch nie gesehen.«
»Heißt?«
»Der eine hat gekotzt, der andere hat angefangen zu heulen.«
Katja denkt an das, was sie im Laufe ihrer jahrelangen Arbeit als Mordermittlerin schon alles zu sehen bekommen hat. Sie hat nicht ein einziges Mal gekotzt und geheult auch nicht. Aber sich jedes Mal gefragt, wie sie die Bilder, die sich unfreiwillig in sie eingebrannt haben, wieder aus ihrem Kopf kriegt.
Den Schmutz, die Gewalt, das Elend.
Der Anblick eines Toten lässt die Zeit einfrieren. Eine stehen gebliebene Uhr, ein für immer angehaltenes Leben. Es ist nicht der Tod selbst, den man sieht, es ist die Sekunde davor, dieser allerletzte Moment des Übergangs ins Nichts. Das Erschrecken, die Angst, das Verlöschen. Eine vollkommene Einsamkeit. Man schaut auf den fremden Toten vor sich und ist erleichtert, dass man nicht selbst da liegt. Man redet sich ein, dass das Leben weitergeht, und weiß doch, dass man irgendwann selber sterben wird. Und hofft, dass der Moment des eigenen Sterbens ein friedlicher sein wird, begleitet und getröstet von den Menschen, die man liebt.
Jeder Mord ist ein Tod ohne Abschied, denkt Katja, für den Ermordeten genauso wie für die Hinterbliebenen.
»Wissen wir schon was über das Opfer?«, fragt sie.
»Eine alte Frau«, erwidert Dorfmüller. »Rentnerin. Alleinstehend.«
»Wer hat sie gefunden?«
»Eine Nachbarin. Hat sich über die offen stehende Wohnungstür gewundert.«
»Und warum die heftige Reaktion der Kollegen?«
»Weiß ich nicht«, sagt Dorfmüller. »Werden wir sehen.«
Wieder schaut Katja hinaus in die Nacht. Die unbestimmte Ahnung, in der Wohnung der Toten etwas Fürchterlichem zu begegnen. Die unerklärliche Sorge, dass auch sie, genau wie die Kollegen, erschüttert sein wird beim Anblick der Leiche. Sie weiß, dass es unmöglich ist, sich innerlich auf das vorzubereiten, was man an einem Tatort antreffen wird. Weil es jedes Mal ganz anders ist als erwartet. Sie kennt das, sie hat es schon unzählige Male erlebt. Aber diesmal ist das Gefühl stärker als sonst.
Dorfmüller steuert den Granada am Hauptbahnhof vorbei in die Landsberger Straße und weiter über die Agnes-Bernauer-Straße in Richtung Westen. Vorbei an einer Sportanlage und dem Westbad und weiter geradeaus in die Gräfstraße. Zweihundert Meter vor ihnen auf der rechten Seite sieht Katja zwei Streifenwagen, in zweiter Reihe geparkt. Dahinter ein dunkelgrüner Alfa Spider mit beigefarbenem Verdeck. Leah Levy ist also schon da.
Sie steigen aus. Katja hat den Eindruck, dass es draußen wärmer ist als im Granada. Sie merkt, wie durchgefroren sie ist.
Das Haus ist in den 1970er-Jahren gebaut worden. Vier Stockwerke und das Dachgeschoss. Sozialer Wohnungsbau, die üblichen Dreizimmerwohnungen, irgendwas um die siebzig Quadratmeter. Eine kleine Küche, ein innen liegendes Bad und nach hinten raus ein Balkon. Groß genug, um sich nicht gescheitert fühlen zu müssen, zu klein, um sich einzureden, irgendetwas erreicht zu haben. Eines dieser Häuser, in denen man als Mieter jahrzehntelang wohnen bleibt und sich und den Nachbarn Zufriedenheit vorspielt, ein kleines Glück.
»Zweiter Stock«, sagt der uniformierte Beamte, dem Dorfmüller seinen Dienstausweis entgegenhält.
Sie betreten das Haus. Hinter der Eingangstür eine Reihe Briefkästen, daneben die in Folie eingeschweißte Hausordnung und eine Liste mit Notfallnummern. Im Durchgang zur Hoftür steht ein Kinderwagen mit einem Sitzsack aus Lammfell, daneben lehnt ein Schneeschieber. Die Wände sind in einem verwaschenen Hellblau gestrichen, billige Lackfarbe auf Rauputz, das Treppengeländer ist mit schwarzem Kunststoff ummantelt.
Katja folgt Dorfmüller hinauf. Von oben hört sie das papierene Rascheln von Einwegoveralls.
»’n Abend Jungs«, sagt sie und nickt den beiden Kollegen der Spurensicherung zu, die an der Wohnungstür Fingerabdrücke abnehmen.
Keine sichtbaren Einbruchsspuren. Das Opfer muss den Täter freiwillig hereingelassen haben. Oder er besaß einen Schlüssel. Was bedeuten würde, dass die beiden sich gekannt haben.
Sie zieht ein Paar Latexhandschuhe und Papierüberzieher für ihre Schuhe aus der Tasche, streift sie sich über. Dorfmüller folgt ihrem Beispiel. Dann betreten sie die Wohnung.
Genau wie Katja gedacht hat: ein schmaler Flur, an dessen Ende das fensterlose Badezimmer liegt. In der Tür ein Lüftungseinsatz mit Lamellen aus Kunststoff. Zur Straße hin das Esszimmer, dahinter das mit einer Flügeltür abgetrennte Wohnzimmer. Hinten raus eine kleine Küche und das Schlafzimmer.
An der Wand pastellfarbene Strukturtapeten, ein blasses Gelb, ein zartes Beige, vertikale Streifen in einem wiederkehrenden Muster. Am Übergang zur Decke aufgeklebte Schmuckleisten. Falscher Stuck, der Wertigkeit vorgaukeln soll. Auf dem kleinen Garderobentisch aus Kirschholz eine Ladestation mit dem Festnetztelefon, daneben eine Handtasche, ein Paar wollene Damenhandschuhe, eine Strickmütze. Und ein Schlüsselbund mit einem hellgrünen Miniaturtennisball als Anhänger.
»Sie hat Tennis gespielt«, sagt Katja.
Dorfmüller nickt. »TC Pasing«, sagt er und deutet auf ein gerahmtes Foto, das über dem Tisch hängt: eine Gruppe lachender Frauen vor einem Vereinsheim. Alle über sechzig, in Tenniskleidung, Urkunden in den Händen. »›Spiel, Satz, Sieg‹«, liest er die Bildunterschrift vor. »›Danke für vierzig Jahre treue Mitgliedschaft‹.«
»Seit heute nicht mehr«, sagt Katja. »Und mit der Treue ist es auch vorbei.« Und nach einer Pause: »Du hast mir noch gar nicht ihren Namen genannt.«
»Selma«, sagt Dorfmüller. »Selma Kiefer.«
»Wer von denen ist sie?«, fragt Katja mit Blick auf das Foto.
Er greift nach der Handtasche auf dem Garderobentisch. Sie wirkt winzig in seinen riesigen Händen. Er öffnet sie, seine Finger gleiten suchend hinein, ziehen ein Portemonnaie mit Magnetverschluss heraus, braun und abgegriffen, und aus dem Portemonnaie einen Personalausweis. Er hält ihn neben das Foto an der Wand. »Die zweite von rechts«, sagt er.
Katja tritt näher an das Foto heran. Die zweite von rechts. Ein offenes Lächeln unter kurzen grauen Haaren, lebendige Augen, eine energische Nase. Burschikose Züge, irgendwie kantig. Durchaus weiblich, aber darunter eine auffallende Härte.
Eine Frau, die eine Menge durchgemacht hat, denkt Katja, eine, der nicht viel geschenkt worden ist im Leben.
»Wie alt?«
Dorfmüller sucht auf dem Ausweis nach dem Geburtsdatum. »Vierundsiebzig«, sagt er. »Seit einer knappen Woche.«
»Dann hat sie wenigstens noch ihren Geburtstag erlebt«, sagt Katja.
Sie schaut hinüber zum Schlafzimmer, aus dem zwei auf dem Boden kniende Frauenbeine in den Flur ragen. Schwarze Feinstrümpfe mit einer Laufmasche über der rechten Wade, der Saum einer weich fallenden, teuren Hose, hochhackige rote Schuhe, der Gummi darunter schief abgelaufen. Katja fragt sich, wie sie damit das Gaspedal und die Kupplung ihres Alfa Spider bedienen kann, von der Bremse ganz zu schweigen.
»Hallo, Leah«, sagt sie.
Die zu den roten Schuhen gehörende Doktor Leah Levy ist erstaunlich schnell auf den Beinen, nickt Katja und Dorfmüller zu. »’n Abend, ihr zwei.«
Sie ist eine dieser Frauen, deren Alter sich unmöglich einschätzen lässt. Sie könnte Mitte vierzig sein, aber genauso gut auf die sechzig zugehen. Ein zeitloses, waches Gesicht unter schulterlangen, sorgfältig gefärbten braunen Haaren. Die schlanken kleinen Hände stecken in Latexhandschuhen, an den Fingerspitzen klebt Blut. Über ihrer Hose trägt sie ein zweireihiges Jackett, darunter eine Seidenbluse, um den Hals eine Perlenkette. Was Katja verwundert. Sie hat Leah Levy noch nie Schmuck tragen sehen.
Die Rechtsmedizinerin bemerkt ihre Irritation und zuckt mit den Schultern. »Lohengrin«, sagt sie. »Der Anruf kam in der Pause nach dem zweiten Akt.«
»Gute Inszenierung?«
»Lausig. Aber die Sänger waren ausgezeichnet. Immerhin.«
Katja wundert sich erneut. Die Leah Levy, die sie kennt, interessiert sich eher für Jazz als für Opern. Gesellschaftliche Auftritte sind ihr ein Graus. Seit ihrer Rückkehr aus Tel Aviv, wo sie länger, als ihr guttat, eine kinderlose, unglückliche Ehe mit einem israelischen Proktologen geführt hat, gilt ihre Leidenschaft ausschließlich ihren Toten.
»Seit wann gehst du in die Oper?«
»Seit mein israelischer Scheidungsanwalt auf die Idee kam, eine Reise zu seinen deutschen Wurzeln zu unternehmen, und mich als Fremdenführerin durch die ›Hauptstadt der Bewegung‹ engagiert hat.«
»Ein Israeli, der freiwillig Wagner hört?«
»Wie gesagt: deutsche Wurzeln.«
»Dann hat dich der Anruf der Kollegen also gerettet?«
»Sagen wir so: Er kam mir nicht ganz ungelegen.« Sie steht mitten in der Tür, so als wollte sie den Blick auf den Fundort der Leiche verbergen.
Katja schaut über ihre Schulter: Teile einer Schrankwand, das Schlafzimmerfenster, eingerahmt von Vorhängen, dahinter die Nacht. Selma Kiefer liegt auf dem Boden zwischen Bett und Schrank, das Gesicht zur Seite gedreht, die faltige Haut am Hals gespannt. Der Kragen einer weißen Bluse über dem Rundhalsausschnitt eines gelben Pulloves, Lammwolle oder Kaschmir, darunter ein Faltenrock, grün-blau kariert, hochgeschoben, der Saum und Teile des Satinfutters nach außen geklappt, bloßliegende Oberschenkel, übersät mit Besenreisern, ein Netz aus bläulichen Venen.
»Ich würde euch den Anblick gerne ersparen«, sagt Levy.
»Musst du nicht.«
»So was habt ihr noch nie gesehen.«
»Solange du da stehen bleibst, werden wir das nicht beurteilen können.«
Levy tritt zur Seite, gibt die Tür frei. Und mit der Tür den vollen Blick auf die Leiche.
Katja starrt auf den toten Körper von Selma Kiefer, ihren ganzen Körper, und damit auch auf all das, was sie bis jetzt nicht sehen konnte. Sie schließt die Augen. Ein Reflex. Sie will sich vor dem Anblick schützen. Ein Bild schießt ihr in den Sinn, ein Tatort von früher, Jahre her, sie kann sich nicht dagegen wehren: ein Müllcontainer am Ostbahnhof, darin der blutige Torso einer jungen Frau. Ohne Kopf, ohne Arme, ohne Beine. Das Werk eines Wahnsinnigen, ein nie gelöster Fall, der ihren Chef Reinhard Koller über Nacht ergrauen ließ.
Sie hat gehofft, nie wieder etwas Vergleichbares ansehen zu müssen. Jetzt weiß sie, dass ihre Hoffnung sie getrogen hat. Sie zwingt sich dazu, die Augen wieder zu öffnen.
Sie muss hinschauen. Sie hat keine Wahl.
3
Katja merkt, wie sich ihre Schultern verspannen, dann der Rest ihres Körpers. Sie spürt den Wunsch, sich einfach abzuwenden und den Tatort zu verlassen. Und weiß, dass das nicht möglich ist. Man muss sich der Toten annehmen, man darf sie nicht allein lassen, keinen von ihnen, unter keinen Umständen.
Also schaut sie weiter hin, bemüht, ihre Gefühle auszublenden. Sie darf sich davon nicht mitreißen lassen, sie kann sich das nicht leisten, nicht jetzt. Weil sie sonst übersieht, was wichtig ist. Weil ihr sonst das große Ganze entgeht und mit dem großen Ganzen die Details, die winzigen Puzzlesteine, die hoffentlich irgendwann einen Zusammenhang ergeben werden.
Sie muss einen Tatort inhalieren, ihn in sich aufnehmen. Ungefiltert, ohne den störenden Einfluss ihrer persönlichen Befindlichkeit. Sie muss das alles nicht verstehen, das kommt erst später, aber sie muss ein Gefühl dafür entwickeln. Für den Ort, die Bilder, die Gerüche.
Natürlich wird sie sich das alles auf den Tatortfotos noch einmal anschauen, wieder und wieder, aber das ist nicht dasselbe. Der erste Eindruck zählt, der erste Blick. Wo eine Leiche liegt. Das Umfeld, in dem sie liegt. Die Art, wie sie daliegt. Weil das Rückschlüsse zulässt. Auf den Hergang der Tat, auf das Motiv des Täters, auf die mögliche Verbindung zwischen ihm und seinem Opfer.
Selma Kiefers Unterleib ist vollkommen entblößt. Ihre Strumpfhose liegt neben ihrem rechten Oberschenkel. Darauf ihre Unterhose. Beigefarbenes Lycra mit Einsätzen aus Spitze. Der Täter hat sie ihr ausgezogen und ordentlich zusammengefaltet. Auf ihrem Bauch ein Kranz aus ineinandergeflochtenen dornigen Zweigen.
Katja schaut auf das rot glänzende Dreieck zwischen den Beinen der Toten. Ein mehrere Zentimeter breiter Streifen herausgeschnittener Haut, das geschändete Geschlecht einer alten Frau.
Katja weiß nicht, was sie sagen soll. Sie hat keine Worte für das, was sie sieht. Auch Dorfmüller schweigt. Sie kann ihm ansehen, wie er mit sich kämpft, genau wie sie.
»Jetzt wisst ihr, was ich meine«, sagt Leah Levy nüchtern.
»Ja«, erwidert Katja. »Jetzt wissen wir es.«
»Also gut«, sagt Levy. »Fangen wir an.« Sie macht eine Pause, kniet sich erneut neben die Tote. »So, wie sie daliegt, den Körper der Tür zugewandt, muss der Täter sie vor sich her aus dem Flur ins Schlafzimmer getrieben haben. An ihrem Hinterkopf, oberhalb des ersten Halswirbels, hat sie eine Platzwunde.«
Sie kämmt mit den Fingern Selma Kiefers Haare nach oben, bis eine blutverkrustete Wunde sichtbar wird. »Entweder hat er sie geschubst, oder sie ist ins Stolpern geraten und gestürzt.« Sie zeigt auf einen kleinen Blutfleck auf der Tagesdecke, dort, wo sie über die Kante des Bettes fällt. »Dabei hat sie sich den Kopf blutig geschlagen. Sie ist benommen, was der Täter ausnutzt.« Levy deutet auf eine Einstichstelle am Hals der Toten, die von einem rötlichen, kreisrunden Kranz umgeben ist.
»Eine Spritze«, sagt Katja.
»Mit voller Wucht bis zum Anschlag in den Hals gerammt.«
»Deshalb das Hämatom rund um die Einstichstelle.«
Levy nickt. »Irgendeine tödlich wirkende Substanz, die zu einem Herzstillstand geführt hat. Genaueres kann ich euch sagen, wenn ich sie obduziert habe.«
Wieder schaut Katja auf den Körper der Toten, nüchterner als beim ersten Mal. Ihre Professionalität hat den ersten Schock überlagert. Selma Kiefers abgewandtes Gesicht, ihr hochgezogener Rock. Der geflochtene Kranz auf ihrem Bauch, ihr abgeschältes Geschlecht. Der Eindruck von Ordnung und Reinlichkeit. Als würde sich alles an seinem ihm zugewiesenen Platz befinden. So als hätte der Täter die Tote hergerichtet, ihren Körper inszeniert, sie »schön« gemacht. Selbst die Wunde zwischen ihren Beinen strahlt eine fast klinische Sauberkeit aus. Und nirgendwo Blut. Nicht an ihrem Unterleib, nicht an den Beinen, nicht auf dem Teppich unter ihr.
»Warum ist da nirgendwo Blut?«, fragt Katja.
»Gute Frage«, sagt Levy. »Ich tippe darauf, dass er gewartet hat, bevor er sich ans Werk gemacht hat. Ungefähr eine Stunde, bis das Blut in ihrem Körper geronnen war. Jedenfalls der korpuskuläre Teil und das Fibrin. Das Serum bleibt länger flüssig.«
»Auch davon ist rund um die Wunde nichts zu sehen.«
»Weil er sie anschließend gereinigt hat«, sagt Levy. »Riecht ihr das?«
Dorfmüller schnüffelt. »Alkohol oder so was.«
»Feines Näschen«, sagt Levy.
»Kannst du uns irgendwas zu dem Messer sagen, das er benutzt hat?«, fragt Katja.
»Ich tippe auf ein Skalpell. Eine Klinge aus gehärtetem Stahl. Äußerst scharf. Keinerlei Ausfransungen an den Schnittkanten. Vier Schnitte, sehr präzise. Das Anheben von Epidermis und Dermis mithilfe der Klinge, Durchtrennen von Nerven und Blutgefäßen und gleichmäßiges Abziehen von oben nach unten.«
»Warum tut jemand so was?«
»Dafür bin ich die falsche Adresse. Das musst du einen Fachmann fragen. Einen Psychiater. Einen, der sich mit so was auskennt.«
Die Abgründe der Seele, denkt Katja. Ein innerer Zwang. Die Umsetzung einer Vision, die den Täter so lange verfolgt hat, bis er sie in Wirklichkeit verwandelt hat. »Hat er sie vergewaltigt?«
»Kann ich ausschließen.«
»Was ist mit der Tatzeit?«
»Einsetzender Rigor mortis an den äußeren Extremitäten, aber nicht sonderlich ausgeprägt. Lange ist es nicht her. Zwei, zweieinhalb Stunden, höchstens drei. Wie spät ist es jetzt?«
Katja schaut auf ihre Uhr. »Halb eins.«
»Dann schätze ich, so gegen zehn. Plus minus die übliche Toleranz. Alles natürlich unter Vorbehalt.«
Katja stellt sich vor, wie der Täter der wehrlosen Selma Kiefer die Spritze in den Hals stößt, den Kolben herunterdrückt und sie anschließend wieder herauszieht. Wie sie sich trotz ihrer Benommenheit reflexartig an den Hals fasst, ohne zu begreifen, was da mit ihr geschieht. Wie sie ihren Mörder anstarrt, während die tödliche Substanz in ihrem Körper zu wirken beginnt. Wie sie hilflos nach Luft schnappt, einmal, zweimal, immer schneller. Bis ihr Herz ein letztes Mal schlägt und für immer stehen bleibt.
Katja malt sich aus, wie der Täter Selma Kiefers Unterleib entblößt, wie er erst ihre Strumpfhose und dann ihre Unterhose zusammenfaltet und neben sie legt. Wie er die Tote stumm betrachtet, während er immer wieder auf seine Uhr schaut und wartet, dass ihr Blut stockt. Wie er schließlich ein Skalpell zückt und den ersten Schnitt ansetzt. Wahrscheinlich genießt er das alles, vielleicht erregt es ihn sogar.
Sie spürt, wie sich ihr Bauch schmerzhaft verkrampft.
»Alles in Ordnung?«, fragt Dorfmüller.
»Und mit dir?«, fragt sie zurück.
Er verzichtet auf eine Antwort.
Sie beugt sich nach unten, dreht den Kopf der Toten zu sich. Es kostet sie Überwindung, das zu tun, aber es geht nicht anders, sie muss ihr ins Gesicht schauen, wenigstens einmal.
Selma Kiefers Augen sind geschlossen, die Lippen aufeinandergepresst, die Züge verkrampft.
»Was ist das?«, fragt Dorfmüller. Er deutet auf mehrere kreisrunde Male auf der Außenseite des rechten Oberschenkels der Toten.
Katja merkt auf.
»Ist mir auch schon aufgefallen«, sagt Levy. »Sieht aus wie die Narben ausgedrückter Zigaretten.«
»Aber nicht frisch, oder?«
Levy schüttelt den Kopf. »Verschiedene Stadien der Rötung, unterschiedliche Ausprägung der Verwachsungen im Narbengewebe. Muss schon länger her sein. Irgendwas zwischen einem und mehreren Jahren.«
»Also eine Wiederholung. Über einen längeren Zeitraum.«
»Ja«, sagt Levy. »Auf jeden Fall.«
»Hat sie sich die selber zugefügt?«
»So gravierende Selbstverletzungen? In ihrem Alter? Aus meiner Sicht mehr als unwahrscheinlich.«
»Und die Hämatome da?« Katja deutet auf verfärbte Stellen an der Innenseite von Selma Kiefers Oberschenkeln, im Zentrum grünlich, zu den Rändern hin gelblich auslaufend.
»Die sind relativ frisch«, sagt Levy. »Zwei, drei Wochen, nicht älter.«
»Folgen von Schlägen?«
»Von der Form her tippe ich eher auf Tritte.«
»Aber genau wie die Zigarettennarben nicht vom Täter.«
»Es sei denn, er hätte sie früher schon mal besucht. Was ich mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen kann. Wer Zigaretten auf meinen Oberschenkeln ausdrückt, den lasse ich nicht ein zweites Mal in meine Wohnung.«
»Danke dir«, sagt Katja.
»Keine Ursache«, erwidert Levy und beginnt ihre Utensilien zusammenzupacken.
Katja reißt sich vom Anblick der Leiche los und geht rüber zur Schrankwand. Der zum Flur hin gelegene Teil ist voll mit Selma Kiefers Kleidung. Die übliche Trennung zwischen Regalen und Kleiderstangen. Ganz unten Schuhe. Dann Schubkästen voller Unterwäsche und Strümpfe. Aufgehängte Blusen, Kleider und Röcke. Ein paar Hosen. Darüber Bettwäsche und Laken, ganz oben ein Koffer und eine Reisetasche.
Katja öffnet die übrigen Schranktüren. Sämtliche Regalböden sind leer, genau wie die Abteilung mit den Kleiderstangen. Sie tritt ans Bett, schlägt die Tagesdecke auf. Zwei Matratzen, beide mit Laken bezogen, aber nur auf einer liegt Bettwäsche.
Es gab also einen Mann in ihrem Leben, denkt Katja. Die Frage ist nur: Warum und wie lange gibt es ihn schon nicht mehr?
4
Auch das Wohnzimmer ist tapeziert, genau wie der Flur. Hier wie dort Längsstreifen, nur die Farben sind andere. Ein helles Altrosa im Wechsel mit einem fahlen Grün. Dazu ein zweisitziges Sofa und ein dazugehöriger Sessel mit malvenfarbenen Stoffhussen. Ein Couchtisch aus Nussbaum. An der gegenüberliegenden Wand ein klassischer Wohnzimmerschrank, ebenfalls aus Nussbaum. Unten Türen mit brünierten Messinggriffen, oben Regale. Einige der Borde sind leer, auf die übrigen verteilen sich Tennispokale des TC Pasing, Schmuckteller in Ständern, ein paar Porzellanfiguren: ein Hirtenjunge mit Flöte, ein schwimmender Schwan, ein tanzendes Mädchen in einem Rokkokokleid. Daneben eine Handvoll Bücher. Die erwartbaren Frauenromane, kleine Fluchten in eine bessere Welt.
Sie öffnet die Schranktüren. Sauber beschriftete Aktenordner, die sie einen nach dem anderen herauszieht. Die Unterlagen einer Toten. Auch nach Jahren als Ermittlerin fällt es ihr nicht leicht, in die Privatsphäre eines Mordopfers einzudringen. Persönliche Dokumente, Rechnungen, Arztdiagnosen. Briefe von Versicherungen oder städtischen Behörden. Arbeitsnachweise, Rentenbelege. Das Auf und Ab einer jahrzehntelangen Existenz, zusammengefasst zwischen Pappdeckeln. Für Katja hat das etwas Erbärmliches an sich, als würde das gelebte Leben eines Menschen reduziert auf Zahlen und Floskeln. Und am Ende bleiben eine Abschlagszahlung an ein Elektrizitätsunternehmen oder die Jahresabrechnung für die Heizung –Danke für Ihr Vertrauen, mit freundlichen Grüßen.
Katja blättert sich durch Selma Kiefers abgeheftetes Leben. Alles ordentlich sortiert und gewissenhaft dokumentiert. Sie sucht nach Hinweisen auf einen Todesfall oder eine Scheidung. In Wahrheit sucht sie nach den Gründen für die Narben auf ihren Beinen, die Hämatome auf ihren Oberschenkeln.
Schließlich wird sie fündig. Ein Scheidungsurteil, einen Monat alt. Selma Kiefer, geborene Reichel, gegen Josef Kiefer, bis zu ihrer Trennung im Vorjahr gemeinsam wohnhaft in München Pasing, Gräfstraße 67, zweites OG. Er zwei Jahre älter als sie, beide Rentner, über vierzig Jahre miteinander verheiratet. Mit vorliegendem Urteil rechtskräftig voneinander geschieden. Gezeichnet: Stadlhuber, Richterin am Amtsgericht München, Abteilung für Familienverfahren.
Zwei Eheleute, beide über siebzig und im Ruhestand. Katja fragt sich, was nach einer so langen Ehe zu Trennung und Scheidung führt. Sie denkt an die Narben auf dem Körper der Toten. Sie kann den Geruch nach verbranntem Fleisch riechen. Wie viel kann ein Mensch aushalten?
Sie schaut durch die Flügeltür ins Esszimmer. Ein ovaler Tisch, vier Stühle, an der Wand dahinter ein Sideboard aus lackierter Esche. Darüber drei kolorierte Kupferstiche aus dem 19. Jahrhundert in dünnen Holzrahmen mit goldener Linierung: das alte München. Frauenkirche, Isartor, Feldherrnhalle.
Alles hier hat seinen Platz, denkt sie, auffallende Sauberkeit, kein bisschen Staub. Eine alte Frau, die versucht hat, mit ihrer Wohnung auch ihr Inneres in Ordnung zu halten.
Sie geht zum Sideboard, öffnet es. Akkurat gefaltete Tischdecken und gebügelte Stoffservietten. Flaschen mit Cognac, Kirschwasser oder Eierlikör, die meisten noch verschlossen. Geschenke vielleicht, vergessen oder unerwünscht. Oder einfach nur aufbewahrt für einen Anlass, der sich nie ergeben hat.
Ein stoffbezogenes Buch weckt ihre Aufmerksamkeit. Ein Fotoalbum. Sie legt es auf den Esstisch, setzt sich und beginnt es durchzublättern. Ein Leben im Schnelldurchlauf. Ein Kind mit seinen Eltern, ein Haus in ländlicher Umgebung, keine Brüder oder Schwestern. Ein junges Mädchen mit einem Abschlusszeugnis, ernst und verloren. Dann ein Gruppenfoto. Junge Krankenschwestern in weißer Tracht, in der Mitte eindeutig Selma, eine von ihnen und doch allein. Ein Krankenhaus in einer großen Stadt. Darunter sie und ein junger Arzt im Schwesternzimmer einer Station. Ein paar Seiten danach eine Aufnahme aus Rom, hinter Selma das Kolosseum, sie ist jetzt Mitte zwanzig, und endlich, zum ersten Mal, zeigt sie den Anflug eines Lächelns.
Dann, viele Seiten lang, nur die Klebestellen herausgerissener Fotos. Als hätte Selma Kiefer große Teile ihres Lebens aus sich herausreißen wollen. Keine Aufnahme ihrer Hochzeit, kein Bild ihres Mannes. Nur, inmitten von Leerstellen, Selma und ein schlafendes Baby auf ihrem Bauch, laut Bildunterschrift ihre Tochter Paula.
Danach wieder dieses seitenlange Nichts, die Trennblätter aus Pergamin rascheln zwischen Katjas Fingern hindurch. Bis auf den letzten Seiten wieder Selma zu sehen ist, allein, an Deck eines Kreuzfahrtschiffes, vor Mykonos, im letzten Sommer, wie dem darunterstehenden Datum zu entnehmen ist. Eine Reise nach der Trennung von ihrem Mann, in ihrem Gesicht ein aufgeräumtes Lächeln, erleichtert und froh.
Katja klappt das Album zu, schaut nachdenklich auf den Einband aus meliertem Stoff, legt es zurück und entdeckt dabei zwei gerahmte Fotografien, aufeinandergestapelt, mit der Bildseite nach unten. Sie nimmt sie heraus, betrachtet sie. Die eine zeigt ein etwa sechsjähriges Mädchen auf Selma Kiefers Schoß, eine Schultüte im Arm. Lange her, die Farben sind vergilbt. Mutter und Tochter, denkt Katja, am Tag von Paulas Einschulung. Auf der anderen ist eine junge Frau zu sehen, die Selma auffallend ähnelt. Eine wesentlich neuere Aufnahme der Tochter, noch unverblichen: Paula an einem Pool, Urlaub im Süden, im Hintergrund eine Hotelanlage.
Katja fragt sich, warum Selma Kiefer die Fotos in den Schrank verbannt hat, mit der Bildseite nach unten. Als hätte sie es nicht länger ertragen, sie um sich zu haben, als wäre mit dem Anblick dieser Fotos eine tiefe Verletzung verbunden.
Einer der Spurensicherer taucht in der Tür zum Flur auf. Die Kapuze seines Overalls hat er sich vom Kopf gezogen.
»Wir wären dann durch«, sagt er.
»Irgendwas Wesentliches?«, fragt Katja.
»Sieht nicht so aus.« Er zieht sich die Latexhandschuhe aus. »Fingerabdrücke an der Wohnungstür, ein paar Haare im Schlafzimmer, Hautschuppen. Ob sich darunter auch die DNA des Täters befindet, kann ich dir nicht sagen. Musst du die Analyse abwarten.«
»Nichts, das auf ein gewaltsames Eindringen hindeutet? Kratzspuren von einer durch den Türspalt gezogenen EC-Karte oder so was?«
»Negativ.«
»Trotzdem danke.«
»Immer wieder gerne.«
Er lächelt ihr müde zu und geht hinaus.
Katja weiß, dass es voreilig ist, Schlussfolgerungen zu ziehen. Trotzdem ist sie sich sicher, dass die Spurenanalyse nichts ergeben wird. Die Hautschuppen und die Haare werden Selma Kiefer zugeordnet werden, genau wie die Fingerabdrücke an der Tür. Der Täter hat keine Spuren hinterlassen. Er ist mit Bedacht vorgegangen, sorgfältig und überlegt.
Der Tatzeitpunkt ist klug gewählt. Sonntagabend, man bleibt zu Hause, die meisten Nachbarn lassen das Wochenende vor dem Fernseher ausklingen, genau wie Jenny und sie ein paar Stunden zuvor. Das Risiko, jemandem auf der Straße oder im Hausflur zu begegnen, ist äußerst gering.
Wieder fragt Katja sich, wie der Täter in die Wohnung gelangt ist. Selma Kiefer muss ihm freiwillig die Tür geöffnet haben. Entweder die beiden kannten sich, oder er besaß einen Schlüssel. Oder beides.
»Katja!«
Aus ihren Gedanken gerissen, blickt sie auf.
Dorfmüller ist hereingekommen, zieht sich einen Stuhl vom Esstisch heran, faltet seine zwei Meter Körpergröße darauf zusammen, klappt seinen Notizblock auf. »Ich hab mit der Nachbarin gesprochen, die sie gefunden hat«, sagt er. »Sandra Schilling, Mitte fünfzig, drittes OG links. Wohnt seit siebzehn Jahren im Haus. Gemeinsam mit ihrem Mann Ludwig. Normalerweise trägt er den Müll runter. Oder wie er das nannte: klassische Rollenverteilung. Ich hätte ihm am liebsten eine verpasst. Hatte vor nicht allzu langer Zeit einen Bandscheibenvorfall, deswegen spart er sich so weit wie möglich das Treppensteigen.«
»Also hat sie das übernommen.«
»Du sagst es. Und als sie mit dem leeren Mülleimer in der Hand wieder hochkommt, fällt ihr auf, dass die Wohnungstür von Selma Kiefer nur angelehnt ist. Sie klopft, aber niemand antwortet.«
»Sie kann nicht widerstehen und drückt die Tür auf.«
»Kleinbürgerliche Neugier, hinter Sorge versteckt«, vermutet Dorfmüller. »Endlich mal sehen, wie die Nachbarin so wohnt. Um sich anschließend mit ihrem Mann das Maul über sie zu zerreißen. Hat sie natürlich nicht gesagt, war ihr aber deutlich anzumerken.«