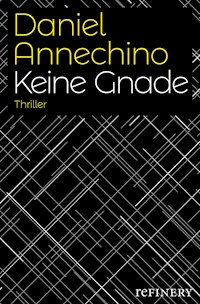
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Sami-Rizzo-Thriller
- Sprache: Deutsch
Wenn ich diesen Eid erfülle und nicht breche, so sei mir beschieden, (…) Ansehen bei allen Menschen für alle Zeit zu gewinnen. Wenn ich ihn aber übertrete und breche, so geschehe mir das Gegenteil. Ein brutaler Serienmörder versetzt San Diego in Angst und Schrecken: Die Opfer werden ohne Narkose am Herzen operiert – und sterben. Ein grausamer Tod. Detective Inspector Samantha Rizzo und ihr Kollege Alberto Diaz sind auf der Jagd nach einem Mann, der den hippokratischen Eid bricht. Ohne Reue. Er ist ein Killer ohne Gnade.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Wenn ich diesen Eid erfülle und nicht breche, so sei mir beschieden, (…) Ansehen bei allen Menschen für alle Zeit zu gewinnen. Wenn ich ihn aber übertrete und breche, so geschehe mir das Gegenteil.
Ein brutaler Serienmörder versetzt San Diego in Angst und Schrecken: Die Opfer werden ohne Narkose am Herzen operiert – und sterben. Ein grausamer Tod. Detective Inspector Samantha Rizzo und ihr Kollege Alberto Diaz sind auf der Jagd nach einem Mann, der den hippokratischen Eid bricht. Ohne Reue. Er ist ein Killer ohne Gnade.
Der Autor
Daniel Annechino lebt und arbeitet in San Diego, Kalifornien. Sein Debüt Leise stirbst du nie erschien in den USA im Selbstverlag und entwickelte sich zum Internet-Bestseller. Auch hierzulande stürmte Annechino die Bestsellerlisten. Keine Gnade ist der zweite Fall für DI Sami Rizzo.
Von Daniel Annechino ist in unserem Hause bereits erschienen:
Leise stirbst du nie
Neuausgabe bei Refinery
Refinery ist ein Digitalverlag
der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Dezember 2017 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2012
© Daniel Annechino
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Resuscitation
(Amazon Encore, Las Vegas)
Satz und eBook: LVD GmbH, Berlin
Covergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin
ISBN 978-3-96048-126-3
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
FÜR JENNIFER
mit Dank für Deine aufmunternden Worte und Deine unermüdliche Unterstützung
Prolog
Als Genevieve Foster aufwachte, war sie völlig orientierungslos und fühlte sich wie jemand, der nach einer schweren Operation und einer tiefen Vollnarkose wieder zu Bewusstsein kam. Sie lag auf einem Bett und wusste nicht, wo sie sich befand oder wie sie dorthin gekommen war. Als sie versuchte, sich das Haar aus dem Gesicht zu streichen, stellte sie fest, dass ihre Handgelenke mit Nylonriemen ans Kopfende des Bettes gebunden waren. Sie hob ihren schmerzenden Kopf und konnte sehen, dass auch ihre Fußgelenke ans Bett gefesselt waren. Sie lag mit gespreizten Armen und Beinen auf dem Bett. Neben dem Bett entdeckte sie die Umrisse eines Infusionsbeutels, der an einem Metallständer hing. Der Schlauch aus dem Beutel führte zu einer Kanüle, die in ihrer Armbeuge steckte. Abgesehen von dem dünnen Laken über ihrem Körper war sie vollständig nackt.
Das kann nicht wirklich wahr sein.
Das einzige Licht im Raum kam von den vorbeifahrenden Autos, deren Scheinwerfer die hohen Fenster gerade lange genug streiften, um Genevieve einen Eindruck von ihrer Umgebung zu verschaffen. Der Raum wirkte groß, vielleicht war es ein Loft oder ein kleines Lager. Da draußen ziemlich viele Autos vorbeikamen, vermutete Genevieve, dass es sich um eine Wohngegend handelte. Wenn sie still lag und genau hinhörte, konnte sie im Hintergrund etwas brummen hören, wahrscheinlich ein Kühlschrank. Und irgendwo auf der anderen Seite des Raums hörte sie das regelmäßige Ticken einer Uhr.
Ticktack. Ticktack.
Ihr kam es vor, als wollte die Uhr sie vor einer drohenden Gefahr warnen.
Sie schloss ihre Augen und versuchte die verschwommenen Bildfetzen, die durch ihren Kopf taumelten, zusammenzufügen. Sie sah nach links, nach rechts, hielt Ausschau nach irgendetwas, das ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen könnte. Aber sie entdeckte nichts und niemanden und fühlte sich unglaublich allein, von der Welt abgeschnitten. Eigenartigerweise musste sie an Cast Away – Verschollen denken, den Film mit Tom Hanks. Obwohl sie nicht wie er auf einer verlassenen Insel gestrandet war, so kam ihr dieses dunkle unheimliche Gefängnis genauso ausgestorben vor.
Wer würde ihr zu Hilfe kommen?
Sie atmete tief durch, sog die Luft in kurzen zittrigen Atemzügen ein und bemühte sich mit jeder Faser ihres Körpers, wach zu bleiben. Einschlafen war das Letzte, was sie im Moment wollte. Sie nahm an, die Infusionslösung war mehr als eine Nährflüssigkeit, denn sie fühlte sich viel ruhiger, als die Situation es eigentlich zuließ. Sollte sie nicht eigentlich schreien, bis sie heiser war? Ihr Körper zitterte unkontrolliert und erinnerte sie an einen kühlen Novembermorgen, als ihr Bruder sie zu einem kurzen Bad im fünfzehn Grad kalten Pazifik herausgefordert hatte. Sie schreckte nie vor einer Mutprobe zurück, war ein Wildfang in jeder Hinsicht, und so stellte Genevieve sich auch diesem Wagnis und ging nicht nur ins Wasser, sondern schwamm bis zum Ende des Crystal Pier und zurück. Zweimal. Danach war ihr so kalt, dass sie eine Stunde lang nicht aufhören konnte zu zittern. In genau diesem Augenblick würde sie ihre Situation liebend gern gegen eine ausgedehnte Runde Schwimmen in eisigem Wasser eintauschen.
Sie lag einfach still da, versuchte das überwältigende Gefühl von Hilflosigkeit zu unterdrücken und erinnerte sich dunkel an einen Sandstrand, einen Sonnenuntergang, ein hübsches Gesicht. Aber nichts von alledem passte irgendwie zusammen, ihr Gedächtnis wies allzu viele Lücken auf. Als sie schon fast dabei war, den Kampf gegen die Wirkung der starken Droge, die ihr intravenös verabreicht wurde, aufzugeben, hörte sie, wie die Tür aufgeschlossen wurde. Ihr Kopf fuhr zur Tür herum, ihre Augen waren auf einmal wachsam und forschend. Licht fiel auf den Hartholzboden, aber nur für einen Augenblick.
Dann versank wieder alles in der Dunkelheit.
Plötzlich hörte Genevieve Foster ein Geräusch, das sie mehr als alles andere in Furcht und Schrecken versetzte: schwere Schritte, die auf sie zukamen.
1 Er saß an der Bar und nippte an seinem zweiten Johnny Walker Blue, um den Mut für das Undenkbare aufzubringen. Undenkbar? Gab es denn kein Wort, das seine Pläne genauer beschrieb? Er ließ den weichen Scotch im Mund kreisen, bevor er ihn langsam und bedächtig hinunterschluckte. Die Zweihundert-Dollar-Flasche war jeden einzelnen Penny wert, dachte er bei sich. Wenn er über die Ereignisse der letzten Wochen nachdachte, den Brief, den er von der GAFF, der Global A-Fib Foundation, erhalten hatte und der sein Leben verändern würde, so konnte er nicht glauben, was er vorhatte. Aber blieb ihm eine Wahl? Sie hatten ihn an diesen Scheidepunkt gebracht. Hier saß er nun und trank in Tony’s Bar and Grill Scotch wie zur Happy Hour an einem Freitagnachmittag. Doch in Wirklichkeit stand ihm der Sinn überhaupt nicht nach zwanglosem Geplauder mit Kollegen. Obwohl er mit Hunderten von Freiwilligen gearbeitet hatte, so waren Julians Ergebnisse doch überschaubar geblieben. Er hatte jede nur erdenkliche Möglichkeit in Betracht gezogen, doch sein Problem konnte nicht anders gelöst werden. Seine einzige Hoffnung, die Forschungen abzuschließen, lag in der Arbeit am lebenden Subjekt, ohne jegliche Einschränkungen. Dieser Entschluss war ihm nicht leichtgefallen. Denn in erster Linie war er ein Heiler, ein angesehener Kardiologe, aber kein Mörder. Doch außergewöhnliche Situationen erfordern oft außergewöhnliche Maßnahmen.
Als er den zertifizierten Brief erhalten hatte, war er zunächst davon ausgegangen, dass der Vorstand der GAFF mit den Ergebnissen seiner Forschungen zufrieden war und ihm die Fördermittel von zehn Millionen Dollar bewilligt hätte. Doch die ersten beiden Absätze hatten ihn in die Knie gezwungen.
»Unser Komitee hat die Ergebnisse Ihrer Forschungen sowie die aus der kontrollierten Studie zur Entwicklung neuer operativer Behandlungsmöglichkeiten von Vorhofflimmern resultierenden Statistiken genauestens unter die Lupe genommen. Obwohl sie in vielerlei Hinsicht wegweisend sind, so fanden wir die Ergebnisse doch nicht ausreichend genug, um Ihren Antrag bewilligen zu können. Genauer gesagt, die vorgelegten Testresultate, die Änderungen bei der gängigen Katheterablation und der Maze-Operation vorsehen, sind unvollständig, und wir stimmen nicht mit Ihrem Ergebnis überein, dass das Verabreichen von Amiodaron in Dosen von weniger als 200 Milligramm effizient sein könnte. Doch angesichts Ihrer beeindruckenden Bemühungen freuen wir uns, Ihnen eine sechsmonatige Fristverlängerung anbieten zu können, während der Sie Ihre Befunde ergänzen und zusätzliche Ergebnisse vorlegen können. Nach dieser Zeit werden wir das Material neu sichten und bewerten.
Beigefügt erhalten Sie eine umfassende Zusammenstellung der Daten, die wir benötigen, um Ihren Antrag nochmals prüfen zu können.«
Zwei Jahre lang hatte er von morgens bis spät in die Nacht gearbeitet, seine Familie vernachlässigt und einen Rückschlag nach dem anderen hingenommen, und alles, was er nun vorweisen konnte, war ein zweiseitiger Brief, der seine harte Arbeit schmälerte.
Nachdem er sorgfältig die Kommentare gelesen hatte, die in allen Einzelheiten die zusätzlich benötigten Daten darlegten, kam Julian zu dem Schluss, dass er acht Probanden brauchte, um die Bedingungen der GAFF zu erfüllen. Zunächst dachte er dabei an seine eigenen Patienten. Schließlich verfügte er über alle Einzelheiten ihrer Krankengeschichte und könnte jeden von ihnen nach bestimmten Parametern gezielt aussuchen. Aber was würde passieren, wenn seine Patienten verschwanden, die Polizei ermittelte und eins und eins zusammenzählte? Er wäre der gemeinsame Nenner. Nein, er befand sich nicht in der angenehmen Lage, sich die perfekten Probanden aussuchen zu können. Da er keine andere Wahl hatte, musste er sich bei der Suche nach den idealen Testpersonen auf seinen Instinkt verlassen. Aber durch den gezielten Einsatz von Medikamenten und sorgfältig eingesetzten Operationsmethoden konnte er fast jedes Symptom oder jede Verfassung hervorrufen, die er für die benötigten Daten brauchte.
Julian fühlte sich in dieser Bar nicht wohl, hier war er nicht in seinem Element. Aber er war nicht ohne Grund hier, denn in diesem beliebten Hotspot des Gaslamp Quarters im Zentrum von San Diego war jede Menge los, hier war es leichter für ihn, nicht aufzufallen – einfach nur einer unter vielen zu sein.
Er konnte sich noch an die Zeiten erinnern, als es im Gaslamp Quarter kaum etwas mehr gab als ein paar mit Brettern verbarrikadierte Häuser und Betrunkene, die auf den Straßen herumlungerten. Nun war aber mit renovierten Hotels, Jazzclubs, schicken Boutiquen und Straßencafés – einmal ganz abgesehen vom PETCO Park, dem neuen Baseballstadion der San Diego Padres – neues Leben in das Viertel eingezogen, und es brummte nur so vor Geschäftigkeit.
Julian hoffte, dass er mit seinen zweiundvierzig Jahren seinen Charme noch nicht verloren hatte. In früheren Jahren hatte er Frauen geradezu magnetisch angezogen. Im College konnte er sich darauf verlassen, mit seinem Lächeln und seinen lebhaften blauen Augen eine willige Begleitung zu finden. Aber das war zwanzig Jahre her, und kein Mann kann seine jugendliche Erscheinung für immer bewahren. Außerdem hatte er längst nicht mehr die Statur eines Athleten.
Er nahm Augenkontakt mit einer blonden Frau auf, die ein paar Barhocker weiter saß, setzte sein bestes Lächeln auf und hoffte, sie würde darauf reagieren. Seit mehr als zehn Jahren war er verheiratet und hatte nicht die leiseste Ahnung, wie man Frauen in einer Bar anmachte. Die Blondine war offensichtlich schüchtern, denn sie schaute weg, nahm einen Schluck von ihrem Martini und unterhielt sich weiter mit einer anderen Frau. Als sich ihre Blicke wieder trafen, nahm er sein Glas und prostete ihr zu. In den nächsten Minuten sah er regelmäßig zu ihr hin und ertappte sie dabei, wie auch sie hinübersah und einem unschuldigen Flirt offenbar nicht abgeneigt war.
Er wartete geduldig, dass sie auf ihn zukam. Er war völlig in Gedanken versunken, als ihn schließlich jemand sachte an der Schulter berührte, und als er sich umdrehte, war er erleichtert, die Blondine zu sehen, die sichtlich nervös war.
»Ich hatte gehofft, dass Sie rüberkommen würden«, sagte er und war erfreut, dass sie jung, relativ schlank und gesund zu sein schien. Er hätte am liebsten zu ihr gesagt: »Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich Ihr Herz mit einem Stethoskop abhöre, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist?«
»Tatsächlich?«, sagte die Blonde und hatte ihre Hände in die Taille gestemmt.
»Haben Sie mein Zeichen denn nicht gesehen?«, antwortete er.
»Na ja, ich bin hier, also scheint bei mir doch etwas angekommen zu sein.«
Er hielt ihr die Hand hin. »Ich bin Julian.«
Sie nahm seine Hand und drückte sie fest. »Ich bin Genevieve.«
»Schöner Name.« Obwohl er sich gar nicht so fühlte, winkte er selbstsicher den Bartender heran. »Kann ich Ihnen einen Drink spendieren?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich hatte schon mehr, als mir guttut.«
»Und was würde passieren, wenn Sie weitertrinken?«
»Das erzähle ich Ihnen lieber nicht.«
Er nippte an seinem Glas. »Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, weil Sie Ihre Freundin im Stich gelassen haben?«
»Sie ist ein großes Mädchen. Sie kommt allein zurecht.«
»Und wie oft lassen Sie Ihre Freundinnen wegen fremder Männer sitzen?«
Sie legte ihr Täschchen auf die Bartheke und lachte. »Heute Nacht?«
Er nickte.
»Sie sind der Erste.«
Das bezweifelte er. »Und warum gerade ich?«
»Sie wirken … interessant.«
»Sollte ich mich geschmeichelt fühlen?«
»Ja.« Sie deutete auf die vielen Gäste. »Falls Sie es nicht gemerkt haben sollten, es gibt hier reichlich Gelegenheiten.«
»Sie sind nicht gerade schüchtern, Genevieve. Ich mag das an Frauen.«
»Was mögen Sie noch an einer Frau?«
»Ich glaube, wir beide kennen die Antwort auf diese Frage.« Er bestellte sich einen weiteren Scotch und legte einen Fünfzig-Dollar-Schein auf die Theke. Er musste sich zwingen, seine Hände ruhig zu halten. »Und Sie sind sich sicher, dass Sie nicht noch etwas mögen?«
»Nein, wirklich nicht.«
Der Barkeeper goss ihm seinen Drink ein, und Julian nahm einen Schluck. »Und was machen Sie so, Genevieve? Sind Sie ein Model oder eine vielversprechende Schauspielerin?«
»Erstes Jahr Jura an der Uni.«
»Beeindruckend.« Er lächelte schüchtern wie ein Schuljunge. »Und ich bin nicht so schnell zu beeindrucken.«
»Da ist nicht wirklich etwas dabei. Anwälte gibt es heutzutage wie Sand am Meer.«
»Welche Richtung wollen Sie als Juristin einschlagen?«
»Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ich tendiere zu Gesellschaftsrecht.« Sie drehte sich eine Haarsträhne um den Finger. »Ich weiß, es ist langweilig.«
»Hey, wenn es Ihnen liegt, müssen Sie es machen.« Sein Selbstvertrauen wuchs, und er entspannte sich.
»Und wie ist es mit Ihnen, Julian? Was machen Sie so?«
Auf diese Frage war er nicht vorbereitet und musste sich schnell etwas ausdenken. »Ich versuche mich in Immobilien.«
»Versuchen?«
»Ich kaufe. Ich verkaufe. Ich mache einen Haufen Geld. Ich verliere einen Haufen Geld.«
»Hört sich riskant an.«
»Nur, wenn man mehr verliert als gewinnt.«
Sie saßen ein paar Minuten still da und ließen bloß ihre Augen sprechen.
Er hatte von vielen seiner alleinstehenden Medizinerkollegen gehört, dass junge Frauen heutzutage leicht zu haben waren. Es war an der Zeit, das in Erfahrung zu bringen. »Genevieve, sind Sie eine Spielerin?«
»Wenn man das durchs Spielen an Geldspielautomaten etwa im Barona Casino wird, dann bin ich das wohl.«
»Was halten Sie von einer kleinen Wette – nur so zum Spaß?«
»Was für eine Wette?«, fragte sie misstrauisch.
»Zwanzig Dollar darauf, dass Sie heute Nacht um halb zwölf bei mir zu Hause ein Glas Wein trinken werden.«
»Sie haben schon verloren, Julian. Her mit meinen zwanzig Dollar!«
»Ich kann Ihnen nicht folgen.«
Sie grinste. »Ich trinke keinen Wein.«
»Okay, schon haben Sie mich. Lassen Sie es mich neu formulieren. Ich wette um ein Bild von Andrew Jackson, dass Sie um halb zwölf in meiner Wohnung sitzen werden.«
»Sie sind ja ganz schön von sich überzeugt, Buster.«
Eigentlich war er das überhaupt nicht und bereute seinen Vorstoß schon. Aber nun konnte er nicht mehr zurück. »Jedenfalls genug, um zwanzig Dollar zu riskieren.«
»Wollen Sie mich hier vertreiben?«
»Sie würden jetzt niemals gehen.«
»Was Sie nicht sagen. Und warum nicht?«
»Weil wir einfach zu viel Spaß miteinander haben.«
»Mein Gott. Sie sind einfach unglaublich.« Sie griff sich ihre Tasche von der Theke. »Vielleicht fallen andere Frauen auf Ihren dreisten Schwachsinn rein, aber …« Sie schüttelte ihren Kopf und wandte sich zum Gehen.
Das war seine letzte Chance. »Schauen Sie mir in die Augen, Genevieve. Wollen Sie wirklich gehen?«
»Sind Sie immer so überheblich?«
»Ich bin nur ehrlich. Wieso müssen wir hier Katz und Maus spielen? Wenn Sie mich nicht sympathisch finden würden, wären Sie nicht hergekommen. Und wenn ich kein Interesse an Ihnen hätte, wäre unser Gespräch in einer Minute beendet gewesen. Sie mögen mich, und ich mag Sie. Warum gehen wir dann nicht zum nächsten Schritt über?«
»Nächsten Schritt? Ich küsse nicht einmal bei einem ersten Date, und Sie wollen darauf wetten, mich ins Bett zu kriegen?«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Aber Sie haben es gemeint. Ich bin alt genug, um zwischen den Zeilen zu lesen. Sehe ich etwa wie ein billiges Flittchen aus?«
»Nein, Genevieve. Sie sehen aus wie eine Frau, die niemals ihre Deckung aufgibt.«
Sie konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Ist das so offensichtlich?«
Er zuckte mit der Schulter. »Ich sag nur, was ich sehe.«
»Es geht hier hart zu«, sagte sie und deutete auf das Gewühl. »Jede Menge Arschlöcher.«
Und genau so fühlte er sich auch gerade. »Wenn ich Ihnen zu nahe getreten bin, möchte ich mich entschuldigen. Alkohol bringt nicht gerade meine charmanteste Seite zum Vorschein. Geben Sie mir noch eine Chance?«
Es schien, als dachte sie über seine Bitte nach. Aber dann streckte sie ihm ihre Hand entgegen. »Es war …interessant,Julian. Vielleicht laufen wir uns eines Tages wieder über den Weg, wenn der Alkohol Ihren Charme mal nicht ausgebremst hat. Und sollte es ein nächstes Mal geben, könnten Sie darüber nachdenken, es ein wenig ruhiger angehen zu lassen.«
»Sie wollen gehen?«
»Da können Sie drauf wetten.«
»Bekomme ich wenigstens einen unschuldigen Abschiedskuss?«
»Ich glaube nicht, dass es an Ihnen irgendetwas Unschuldiges gibt. Sie geben wirklich nicht auf, oder?«
»Nicht bei einer Frau wie Ihnen.«
»Na gut, wären Sie mit einem Küsschen auf die Wange zufrieden?«
»Nicht gerade das, worauf ich gehofft hatte, aber sicher.«
Sie beugte sich zu ihm hin und drückte ihre Lippen auf seine Wange. Als sie sich gerade zurückziehen wollte, fasste Julian ihre Schulter. Ihre Augen trafen sich, ihre Gesichter waren nur Zentimeter voneinander entfernt. Er beugte sich vor und küsste sie sanft auf den Mund. »Meine Wohnung ist ganz in der Nähe.«
Kaum zu glauben, wie mühelos er Genevieve abschleppen konnte, oder genauer gesagt, wie einfach sie ihn angebaggert hatte. Und so brachte Julian sie zu seinem Mietwagen. Sie fuhren in dem perlweißen Cadillac CTS zu dem Loft, das er erst vor wenigen Wochen gemietet hatte. Da es nur vier Blocks von Tony’s Bar and Grill entfernt lag, brauchten sie nur einige Minuten. Julian hatte seit über zehn Jahren keine andere Frau mehr geküsst. Auch wenn er nicht wollte, dass der Kuss ihn erregte, so war er doch ziemlich aufgewühlt und hasste sich dafür.
Genevieve kramte in ihrer Tasche herum. »Hast du was dagegen, wenn ich meiner Freundin Katie eine Nachricht schicke? Ich habe jetzt doch ein schlechtes Gewissen, weil ich einfach gegangen bin.«
»Und was willst du ihr sagen?«
»Sie soll nicht auf mich warten.«
Julian konnte nicht erfreuter sein. Er drückte auf die Fernbedienung, die Sicherheitsschranke hob sich, und er fuhr den Cadillac in die schwach beleuchtete Tiefgarage. Sein Wagen war der Einzige hier unten.
»Das ist ein bisschen unheimlich, Julian«, sagte Genevieve, und ihre Finger flogen über die Tasten ihres Telefons.
»Tut mir leid, aber die Tiefgarage sieht aus wie ein Verlies. Ich habe das Gebäude vollständig saniert, aber für die Garage hatte ich noch keine Zeit. Sie ist aber auch nicht so wichtig. Mein Loft nimmt den ganzen zweiten Stock ein, es wird dir gefallen. Die Architekten vom Stockwerk darunter sind selten hier, und so habe ich das Haus meist ganz für mich allein. So eine Ruhe ist mitten in San Diego kaum zu finden.«
Sie traten in den Aufzug, und als sich die Türen schlossen, hatte Julian schon seine Arme um sie gelegt und küsste sie unbeherrscht. Das war eigentlich nicht seine Absicht gewesen. Urinstinkte hatten jetzt die Führung übernommen, und er hatte fast vergessen, warum er sie in sein Loft gebracht hatte.
Das ist der Alkohol, Julian. Denk an deine Aufgabe.
Sie wich ein wenig zurück, war fast außer Atem.
Julian merkte, dass er sich auf gefährliches Terrain begab. Was dachte er sich nur dabei! Wenn er nicht vorsichtig war, würde er ganz leicht abgelenkt werden. Doch er konnte es sich nicht leisten, seine Studie in irgendeiner Form zu gefährden. Aber als er diese schöne junge Frau so leidenschaftlich geküsst hatte, waren Erinnerungen an Rebecca und Marianne hochgekommen, an den dunklen Schuppen hinter ihrem Haus und an das Spiel, das sie ihm vor so vielen Jahren aufgezwungen hatten, ein Spiel, das seine Sexualität mit geprägt hatte.
»Du verlierst aber auch keine Zeit, was?«
»Ich bin ein sehr ungeduldiger Mann.«
»Können wir es nicht ein bisschen langsamer angehen lassen?«
Es lief alles ganz anders, als er geplant hatte. Er hatte nicht damit gerechnet, sich ablenken zu lassen. Doch plötzlich beherrschten sexuelle Allmachtsfantasien sein Bewusstsein. Das durfte er nicht zulassen. Er musste sich auf sein eigentliches Ziel konzentrieren: die Anerkennung seiner bahnbrechenden Forschung. Er konnte es sich nicht leisten, das aus den Augen zu verlieren.
Sie bekam weiche Knie bei der Vorstellung, dass Julian mit ihr schlafen würde. Sie hatte etliche Männer gehabt, einige waren verklemmt und unsicher, andere wie stürmische Bullen gewesen. Doch Julian war anders, davon war sie überzeugt; bestimmt würde sie bald in seinem Bett landen. Sie fühlte sich auf unerklärliche Weise zu ihm hingezogen. So sehr, dass sie jede Vernunft außer Acht ließ. Doch so sehr sie auch mit ihm ins Bett wollte, in ihrem Hinterkopf ertönte eine kleine warnende Stimme.
Sie war nicht ehrlich zu ihm gewesen. Er war nicht der erste Mann, den sie in einer Bar aufgegabelt hatte. Wirklich nicht! Doch während sie mit anderen Männern nichts anderes als einen ausgelassenen Abend ohne jede Verpflichtung suchte, wollte sie von Julian mehr. Genevieve wusste nicht warum – sie kannte ihn kaum –, aber es war so. Sie stellte sich vor, mit ihm Kaffee zu trinken, ein gemeinsames romantisches Abendessen, lange Spaziergänge am Strand – all die kitschigen Unternehmungen, die sie schon in Hunderten von Frauenfilmen gesehen hatte. Sie konnte sich auch vorstellen, wie er den Esstisch abräumte, ihr die Kleider vom Leib riss, sie aufs Bett warf und sie nahm. Doch wenn sie ihm heute in allem nachgab, gäbe es keine Blumen, keinen Konfekt, er würde sich nicht um sie bemühen müssen. Es verwirrte sie, dass sie sich zu so einem frühen Zeitpunkt schon ein Happy End vorstellte. Doch irgendetwas an Julian ließ ihr Herz lichterloh brennen.
Einen Augenblick lang erwog sie eine glaubhafte Entschuldigung, warum sie wieder losmüsse. Doch als sich die Aufzugtür öffnete, hatte Julian seine Arme schon wieder um sie gelegt. Dieses Mal küsste er sie sanft und innig, wie bei einem ersten Date, und nichts erinnerte an seinen letzten Kuss.
»Willkommen in meiner bescheidenen Hütte.«
Das weiträumige Loft war alles andere als bescheiden, sondern sah aus wie ein Cover von House & Garden. Von den brasilianischen Kirschholzböden, den Arbeitsplatten aus Granit und der Gourmetküche bis hin zu der Einrichtung von Ethan Allen wirkte alles hier wie aus einem hippen Loft in SoHo, New York.
»Bescheiden ist nicht gerade das Adjektiv, das mir zu dieser Wohnung einfällt«, meinte Genevieve.
»Sie ist charmant, nicht wahr? Wie wäre es mit einem kleinen Bailey’s oder einem Grand Marnier? Gegen die Nervosität?«
Das würde sie ganz sicher vertragen. Sie erinnerte sich daran, was er ihr über Alkohol und sein Verhalten gestanden hatte.
»Trinkst du auch etwas?«
»Ich habe mein Limit schon überschritten.«
»Wenn das so ist, hätte ich gern einen ganz kleinen Bailey’s, bitte. Auf Eis.«
Julian deutete auf das viktorianische Sofa. »Mach es dir bequem, während ich die Drinks hole.«
Er ging an seine Bar in der Küche, wo er eine große Auswahl an Wein und Likören bereithielt. Julian stand mit dem Rücken zu ihr, während er sich an ihrem Drink zu schaffen machte, und redete über seine Schulter mit ihr. »Möchtest du etwas zu knabbern – Crackers und Käse, ein paar knusprige Bruschetta oder Schokolade von Godiva?«
»Mmmm. Wer könnte bei Godiva schon nein sagen?«
Er gab einige Eiswürfel in einen Cognacschwenker, goss Bailey’s darüber und rührte ihren Drink gut um, um sicherzugehen, dass sich das starke Betäubungsmittel verteilte. Er setzte sich neben sie aufs Sofa, gab ihr den Drink und legte die Schachtel mit den Trüffeln auf den Wohnzimmertisch. Dann prostete er ihr mit einem Glas sprudelndem Mineralwasser zu.
»Auf dich, Genevieve. Mögen all deine Träume wahr werden.«
Julian stand über Genevieve gebeugt und war beunruhigt, dass sie immer noch fest schlief. Sie hatte sich überhaupt noch nicht gerührt. Hatte er sich bei der Menge des Betäubungsmittels verrechnet? Als er bei ihr nach Lebenszeichen sehen wollte, stöhnte sie, drehte ihren Kopf und öffnete die Augen.
»Willkommen zurück«, sagte Julian. Er lächelte herzlich, wandte sich dann ab und stellte den Regler am Infusionsbeutel neu ein. Anschließend setzte er sich auf die Bettkante. Genevieve drehte ihren Kopf von Julian weg, und er bemerkte, dass sie die Videokamera auf dem Stativ betrachtete.
»Warum tust du … das?«, flüsterte sie kaum hörbar.
»Ich habe keine Wahl, Genevieve.«
»Du … hast eine Wahl. Du kannst diese verdammten Fesseln durchschneiden … mir meine Kleider geben … und mich gehen lassen.«
»Ich befürchte, wir haben den Point of no Return schon hinter uns gelassen.«
»Ich verstehe nicht, was du damit meinst.«
»Das Schicksal nimmt schon seinen Lauf.«
Er sprach in Rätseln. »Was hast du mit mir gemacht … während ich ohne Bewusstsein war?«
»Ich habe dich ausgezogen und mit einem Laken zugedeckt.«
»Du hast mich vergewaltigt, nicht wahr? Dich dabei gefilmt … wie du mich gefickt hast.«
»Ich bin kein Vergewaltiger.«
»Wieso bin ich dann nackt?«
»Das ist komplizierter.«
»Du bist ein verdammter Lügner!«
»Wenn ich dich vergewaltigt hätte, würdest du es wissen. Würdest du es nicht spüren, wenn deinem Körper Gewalt angetan worden wäre?«
»Ich kann nicht einmal geradeaus sehen. Wie sollte ich dann wissen, ob du …?«
»Deine Wut macht alles nur noch schwieriger.«
Genevieve fing an zu schluchzen. »Bitte … tu mir nichts. Bitte lass mich gehen.«
Er erhob sich und ging in eine Ecke des Raums. Einige Minuten später kehrte er zu ihrem Bett zurück, wobei er einen Monitor auf einem dreibeinigen Ständer neben sich her schob.
»Ist das ein … Herzmonitor?«, wollte sie wissen.
Er setzte sich auf die Bettkante und streichelte sanft ihren Arm. »Hast du schon mal den Ausspruch gehört: ›Das Wohl der Allgemeinheit ist wichtiger als das Wohl des Einzelnen‹?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Spock sagte das in einem der Star-Trek-Filme. Aber er hat abgekupfert, denn genau das Gleiche, nur viel komplexer und viel philosophischer, hat Aristoteles schon vor Tausenden von Jahren gesagt.«
»Aber was soll der Spruch von Spock überhaupt?«
»Leider stehst du hier für den Einzelnen, Genevieve.«
2 Sami Rizzo hob ihr Weinglas und prostete Alberto Diaz zu. »Auf dich, mein Lieber.«
Er hob auch sein Glas und stieß vorsichtig mit seinem alkoholfreien Bier gegen Samis Glas mit Merlot. »Ich kann nicht glauben, dass wir schon seit zwei Jahren zusammen sind.«
Sie fasste über den Tisch und legte ihre Hand auf seine. »Bereust du es?«
»Eigentlich nur, dass ich mich dir nicht schon früher erklärt habe. Wir sollten schon unser viertes gemeinsames Jahr feiern.«
»Alles steht und fällt mit dem richtigen Zeitpunkt. Und deiner war perfekt. Früher wäre ich für mehr als eine Freundschaft nicht bereit gewesen.«
»Ich wünschte, ich könnte dir mit einem Glas Wein zuprosten«, meinte er.
»Ich befürchte, dass du und der Alkohol nie wieder Freunde werdet.«
»Alkohol und ich waren niemals Freunde.«
Wenn er daran dachte, was er ihr gleich erzählen wollte, hätte Al gern einen kräftigen Drink vor sich gehabt. Seit Sami von Simon, dem Serienkiller, in seinem Erlösungsraum als Geisel gehalten und dort wie vier andere Frauen gekreuzigt werden sollte, hatten Al und sie vereinbart, niemals wieder von Simon zu sprechen.
Doch obwohl sie sich bemüht hatten, die traumatischen Nachwehen in den Begriff zu bekommen, litt Sami immer noch unter heftigen Alpträumen. Allerdings hatte die Häufigkeit enorm abgenommen – dank eines Jahres intensiver Therapie –, doch es verging keine Woche, in der Sami nicht mitten in der Nacht in kalten Schweiß gebadet hochfuhr und hemmungslos am ganzen Körper zitterte. Sie und Al hatten das schon oft genug gemeinsam durchgestanden. Die Erinnerung an ihre Atemnot, als sie an diesem Kreuz hing und ihr Herz wie verrückt hämmerte. Al fragte sich, wie oft sie immer wieder den kalten Stahl fühlte, der durch ihre Handgelenke geschlagen wurde. Wie oft die Träume ihr vorgaukelten, dass jemand Nägel durch ihre Füße trieb? Auch nach über hundert Therapiesitzungen hatte sie noch einen weiten Weg vor sich.
Seit mehreren Tagen hatte Al vor, ihr Versprechen zu brechen und Sami zu fragen, ob sie die Neuigkeiten gehört hatte. Es war überall in den Zeitungen, und jeder Fernsehsender berichtete darüber, aber sie hatte es noch nicht erwähnt. Es war durchaus möglich, dass ihr voller Terminkalender sie vor aktuellen Ereignissen abschirmte. Sie hatte vier anspruchsvolle Seminare an der San Diego University belegt, kümmerte sich um ihre Tochter und verbrachte viel Zeit mit ihrer Mutter, der es in letzter Zeit nicht besonders gut ging. Doch diese Neuigkeit würde Sami höchstwahrscheinlich interessieren.
»Hast du dir in letzter Zeit die Nachrichten angesehen?«, fragte Al.
»Wann denn? Ich habe ja kaum Zeit, auf die Toilette zu gehen. Und niemand weiß das besser als mein schrecklich vernachlässigter Geliebter.«
Er musste nicht daran erinnert werden. Sex hatten sie nicht mehr gehabt seit … Wie lange eigentlich, einem Monat, sechs Wochen? Und so sehr Al Sami auch liebte, sie anbetete, dieser platonische Aspekt ihrer Beziehung fing langsam an, ihren Tribut zu fordern. Angelina schlief tief und fest und wachte eigentlich kaum einmal mitten in der Nacht auf. Und da sie heute ihren zweiten Jahrestag gefeiert hatten, hoffte Al darauf, dass sie den Rest des Abends im Bett verbringen würden.
»Simon hat auf eine Berufung verzichtet«, platzte Al heraus. »Hat irgendeinen Schwachsinn erzählt, will bei einer höheren Macht Berufung einlegen.«
Sami starrte Al an, ohne ein Wort zu sagen.
»Normalerweise dauert es Jahre, bis ein Mörder hingerichtet wird, doch als Simon auf eine Berufung verzichtete, hatte Richterin Carter, eine Frau mit mehr Mumm als ein Gorilla, kein Problem damit, das Gesetz voll auszuschöpfen. Von ihr ist keine Gnade zu erwarten.«
»Tod durch Giftspritze?«, fragte Sami.
Al nickte.
Sie brauchte ein paar Minuten, um das Gehörte zu verdauen. »Das ist verdammt noch mal zu barmherzig. Der Kerl sollte für den Rest seines abartigen Lebens im Knast verrotten.«
»Es kann noch eine ganze Weile dauern, bis sie das Urteil vollstrecken.«
»Das kann man nur hoffen.«
»Es tut mir leid, dass ich unsere Abmachung gebrochen habe, aber …«
»Ich bin froh, dass du es mir erzählt hast.«
Sami entschuldigte sich, ging in die Küche, kam mit zwei dampfenden Tellern zurück und stellte sie auf den Tisch.
»Das sieht wunderbar aus«, meinte er. Er probierte einen Happen von dem Wolfsbarsch und gab ein anerkennendes Grunzen von sich. »Du hast dein Versprechen gehalten.«
»Welches Versprechen?«
»In nur zwei Jahren bist du von Tiefkühlpizza und chinesischem Fastfood zu wunderbarem selbstgekochten Essen übergegangen. Ich weiß nicht, wie du das schaffst mit deinem verrückten Terminplan.«
»Liebe lässt eine Frau eben über sich hinauswachsen.«
»Jetzt werde ich aber rot.«
»Du wirst rot, weil ich meine Tochter liebe?« Sami konnte ihr Lachen kaum unterdrücken.
Er lachte. »Ich bin froh, dass dein Arbeitspensum deinem Humor nichts anhaben konnte.«
»Hey, wenn ich meinen Sinn für Humor verlieren würde, hättest du nichts mehr zu lachen.«
Sie aßen zu Abend und unterhielten sich. Dann brachte Sami den Nachtisch – New-York-Cheesecake mit frischen Erdbeeren.
»Vermisst du die Polizeiarbeit?«, fragte Al.
Die Frage überraschte sie. »Mir reicht völlig, was ich bei dir mitbekomme.«
»Wirklich? Ich meine nur, du bist jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr bei der Mordkommission, willst du immer noch unbedingt Sozialarbeiterin werden?«
»Mein Blick auf die Sozialarbeit ist nicht mehr so ganz ungetrübt. Ich weiß, dass meine idealistischen Vorstellungen und die wirkliche Welt ziemlich auseinanderklaffen. Zwei meiner Professoren haben sich mehr als deutlich über die Herausforderungen geäußert, denen sich Sozialarbeiter stellen müssen. Und um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, ob ich mit dem ganzen politischen Bockmist umgehen kann.«
»Ich spiele jetzt mal den Advocatus Diaboli«, sagte er, »hast du denn nicht immer mit der Politik zu tun, egal, wo du arbeitest?«
»Das stimmt, aber ich habe als Detective meinen Beitrag dazu geleistet und gelernt, wie man das System bedient. Sozialarbeit ist dagegen noch unerforschtes Gebiet.«
Al half Sami beim Tischabräumen und das Geschirr in den Geschirrspüler zu sortieren. Als sie damit fertig waren, zog er sie zu sich heran und umarmte sie. »Das hört sich jetzt ein bisschen an wie ein Klischee, aber du bringst wirklich Licht in mein Leben.«
»Und du wirst dich niemals dafür entschuldigen, etwas so Liebes zu sagen.«
Er küsste sie sanft auf die Lippen und reichte ihr ein wunderschön eingewickeltes Geschenk. »Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag, mein Liebling.«
Sie sah es einen Augenblick lang an und wickelte es dann langsam aus. In der Samtschachtel fand sie ein diamantbesetztes Herz an einer Goldkette. »Ist das schön. Danke.« Sie schaute zu Boden und schüttelte ihren Kopf. »Mmh, und ich habe nichts für dich …«
»Lass uns ins Bett gehen und uns die ganze Nacht lang lieben.«
»Das ist eine wunderbare Idee.«
Genevieve beobachtete, wie Julian mehr Infusionslösung durch den Schlauch laufen ließ. Sie versuchte verzweifelt, sich zu wehren, doch da ihre Arme und Beine fest ans Bett gebunden waren, konnte sie nichts ausrichten. Schon Augenblicke nach ihrem ergebnislosen Bemühen, sich loszureißen, war ihr schwindelig und übel. Ihr Körper und Geist schienen zwischen Wachsein und Bewusstlosigkeit zu schweben. Julian befestigte sorgfältig die Elektroden des Herzmonitors, ironischerweise an Stellen, die ein Geliebter liebkosen würde: auf ihrem nackten Oberkörper, Handgelenken, Schulter und Knöcheln. Er schaltete den Herzmonitor ein, und Genevieve, die sich anstrengte, ihre Augen offen zu halten, konnte ihren Herzrhythmus auf dem Monitor verfolgen. Sie war sich nicht sicher, wie eine normale Herzfrequenz aussah, aber sie konnte gerade noch sehen, dass ihr Puls siebenundneunzig Mal in der Minute schlug.
Julian, der grüne Krankenhauskleidung trug, stellte die Videokamera an und stand am Bett neben einem kleinen Tisch mit allem möglichen Operationsbesteck. Er schätzte diese Qualitätsinstrumente. Für manche waren sie einfacher kalter Stahl, doch einem Chirurgen waren sie heilig. Er betrachtete jedes einzelne prüfend und vergewisserte sich, alles Nötige dort liegen zu haben. Er überprüfte bei Genevieve, ob die Narkose auch wirkte und sie nicht bei Bewusstsein war. Dann erst griff er nach einem Skalpell und verharrte einen Augenblick, bevor er den kritischen ersten Schnitt an ihrem nackten Körper setzte.
Er stellte fest, dass er gewisse Einschränkungen hinnehmen musste. Im Operationssaal eines Krankenhauses würden ihm andere Chirurgen zur Hand gehen, ein Anästhesist, mehrere Krankenschwestern und ein Operationstechniker. Hier war er völlig allein. Und in seinem Loft gab es natürlich keinen sterilen Bereich. Auf der anderen Seite müsste er sich darum keine Gedanken machen, denn eine Infektion wäre völlig unerheblich, da keines seiner Studienobjekte die Experimente überleben würde.
Von nun an würde sich alles, was Julian in seinem Leben, seiner Karriere, seinen Beziehungen zu Familie und Freunden lieb und teuer war, für immer ändern. Und er würde gegen den hippokratischen Eid verstoßen. Wenn er erst einmal den Mut gefunden hatte, mit dem Skalpell gegen ihr Brustbein zu drücken, gab es kein Zurück mehr.
Er zwang sich dazu, sich auf das wichtigste Ziel dieser Forschungsstudie zu konzentrieren: die weltweite Anerkennung. Er wollte als Pionier unter den Chirurgen gelten.
Er betrachtete ihren perfekt geformten Körper, ihre Verletzlichkeit, die sanften Kurven, die von der Schulter zu den Brüsten bis zu den Hüften verliefen, den sorgfältig enthaarten Intimbereich und – zog das Skalpell zurück. Auch wenn es gegen jeden Rest von Vernunft sprach, der ihm irgendwo noch geblieben war, so begehrte er sie doch. Oh, und wie sehr er sie begehrte. Wenn er mit ihr schlief, müsste er sich nur mit seinem Gewissen auseinandersetzen.
Ihm fiel die Ähnlichkeit erst jetzt auf, doch Genevieve erinnerte ihn an ein Mädchen, mit dem er im College befreundet war. Nun ja, »befreundet« ist kaum der richtige Ausdruck. Sie war in die zwölfte Klasse gegangen, er in die zehnte. Eva Sowieso. Eine Studentin aus Island. Ihren Nachnamen hatte er nie aussprechen können. Tatsächlich hatte niemand ihn aussprechen können, denn er war so lang wie ein ganzer Straßenzug.
Eines Tages änderte sich alles, als er in Evas Wohnung kam und sie im Bett vorfand, die Handgelenke mit Satinbändern an das Kopfende des Bettes gebunden. Bis heute hatte er keine Ahnung, wie sie das ohne jede Hilfe geschafft hatte. Er hatte nie gefragt. Und sie hatte es ihm nie erzählt.
»Fick mich«, hatte sie gesagt. »Fick mich hart.«
Ihre Aufforderung, so simpel wie direkt, katapultierte seine Lust in Höhen, die er nicht für möglich gehalten hätte. Sogar jetzt noch klangen diese Worte in seinem Kopf nach wie eine magische Symphonie. Er konnte sich nicht daran erinnern, jemals so erregt gewesen zu sein. Er war wie auf einer Überdosis eines exotischen Aphrodisiakums. Erregter als jemals zuvor fiel Julian heftig über sie her und genoss jede einzelne Minute. Und Eva, die stöhnte wie eine verwundete Katze, musste es genauso genossen haben. So umwerfend die Erfahrung auch gewesen war, der bloße Gedanke, sie auf jede nur erdenkliche Weise zu nehmen, dass er völlige Kontrolle über sie hatte, vollkommen egoistisch sein konnte und, wenn er wollte, nur sich selbst zu befriedigen brauchte, machte ihm Angst; er befürchtete, niemals wieder herkömmlichen Sex genießen zu können.
Aber da gab es noch etwas. Die ganze Zeit, bei jedem Stoß, sprach er innerlich diese Worte: »Dies-ist-für-dich-Rebecca. Dies-ist-für-dich-Marianne.« Es war wie ein stiller Triumph, als ob er mit ihnen abrechnete.
Julian zwang seine Gedanken wieder in die Gegenwart und fand die Kraft, der Versuchung zu widerstehen. Er drückte das Skalpell gegen Genevieves Brustbein und setzte den Schnitt. Dann griff er nach der Kreissäge, wie so oft in seinem Beruf, wenn er Operationen durchführte. Als er halb durch das Brustbein war, setzte er die Säge ab. Ihm war so schlecht, dass er versuchte, ins Bad zu kommen, doch er übergab sich direkt auf den Boden. Mit dieser Reaktion hatte er nicht gerechnet. Er fühlte sich wie ein Anfänger bei seiner ersten Operation am offenen Herzen. Wie viele Brustkörbe hatte er schon geöffnet? Mehr als er sich erinnern konnte. Wie viele Herzen hatte er schon in der Hand gehalten? Aber das hier war anders. Die Befürchtung, sie könnte verbluten, gab ihm die Kraft fortzufahren.
Das ist viel schwieriger, als ich gedacht habe.
Er vollendete den Schnitt durch das Brustbein, setzte sorgfältig den Rippenspreizer ein und kurbelte den Brustkorb auf. Dann öffnete Julian ihre Vene oben am Oberschenkel und schob einen Katheter ein, den er vorsichtig in Richtung Herz schob. Als er die richtige Stelle erreicht hatte, injizierte er eine Mischung aus Epinephrin und Kaliumchlorid in den Infusionsschlauch und schickte einen hochfrequenten elektrischen Impuls durch den Katheter. Nach einigen Minuten entwickelte ihr Herz eine sporadische Arrhythmie, die kurz darauf in Vorhofflimmern überging.
Nun kam der knifflige Teil. Er musste jetzt genau den Bereich des Herzens finden, wo die durch die Medikamente und den Katheter verursachten falschen elektrischen Impulse herkamen. Unter normalen Umständen würden bei einem Vorhofflimmern zwei, manchmal auch drei Chirurgen die rettende Operation durchführen, doch Julian musste nun alles allein schaffen. Da er sich wegen der Langzeitkomplikationen aber keine Sorgen zu machen brauchte, konnte er es sich leisten, ohne medizinische Einschränkungen kühn zu experimentieren. Sein Hauptziel war es, sie so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Er entfernte den Katheter und führte stattdessen einen anderen Katheter ein, um eine Hochfrequenzablation durchzuführen. Er vergewisserte sich, dass der automatische Defibrillator in Reichweite lag.
»Vergib mir, Genevieve, aber das Wohl der Allgemeinheit ist wichtiger als das Wohl des Einzelnen.«
Das war von nun an sein Credo.
3 Als das Telefon morgens um Viertel vor vier klingelte, griff Sami völlig schlaftrunken nach dem Hörer, wobei sie fast den Radiowecker vom Nachttisch schubste.
»Hallo«, flüsterte sie heiser.
»Sami? Hier ist Captain Davison. Tut mir leid, so früh anzurufen, aber ich muss mit Al sprechen.«
Sie hatte seit Monaten nicht mit Captain Davison gesprochen, aber für Small Talk war jetzt nicht die Zeit. Al schnarchte wie ein Grizzlybär im Winterschlaf, er war nicht wach geworden. Sie griff nach seiner Schulter und schüttelte ihn.
Al stöhnte, wachte aber nicht auf. Stattdessen schnarchte er weiter.
Sie schüttelte ihn wieder, jetzt ein wenig heftiger. »Al, aufwachen.«
»Was zum Teufel ist los?«
Sie reichte Al das Telefon und rollte sich wieder auf ihre Seite. »Es ist der Captain.«
Er brauchte ein paar Sekunden, um sich zu sammeln, fuhr mit der Hand durch seine Haare und war sich sicher, dass der Captain ihn nicht anrief, um ihn zu einem Frühstück noch vor Tagesanbruch einzuladen.
»Was gibt es zu dieser unchristlichen Zeit?«, wollte Al wissen.
»Ziehen Sie sich an, und schieben Sie Ihren Hintern zum Mission Bay Park«, ordnete der Captain an.
»Für ein Picknick ist es noch ein bisschen früh.«
»Hören Sie mit der Klugscheißerei auf, und machen Sie, dass Sie auf den Parkplatz östlich vom Touristeninfocenter kommen. Wissen Sie, wo das ist?«
Jetzt war Al hellwach. »Was ist denn los?«
»Mord ist los.«
Dann war da nur noch das Freizeichen. Er zog sich so schnell wie möglich im Dunkeln an, sehr darum bemüht, Sami nicht zu stören. Aber kaum war er halb angezogen, machte sie das Licht auf ihrem Nachttisch an.
»Was ist los?«
»Kaum Informationen.« Selbst wenn er alle schrecklichen Einzelheiten wüsste, hätte er sie nie weitergegeben. Während der letzten zwei Jahre war er ein Meister darin geworden, Sami alles Mögliche über seine Mordermittlungen zu erzählen, ohne ihr wirklich etwas zu erzählen. Es war wie ein Ausbildungscamp für Politiker.
»Gibt es eine Leiche?«, wollte Sami wissen.
»Bin mir nicht sicher. Ich muss los. Versuche noch etwas zu schlafen.«
»Das wird wohl kaum noch was werden.« Sie schlug die Decke zurück, stand auf und streckte sich. Ihre täglichen Dehnungsübungen halfen ihr sehr bei ihren Rückenproblemen. Sie stand vor Al, als er hektisch sein Hemd zuknöpfte. »Letzte Nacht war toll.«
»Hast du was anderes von einem heißblütigen Latino wie mir erwartet?«
Sie lächelte. »Sollte ich nicht hier sein, wenn du nach Hause kommst, rufe mich auf dem Handy an. Ich werde Angelina etwas später zu meiner Mutter bringen.«
»Warst du nicht erst gestern bei ihr?«
»Ich mache mir Sorgen um sie. Sie bekommt kaum Luft, wenn sie einfach nur auf der Straße läuft. Und ihr Gedächtnis? Ich bin schon überrascht, wenn sie mich überhaupt erkennt.«
Al legte sein Schulterholster um und schlüpfte in seine Lederjacke. »War sie bei ihrem Arzt?«
»Er hat ihr neue Medikamente verschrieben, aber ich bin nicht sicher, ob die viel bringen. Ich mache mir Sorgen, weil sie alleine wohnt. Wenn mitten in der Nacht etwas passiert …«
»Vielleicht sollte sie eine Weile bei uns wohnen.«
Sein Vorschlag überraschte sie. »Und du hättest kein Problem damit?«
»Solange wir ein Schloss an unserer Schlafzimmertür haben, stört es mich nicht.«
Sie streichelte sein Gesicht mit beiden Händen und küsste ihn zärtlich. »Du bist ein wirklicher Schatz.«
Gerade als er zur Tür wollte, hielt sie ihn an der Schulter zurück. »Du musst mich nicht mehr vor dem Schwarzen Mann beschützen, Al. Ich bin ein großes Mädchen, du musst nicht aufpassen, was du mir alles erzählst. Ich kann damit umgehen.«
»Es gibt nichts zu erzählen. Noch nicht.«
»Na gut, aber wenn ja, dann hab keine Angst, mir davon zu berichten.«
Als Julian wieder bei sich zu Hause war, stürmten Gedanken an Genevieve auf ihn ein. Einige waren erregend, andere bedrückend. Sie war seine Erste gewesen, eine Jungfernreise in eine unbekannte Welt. Ganz egal, wie sehr er versucht hatte, seine Reaktion vorherzusagen oder sich vorzustellen, was auf ihn zukommen würde, nichts hätte ihn auf den überwältigenden Ansturm widersprüchlicher Gefühle vorbereiten können, die er jetzt empfand. Einerseits kam er sich wie ein Pionier vor, ein Mann, der vielleicht bald Medizingeschichte schrieb; andererseits fühlte er sich wie ein Monster, ein Heuchler, ein Mörder, der unschuldige Menschen auf dem Gewissen hatte.
Seine Situation war paradox. Als erfahrener Herzchirurg hatte er viele Menschenleben gerettet und nur wenige verloren. Doch er konnte Genevieve nicht als normale Patientin betrachten. Wenn auch unfreiwillig stand sie nun für einen grundlegend ersten Schritt in seiner Forschungsstudie. Die Daten, die er sammeln konnte, bevor all seine Bemühungen, sie wiederzubeleben, gescheitert waren, machten ihm schmerzlich deutlich, dass die Antworten, nach denen er suchte, nur am lebenden Subjekt zu finden waren. Er musste der Global A-Fib Foundation unzweifelhaft beweisen, dass man durch die Modifizierung der Katheterablation sowie der Maze-III-Operation das Vorhofflimmern mit einer Erfolgsquote von 95 Prozent in den Griff bekam. Von Beginn des Projektes an hatte er befürchtet, dass kontrollierte Testreihen und die Arbeit an Leichen niemals die Daten liefern würden, die er bräuchte, um seine Forschungsstudie abzuschließen. Genevieve hatte seine Theorie nun bestätigt.
Wie in Trance wanderte Julian in die Küche, er fühlte sich schwach, und ihm war beklommen zumute. Er stellte sich hinter seine Frau, die am Küchentresen einen Apfel schnitt, und küsste Nicole auf den Hals, mehr aus Gewohnheit als mit Absicht. Sie drehte sich um und schaute ihn an.
»Herrje«, sagte Nicole, »du siehst aus wie ein Gespenst. Bist du etwa krank?«
»Nur ein wenig vergrippt.«
»Und dann küsst du mich? Halt dich bloß von den Mädchen fern. Das Letzte, was ich jetzt noch brauche, sind ein paar kranke Kinder.«
»Entschuldige«, erwiderte er. Seit einiger Zeit schien »entschuldige« sein meistbenutztes Wort zu sein. Zumindest wenn er mit Nicole zusammen war.
»Ich muss dich etwas fragen«, meinte Nicole. »Es ist ein heikles Thema, ich weiß, aber was würdest du davon halten, wenn du das Vorhofflimmern-Projekt an einen deiner Kollegen abgeben würdest?«
»Willst du mich auf den Arm nehmen?«
»Ich möchte wirklich, dass du darüber nachdenkst.«
»Kannst du dir nicht vorstellen, wie blöd ich vor der gesamten Medizinerzunft dastehen würde?«
»Was ist wichtiger, dein kostbares Ego oder deine Familie?«
Julian wollte sich von humanitären Motiven leiten lassen, von dem Bedürfnis, die Welt zu retten. Doch in Wirklichkeit war sein Bemühen, das Vorhofflimmern weltweit ausrotten zu helfen, bloß eine nebensächliche Veranstaltung. Nein, so sehr es sein Gewissen auch belastete, diese Forschungsstudie war genau das Richtige für ihn: der Ruhm, die Anerkennung, sein Foto auf der Titelseite des American Journal of Medicine und vielleicht sogar eine Nominierung für den hochangesehenen Nobelpreis für Medizin. Oh, wie war er doch versessen auf Anerkennung und Prestige.
»Du verlangst von mir, zwei Jahre, in denen ich mir den Arsch aufgerissen habe, einfach wegzuwerfen? Zwölf Stunden Arbeit am Tag. Kein Urlaub – nicht mal ein langes Wochenende in Big Bear. Wie meinst du, würde es mir denn gehen, wenn ich jetzt aufgebe? Willst du mich verscheißern? Ich bin fast am Ziel, und du willst, dass ich das Schiff verlasse?«
»Dann hat dich der Brief von der Global A-Fib Foundation nicht entmutigt?«
»Natürlich hat er das. Hat mich fertiggemacht. Aber hat mir auch Hoffnung gegeben, weil er mir klargemacht hat, dass ich so nah dran bin.« Er hielt seine Hand hoch und gestikulierte mit Daumen und Zeigefinger.
»Hey, Julian, es ist deine Karriere. Tu, was auch immer du für richtig hältst. Zur Hölle mit mir und zur Hölle mit den Mädchen. Aber falls du Unterstützung brauchst, dann habe ich zwei Worte für dich. Und die sind ganz sicher nicht ›Fröhliche Weihnachten‹.«
Um 4:35 Uhr fuhr Al auf den Parkplatz in der Nähe des Touristeninfocenters am Mission Bay Park, wo hektisches Treiben herrschte. Rote Rundumleuchten blitzten, überall war gelbes Absperrband zu sehen, Kameras leuchteten die Gegend aus, Detectives liefen herum, und die Forensiker drängten sich um eine Leiche, wie Al annahm. Sogar ein Nachrichtenübertragungswagen mit einer Satellitenschüssel auf dem Dach stand in einer Ecke des Parkplatzes. Wie konnten sie so schnell von diesem Mord erfahren haben, fragte er sich. Die Morgenluft war jetzt im Spätfrühling immer noch frisch. Auf den Wellen der Bucht tanzte das sich reflektierende Licht des Vollmonds.
Al stieg aus seinem Wagen und ging zu Captain Davison, der inmitten von etwa einem Dutzend Arbeitsbienen leicht auszumachen war. Wer sonst hätte so früh am Morgen schon einen Anzug an, eine Zigarette in der einen Hand und einen Becher Kaffee in der anderen? Doch den Captain hier anzutreffen überraschte Al. Davison arbeitete normalerweise die Schicht von neun bis fünf. Ihn noch vor Sonnenaufgang an einem Tatort zu sehen, würde bedeuten, dass es sich um keinen normalen Mordfall handelte. Obwohl Al eigentlich an einem Mordfall noch nie etwas normal finden konnte.
Wie immer zog Davison an seiner Zigarette mit der Leidenschaft eines Mannes, der seinen letzten Atemzug macht. »Tut mir leid, Ihren Schönheitsschlaf unterbrochen zu haben, Detective Diaz.«
»Würde ich um nichts in der Welt versäumen.« Al beobachtete drei Forensiker bei der Untersuchung der sterblichen Überreste. Er bekam ein wenig Qualm von Davisons Zigarette ab und hätte liebend gern einen Zug genommen. »Haben sie die Leiche identifiziert?«
Der Captain schüttelte den Kopf. »Das ist irgendwie unheimlich. Das Opfer ist nicht nur vollständig bekleidet, sie sieht auch noch aus, als ob sie in die Oper gehen wollte. Mir ist noch nie ein so perfekt aussehendes Opfer untergekommen.«
»Und was halten Sie davon?«
»Ich habe nicht die leiseste Ahnung.«
»Ist sie angegriffen worden?«
»Betsy arbeitet gerade daran.«
»Todesursache?«
»Ihr Brustbein war in der Mitte geteilt, und es sieht aus, als ob ihre Rippen mit so einem Spreizer auseinandergezogen worden sind, wie sie Chirurgen bei Operationen am offenen Herzen benutzen.«
Al wurde kalt, und er zog den Reißverschluss seiner Jacke hoch. »Wer hat die Leiche gefunden?«
»Ein paar Teenager.« Der Captain deutete auf eine noch qualmende Feuerstelle in der Nähe des Wassers. »Ein Haufen Kids haben die Nacht durchgemacht. Lagerfeuer. Bier. Pot. Zwei der Jungs mussten pinkeln und haben die Leiche in der Nähe der Toiletten gefunden.«
Al war klar, dass es zu seinem Job gehörte, die Leiche zu untersuchen. Er hatte schon Dutzende von ihnen gesehen. Erschossen. Erstochen. Zu Tode geprügelt. Zerstückelt. Aber seit Samis Martyrium vor zwei Jahren war es für ihn zusehends schwieriger geworden, Mordopfer zu untersuchen, was für einen Detective bei der Mordkommission genauso absurd war wie für einen Taucher die Angst vor Wasser.
»Ich möchte, dass Sie den Fall übernehmen«, sagte der Captain.
Als erste Reaktion wäre es gewesen, »Nie im Leben« zu entgegnen, doch eine Diskussion wäre sinnlos gewesen. »Mit wem werde ich zusammenarbeiten?«
»Ich denke da an Ramirez. Aber ich will, dass alle bei der Ermittlung mitarbeiten.«
»Kann ich etwas dazu sagen?«
»Wir sind hier nicht in einem demokratischen Verein.«
»Kann ich wenigstens in meinem Fall plädieren?«
Der Captain verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich höre.«
»Ramirez ist nutzlos. Seit seiner Beförderung zum Lieutenant sitzt er sich seinen Hintern in seinem gemütlichen Büro platt. Er ist kein Cop mehr, der in die erste Reihe gehört.«
»Ihre Bedenken sind registriert.«
Al hasste es, wie ein Kind behandelt zu werden.
Der Captain warf seine Zigarette auf den Rasen und zerdrückte sie mit seinem Schuh. »Wie geht es Sami denn so?«
»Sie behauptet sich.«
»Habe sie lange nicht mehr gesehen. Früher hat sie ab und zu mal auf dem Revier vorbeigeschaut. Mag sie uns nicht mehr?«
»Nehmen Sie es nicht persönlich, Captain. Wir wohnen zusammen, und ich muss mich inzwischen mit ihr verabreden, wenn ich sie zum Abendessen sehen will.«
Der Captain durchwühlte seine Taschen nach einer weiteren Zigarette. »Wie geht es denn so mit euch beiden?«
»Wir haben auch unsere kleinen Reibereien, aber eigentlich läuft’s bis jetzt ganz gut.« Das war nur die halbe Wahrheit, denn in letzter Zeit war er sich nicht sicher, was er von ihrer Beziehung halten sollte. So komisch es sich auch anhörte, er liebte sie, war sich aber nicht im Klaren darüber, ob er mit ihr zusammenleben wollte.
»Sie haben das große Los gezogen. Versauen Sie es sich nicht.«
»Ich versuche mein Bestes, Captain.«
Al ging zu der Leiche, wobei ihm unwohler war als sonst. Der Körper war vom Hals bis zu den Knöcheln mit einem weißen Laken abgedeckt und lag mit dem Gesicht nach oben auf dem frisch gemähten Rasen. Er ging mit einer Taschenlampe in der Hand neben der Leiche in die Knie und betrachtete die sterblichen Überreste der Frau. Ihr blondes Haar wirkte wie eben frisch frisiert. Nicht eine Strähne lag verkehrt. Doch für so eine junge Frau – sie schien in den Zwanzigern zu sein – kamen ihm die dunklen Ringe und die Tränensäcke unter ihren Augen sonderbar vor. Er war so auf sie konzentriert, dass er zusammenfuhr, als ihn jemand an der Schulter berührte. Betsy von der Spurensicherung stand über ihm und lächelte. »Hey, ein bisschen schreckhaft heute, Diaz?«
»Ich bin immer angespannt, wenn ich neben einer Leiche knie«, sagte er und erhob sich leise stöhnend. »Meine alten Knochen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.«
»Aha«, meinte Betsy, »aber dein Gesicht ist immer noch ganz hübsch.«
»Genau das ist es, was ein vierzig Jahre alter Mann hören will«, erwiderte Al und sehnte sich nach einer entspannenden Zigarette. Das Rauchen hatte er schon vor ein paar Jahren aufgegeben, aber jetzt würde er hundert Dollar für eine Zigarette geben – fünfzig für einen langen Zug. »Was hast du bis jetzt herausgefunden?«
»Das ist ziemlich merkwürdig«, meinte Betsy. »Die Leiche war komplett bekleidet, als wir am Fundort ankamen. Und wenn ich sage ›komplett‹, meine ich richtig aufgetakelt – einschließlich ziemlich teurer Stöckelschuhe.«
»Wie teuer?«
»Nun denn, sie trug ein Cocktailkleid von Carolina Herrera – das wird dir nichts sagen, aber das verdammte Preisschild hing noch dran. Es war an einem Knopf an der unteren Seite des Saums befestigt. Es stammt von Saks Fifth Avenue, und nun rate mal, was es gekostet hat?«
»Null Ahnung.«
»Fünf Mäuse fehlen an dreitausend Dollar.«
Er brauchte eine Minute, um das zu verarbeiten. »Und was schließt du daraus?«
»Sofern sie keine reichen Eltern hat oder im Lotto gewonnen hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das Kleid gekauft hat.«
»Also denkst du, dass unser Typ ihren verdammten Brustkorb aufgestemmt hat, dem armen Ding Unglaubliches angetan hat und sie dann in ein Dreitausend-Dollar-Kleid gesteckt hat?«
»Sieht so aus. Aber das ist nur ein Teil der mysteriösen Geschichte. An den Schuhen hing kein Preisschild, aber es sind Jimmy Choos, und ich möchte wetten, die haben an die tausend gekostet.«
»Ich fasse es nicht. Er bringt sie um und gibt dann vier Riesen für Klamotten aus?«
»Das ist ganz sicher merkwürdig«, erwiderte Betsy.
»Sieht so aus, als ob er nach dem Mord schwere Gewissensbisse gehabt hätte.«
»Entweder das, oder er will uns eine versteckte Botschaft zukommen lassen.«
»Irgendwelche Fingerabdrücke auf dem Preisschild?«
»Ist blitzblank.«
»Sonst noch etwas?«
»Ich glaube nicht, dass er sie vergewaltigt hat, aber das kann ich erst bei der Autopsie feststellen.« Sie schüttelte ihren Kopf. »Ich habe keine Ahnung, warum er sie auf diese Weise getötet hat. Das ist mir noch nicht untergekommen.«
Al ging wieder in die Knie und enthüllte langsam ihren Oberkörper. »Das ist verdammt noch mal nicht wahr.« Er musste an den letzten Serienkiller denken und wie er seinen Opfern die Herzen als Trophäen entnommen hatte. »Er hat ihren Oberkörper geklammert?«
»Sehr genau und ordentlich.«
»Gibt es irgendwelche Blutergüsse oder Wunden?«
»Das ist das Verrückte. Ihr restlicher Körper – soweit man erkennen kann – scheint nicht angetastet zu sein. Aber ich kann das wirklich erst abschließend sagen, sobald wir sie auf einem Untersuchungstisch haben.«
»Ruf mich an, sobald du einen vollständigen Bericht hast.«
»Mach ich, Detective.« Einen Augenblick lang herrschte betretenes Schweigen. »Grüß Sami von mir. Sag ihr, dass ich sie wirklich vermisse.«
4 Sami und Angelina waren noch vor dem Mittag bei Josephine zu Hause angekommen, gerade rechtzeitig zum Essen. Angelina liebte die Käsemakkaroni ihrer Großmutter, und Oma Rizzo hatte sie ihr versprochen. Da es mit der Gesundheit ihrer Mutter in letzter Zeit ziemlich bergab gegangen war, hatte Sami Gewissensbisse, weil sie ihre Mutter gebeten hatte zu kochen. Doch Sami kannte ihre Mutter nur zu gut. Josephine war eine toughe alte Frau, und es würde mehr als ein schwaches Herz und ein nachlassendes Gedächtnis brauchen, um sie aus dem Verkehr zu ziehen. Außerdem hatte Josephines Kardiologe gemeint, dass es sinnvoll wäre, ihre Mutter mit nicht zu anstrengenden Aufgaben zu beschäftigen. Und Sami wusste nicht, was ihrer Mutter mehr Spaß machte als zu kochen – besonders für Angelina.
Sie saßen zusammen am Küchentisch, Josephine hatte kaum einen Happen von ihren Käsemakkaroni gegessen. Angelina hatte alles aufgefuttert und leckte ihren Teller ab.
»Liebling«, meinte Sami, »wie oft habe ich dir schon gesagt, dass junge Damen ihren Teller nicht ablecken?«
»Aber Mami«, erwiderte die Sechsjährige, »ich bin doch noch ein kleines Mädchen. Können denn kleine Mädchen ihren Teller ablecken?«
Josephine sah Sami eindringlich an. »Lass sie doch. Sie muss sich bei mir nicht wie in einem Restaurant benehmen. Wenn sie den Teller ablecken möchte, lass sie machen.«
»Aber Ma …«
»Lass das ›aber Ma‹, Samantha Marie Rizzo. Kannst du dich noch daran erinnern, was du mit Eiscremeschüsseln gemacht hast, als du so alt wie Angelina warst? Du hast sie ausgeleckt und in den Küchenschrank zurückgestellt.«
»Das habe ich ganz sicher nicht gemacht.«
Josephine legte ihre linke Hand auf ihr Herz und hob die rechte Hand. »Gott ist mein Zeuge.«
Es gab keinen Grund, sich mit ihr zu streiten. Sami nahm an, dass es nur ein weiterer Beweis dafür war, dass ihre Mutter senil wurde. Josephine konnte sich an Sachen erinnern, die vor dreißig Jahren passiert waren, aber nicht an das, was sie gestern zum Frühstück gegessen hat. Der Doktor hatte Sami gewarnt, dass ihr Kurzzeitgedächtnis schnell schwinden würde. Und während der letzten Monate hatte sich der Zustand ihrer Mutter zusehends verschlechtert. »Hast du immer noch Schmerzen in der Brust und bist kurzatmig, Ma?«
»Es kommt und geht.«
»Nimmst du auch jeden Tag deine Medizin?«
»Wenn ich dran denke.«
»Deshalb habe ich dir doch die Wochen-Pillenbox besorgt. Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir darüber gesprochen haben, dass du sie immer sonntags auffüllst und die blaue Pille morgens und die weiße und die rosa Pille zum Abendessen nimmst?«
Josephine wedelte mit ihrem Arm, als ob sie nichts davon hielt. »Ich habe alles auf einen Zettel geschrieben, aber kann mich nicht daran erinnern, wo ich ihn hingelegt habe.«
»Ich werde es dir noch mal aufschreiben und es auf den Kühlschrank legen.«
Plötzlich wurde Josephine kreidebleich und griff sich an die Brust.
Sami sprang auf, wobei sie ihren Stuhl nach hinten umwarf. »Was hast du, Ma?«
»Mir sind die Käsemakkaroni nicht bekommen. Ich hätte wissen müssen, dass ich so fettes Essen nicht vertrage.«
»Aber du hast doch kaum etwas gegessen.«
»Mein Magen ist nicht mehr der alte.«
Sami konnte sehen, dass Josephine Mühe mit dem Atmen hatte und eindeutig litt. Schweiß lief von ihrer Stirn. Sami suchte hektisch in ihrer Handtasche nach dem Handy. »Ich rufe einen Notarzt.«
Josephine lehnte sich nach vorn, ihr Oberkörper lag fast auf dem Tisch. »Es ist alles in Ordnung. Das geht vorbei. Es ist nur der Magen.«
Sami achtete nicht auf sie und wählte den Notruf.
Al war auf dem Weg ins Revier, als Sami anrief. Er packte seine Magnetleuchte aufs Dach, stellte die Sirene an, machte kehrt und fuhr zum Saint Michael’s Hospital.
Nach weniger als zehn Minuten hielt er mit quietschenden Reifen genau vor der Notaufnahme, wo nur Krankenwagen halten dürfen. Er klappte die Sonnenblende mit dem Schild »Polizei im Einsatz« und dem Logo der Polizei von San Diego herunter. Er stürmte durch die Eingangstüren zum Empfang. Nach einer kurzen Unterhaltung verwies die Schwester Al auf den kleinen Warteraum vor der Notaufnahme.
Er konnte Sami sehen, die mit gesenktem Kopf und im Schoß gefalteten Händen in einer Ecke des dunklen Raumes saß. Das letzte Mal hatte er sie so verloren aussehend auf der Beerdigung ihres Exmannes Tommy DiSalvo gesehen. Angelina konnte er nirgends erblicken. Er ging langsam auf sie zu, räusperte sich ein paar Mal, um sie nicht zu erschrecken, setzte sich neben sie und legte ihr seinen Arm um die Schultern.
»Wie geht es ihr?«
Sie sah ihn mit dicken rotgeweinten Augen an. »Sie hatte einen Herzanfall. Sie machen gerade ein Angiogramm, um herauszufinden, ob es irgendwo Verstopfungen gibt. Sie haben noch nicht feststellen können, ob ihr Herz geschädigt wurde.«
Al küsste Sami auf die Wange. »Sie ist hart im Nehmen. Sie wird es schaffen.« Er hatte nicht das Gefühl, sie überzeugt zu haben. »Wo ist Angelina?«
»Emily passt auf sie auf.«
»Wo?«
»Im Haus.«
»Soll ich sie herholen?«
»Kein Ort für eine hyperaktive Sechsjährige. Außerdem liebt Angelina Emily.« Emily war Samis einzige Kusine. Sami griff nach Als Hand. »Kannst du bei mir bleiben?«
Er starrte auf seine abgewetzten Schuhe und schüttelte den Kopf. »Ich hasse es, Sami, aber ich muss …«





























