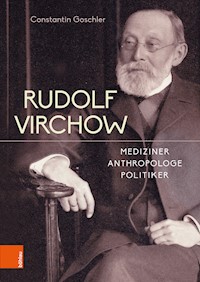26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Als 1950 das Bundesamt für Verfassungsschutz gegründet wurde, erwarteten sowohl die Alliierten als auch die Öffentlichkeit vor allem eines von der neuen Behörde: dass sie ganz anders sein würde als die Gestapo, die ihren Schatten auf die junge Demokratie und ihre Wächter warf. Doch im Laufe seines Bestehens wurde dem Bundesamt immer wieder vorgeworfen, von Altnazis durchsetzt und deshalb «auf dem rechten Auge blind» zu sein. Wie zutreffend ist dieses Urteil? Die Historiker Constantin Goschler und Michael Wala haben die ersten 25 Jahre des Bundesamtes für Verfassungsschutz erforscht und hatten dafür Zugang zu vielen bislang geheimen Akten. Wie wurde die neue Behörde aufgebaut? Was für Menschen haben während dieser Zeit für sie gearbeitet? Wie viele Belastete gab es, und welchen Einfluss hatten sie? Darüber hinaus beleuchtet das Buch die Handlungsspielräume des Verfassungsschutzes unter alliierter Kontrolle, seine Rolle im Kalten Krieg und die Hintergründe der zahlreichen Skandale. Welches Selbstverständnis pflegte die Behörde, und wie wandelte es sich unter dem Eindruck der jeweils aktuellen Bedrohungsszenarien? So schreiben die Autoren zugleich eine Geschichte der politischen Kultur der Bundesrepublik von der Adenauerzeit bis in die sozialliberale Ära im Spiegel der faszinierenden Welt der Geheimdienste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 597
Ähnliche
Constantin Goschler • Michael Wala
„Keine neue Gestapo“
Das Bundesamt für Verfassungsschutz und die NS-Vergangenheit
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Als 1950 das Bundesamt für Verfassungsschutz gegründet wurde, erwarteten sowohl die Alliierten als auch die Öffentlichkeit vor allem eines von der neuen Behörde: dass sie ganz anders sein würde als die Gestapo, die ihren Schatten auf die junge Demokratie und ihre Wächter warf. Doch im Laufe seines Bestehens wurde dem Bundesamt immer wieder vorgeworfen, von Altnazis durchsetzt und deshalb «auf dem rechten Auge blind» zu sein. Wie zutreffend ist dieses Urteil?
Die Historiker Constantin Goschler und Michael Wala haben die ersten 25 Jahre des Bundesamtes für Verfassungsschutz erforscht und hatten dafür Zugang zu vielen bislang geheimen Akten. Wie wurde die neue Behörde aufgebaut? Was für Menschen haben während dieser Zeit für sie gearbeitet? Wie viele Belastete gab es, und welchen Einfluss hatten sie?
Über Constantin Goschler • Michael Wala
Constantin Goschler, geboren 1960, ist Professor für Zeitgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum und hat unter anderem zahlreiche Bücher zur Geschichte der Wiedergutmachung für NS-Verfolgte veröffentlicht. Zurzeit beschäftigt er sich neben der Geschichte von Sicherheitspolitik und Geheimdiensten in der Bundesrepublik auch mit der Kulturgeschichte von Vererbung und Umwelt.
Inhaltsübersicht
Einleitung
Es war eine disparate Gruppe, die der Gründungspräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz Otto John Anfang 1953 auf die vor ihr liegende Aufgabe einschwor. Jeder Einzelne, so John in seinem ersten «Betriebsappell» an die knapp einhundert Mitarbeiter – darunter sowohl ehemalige NSDAP-Mitglieder wie frühere Widerstandskämpfer – trage die Verantwortung dafür, «dass unser Volk vor einer nochmaligen Vergewaltigung durch ein Gewalt- und Terrorregime bewahrt bleibt. Jeder von Ihnen kann sich selbst ausmalen, was unser Schicksal sein würde, wenn die Kräfte sich durchsetzen und zur Macht kommen würden, deren Pläne und Umtriebe wir erforschen müssen, damit sie wirksam bekämpft werden können. Die Ersten, die gehängt werden oder ins KZ wandern würden, wären wir!» Mahnend fügte er hinzu: «Ein Fehler, eine Unaufmerksamkeit heute kann entscheidend für die Zukunft werden!»[1] Kaum eineinhalb Jahre später machte John selbst einen entscheidenden «Fehler»: Er ging in die DDR und riskierte mit diesem Schritt, dass das von ihm aufgebaute Amt abgewickelt wurde. Nach seiner Rückkehr in die Bundesrepublik im Dezember 1955 wurde John der Prozess gemacht, der Bundesgerichtshof verurteilte ihn wegen Landesverrats zu vier Jahren Zuchthaus. Das Bundesamt aber hat die teilweise chaotischen Anfangsjahre überstanden, nur in den Schlagzeilen blieb der Verfassungsschutz auch danach fast permanent präsent.
Als wir im November 2011 damit begannen, die Frühgeschichte des Bundesamts für Verfassungsschutz zu erforschen, schlug die öffentliche Erregung über «ehemalige Nazis» in deutschen Ministerien und Behörden seit einigen Monaten wieder einmal hohe Wellen. Die damalige hitzige Debatte hatte sich an den Thesen der Studie Das Amt und die Vergangenheit entzündet, deren Autoren den deutschen Diplomaten der NS-Zeit eine wesentliche Mitverantwortung an der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden zuwiesen.[2] Bald darauf befeuerten die Enthüllungen über die Terrorgruppe NSU und seit Juni 2013 den amerikanischen Geheimdienst NSA das Interesse an der Vergangenheit des Bundesamts: Mehr als zehn Jahre lang hatten die Rechtsextremisten vom «Nationalsozialistischen Untergrund» vorwiegend türkische Geschäftsleute erschossen, ohne dass Polizei oder Verfassungsschutz das ausländerfeindliche Motiv dieser Mordserie erkannt hatten; die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden über die Ausspähungen der National Security Agency wiederum warfen die grundsätzliche Frage auf, welche Informationen westliche Geheimdienste eigentlich sammeln, wer sie dabei kontrolliert und wozu sie diese Daten schließlich nutzen. Im Fall des Bundesamts für Verfassungsschutz wollten viele vor allem wissen, wie stark diese Behörde in ihren früheren Jahren durch einstige Gestapo- oder SS-Offiziere geprägt worden war – und ob sich das offenkundige Versagen gegenüber dem NSU darauf zurückführen ließ. Weiten Teilen der Öffentlichkeit galt als ausgemacht, dass das Bundesamt aufgrund solcher Prägungen seit jeher auf dem «rechten Auge» blind sei und sich seine Mitarbeiter daher in erster Linie damit beschäftigten, kritische Stimmen von links zu bespitzeln. Bislang ließen sich solche Annahmen mangels Quellenzugang allerdings weder bestätigen noch widerlegen.[3]
Historiker sollten sich nicht blindlings in tagesaktuelle Debatten stürzen und vorschnelle Bewertungen abgeben. Gleichwohl bildet das Bedürfnis der Öffentlichkeit nach Orientierung einen legitimen Ausgangspunkt, um die eigenen Erkenntnisinteressen zu klären, die im besten Sinne der historischen Aufklärung dienen sollten. Das Interesse an der Geschichte des Bundesamts für Verfassungsschutz speist sich zum einen aus der grundsätzlichen Spannung zwischen dem Transparenzanspruch von Demokratien und der Praxis von Nachrichtendiensten, die in allen Ländern von einer Kultur des Geheimnisses geprägt ist. Aus dieser Spannung erwächst ein permanentes Misstrauen, das durch periodisch wiederkehrende Skandale geschürt wird und sich regelmäßig in öffentlicher Empörung Bahn bricht. Zum anderen spielt im konkreten Fall des Bundesamts das spezifische Problem der frühen Bundesrepublik eine wichtige Rolle, welche Positionen man früheren Nationalsozialisten in der Nachkriegsgesellschaft zubilligen wollte; beim Aufbau einer Organisation, die ausdrücklich die Verfassung eines neuen demokratischen Staates schützen sollte, gewann diese Frage eine besondere Brisanz.
Schon den Zeitgenossen der 1950er Jahre war bekannt, dass sich unter den Verfassungsschützern der ersten Stunde eine Reihe früherer Gestapo-Angehöriger befanden, ungeklärt blieb hingegen bis heute, wie viele dieser Personen für das Bundesamt arbeiteten und wie sich ihre Beschäftigung auf das Amt selbst auswirkte. Die Frage nach den Ursachen, dem Ausmaß und den Folgen solcher personellen Kontinuitäten stand somit am Anfang unserer Untersuchung. Die Darstellung konzentriert sich dabei auf die Zeit von der Gründung des Bundesamts im Jahr 1950 bis zum 1975 vollzogenen Wechsel an der Spitze, wobei der Endpunkt vor allem dem vorgegebenen «biographischen Sicherheitsabstand» Rechnung trägt. In diesem Vierteljahrhundert wuchs die Kölner Behörde auf rund zweieinhalbtausend Mitarbeiter an und erweiterte ständig ihre Aufgaben. Damit reagierte die Bundesregierung auf eine wahrgenommene Zunahme der Gefahren, umgekehrt führte dies allerdings auch dazu, dass der Verfassungsschutz selbst vielen Beobachtern immer mächtiger und somit gefährlicher erschien. Das vorliegende Buch greift die in den öffentlichen Debatten formulierten Probleme auf und stellt seine Fragen vor dem Hintergrund eines grundsätzlichen gesellschaftlichen Interesses an der Rolle von Geheimdiensten in Demokratien. Zugleich widmet es sich der Frage, wie die Zeitgenossen die Probleme des Verfassungsschutzes wahrnahmen; diese Wahrnehmungen sind inzwischen längst zu einem historischen Untersuchungsgegenstand geworden, und das gilt insbesondere für die Skandale des Bundesamts. Vier zentrale Untersuchungsperspektiven bestimmen somit diese Darstellung:
Erstens verdeutlicht dieses Buch den zeithistorischen Ort des Bundesamts und rückt es dazu in den Kontext der Entwicklung der nationalen und transatlantischen Sicherheitsarchitektur im Kalten Krieg. Nicht nur die Zusammenarbeit mit den Landesämtern für Verfassungsschutz erwies sich von Anfang an als problematisch (und wie zuletzt das Versagen angesichts der Terrorserie des NSU verdeutlichte, konnten diese Schwierigkeiten bis in die jüngste Vergangenheit hinein nicht beseitigt werden), auch die Kooperation des Bundesamts mit dem Bundesnachrichtendienst, dem Bundeskriminalamt und später dem Militärischen Abschirmdienst litt häufig unter unklaren Abgrenzungen und nicht zuletzt an der Konkurrenz der Dienste untereinander. Die Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten der westlichen Bündnispartner wiederum wurde unter den Bedingungen der alliierten Besatzungsherrschaft begründet, und wenngleich sich inzwischen zwar ein zunehmend partnerschaftlicheres Verhältnis entwickelt hat, haben die beiden Seiten niemals auf Augenhöhe agiert; das gilt bis zum heutigen Tag. Wie also entwickelte sich die Rolle des Bundesamts in diesem Kontext zwischen 1950 und 1975? Und wie wirkte sich die nationale und transatlantische Sicherheitsarchitektur auf seine Struktur, seine Personalpolitik und seine Tätigkeit aus?
Die Historisierung der öffentlichen Auseinandersetzung um das Bundesamt betrifft zweitens die Frage nach der Rolle von Mitarbeitern des Bundesamts, die bis 1945 Angehörige von Gestapo oder SS gewesen waren. In diesem Buch geht es uns allerdings nicht in erster Linie darum, die Identität «alter Nazis» im Bundesamt zu enthüllen. Zwar haben wir Personal und Personalpolitik des Bundesamts systematisch untersucht, allerdings soll in diesem Zusammenhang auch danach gefragt werden, wie sich die zeitgenössischen Kriterien dafür, was als «NS-Belastung» galt, veränderten und welche konkreten Konflikte um Mitarbeiter des Bundesamts daraus resultierten.[4] Bezeichnenderweise entzündeten sich Skandale wegen der Beschäftigung solcher Personen nur selten daran, dass neue Tatsachen über ihre Vergangenheit enthüllt wurden. Daher rührte auch das in vergangenheitspolitischen Auseinandersetzungen immer wieder auftretende Phänomen, dass die jeweils Betroffenen gar nicht so recht begreifen mochten, wie ihnen geschah: Sie selbst meinten, das Kapitel ihrer NS-Vergangenheit sei mit dem Ende der Entnazifizierung Anfang der 1950er Jahre geschlossen worden.
Drittens schildert dieses Buch, wie die Mitarbeiter des Bundesamts auf ihre politische Umwelt blickten und welche Gefahren sie dort lauern sahen. Hierbei muss zunächst geklärt werden, wen oder was sie eigentlich schützen sollten und wollten – nicht wenige scheinen den Begriff «Verfassungsschutz» jedenfalls eher als Tribut an den Zeitgeist denn als Beschreibung ihrer Kernaufgabe verstanden zu haben. Wie veränderten sich die im Bundesamt herrschenden Vorstellungen über die dominierenden politischen Gefahren? Wie reagierten seine Mitarbeiter auf die dramatischen Veränderungen der politischen Landschaft, von der Hochzeit des Kalten Krieges über die Zeit der Entspannungspolitik bis zur Ära des internationalen Terrorismus? Und inwieweit wurden ihre Gefahreneinschätzungen durch die vielzitierten vermeintlichen «braunen Wurzeln» des Verfassungsschutzes beeinflusst?
Viertens befasst sich dieses Buch natürlich auch damit, wie die Arbeit des Bundesamts eigentlich in der Praxis aussah und wie sich diese Praxis im Laufe der Jahre veränderte. Im Kern geht es dabei um die Frage, welche Kompetenzen dem Verfassungsschutz zugebilligt wurden. Diese hatten die Alliierten in der Gründungsphase des Bundesamts bewusst eingeschränkt, um den Missbrauch der neuen Behörde von vorneherein auszuschließen. Die Erfahrungen mit der Geheimen Staatspolizei dienten dabei als Negativfolie: Die Gestapo konnte selbst Verhaftungen und Verhöre durchführen und hatte bis zuletzt mit Terror die NS-Herrschaft gesichert. Die Distanzierung von der Gestapo war durch diese eingeschränkten Kompetenzen von Beginn an in die Arbeit des Bundesamts eingeschrieben; seine Mitarbeiter sollten sich im Wesentlichen darauf konzentrieren, politische Extremisten zu beobachten und über deren Aktivitäten zu berichten. Über mögliche Festnahmen hatten hingegen Polizei und Justiz zu entscheiden. Welche Konsequenzen resultierten aus dieser Beschränkung, wie wurde das so gewonnene Wissen verwertet, und wie präsentierte das Bundesamt seine Arbeit schließlich in der Öffentlichkeit? Zur Praxis der Verfassungsschützer gehörte aber nicht nur die Beobachtung von Verfassungsfeinden, sondern auch der Blick darauf, wie die Öffentlichkeit sie selbst wahrnahm, und der Versuch, dieses Bild selbst zu beeinflussen.
Zur Fremdbeobachtung des Bundesamts gehört auch das vorliegende Buch. An dessen Anfang steht eine Ausschreibung des Beschaffungsamts des Bundesinnenministeriums: Gefragt war eine «Organisationsgeschichte des Bundesamtes für Verfassungsschutz 1950–1975, unter besonderer Berücksichtigung der NS-Bezüge früherer Mitarbeiter in der Gründungsphase». Schon diese Ausschreibung war eine Besonderheit in der Vergabe von Forschungsprojekten, die unter dem Sammelbegriff «Aufarbeitung» genannt werden. Meist werden sie von Firmen oder Behörden direkt und aufgrund wenig transparenter Kriterien vergeben, anstatt in einem offenen Wettbewerb der Forschungsideen. Die Probleme solcher Auftragsforschung liegen auf der Hand und lassen sich auch durch ein Ausschreibungsverfahren nicht gänzlich beseitigen. Wir haben mit dem Beschaffungsamt daher vereinbart, dass wir nicht allein in unseren Fragestellungen und Zugriffsweisen völlig unabhängig sein müssen und die Ergebnisse in einem Verlag unserer Wahl publizieren können, sondern auch, dass es keine Eingriffe in die Darstellung unserer Ergebnisse geben wird und zudem sämtliche von uns im Bundesamt für Verfassungsschutz ausgewerteten Quellen nach Abschluss des Projekts dem Bundesarchiv übergeben werden. Nur so ist gewährleistet, dass unsere Forschungen öffentlich und wissenschaftlich überprüft und kritisch begutachtet werden können.
Allerdings sind die Archive eines Geheimdienstes eine «Black Box». Die Quellen, die Historiker für ihre Arbeit benötigen, sind «Verschlusssachen», oft geheim oder gar streng geheim. Bevor wir also die ersten Dokumente aus dem Archiv des Bundesamts, dem Zentralen Altaktenwesen, in Händen hielten, wussten wir nicht, ob sich die vor uns liegende Aufgabe mit dem vorhandenen Material bewältigen lassen würde. Und tatsächlich: Trotz optimaler Arbeitsbedingungen im Archiv und der Unterstützung, die uns gewährt wurde und die auch den Zugang zu allen Registraturen einschloss, die noch nicht Teil des Archivs waren, stellte sich schnell heraus, dass der im Bundesamt vorhandene Quellenbestand große Lücken aufwies. Dies betraf insbesondere die für uns zentralen Personalakten der frühen Mitarbeiter. Diese Unterlagen waren längst an die Oberfinanzdirektionen und andere Ämter abgegeben worden, die den ausgeschiedenen Beamten und Angestellten ihre Pensionen und Renten auszahlen. Zuvor hatte man routinemäßig den «Sicherheitsteil» dieser Akten vernichtet, also gerade den Teil, der konkrete Informationen über die Vergangenheit der jeweiligen Personen enthielt. Nur durch Zufall hatten sich vereinzelte Reste der Akten aus der Personalverwaltung erhalten.
Um wenigstens den Personalbestand für die Zeit von 1950 bis 1975 zu rekonstruieren, mussten wir daher Umwege einschlagen: Mit Hilfe von Impflisten, Röntgenreihenuntersuchungen und Listen für Personalratswahlen, die hier und da zwischen anderen Informationen der Personalabteilung auftauchten, sowie Kopien von Akten auf Sicherheitsfilmen, die angefertigt worden waren, wenn die Papierdokumente vernichtet wurden, konnten wir etwa anderthalbtausend Namen des Personals aus dem Untersuchungszeitraum bis zum Geburtsjahr 1929 rekonstruieren und dann mit anderen Quellenbeständen abgleichen, etwa dem früheren Berlin Document Center im Bundesarchiv.
Die Fragestellungen, die wir entwickelt hatten, ließen sich aber, auch das war schnell deutlich, nicht allein auf der Grundlage des Quellenbestandes im Zentralen Altaktenwesen des Bundesamts klären. Seit den späten 1950er Jahren wurde nach Absprachen mit dem Bundesarchiv jener Teil der Akten von der Vernichtung ausgenommen, der als zeitgeschichtlich relevant angesehen wurde. Die Entscheidung aber, was «relevant» sei, hatte man den Referaten überlassen. Von der Vernichtung ausgenommen werden sollten, so hieß es in einem internen Rundschreiben des Bundesamts aus dem Jahr 1963, lediglich solche Akten, die über die «politische und geistige Einstellung eines größeren Kreises der Zeitgenossen im verfassungsfeindlichen Sinne» Auskunft gäben. Dazu zählte man «Rädelsführer und Hintermänner von Parteien, Organisationen und Verbänden, die auf Bundesebene in Erscheinung getreten sind», sowie «insbesondere … Bundes- und Landtagsabgeordnete, … Hochschullehrer, Publizisten und ehemalige höhere Führer der NSDAP und ihrer Organisationen». Dokumente über die Geschichte des eigenen Hauses zählte die Führung des Bundesamts hingegen nicht zum «zeitgeschichtlich bedeutsamen Schriftgut».[5] Für Historiker ist ein solcher Quellenbestand problematisch, da seine Zusammensetzung allein von denjenigen bestimmt wurde, deren Arbeit darin dokumentiert wird. Deshalb erwiesen sich Parallelüberlieferungen aus dem Innenministerium und anderen Bundesbehörden als unverzichtbar, und mit ihrer Hilfe gelang es, die Personalpolitik des Bundesamts und insbesondere die Praxis der Einstellungen aufzuklären.
Als ausgesprochen aufschlussreich erwiesen sich zudem die Akten anderer Geheimdienste. Der Bundesnachrichtendienst gewährte uns dankenswerterweise Einblick in sein Archiv, allerdings streng begrenzt und ohne Zugriff auf die Personalakten. Mit wem wir es bei den hilfreichen Mitarbeitern in Pullach wirklich zu tun hatten, werden wir leider nie erfahren; mit einer Ausnahme arbeiten dort alle unter Decknamen. Insbesondere die Akten der Central Intelligence Agency in den National Archives waren eine sehr wertvolle Ergänzung. Zehntausende von Dokumenten sind infolge des Nazi War Crimes Disclosure Act offen gelegt worden, viele davon behandeln das Bundesamt und seine Mitarbeiter. Die Mitarbeiter der CIA waren seinerzeit hervorragend über Interna informiert: Viele Mitarbeiter des Verfassungsschutzes klagten ihnen ihr Leid über Kollegen oder berichteten von Strukturreformen der Behörde, erzählten von Veränderungen oder Stellenumbesetzungen und sprachen mit ihnen über politische Hintergründe. Vielfach haben wir durch diese Quellen mehr über das Bundesamt erfahren als durch die in Köln oder im Bundesarchiv überlieferten Akten.
Freilich fand die Auskunftsfreude ihre Grenzen, sobald es um noch nicht freigegebene Akten ging: Bei zwei Besuchen im Hauptquartier der CIA in den vergangenen Jahren wurden wir sehr freundlich empfangen, uns wurde Kaffee und Kuchen gereicht, kleine Hamburger und Teegebäck. Ausgestattet mit unterstützenden Briefen des Verfassungsschutzpräsidenten Heinz Fromm und seines Nachfolgers Hans-Georg Maaßen trugen wir den jeweils sechs bis sieben CIA-Mitarbeitern, die uns dort gegenübersaßen, unsere Wünsche nach weiteren Dokumenten vor, die wir in den Beständen der CIA vermuten. Freundlich versicherte man uns beide Male, dass man uns natürlich gerne unterstützen, unser Anliegen wohlwollend prüfen werde, denn es gebe wohl noch relevante Akten. Aber außer einem Kugelschreiber (Made in China) mit dem Aufdruck «Central Intelligence Agency» ist dabei nichts Handfestes herausgekommen. – Dessen Mine ist nun leergeschrieben.
I.Aufbau
Zwischen Staatsschutz und doppelter Eindämmung
Nachdem die Anti-Hitler-Koalition bereits in der letzten Phase des Zweiten Weltkriegs auseinandergebrochen war, standen die drei Westmächte vor der Aufgabe, aus ihren Besatzungszonen einen deutschen Teilstaat zu formen, der bald ohne Unterstützung von außen überlebensfähig sein würde und vor allem als stabiler Partner im sich abzeichnenden Kalten Krieg fungieren konnte. Er sollte fortan als wichtiger Eckpfeiler der transatlantischen Sicherheitsarchitektur und der Eindämmungspolitik gegenüber der Sowjetunion dienen. Die Deutschen auf Dauer in einem Besatzungsregime zu halten, wäre ohnehin weder den USA noch den anderen Westalliierten möglich gewesen: Die Besetzung verschlang enorme Ressourcen, die insbesondere Frankreich und Großbritannien eigentlich dringend benötigten, um die Kriegsfolgen zu bewältigen. Allerdings konnte Deutschland weder geographisch noch wirtschaftlich oder politisch so wiederhergestellt werden, wie es vor 1945 existiert hatte. Die Westalliierten mussten also Staatsbildung in einem bisher fast beispiellosen Umfang betreiben. Zugleich waren sich die drei Verbündeten darin einig, wie wichtig es war, die junge Bundesrepublik gegen «subversive» Angriffe von innen und außen abzusichern.
Dass man für diesen Zweck nicht nur lokale Polizeistationen brauchte, sondern auch übergeordnete Sicherheitsorgane, war für die Alliierten selbstverständlich. Zugleich stand außer Frage, dass gerade diese Institutionen besonders genau überwacht werden mussten, um ein Wiederaufleben alter NS-Strukturen in neuem Gewand zu verhindern. Schon von 1945 an hatten die Westmächte in Deutschland ein dichtes nachrichtendienstliches Netz gewoben – zunächst, um der Kriegsverbrecher habhaft zu werden, dann um den Schwarzmarkt einzudämmen und so die wirtschaftliche Erholung abzusichern. Hierbei spielte das Counter Intelligence Corps der US Army (CIC) eine zentrale Rolle, die nach 1947 keineswegs reibungsfrei von der Central Intelligence Agency (CIA) übernommen wurde.[1] Wie das gesamte Besatzungsregime war diese Form der Überwachung zeitlich begrenzt, mittelfristig sollten die Deutschen auch im Bereich der Nachrichtendienste weitgehend auf eigenen Füßen stehen.
Beim Aufbau der neuen Sicherheitsbehörden folgten die amerikanischen, französischen und britischen Militärverwaltungen in ihren jeweiligen Besatzungszonen teils heimischen Mustern, teils stützten sie sich auf Vorbilder aus der Weimarer Republik. Auf der Ebene des zukünftigen westdeutschen Bundesstaats aber war eine gemeinsame Linie gefragt. Dies erforderte Absprachen und Kompromisse, aufgrund der neuen Machtverhältnisse gaben freilich die Vereinigten Staaten hierbei in der Regel den Ton an: Sie waren nicht nur politisch und militärisch gestärkt aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen, sie hatten auch die Umstellung von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft erfolgreicher gemeistert als Großbritannien und Frankreich. In der unmittelbaren Nachkriegszeit übernahmen die USA daher endgültig von Großbritannien die Führungsrolle in der westlichen Welt. Mit dem Marshallplan schmiedete die Regierung in Washington ein transatlantisches politisch-wirtschaftliches Bündnis, mit der Nato schuf sie von 1949 an das militärische Pendant dazu.
Der beherrschende Einfluss der Vereinigten Staaten auf die neuen deutschen Sicherheitsbehörden zeichnete sich bereits bei der Gründung des Bundeskriminalamts und der Organisation Gehlen ab, dem Vorläufer des deutschen Auslandsnachrichtendienstes. Die Schaffung einer Polizeiorganisation des Bundes, die sich der länderübergreifenden und organisierten Kriminalität widmete, wurde als dringlich angesehen, sie war bei Franzosen und Briten aber umstritten. Die schließlich realisierten Pläne für ein Bundeskriminalamt (BKA) basierten dann im Wesentlichen auf den Überlegungen von Paul Dickopf; er war Kriminalpolizist, ehemaliges SS-Mitglied – und amerikanischer Agent. Dickopf hatte sich bereits 1944 in die Dienste des amerikanischen Kriegsgeheimdienstes Office of Strategic Services (OSS) gestellt, später baute ihn die CIA unter dem Decknamen Caravel als Quelle und Einflussgröße auf.[2] Ende Dezember 1948 bat ihn der Geheimdienst, die Struktur und Organisation eines zentralen Kriminalpolizeiamts der westlichen Besatzungszonen zu entwerfen, und Dickopf nutzte dann seine Kontakte in der britischen Besatzungszone, um seine Ideen voranzutreiben.[3] Mit Wissen der CIA bot er sich Ende 1949 dem Bundesinnenministerium an, um seine Pläne für ein Bundeskriminalamt umzusetzen, und die Agency erreichte wiederum, dass Bedenken der Alliierten Hohen Kommissare überwunden wurden; diese nahmen seinerzeit noch die Hoheitsrechte innerhalb der Bundesrepublik wahr.[4] Ein Mitarbeiter der CIA schrieb 1952 rückblickend über die Verhandlungen: «Während all der Monate, in denen das BKA aufgebaut wurde, haben Caravels Vorgesetzte ihn ständig gedrängt, bei ‹den Amerikanern› zu intervenieren, damit das BKA-Gesetz gebilligt wird, trotz dessen zentralistischen Charakters, der den bestehenden Direktiven der drei Alliierten direkt widersprach. Das Gesetz wurde von der Alliierten Hohen Kommission behandelt und angenommen, obwohl die Vertreter der USA und Frankreichs in letzter Minute Einsprüche erhoben.» Nach Ansicht des Innenministeriums seien es «Caravels» Kontakte gewesen, «die dieses Wunder vollbrachten».[5] Von Mai 1950 an arbeitete Paul Dickopf im Bundesinnenministerium an der Gründung des BKA, 1952 wurde er Vizepräsident des Amts und schließlich 1965 dessen Präsident; während der ganzen Zeit blieb Dickopf auf der Gehaltsliste der CIA.[6] Für den amerikanischen Geheimdienst überwogen die Vorteile der so gewonnenen Einflussmöglichkeit auf das Bundeskriminalamt die Nachteile, indirekt bei der personellen Rekonstruktion des Reichskriminalpolizeiamts der NS-Zeit Pate gestanden zu haben: 1958 waren etwa siebzig Prozent der führenden Mitarbeiter des BKA ehemalige SS-Leute.
Parallel zum Bundeskriminalamt nahm der spätere Bundesnachrichtendienst in Form der Organisation Gehlen Gestalt an. Als Leiter der Abteilung Fremde Heere Ost im Generalstab des Heeres hatte Reinhard Gehlen während des Zweiten Weltkriegs mehr oder weniger erfolgreich taktische Informationen über die Rote Armee gesammelt. Nach Kriegsende führten er und einige seiner Mitarbeiter diese Tätigkeit als Operation Rusty zunächst für die US Army fort, bevor seine Organisation (kurz Org genannt) von der Counter Intelligence Group, der Vorläuferin der CIA, übernommen wurde.[7] Nach einigen Auseinandersetzungen über das Aufgabenfeld konnten die Skeptiker innerhalb der Agency und der amerikanischen Regierung schließlich davon überzeugt werden, die Organisation unter dem Decknamen Zipper weiterzuführen.[8] Die Kontrolle über den ambitionierten Gehlen und die auch für die Amerikaner undurchsichtige Personalstruktur der umfangreichen Organisation war ein ständiger Reibungspunkt, der die Org mehrmals an den Rand der Auflösung brachte oder Gehlens Ablösung nahelegte. Letztlich aber obsiegten innerhalb der US-Nachrichtendienste diejenigen, die davon ausgingen, er werde zukünftig eine wichtige Rolle in der Bundesrepublik spielen. Der CIA-Deckname für Gehlen, Utility, weist deutlich auf den Nutzwert hin, den man ihm im Kalten Krieg zumaß.
Für einen zukünftige Bundespolizei und das Fundament für einen zukünftigen Auslandsnachrichtendienst war also bereits 1949 gesorgt; es blieb das schwierigere Problem, einen Inlandsnachrichtendienst zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aufzubauen. Zwar waren die allermeisten Bundesbürger froh, unter dem Schutzschirm der Westalliierten zu leben: Die NS-Indoktrination von der bolschewistischen Gefahr saß tief, und die konkreten Erfahrungen mit sowjetischen Truppen bei Kriegsende und der Sowjetunion als Besatzungsmacht hatten diese Angst keinesfalls gemindert.[9] In die positive Grundstimmung mischten sich nach der Gründung der Bundesrepublik jedoch zunehmend Irritationen über die fortwährenden tiefen Eingriffe der Besatzungsmächte in die Belange des neuen Staats. Das schon in der Weimarer Zeit virulente Misstrauen gegenüber westlichen demokratischen Traditionen wirkte weiter, erst langsam begann die Bevölkerung, sich politisch und gesellschaftlich als Teil der westlichen Welt zu verorten. Zahlreiche neugegründete Gruppen, Soldatenverbände und Parteien dienten vorerst eher dazu, die neue Ordnung kritisch zu hinterfragen, als sich politisch für die junge Bundesrepublik zu engagieren.[10] Die westlichen Besatzungsmächte erkannten, dass sich in diesen Gruppen Zukunftsängste mit Unzufriedenheit paarten. Die Suche nach einfachen Antworten und Wahrheiten konnte schnell in Ablehnung des westlichen Gesellschafts- und Politikmodells umschlagen und somit das Demokratisierungsprojekt insgesamt gefährden. Der Aufbau der Bundesrepublik erforderte daher auch die Schaffung von Sicherheitsorganen des Bundes, mit denen politische Aktivitäten erkannt und bekämpft werden konnten, die gegen die sich etablierende Ordnung gerichtet waren.
Den Westalliierten war bewusst, dass sie den Deutschen mit einem Inlandsgeheimdienst ein Instrument in die Hand gaben, das sich über kurz oder lang nicht mehr kontrollieren lassen würde, wenn es denn seine Aufgaben erfüllen sollte; Marionetten-Behörden, die an langen Fäden liefen, waren für eine effektive Arbeit kaum zielführend. Eine solche Behörde als Teil einer «wehrhaften Demokratie» durfte weder von der deutschen Bevölkerung noch von der Weltöffentlichkeit als Bedrohung wahrgenommen werden, und sie musste der neuen Bundesregierung gegenüber loyal sein. Gleichzeitig war den Alliierten bewusst, dass diese Behörde bald in Konkurrenz mit den eigenen Diensten und den von ihnen gelenkten Organisationen stehen würde – zumindest in einer langen Übergangsphase mussten die Westdeutschen daher daran gehindert werden, allzu eigenständig und möglicherweise gegen die Interessen der Westmächte zu agieren.
Im Gegensatz zu den beiden anderen Sicherheitsbehörden des Bundes wurde der Aufbau des Bundesamts für Verfassungsschutz weder von CIA-Agenten gesteuert, noch diente als dessen Fundament eine CIA-Operation, die aus Personal der Abwehr (dem militärischen Geheimdienst der Wehrmacht), der Gestapo oder des SD bestand. Das Bundesamt war eine Neugründung, es konnte und sollte auf keinerlei Kontinuitäten oder Vorgängerorganisationen aufgebaut werden. Auch aus diesem Grund wurde es in einem langwierigen und nicht immer einvernehmlichen Aushandlungsprozess zwischen den drei Westmächten untereinander und mit den Vertretern der jungen Bundesrepublik aus der Taufe gehoben. Eines allerdings war von Beginn an unwidersprochen: Diese neue Behörde durfte unter keinen Umständen eine neue Gestapo werden.
Gründungsdebatten
Das Bundesamt für Verfassungsschutz, das heute mehr als zweieinhalbtausend Beschäftigte zählt, begann seine Arbeit 1950 äußerst bescheiden. Der Bundestag hatte der neuen Behörde vorerst nur wenige Planstellen bewilligt: Neben dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten sowie zwei Regierungsdirektoren sollten lediglich 14 weitere Beamte eingestellt werden, ferner 43 Angestellte und 22 Arbeiter. In Köln hatte man unweit des Doms ein Gebäude mit 50 Diensträumen angemietet; die Mitarbeiter konnten dort einen Sitzungssaal sowie ein Wartezimmer nutzen, außerdem gab es eine Registratur. Für eine Bücherei waren zunächst 14000 Mark vorgesehen, zudem erhielt das Bundesamt fünf Automobile: zwei Mercedes, einen Opel Kapitän und zwei Volkswagen. Insgesamt standen für die komplette Ersteinrichtung 612500 Mark zur Verfügung, die laufenden Sachkosten schätzte das Bundesinnenministerium auf 186500 Mark, die Personalkosten auf 624800 Mark. 15 Schreibmaschinen bildeten den Kern der technischen Ausstattung.[1]
Angesichts der umfangreichen Aufgaben, die man der neuen Behörde übertragen wollte, war sie personell auf den ersten Blick also dürftig ausgestattet. Den bescheidenen Mitteln für reguläre Planstellen stand jedoch bereits im Rechnungsjahr 1950 ein sehr großzügig bemessener Betrag von drei Millionen Mark gegenüber, der im Bundeshaushalt etwas kryptisch «für die Zwecke des Verfassungsschutzes» ausgewiesen war und dessen Verwendung allein durch den Präsidenten des Bundesrechnungshofs überprüft werden sollte.[2] Die Summe von drei Millionen Mark entsprach dem Fünffachen der offiziellen Personalkosten und erlaubte es dem Amt, eine große Anzahl von Informanten und inoffiziellen Mitarbeitern zu beschäftigen – kostspielige technische Ausrüstungen wurden in den ersten Jahren noch kaum benötigt. Das Monatsgehalt eines mittleren Angestellten lag bei drei- bis vierhundert Mark, das Handgeld für Informanten bewegte sich entsprechend dem Wert ihrer Auskünfte ungefähr auf gleichem Niveau. Der hohe Betrag und die unbestimmte Bezeichnung dienten der Verschleierung, zeigten aber die Unsicherheit darüber, was genau das neue Amt eigentlich tun sollte.
Eine «harmlose, nichtssagende Bezeichnung»
Bevor die ersten Mitarbeiter des Bundesamts Ende 1950 ihre Räume beziehen und die Schreibmaschinen auspacken konnten, hatten die westlichen Alliierten untereinander sowie mit den Vertretern der Bundesrepublik langwierig über diese Frage verhandelt. Bereits Ende März 1949 hatten die Militärgouverneure dem Parlamentarischen Rat die Aufstellung von Polizeikräften genehmigt, wenige Tage später erlaubten sie der zukünftigen Bundesregierung im sogenannten Polizeibrief auch, eine Behörde einzurichten, die Informationen über «subversive» Aktivitäten sammeln sollte. Konkret legten sie in diesem Dokument jedoch eigentlich nur fest, dass dieses neue Amt weder Polizeibefugnisse erhalten sollte noch den Landespolizeien oder einzelnen Polizeidienststellen Weisungen erteilen durfte. Ende Juli 1949 stimmte sich der designierte amerikanische Hohe Kommissar für Deutschland, General John J. McCloy, mit dem Oberkommandierenden der amerikanischen Streitkräfte in Europa über ihre Position zu diesem zukünftigen deutschen Inlandsnachrichtendienst ab,[1] doch erst im November nahmen sich die Sicherheitsdirektoren der drei westalliierten Hohen Kommissare der Sache an und begannen, Prinzipien für die Aufgaben und für die Organisation zu entwickeln.
Als die Hohen Kommissare Ende November 1949 dann persönlich zusammentrafen, um sich über die konkrete Ausgestaltung des Amts abzustimmen, offenbarten die Gespräche aber zunächst in erster Linie die großen Differenzen zwischen den Verbündeten. Während McCloy einen Inlandsnachrichtendienst des Bundes favorisierte, befürchtete der französische Hohe Kommissar André François-Poncet, die deutschen Sicherheitsdienste könnten sich verselbständigen. Er malte das Gespenst einer Wiederherstellung der Gestapo an die Wand und musste sich erst in Paris rückversichern, bevor er bereit war, die Vorschläge der anderen Kommissare auch nur weiter zu diskutieren.[2] Auch der britische Hohe Kommissar Brian Hubert Robertson plädierte für dezentrale Nachrichtendienste, die auf Ebene der Bundesländer agierten und lediglich durch den Bund koordiniert würden. Wenn erst einmal ein Nachrichtendienst allein auf Bundesebene etabliert war, so fürchtete die britische Seite, werde auch schnell der Ruf nach einer Bundespolizei laut. Eine zentrale Polizeibehörde lehnte man in London damals aber noch strikt ab: Die Landespolizeien würden dann der Kontrolle der Alliierten entgleiten und unter die Ägide des Bundes fallen.[3] Offensichtlich waren der britische und der französische Hohe Kommissar allerdings mit sehr viel weniger Entscheidungsvollmacht oder -willen ausgerüstet als McCloy, der oft ohne Rücksprache mit Washington entschied und seine Regierung nur nachträglich informierte. Dies sollte sich für die amerikanische Verhandlungsposition als Vorteil erweisen, ermöglichte den USA aber dennoch nicht, sich in allen Punkten durchzusetzen.
Bei allen Meinungsverschiedenheiten teilten die drei Besatzungsmächte die Befürchtung, die Deutschen könnten sie vor vollendete Tatsachen stellen und einen Nachrichtendienst ohne ihre Mitwirkung aufstellen. Bei den Amerikanern machten seinerzeit bereits wilde Gerüchte die Runde: Die SPD habe vorgeschlagen, ein Zehntel der Polizisten sofort für eine solche neue Behörde abzukommandieren und entsprechend auszubilden, die Landesinnenminister würden noch vor Jahresende gemeinsam beraten, und Rudolf Diels, der erste Gestapo-Chef, sei in dieser Sache bereits konsultiert worden.[4] Keine dieser Meldungen entsprach der Realität, sie zeigten jedoch, wie gering das Vertrauen in die neue politische Klasse der Bundesrepublik weiterhin war: Der spätere Direktor der CIA, Allen W. Dulles, sah die erfolgreiche Demokratisierung Deutschlands Anfang 1947 als so unsicher an, dass er für diesen Prozess Jahre, wenn nicht Jahrzehnte ansetzte.[5] Der Kontrollverlust der Alliierten als Folge unabhängiger werdender Institutionen der Bundesrepublik schien zwar unausweichlich, doch hielt man es vor diesem Hintergrund für angebracht, die deutschen Nachrichtendienste zumindest über Verbindungsleute auf Bundes- und Länderebene weiterhin genau zu beobachten und gegebenenfalls zu beeinflussen.
In den drei westlichen Besatzungszonen waren bis Ende 1949 bereits Vorläufer solcher Inlandsgeheimdienste in unterschiedlichen Ausformungen entwickelt worden. Die Briten hatten dreißig bis vierzig «Special Branches» aus Mitgliedern der deutschen Polizei aufgestellt, die sich nachrichtendienstlicher Methoden bedienten und Mitteilungen über «subversive» Aktivitäten sammelten, aber nicht mehr der Polizei unterstanden. In Nordrhein-Westfalen war zudem eine sogenannte Informationsstelle («I-Stelle») eingerichtet worden, aus der später das Landesamt für Verfassungsschutz hervorging.[6] Die Amerikaner hatten in dieser Richtung bisher weniger unternommen, da CIA und CIC sehr stark aufgestellt waren und die Bevölkerung wie auch die neuentstehenden politischen und sozialen Einrichtungen auf allen Ebenen mit Agenten und Informanten durchdrungen hatten.[7] Aufgrund der zunehmenden Infiltration der Westzonen durch «kommunistische Agenten» kamen jedoch auch die amerikanischen Stellen zu der Überzeugung, dass ein Inlandsnachrichtendienst in ihrem unmittelbaren Einflussgebiet immer dringlicher wurde.[8] Erste Schritte in Richtung eines Landesamts für Verfassungsschutz waren in Bayern bereits in die Wege geleitet worden, und im Februar 1950 ermächtigte McCloy die Landesregierung in München, «eine kleine Dienststelle zum Zwecke der Sicherstellung von Nachrichten über umstürzlerische Tätigkeiten» einzurichten.[9]
In ihren weiteren Verhandlungen einigten sich die Hohen Kommissare darauf, den Verfassungsschutz zweigleisig sowohl auf Landes- wie auf Bundesebene aufzubauen, wobei das Bundesamt keine Weisungsbefugnis gegenüber den Landesämtern haben sollte. Auch die geringe Personalausstattung des Bundesamts, von der französischen Seite vehement gefordert, resultierte aus einer Abwägung zwischen der Furcht vor dem Wiedererstarken einer geheimen deutschen Exekutivbehörde und der Sorge vor einer Unterwanderung Westdeutschlands durch Kommunisten aus der «Sowjetischen Besatzungszone». François-Poncets Vorschlag, die Inlandsgeheimdienste direkt dem Bundeskanzler bzw. den Ministerpräsidenten zu unterstellen – und die Regierungschefs damit unmittelbar in die Verantwortung für diese Ämter einzubinden – stieß bei den beiden anderen Alliierten ebenso auf Vorbehalte wie das Ansinnen des Franzosen, die Aktivitäten des Bundesamts ausdrücklich auf das Gebiet der Bundesrepublik zu begrenzen. Beide Punkte wurden aber in das Diskussionspapier für ein erstes Treffen mit Bundeskanzler Adenauer in dieser Sache am 12. Januar 1950 aufgenommen.[10]
In der Zwischenzeit hatten die direkten Konsultationen zwischen Alliierten und Vertretern der Bundesregierung über die konkrete Ausgestaltung des Verfassungsschutzes begonnen. Anfang Januar 1950 trafen die Sicherheitsdirektoren der Hohen Kommissare mit dem zuständigen Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren, Hans Ritter von Lex, und Ministerialdirigent Herbert Blankenhorn vom Bundeskanzleramt zu einem «inoffiziellen, streng vertraulichen Gedankenaustausch» zusammen. Auf Augenhöhe verlief dieses fünfstündige Gespräch nicht, die westlichen Verbündeten erläuterten von Lex und Blankenhorn vielmehr den Minimalkonsens, auf den sie sich hatten einigen können: Die zentrale Verfassungsschutzbehörde dürfe weder Verhaftungen vornehmen oder anordnen, noch werde sie befugt sein, anderen Bundesorganen, den Innenministern der Länder oder Polizeidienststellen Anweisungen zu erteilen oder über diese Kontrollbefugnisse auszuüben. Das zukünftige Bundesamt könne lediglich Ratschläge und Anregungen geben sowie Benachrichtigungen und Informationen der Landesbehörden entgegennehmen. Die Alliierten machten auch deutlich, dass sie Zugang zu Informationen und Archiven der neuen Behörde wünschten. Die drei Westmächte sollten zudem dauernd über alle Ermittlungen und Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten werden, die für die Sicherheit der Alliierten wichtig oder für diese sonst von besonderem Interesse wären, ohne jeweils nach Informationen suchen zu müssen. Die Hauptaufgabe des neuen Amts bestünde freilich darin, den Bundeskanzler, seine Minister und das Kabinett über subversive und illegale Betätigung im Inland zu unterrichten, gleichgültig ob dies die politische Rechte oder die politische Linke betreffe.[11]
Eine kleine, aber solide Gruppe von Mitarbeitern müsse zusammengestellt werden, nicht mehr als fünfzig bis siebzig Personen, dabei hänge viel von der sorgfältigen Auswahl ab – keine der politischen Parteien dürfe übermäßig stark repräsentiert sein. Als Chef dieser Behörde solle eher ein technischer Beamter als eine politische Persönlichkeit berufen werden, eine Person, die weder durch ihre Vergangenheit noch durch gegenwärtige Verbindungen angreifbar sei. Vorteilhaft sei etwa ein bewährter Kriminalbeamter. Kriminalbeamte könnten auch als Mitarbeiter beschäftigt werden, solange sichergestellt sei, dass sie für die Dauer ihrer Beschäftigung in der neuen Behörde aus der Polizei ausschieden. Eine Zustimmung der Alliierten vor Einstellung der Bewerber müsse zwar nicht eingeholt werden, sie behielten sich aber vor, Personalentscheidungen nachträglich zu widersprechen. Wichtig war den Sicherheitsdirektoren allerdings, dass die neue Behörde auch nach außen hin unter allen Umständen der Eindruck vermeide, es handle sich bei ihr um eine Dienststelle der Polizei oder gar einer neuen politischen Polizei. Bei der Namensgebung solle daher eine «harmlose, nichtssagende Bezeichnung» gewählt werden.[12]
Großen Spielraum ließen die Alliierten der Bundesregierung bei der Ausgestaltung ihres Inlandsnachrichtendienstes also nicht. Aber es ergaben sich trotz dieser Detailsteuerung Bereiche, an deren klarer Abgrenzung die Hohen Kommissare wenig interessiert waren und die den Deutschen gewisse Freiräume eröffneten. Dies zeigte sich beispielsweise bei der Frage, welche Gebiete für die neue Behörde denn als «Inland» gelten sollten. Als von Lex gegenüber den Sicherheitsdirektoren insistierte, für die Bundesregierung sei die «Ostzone Deutschlands nicht als Ausland zu betrachten», gestanden diese dem zukünftigen Geheimdienst zu, auch auf dem Gebiet der DDR zu agieren. Zu einer «genauen Stellungnahme in dieser Frage» wollte der britische Vorsitzende Joseph Charles Haydon aber nicht gedrängt werden. Entscheidend war aus seiner Sicht in erster Linie, dass die neue Dienststelle nicht «außerhalb der gegenwärtigen Grenzen Deutschlands» aktiv werde.[13]
Trotz des offensichtlichen Machtunterschieds und der eindeutigen Anweisungen versicherten die alliierten Sicherheitsdirektoren, dass sie ihre Zustimmung zur Errichtung eines zentralen Inlandsgeheimdienstes als «einen äußerst wichtigen Schritt» beim Ausbau der Zusammenarbeit mit den Deutschen auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik ansahen. Als ihre deutschen Gesprächspartner erklärten, ein Verfassungsschutz als bloßer Erfüllungsgehilfe alliierter Nachrichtendienste und eine «Infiltration der deutschen Dienststelle mit Organen der Alliierten» sei für sie «untragbar», kamen ihnen die Alliierten daher auch schnell entgegen. Man wolle keinesfalls Persönlichkeiten in dieses Amt «hineinzwingen», die für die Bundesregierung nicht annehmbar seien; über Personalfragen werde man sich inoffiziell einigen. Und bei der Anzahl und Auswahl der V-Leute ließ man der deutschen Seite völlig freie Hand.[14]
Die Mühlen der Gesetzgebung
Die Abwehr extremistischer Bewegungen hatten schon die Abgeordneten des Parlamentarischen Rats als Ziel staatlicher Institutionen definiert, wenngleich sich dies im Grundgesetz zunächst nur in der recht vagen Formulierung über eine mögliche Zusammenarbeit von Bund und Ländern «in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes» niederschlug.[1] Trotz des zunehmenden Drucks von Seiten der Öffentlichkeit, der Alliierten und der Abgeordneten ließ sich die Bundesregierung aber viel Zeit, ein entsprechendes Gesetz ins Parlament einzubringen. Anfang Februar 1950 forderte der Bundestagsausschuss zum Schutze der Verfassung den Bundesinnenminister auf, eingehend über die geplante Errichtung einer «Nachrichtenstelle zur Sammlung von Unterlagen zum Zwecke des Verfassungsschutzes» zu berichten. Für bedrohlicher als eine mögliche kommunistische Unterwanderung Westdeutschlands, wie sie die Alliieren befürchteten, erachteten die Parlamentarier allerdings die «eigenartige Parteienbildung» am rechten Rand. Konkret wurden in diesem Zusammenhang etwa Karl Feitenhansl genannt, Vorsitzender der offen neofaschistischen Vaterländischen Union und später NPD-Abgeordneter im Bayerischen Landtag, Leonhardt Schlüter, niedersächsischer Vorsitzender der Deutschen Konservativen Partei-Deutschen Rechtspartei, der im Kommunalwahlkampf 1948 umjubelte völkische Reden gehalten hatte, sowie Wolfgang Hedler, der bis Januar 1950 der Bundestagsfraktion der Deutschen Partei angehörte und mit antisemitischen Vorträgen auf sich aufmerksam machte.[2]
Im Bundesinnenministerium war man jedoch keineswegs untätig geblieben. Bereits Ende 1949 hatte der Verwaltungsjurist Max Hagemann dort die Grundzüge für eine «Nachrichtenstelle für Verfassungsschutz» entworfen. Was ihn für diese Aufgabe prädestinierte, blieb freilich unklar: Hagemann war während der Weimarer Republik Leiter der Kriminalpolizei in Berlin gewesen, bevor er zum preußischen Oberverwaltungsgericht wechselte und dann von 1942 an als Referent im «Reichskommissariat für die Behandlung feindlichen Vermögens» arbeitete. Sein Interesse galt eigentlich ohnehin mehr dem Wiederaufbau einer Kriminalpolizei, und dementsprechend liest sich sein Gesetzentwurf über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes. Einen Bundesverfassungsschutz stellte sich Hagemann als Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft vor, das auch befugt sein müsse, Vernehmungen und Beschlagnahmungen vorzunehmen, sowie Durchsuchungen und Festnahmen durchzuführen. Er entwarf damit das Konzept einer neuen «Politischen Polizei», wie sie auch Vizekanzler Franz Blücher in einem Interview gefordert hatte. Da dies weit über das Konzept einer reinen Sammelstelle für Informationen hinausging, hatte sein Entwurf für einige Unruhe im Innenministerium gesorgt, wo man die Einstellung der Alliierten genau kannte und Vergleiche mit der «Geheimen Staatspolizei» in der Presse Besorgnis erregten.[3] Hagemann bemühte sich, Staatssekretär von Lex zu beruhigen: Die Befürchtung, das Bundesamt könne sich zu einer neuen Gestapo entwickeln, sei schon deshalb völlig verfehlt, weil es dafür viel zu wenig Personal haben werde.[4]
Die Vorstellungen darüber, was der Verfassungsschutz leisten sollte, wen er vordringlich beobachten, mit welchen Möglichkeiten er ausgerüstet, wie aufgestellt sein und ob es nicht doch ein Weisungsrecht der Bundesbehörde gegenüber den Einrichtungen der Länder geben sollte, war also auch nach fast einjährigen Beratungen noch völlig ungeklärt. Mehr noch: Als Innenminister Gustav Heinemann seinen Kabinettskollegen Anfang Februar 1950 einen eigenen Gesetzentwurf vorlegte, stellte Justizminister Thomas Dehler das Vorhaben grundsätzlich in Frage. Er halte die Einrichtung eines speziellen Bundesamts für Verfassungsschutz und entsprechender Landesbehörden weder für «politisch klug noch sachlich zweckmäßig». Diese Ämter stünden zu sehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit und machten «zu viel von sich reden». Eine Überwachung subversiver Aktivitäten sei zwar notwendig, die Behörde würde aber «Vergleiche mit gewissen Einrichtungen in der Vergangenheit» hervorrufen. Besser wäre es, in den Innenministerien der Länder entsprechende Referate einzurichten und «fachlich und charakterlich geeignete Polizei- und Kriminalbeamte im Rahmen ihrer Aufgaben mit der Beobachtung der politisch Verdächtigen» zu beauftragen; deren Zusammenarbeit werde dann «ohne Aufsehen» sehr viel Besseres leisten können. Es war nicht nur eine mögliche Skandalisierung, die Dehler umtrieb, er befürchtete auch, ein Bundesamt für Verfassungsschutz werde durch einen umfangreichen zentralen Apparat von Kontrollbeamten, Vertrauensleuten, Mitarbeitern und Agenten bald eine «beunruhigende Überwachung der Bevölkerung» hervorbringen.[5] Aufhalten konnte Dehler die Einrichtung des Bundesamts allerdings nicht mehr. Ungeachtet seiner Einwände legte Innenminister Heinemann dem Bundeskanzleramt am 27. Februar 1950 seinen Gesetzentwurf vor, am 8. März ging der Entwurf an den Bundesrat, der am 23. März darüber beraten sollte.
Die Alliierten hatten mittlerweile eine zügigere Umsetzung der Vereinbarungen über den Verfassungsschutz durch die Bundesregierung angemahnt,[6] aber die weiteren Verhandlungen zwischen Staatssekretär von Lex und den Sicherheitsdirektoren der Hohen Kommissare zeigten, dass auch auf dieser Ebene noch nicht alle Streitpunkte ausgeräumt waren. Dies betraf zum einen die Stellung des Bundeskanzlers gegenüber dem Bundesamt, zum anderen das Weisungsrecht des Bundes gegenüber den Ländern.[7] Die Alliierten drängten darauf, dass das Bundesamt dem Bundeskanzler direkt unterstellt werden müsse, um den Regierungschef nach amerikanischem Vorbild direkt in die Verantwortung für den Inlandsgeheimdienst einzubeziehen. Dieses wichtige Amt sollte nicht dem Walten eines Ministers oder gar der Ministerialbürokratie überlassen werden, die aufgrund ihrer geringeren Autorität möglicherweise bald die Kontrolle darüber verlieren würden. In den Gesprächen mit den Sicherheitsdirektoren hatten die Vertreter der Bundesregierung zwar eindringlich darauf hingewiesen, dass sich dies mit der im Grundgesetz festgelegten Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers kaum vereinbaren ließe, aber die Alliierten wichen, trotz hartnäckiger Argumentation des Staatssekretärs in einer mehr als fünfstündigen Besprechung, nicht von ihrem Änderungswunsch ab.[8] Die Einrichtung eines Verfassungsschutzes, führten sie ins Feld, sei «auch von Interesse für die gesamte Weltöffentlichkeit», und man müsse verhindern, «dass man auf Gedanken kommt, die der Vergangenheit angehören». Da half auch nicht von Lex’ Hinweis, bereits das Trennungsgebot zwischen Inlandsgeheimdienst und Polizeibehörden verhindere doch, dass dieses Amt den «schlimmen Ruf» erhalten könne, den sein Vorgänger nach 1933 erworben habe.[9]
Auch in der Frage, ob das Bundesamt Weisungsrechte gegenüber den Ämtern auf Länderebene erhalten sollte – in der Dehler und Heinemann wieder konträre Positionen vertraten[10] – schalteten sich die Vertreter der Hohen Kommissare in die Diskussion ein und stärkten die Position des Bundesrats. Im Gespräch mit einem Abgesandten des französischen Sicherheitsdirektors der Hohen Kommissare malte Staatssekretär von Lex zwar das deutlich übertriebene Szenario einer bereits anlaufenden Unterwanderung der Bundesrepublik an die Wand – «Zehntausende von Angehörigen der FDJ» hätten die Grenze in Richtung Westen überschritten, weil die Länder nicht mit dem Bund an einem Strang zögen – er vermochte den Franzosen aber nicht umzustimmen: Dieser machte deutlich, dass die Alliierten von ihrem Vorbehaltsrecht Gebrauch machen und ihre Zustimmung zu einem Gesetz mit uneingeschränktem Weisungsrecht des Bundesamts versagen würden.[11]
Die Bundesregierung fügte sich. Anfang Juni 1950 stellte von Lex den geänderten Gesetzentwurf über das Bundesamt für Verfassungsschutz im Bundestag vor, der es am 28. Juli 1950 verabschiedete. Obwohl auch der Bundesrat das Gesetz am 11. August desselben Jahres billigte, konnte sich die Bundesregierung nicht beruhigt zurücklehnen. In den Ausschüssen des Bundestags war festgestellt worden, dass eine Unterstellung des Bundesamts direkt unter den Bundeskanzler nicht möglich sei, vielmehr müsse das zu bildende Bundesamt zum Ressort des Bundesinnenministers gehören. Der Ausschuss zum Schutz der Verfassung, dem der SPD-Abgeordnete Georg-August Zinn vorsaß, war sich in dieser Frage einig, und der entsprechende Absatz wurde im Gesetzestext geändert.[12] Zunächst kündigten die Alliierten Widerstand an, ihr Veto konnte jedoch verhindert werden, indem man eine Dienstanweisung in Aussicht stellte, die dem Bundeskanzler eine Einflussnahme auf das Bundesamt zusichern würde.[13] Am 11. September signalisierten Mitarbeiter des französischen Sicherheitsdirektors, die Hohe Kommission werde der Regelung nun zustimmen, am 20. September lief die Frist für einen Einspruch ab. Das Gesetz konnte in Kraft treten.[14]
Auf der Suche nach einem Präsidenten
Der Abstimmungsprozess zwischen der Bundesregierung und den Hohen Kommissaren sowie die politische Diskussion im Parlament über den zukünftigen deutschen Inlandsnachrichtendienst fand bei den Medien ein reges Interesse. Anfang Januar 1950 hatte Die Welt erstmals von den Plänen berichtet, eine neue, gegen politische Extremisten gerichtete Sicherheitsbehörde einzurichten, bei der es sich aber um «keine neue Gestapo» handeln werde.[1] Wie das zukünftige Amt konkret ausgestaltet werden sollte, war der Öffentlichkeit somit noch weitgehend unklar. Recht bald schon wurde die Zeitung daher ungeduldig und warf der Regierung im Monat darauf Tatenlosigkeit vor: Bislang gebe es erst einen «lapidaren Gesetzentwurf», und selbst die Frage, wer die Verfassungsschutzbehörde leiten solle, sei offensichtlich noch ungewiss. Es musste also möglichst schnell ein Präsident ernannt werden, damit das Amt seine Arbeit aufnehmen konnte. Die Welt meinte hierzu, weder ein typischer Beamter noch ein Mann aus der Schule von Wilhelm Canaris, des früheren Chefs der Abwehr, gehöre an die Spitze der neuen Behörde, sondern «eine ihrer Vergangenheit nach politisch völlig integre Persönlichkeit, der eine hohe staatspolitische Verantwortung und die Fähigkeit spezifisch politischen Denkens zur Seite» stünden.[2]
Reinhard Gehlen
Tatsächlich hatte die deutsche Regierung bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Schritte unternommen, sich mit den Alliierten über eine geeignete Person zu verständigen, die diesen hohen Ansprüchen genügte. Und als Staatssekretär von Lex im Auftrag der Bundesregierung mit Reinhard Gehlen am 16. März 1950 einen ersten Kandidaten in die Diskussion einbrachte, drängte er die alliierten Sicherheitsdirektoren sogleich, dem Vorschlag möglichst zügig zuzustimmen: Anfang Februar habe die DDR unter Leitung von Wilhelm Zaisser und dessen Stellvertreter Erich Mielke ein Ministerium für Staatssicherheit gegründet, dessen Agenten nun in großem Maßstab Sabotage- und Spionageaktionen vorbereiteten. «Herr Gehlen» sei früher General gewesen, so pries von Lex die fachlichen Qualitäten seines Kandidaten an, und habe in der Abwehr beste Dienste geleistet. Über Gehlens politischen Hintergrund wusste der Staatssekretär wenig zu berichten: Welcher Partei dieser nahe stehe, sei nicht bekannt, aber er gehöre wohl keiner Partei an. Gehlen gelte jedenfalls als absolut unbestechlich, und die Bundesregierung «würde es begrüßen, wenn sie diesem Mann die Vorbereitung der Errichtung des Bundesamts übertragen könnte». Wichtige Mitarbeiter müssten zudem schon jetzt ausgesucht werden, um keine Zeit zu verlieren – eine Liste von Personen, deren politische Vergangenheit vor 1945 bereits abgeklärt sei, legte von Lex während des Treffens gleich vor – und an dieser Auswahl sollte der zukünftige Leiter beteiligt sein.[1]
Ganz überrascht dürften die Sicherheitsdirektoren über die Personalie Gehlen eigentlich nicht gewesen sein, in- und ausländische Journalisten spekulierten schon seit Wochen über dessen mögliche Berufung an die Spitze des Verfassungsschutzes.[2] Der frühere Wehrmachtsgeneral hatte Mitte Oktober 1949 selbst heimlich Kontakt zu Staatssekretär von Lex aufgenommen und diesem bei einer Reihe von vertraulichen Treffen seine Ideen für einen deutschen Nachrichtendienst erläutert. Von Lex leitete die Konzepte durch seinen Duzfreund Hans Globke an Konrad Adenauer weiter und konnte den Bundeskanzler für eine Kandidatur Gehlens einnehmen. Über den späteren Präsidenten des Landesamts für Verfassungsschutz in Bayern Martin Riedmayr, eine sogenannte persönliche Sonderverbindung Gehlens mit dem Decknamen «S 2006», stand Gehlen weiterhin in enger Verbindung mit von Lex und beriet ihn bei der Auswahl potenzieller Mitarbeiter.[3]
Gehlen hatte bereits zuvor deutlich gemacht, dass er seine inzwischen auf einige Tausend Mitarbeiter angewachsene «Organisation Gehlen» von der CIA loslösen und der deutschen Regierung unterstellen wollte – nun bot sich ihm eine gute Gelegenheit dazu. In der CIA hätten ihn viele gerne ziehen lassen, allerdings ohne die Org. Eine ganze Reihe von Mitarbeitern der Agency empfand Gehlen zunehmend als erratisch und kaum mehr kontrollierbar, wiederholt war gefordert worden, ihn zu entlassen. Gehlens Verbindungsoffizier James Critchfield hielt in der CIA jedoch immer wieder seine schützende Hand über ihn, und Globke ebnete ihm den Weg zu Adenauer. Hier deutete sich der Beginn einer engen Zusammenarbeit und möglicherweise auch einer gegenseitigen Abhängigkeit zwischen Globke und Gehlen an. Beide waren bereit, die Regierung Adenauer auch mit solchen Mittel politisch zu schützen, die jenseits der Legalität lagen, wenn sie damit die eigene exponierte Stellung absichern konnten.[4]
Der amerikanische Sicherheitsdirektor Benjamin Shute erhielt von der CIA wenige Tage nach von Lex’ Vorstoß umfassende Auskunft über Gehlen. Der ehemalige Wehrmachtsgeneral sei durch Pflichtgefühl, Patriotismus, Hass und seine Furcht vor dem Kommunismus geprägt, allerdings fehle ihm eine akademische Ausbildung, daher sei er zu unkritisch. Gehlen strebe nach Erfolg und persönlicher Sicherheit, hieß es in dem Memorandum, und habe nie einen Hehl daraus gemacht, nach dem Ende der Besatzung an der Spitze eines deutschen Nachrichtendienstes stehen zu wollen. Sollte Gehlen das Amt des Verfassungsschutzpräsidenten übernehmen, werde er Adenauer loyal dienen. Eine amerikanische Marionette sei er nicht, im Zweifelsfall werde er deutsche Interessen über die der Alliierten stellen und gegen ihm unliebsame Anweisungen Widerstand leisten.[5]
Ob Shute diese Informationen noch vor dem Treffen der Hohen Kommissare mit Kanzler Adenauer am 23. März an McCloy und dessen Stellvertreter, George Price Hays, weitergeleitet hat, ist unklar.[6] Das Bundesamt für Verfassungsschutz stand gleichwohl im Vordergrund dieser Unterredung, und Adenauer sprach sich klar für Gehlen aus. Man habe ihn nach Erkundigungen und einigem Suchen ausgewählt; er selbst habe sich sehr sorgfältig mit dieser Sache beschäftigt. Er kenne Gehlen zwar nicht persönlich, aber die Auskünfte über ihn seien sehr positiv. Der Kanzler hielt Gehlens Kandidatur allerdings auch für nicht ganz unproblematisch: Sobald bekannt werde, dass ein ehemaliger General das Amt übernehme, werde die Öffentlichkeit sofort über eine mögliche Remilitarisierung der Bundesrepublik zu spekulieren beginnen. Eine Alternative zu Gehlen gebe es derzeit jedoch nicht. Monatelang habe man nach einem Zivilisten Ausschau gehalten, der für die Position passen würde, erklärte Adenauer, «aber wir haben niemanden gefunden».[7]
Fünf Tage später tauschten sich die Sicherheitsdirektoren über Adenauers Vorschlag aus, und es zeichnete sich schnell ab, dass der frühere Abwehroffizier keine Chance haben würde, das Bundesamt zu führen. Insbesondere die britische Seite lehnte Gehlens Nominierung klar ab. Seine antibritische Einstellung war bekannt,[8] stellte aber nicht das entscheidende Ausschlusskriterium dar, zumal die Briten auch keinen anderen Kandidaten vorschlagen konnten. Wahrscheinlicher ist, dass auch dem britischen Sicherheitsdirektor zu Ohren gekommen war, was auf amerikanischer Seite längst als offenes Geheimnis gehandelt wurde: Gehlen fehlte es für die Leitung eines Inlandsnachrichtendienstes an Erfahrungen, obwohl seine Org auch in diesem Feld tätig war. Seine Expertise lag im militärischen Auslandsnachrichtendienst, zumindest prahlte Gehlen gegenüber Adenauer damit, dass für ihn als Leiter der Abteilung Fremde Heere Ost «seit Winter 1941 keine russische Handlung bzw. militaerische Operation ueberraschend kam, sondern in allen Einzelheiten meist Wochen, oft Monate lang vorher bekannt war».[9] Für die Alliierten lag aber auch auf der Hand, dass Gehlen versuchen würde, über das Bundesamt einen kombinierten, im In- und im Ausland operierenden Nachrichtendienst zu schaffen. Die britische Seite befürchtete, auf diese Weise könne der deutsche Nationalismus ein neues Machtzentrum gewinnen oder möglicherweise sogar in der Wiederauferstehung des deutschen Faschismus münden.[10] Ohnehin war die strikte Trennung der beiden Dienste entsprechend dem britischen System, also zwischen dem Inlandsdienst MI 5 und dem Auslandsdienst MI 6, für die Briten nicht verhandelbar.[11]
Offensichtlich glaubte auch Staatssekretär von Lex schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr daran, dass sich Gehlen als Verfassungsschutzpräsident durchsetzen ließ. Anlässlich eines österlichen Heimatbesuchs in Bayern sondierte er im April 1950 nicht nur mit Mitarbeitern des im Aufbau befindlichen Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit dem Bundesamt, er traf sich auch mit Gehlen und einem seiner Mitarbeiter, wahrscheinlich Heinz-Danko Herre. Er habe «einen sehr guten Eindruck» von Gehlens bisheriger Arbeit «auf dem Gebiet des Verfassungsschutzes», schrieb Lex nach dem Treffen an den «lieben Globke», und Gehlen habe ihm zugesichert, auch als Vizepräsident zur Verfügung zu stehen. Ein Vertreter der CIA in München, mit dem sich von Lex anschließend besprach, vermutlich Gehlens Führungsoffizier Critchfield, dämpfte allerdings sogleich die Hoffnungen des Staatssekretärs auf eine solche Lösung. Die Amerikaner seien zwar «natürlich» damit einverstanden, dass Gehlen «die Nr. 2» werde, den Briten jedoch sei er wohl selbst als Vizepräsident nur bedingt vermittelbar.[12]
Das Interesse der CIA, mit Gehlen eine Person im deutschen Nachrichtendienst zu installieren, mit der ihnen auch nach dem Ende des Besatzungsstatuts ein direkter Zugang zur Amtsspitze offen stand, ist klar zu erkennen. Im Fall des CIA-Agenten Paul Dickopf, der im Innenministerium unter Hagemann das Bundeskriminalamt aufbaute, sollte sich diese Strategie ja auch als recht erfolgreich erweisen. Für Gehlen war die Position des Vizepräsidenten sogar noch geeigneter als die des Präsidenten, der im Rampenlicht stand und stärker der Kontrolle der Öffentlichkeit ausgesetzt war. Selbst wenn später ein vom Verfassungsschutz unabhängiger Auslandsnachrichtendienst gegründet und Gehlen dorthin wechseln würde, wären die Strukturen so eingespielt, dass der Einfluss der CIA dauerhaft gesichert bliebe.
Allerdings wäre diese Personalie selbst für die amerikanische Seite mit einer ganzen Reihe von Dilemmata verbunden gewesen: Die Amerikaner wussten, dass Gehlens Organisation einseitig ausgerichtet war und jenseits des militärischen Bereichs nur wenig wirklich verwertbare Erkenntnisse lieferte. Für den Chefposten eines Inlandsnachrichtendienstes eignete sich Gehlen also kaum. Mitarbeiter der CIA hatten ihm wiederholt die mangelhafte Effektivität seiner Organisation vorgehalten und ihn aufgefordert, für Verbesserungen zu sorgen.[13] Obwohl die politischen Ambitionen Gehlens der CIA nicht geheuer waren, passte er somit in ihre strategischen Pläne. Er hatte wichtige Verbindungen zur Politik und zu alten Generalstabsoffizieren aufgebaut, die sich als nützlich erweisen konnten – etwa um die irgendwann anstehende Wiederbewaffnung Deutschlands im amerikanischen Interesse zu lenken.[14] Für den Aufbau eines politisch national und international akzeptierten Inlandsnachrichtendienstes und insbesondere dessen Präsidentschaft kam er wegen seiner Ausbrüche gegenüber seinen amerikanischen Führungsoffizieren hingegen nur sehr bedingt in Frage.
Der massive Widerstand der Briten gegenüber einem integrierten In- und Auslandsnachrichtendienst mag nicht unbedingt im Interesse der Amerikaner gewesen sein, hielt aber immerhin die Option offen, Gehlen für die Leitung eines deutschen Auslandsnachrichtendienstes weiter im Spiel zu halten. Er durfte somit gegenüber dem Bundeskanzler nicht zu stark diskreditiert werden. Der amerikanische Sicherheitskommissar kannte inzwischen die ausführliche Einschätzung über die Vor- und Nachteile der Installierung Gehlens im Verfassungsschutz, er zog es bei einem Treffen mit seinen beiden Kollegen aber vor, den britischen Widerspruch zu stützen: Da die Schaffung des Bundesamts für Verfassungsschutz «eines der heikelsten und eines der sensibelsten Probleme» wäre, mit dem die Alliierten konfrontiert seien, solle die Leitung dieser neuen Behörde keiner Person anvertraut werden, der nicht alle Sicherheitsdirektoren zustimmten.[15] «Bezüglich unserer Kontrolle eines zukünftigen deutschen Geheimdienstes», heißt es in einem CIA-Bericht vom Mai 1950 dann argumentativ nachgeschoben, «ist Utility [Gehlen] bereits zu mächtig, um ihm zu erlauben, diese Position einzunehmen.» Als Präsident des Bundesamts würde er die meisten der Karten gegenüber den alliierten Nachrichtendiensten in seiner Hand halten und dadurch «de facto» zum Chef der deutschen Nachrichtendienste werden.[16]
Indem die Amerikaner von Gehlen als Kandidaten für den Leitungsposten des Bundesamts für Verfassungsschutz Abstand nahmen, schwächten sie zwar dessen Machtposition, die er sich durch seine Kontakte zur Bundesregierung hatte aufbauen wollen. Doch war dies durchaus im Interesse der Amerikaner, denen Gehlen zu eigensinnig geworden war, und erlaubte ihnen gleichzeitig, ihren wichtigen Verbündeten bei der nächsten Gelegenheit stärker zu fördern. Zudem öffnete sich den Amerikanern durch ihren Verzicht, Gehlen an die Spitze des Bundesamts zu befördern, die Möglichkeit, als Ausgleich später Personen ihrer Wahl für die Abteilungsleiterebene leichter gegen den Widerstand der beiden anderen Westmächte durchzusetzen. Richard Helms, Leiter der Auslandsabteilung des Office of Special Operations, war der Meinung, amerikanische Diplomaten würden es zu häufig vermeiden, in die inneren Angelegenheiten eines Staates einzugreifen, auch wenn dieser militärisch besetzt sei, und daher von Franzosen und Briten ausmanövriert werden; hier nun böte sich die Gelegenheit, diese beiden selbst einmal auszumanövrieren.[17]
Die CIA befürchtete in dieser Phase des Kalten Kriegs zudem, ihre unter den Decknamen Odeum und Zipper bereits recht gut eingespielten Geheimdienstoperationen gegen die Sowjetunion würden leiden, wenn Gehlen ins Bundesamt abwanderte. Die bundesdeutsche Regierung, so befürchteten die Amerikaner, könnte dann sogar Informanten und andere Aktivposten gegen die USA wenden. Dies würde ernsthafte strategische und politische Konsequenzen nach sich ziehen, und die ließen sich nur vermeiden, wenn der CIA ausreichend Zeit blieb, eine eigene, stabile Gegenspionage aufzubauen. Gehlen war daher als Verfassungsschutzpräsident für die Amerikaner zu diesem Zeitpunkt zwar eine interessante Option, sie kam aber eigentlich zu früh, zumal ihnen mit zunehmender Reorganisation des politischen und sozialen Lebens in der Bundesrepublik die Kontrolle über die Bevölkerung schneller entglitt, als dies zumindest der CIA lieb war.[18]
Nachdem mit Gehlen der möglicherweise erfahrenste, auf jeden Fall aber ambitionierteste Kandidat ausgeschieden war, wurden Personen aus der zweiten Reihe geprüft. Bereits im Februar und März 1950 waren in der Presse neben Gehlen eher beiläufig weitere Namen genannt worden, darunter Werner Jacobi, Kurt Behnke und Paul Hahn.[19] Jacobi war ein in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat, der 1933 aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums als Gerichtsassessor entlassen worden war. Seit 1947 leitete er das nordrhein-westfälische Staatskommissariat zur Bekämpfung von Korruption und Misswirtschaft, das nachrichtendienstlich arbeitete. Er hatte darauf gehofft, nach einem Wahlsieg der SPD Präsident des Bundesamts zu werden. Es war jedoch kaum denkbar, dass er das Vertrauen Adenauers gewinnen würde, und er entsprach auch nicht dem politischen Kalkül des Staatssekretärs von Lex, der zwar sehr auf den parteipolitischen Proporz im Bundesamt bedacht war, einen Sozialdemokraten an der Spitze des Amts aber verhindern wollte.[20]
Paul Hahn hatte vor 1945 zum sogenannten Bosch-Kreis des Widerstands gehört, war verhaftet und zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Nach 1945 kehrte er nach Stuttgart zurück, wo ihn die französische Besatzungsmacht als Landespolizeidirektor einsetzte. Als die Amerikaner Anfang Juli 1945 die Stadt von den Franzosen übernahmen, konnte er diesen gegenüber seine Vorstellungen einer «Staatspolizei» nicht durchsetzen und legte sein Amt nieder.[21] Den Sicherheitsdirektoren war er daher kaum als geeignet zu vermitteln.
Der Jurist Dr. Kurt Behnke diente während des Kriegs fünf Jahre lang bei der Abwehr und war seit 1949 Abteilungsleiter im Bundesinnenministerium. Bei seinen Recherchen zu seinem Hintergrund stieß ein CIA-Mitarbeiter jedoch auf einen antisemitischen Kommentar zur Reichsdienststrafordnung, den Behnke 1940 verfasst hatte. Unter anderem hieß es darin, es sei die Pflicht jedes Beamten, Kontakte mit Juden zu vermeiden und zu verhindern, dass seine Kinder mit jüdischen Kindern spielten. Damit fiel auch Behnke als Verfassungsschutzpräsident aus.[22]
Kurz darauf brachte die Bundesregierung Friedrich Wilhelm Heinz als Präsident oder Vizepräsident des Bundesamts ins Spiel – er hatte das Kabinett bei den Überlegungen über den Aufbau des Bundesamts beraten. In fachlicher Hinsicht wäre er ein sicherlich geeigneter Kandidat gewesen, da er über umfangreiche Vorkenntnisse im Bereich der Nachrichtendienste verfügte, hinsichtlich seiner politischen Vergangenheit vor 1945 ließ sich dies nicht unbedingt sagen. Seit 1920 gehörte Heinz der rechtsextremen «Organisation Consul» an und war unmittelbar an den Attentaten auf Matthias Erzberger, Philipp Scheidemann und Walther Rathenau beteiligt, mit denen der Geheimbund die Weimarer Republik zerstören wollte. Obwohl er die Machtübergabe an die Nationalsozialisten zunächst begrüßt hatte, schloss er sich während seiner Zeit bei der Abwehr dem militärischen Widerstand gegen Hitler an; nach dem Attentatsversuch vom 20. Juli 1944 wurde er von der Gestapo verhört und tauchte dann bis Kriegsende in Berlin unter. Nach 1947 baute er einen privaten Agentenring auf, der Informationen über die Rote Armee lieferte, die Heinz aber gleich mehrfach an verschiedene westliche Nachrichtendienste verkaufte. Er versuchte auch, diese gegeneinander auszuspielen, woraufhin der französische Dienst seiner Geschäftigkeit überdrüssig wurde. Trotz dieser Vorgeschichte schlug von Lex ihn Mitte 1950 als Verfassungsschutzpräsidenten vor. Die amerikanische Seite hätte Heinz möglicherweise auch akzeptiert – mit der CIA scheint Heinz in dieser Zeit weiterhin gedeihlich zusammengearbeitet zu haben –, aber der britische und der französische Sicherheitsdirektor lehnten ihn wegen seiner zu schillernden Vita und seines «zweifelhaften Charakters» ab.[23]
Nachdem mit Gehlen und Heinz fachlich geeignete, politisch aber umstrittene Bewerber abgelehnt worden waren, wurden vermeintlich akzeptablere Kandidaten für den Posten des Präsidenten ins Feld geführt, etwa Joseph Schneider, von 1942 bis 1945 Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium des Protektorats Böhmen und Mähren und seit 1947 Oberkreisdirektor des Kreises Olpe, oder der Verwaltungsjurist Georg von Fritsch, während des Kriegs Ministerialrat im Oberkommando der Wehrmacht und später, von 1958 an, erster Wehrbeauftragter des Bundestags.[24] Doch auch diese Vorschläge der Bundesregierung scheiterten am Einspruch der Alliierten, und die von allen Seiten als zentral erachtete Präsidentenfrage blieb Monat um Monat offen.
Dies stellte den Bundeskanzler vor ein Dilemma, denn ein solches Amt erschien, auch angesichts der Ängste, die der beginnende Koreakrieg schürte, immer dringlicher. Adenauer beauftragte daher den ehemaligen Panzergeneral Gerhard Graf von Schwerin, zusammen mit seinem außenpolitischen Berater, Herbert Blankenhorn, Pläne für eine bundesdeutsche Sicherheitspolitik zu entwerfen und die Gründung eines Bundesverteidigungsministeriums vorzubereiten. Darüber hinaus sollte die «Dienststelle Schwerin» einen kleinen, vorrangig militärisch ausgerichteten Nachrichtendienst einrichten.[25] Adenauer hatte gegenüber den Hohen Kommissaren bereits deutlich gemacht, dass er sich nicht allein von den Informationen abhängig machen wollte, die ihm die Alliierten lieferten, und obwohl diese Aktivitäten den Kapitulationsbestimmungen widersprachen, legten die Hohen Kommissare kein Veto gegen die Organisation ein. Zum Leiter des Dienstes wurde Friedrich Wilhelm Heinz ernannt, der kurz zuvor als Leiter des Bundesamts für Verfassungsschutz abgelehnt worden war und sich nun verstärkt als möglicher Konkurrent Gehlens für den Posten eines militärischen Nachrichtendienstchefs sah. Von Juli 1950 an baute Heinz den nach ihm benannten Friedrich-Wilhelm-Heinz-Dienst auf, der offiziell als «Archiv für Gegenwartsforschung» firmierte und zunächst auch Aufgaben des Verfassungsschutzes übernahm.