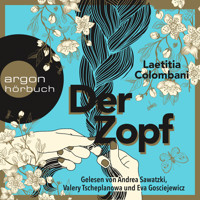3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
»Die Gebote der Liebenden auf dieser Erde sind streng und schrecklich ...« Das erfahren die vier Menschen, deren Liebe und wechselseitige Verstrickung der Autor Karl Wawra schildert. Ein einsamer Garten: ›Kindern Eintritt verboten.‹ Ein junges Paar, das durch die Pforte geht, zum ersten Mal. Zögernde Schritte, eine weite, unbekannte, lang ersehnte Welt; zwei Menschen, geborgen in Fraglosigkeit. Ein anderes, älteres Paar, längst aus der Unschuld in Bewußtheit und betäubenden Taumel verstoßen. Sie begegnen einander. Die »Paradieskinder« erfahren die schmerzende Fülle einer anderen Wirklichkeit. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Ähnliche
Karl Wawra
Kindern Eintritt verboten
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Auf einmal wünschte er, es wäre schon Nacht. Weit und breit war niemand zu sehen. Die Bäume standen reglos im Regen. Alle waren sie kunstvoll gestutzt: grüne Obelisken, Pyramiden, Kugeln. Er liebte die Schüchternheit dieses Parks, das Unterdrückte dieser Vegetation, das Beschnittene der Bäume und Sträucher, die Versklavung der Wege, die sich, vielfach verschlungen, dahinwanden.
Jetzt allerdings war wenig von all dem zu spüren. Der Park wirkte wild wie ein Wald im Gebirge.
Er überlegte, ob der Regen schuld sein könnte an diesem plötzlichen und ungehemmten Hervorbrechen des Baum- und Graslebens, das ihn erschreckte, weil es so heftig war. Er hörte die Vogelstimmen und glaubte die Luft zu sehen – eine Glasscheibe, faltig und runzlig vom Regen. Der Himmel war von freudlosem Grau.
›Was für ein trostloses Wetter‹, dachte er, und in einem jähen Schwall stürzte der Frühling dieses Regens auf ihn los, ein Ungetüm mit Krallen und Keimen und Vogelgezwitscher.
Er vergrub die Hände in den Manteltaschen und senkte den Kopf, aber die Abwehr gelang ihm nicht. Das Ungetüm schlug auf ihn ein, und er empfand müde seine Schutzlosigkeit. Er fühlte einen heftigen Schmerz, aber er war sich nicht klar, was ihm weh tat. Der Schmerz war nicht lokalisiert, er war ein Zustand, dem dieser Regen schadete. Er versuchte, an seinen Körper zu denken, und richtete sich im Gehen auf, aber sein Körper schien ihm zu entfallen, und er war außerstande, einen anderen Halt zu finden. An einem Strauch erblickte er einen sichtlich mutwillig von jemandem abgebrochenen Ast. Dieser Anblick drang tief in ihn ein, in sein Wesen, nicht in sein Gehirn. Er empfand den abgebrochenen Ast, aber er dachte nicht an ihn. Also konnte er auch die Bedeutung dieses Anblickes nur fühlen.
Von dem Glück dieses Nur-Fühlen-Könnens wußte er nichts, denn er war neunzehn, und die unkontrollierbaren Fähigkeiten dieses Alters verschließen sich am tiefsten vor denen, die sie besitzen. So rechnete er nur nach Gedanken und war unglücklich, wenn ihm die nicht gelangen. Hätte er jemanden finden können, der ihm das Wunderbare, das er noch besaß, erklärte–er hätte ihn nicht verstanden. Aber sicher war niemand zu finden.
An einer Wegkreuzung zögerte er, ob er den Umweg eines Parkpfades nehmen oder hinaus auf die Straße treten sollte. Er war noch zu keinem Entschluß gekommen, als er schon auf der Straße stand und weiterging.
Dem Bereich der entfesselten Gräser, Bäume und Sträucher entrückt, empfand er die Angriffe des Ungetüms schwächer, obwohl sie nach wie vor mit gleicher Heftigkeit geführt wurden, denn der Frühling war über der ganzen Stadt.
Das Aufflammen einer Lichtreklame – man hatte sie angeschaltet, obwohl es noch kaum dämmerte – war das letzte, das noch in sein Gefühl eindrang, dann entglitt er seinen Empfindungen.
Er legte das letzte Stück seines Heimweges als Erwachsener zurück, als jene atmende, durchblutete Anhäufung von erstaunlichen Funktionen, die ineinanderspielen, und man weiß nicht wozu. Er lebte an der Schwelle der Jugend, und manchmal überschritt er sie schon.
Er hieß Tino und verdiente bereits seit einem Jahr in einem Büro seinen Lebensunterhalt selbst.
»Die Luft war so rauchig«, sagte Frank, »daß mir die Augen voll Wasser standen. Dabei bin ich sonst gar nicht so empfindlich.«
Antonia sah ihn mißtrauisch an. »Wer war denn sonst noch dort?« fragte sie und bereute schon ihre Worte. Sie wollte rasch weiterreden und etwas Unverfängliches sagen, aber er hatte schon eingesetzt: »Irgendein Film-Mädchen mit einem Kavalier und eine Kunstgewerblerin, die Modeschmuck macht, und noch ein paar Leute.« Er verzog den Mund und löschte seine Zigarette. »So ein Atelier ist schon etwas Wunderbares, wenn man auch im Winter immerzu friert und es im Sommer vor Hitze nicht aushält.«
Antonia lächelte. »Du hättest wohl gern ein großes Atelier für dich allein.« Sie war verärgert, wie immer, wenn er ohne sie an einer Gesellschaft teilgenommen hatte, aber sie wehrte sich, ihren Ärger einzugestehen. Sie wehrte sich fast gegen alles, am meisten gegen ihre Liebe zu Frank, dem sie tiefer und tiefer verfiel. Viele Worte drängten sich ihr auf die Zunge, aber sie sagte keines. Sie konnte jedoch nicht verhindern, daß sie sich alle Mädchen dieses gestrigen Atelierzusammenseins jung, schön und heiter vorstellte und in eine intime Verbindung zu Frank brachte.
»Gehen wir ins Kino?« fragte er und drehte ihr sein Gesicht zu.
Sie erschrak. Immer wieder erschreckte sie das Abenteuer dieses Gesichtes. Er hatte kurzlockiges, pechschwarzes Haar, ganz verzeichnete starke Augenbrauen, sehr lange und sehr dichte Wimpern, ein starkes Kinn, und seine Haut war eine Spur zu dunkel. Aber alles zusammen war von einem seltsamen Zauber und wirkte irgendwie kindlich, obwohl sein Gesicht nicht immer vertrauenerweckend aussah. Er war dreißig Jahre alt und hatte eine sehr tiefe Stimme.
»Ins Kino?« sagte Antonia. »Ach – ich weiß nicht …« Sie legte sich neben ihn auf die Couch, aber sie gab acht, daß sie ihn nicht berührte. Er nahm ihre Hand und rieb die Lackfläche eines ihrer Fingernägel.
Sofort zuckte sie zurück. »Du weißt, ich mag das nicht. Daß du auch immer tun mußt, was ich nicht will.« Sie war gereizt, und ihre eigenen Worte reizten sie noch mehr.
»Die Dame ist wieder in wunderbarer Stimmung.« Er drehte sich ihr zu und fing an, sie zu küssen. Er griff ihr auf die Lippen. Das war eine Bewegung, die sie überaus liebte, wenn er sie im Bett machte, und verabscheute, wenn er sie gedankenlos ausführte. Er wußte das und ärgerte sie damit. Sie schwieg und begnügte sich damit, den Kopf abzuwenden mit einer jener ruckartigen Bewegungen, von denen sie wußte, er mochte sie nicht.
Ihr Zusammenleben, das drei Jahre dauerte, war voll von solchen Sticheleien und Bosheiten.
»Nebenan ist der Film mit dieser Blonden«, sagte Frank, »die wir in ›Schatten der Mauer‹ gesehen haben. Wie hieß sie nur? Du weißt, diese mit den langen Haaren, die mir so gut gefallen hat.«
Antonia wußte den Namen genau, aber sie hütete sich, ihn auszusprechen. Sie merkte sich alles, was Frank einmal bewundert hatte. Sie hoffte, wenn sie den Namen der Schauspielerin nicht nannte, würde er an etwas anderes denken und ihr das Anhören der Hymne auf jene Frau ersparen.
Aber er sagte schon, ganz beiläufig und doch unüberhörbar: »Bestimmt ist sie blöde, aber wie sie sich als Frau ausspielt, das ist großartig …«
»Hör auf«, sagte Antonia, »das verfängt bei mir nicht.« Diese Worte waren für sie etwas Außerordentliches. Sie war fast nie imstande, unbequeme kleine Empfindungen dadurch bedeutungslos zu machen, daß sie sie mit einer ironischen Phrase quittierte.
»Bravo«, sagte Frank prompt, »›sowas verfängt nicht‹ ist gut.«
Er spielte, das wußte sie, auf ihre Humorlosigkeit an. Sie hätte ihm sagen mögen, daß sie es häßlich fand, vor einer geliebten Frau eine andere zu bewundern, daß es sie kränke, daß sie solchen Äußerungen nicht gewachsen sei – aber sie schwieg.
Frank hob die Beine und bewegte sie in der Luft. Er schien sehr heiter. Es machte ihm Freude, seine Schwerelosigkeit, an die er nicht glaubte, vor ihr zu zeigen. Wenn er vor ihr den Schwerelosen spielte, wurde er es. Aber er hielt das für kein Verdienst, denn sie war das Beschwerteste, Ernsteste, was er sich vorstellen konnte. Traf er Leute, die dem Leben wirklich unbeschwert gegenüberstanden, wurde er sofort scheu, schweigsam, grüblerisch.
Manchmal glaubte er, er wäre nur bei ihr, weil sie ihn so sah, wie er zu sein wünschte. Ob er sie liebte, darüber hatte er sich wenig Gedanken gemacht. Er hatte ihren Eintritt in sein Leben gar nicht beachtet. Erst, als ihr Verhältnis schon einige Zeit gedauert hatte, war er sich klargeworden, daß in sein Leben ein zweites und anderes, unübersehbares gekommen war und angefangen hatte, sich breitzumachen. Er hatte diese Tatsache zur Kenntnis genommen und sich nicht sehr damit beschäftigt. Nur zuweilen dämmerte ihm, daß alles verdächtig nach dem aussah, was man mit einem profanen Wort ›Schicksal‹ nennt. Diese Erkenntnis paßte ihm gar nicht. Sie war die Stelle, wo die kleinen Quellchen seiner Bosheit entsprangen, tänzerisch, hübsch und gefährlich.
Das Zimmer füllte sich langsam mit dem Grau der Dämmerung. Draußen sang laut ein Vogel. Sie lagen nebeneinander und rauchten.
Antonia wartete, daß er den Aschenbecher wegstellen würde. Sie dachte: ›Dann muß er sich über mich beugen.‹ Sie schmiedete einen kleinen Plan, wie sie eine reizvolle Bewegung machen würde, einen Lidschlag, eine Kopfdrehung, die ihn dazu bringen würde, sie zu küssen. Aber sofort verließ sie wieder der Mut.
Sie fühlte sich ihm absolut unterlegen. Trotzdem hielt sie sich für eine Frau, wie er so schnell keine wiederfinden würde. Diese Überzeugung war der Punkt, um den ihr ganzes Leben kreiste. Ihre Hilflosigkeit trieb dorthin, ihre Ohnmacht – aber auch ihr Herz, das diese Überzeugung haßte.
Sie war einmal in der Nacht aus dem Schlaf gefahren mit dem Ruf: ›Ich bin wunderbar!‹, und hatte sich nachher voll Entsetzen in ihre Polster verkrochen. Aber in Gedanken schrie sie diese Worte noch oft, während sie sich in ihrem Herzen ekelte.
»Wir können morgen ins Kino gehen«, sagte er und beugte sich, den Aschenbecher in der Hand, über sie. Sie dachte gar nicht mehr an ihren Plan, ihn zu einem Kuß zu bringen. Seine plötzliche Nähe machte sie nur etwas schwindlig.
»Die Ida kommt abends«, sagte sie. Das war eine Aufforderung, die Zeit zu nützen, aber er schien nicht zu verstehen.
»Das alte Luder.« Er setzte sich auf. »Da werde ich bestimmt nicht dableiben.«
»Du kannst ruhig hier sein. Ich habe keine Geheimnisse vor dir.« Er verstand die Spitze. Er lud sie niemals ein, wenn er Freunde traf.
»Ich gehe bestimmt.«
Antonia seufzte. ›Was haben wir heute gesprochen?‹ dachte sie. ›Nichts.‹ Sie hätte gern den Kopf auf sein Knie gelegt und sich an ihn geschmiegt, aber es war ihr nicht möglich. Sie setzte sich auf und starrte vor sich hin.
Frank kannte das genau. ›Sie ist enttäuscht und genießt ihre Unzufriedenheit!‹ Er griff in ihr Haar und zwang sie, ihn anzuschauen.
Sie hätte am liebsten geweint. Langsam senkte sie ihre Lider.
»Maria Stuart, letzter Akt«, sagte er.
Sie wußte, sie wirkte tragisch, und das ohne greifbaren Grund. ›Ich kann nichts dafür, daß ich so bin‹, dachte sie. Sie vergrub ihr Gesicht an seiner Schulter. Er hielt sie fest und wurde ganz ernst.
Dieser Ernst war eine wichtige Station auf ihren täglichen Kreuzwegen. Frank konnte sich ihm nicht entziehen, aber er brachte es nicht zustande, ihn zu etwas Positivem auszugestalten. Dieser Ernst nahm ihm die Lust, Antonia in die Arme zu nehmen und auszuziehen, und machte ihn nicht gütig genug, ihr auf andere Art Liebe zu beweisen.
Es endete immer so, daß er nach einer Weile aufstand und in ruhigem, alltäglichem Tonfall etwas Bedeutungsloses sagte. Auf diese Art lösten sie ihre Beklommenheit, ohne sie zu tilgen. Der Rückstand blieb am Boden ihrer Beziehung und verhärtete sich zu einer Schicht von mißfarbenem Stein, die sich unmerklich verdickte.
Frank knipste das Licht über dem Toilettentisch an. Er blickte auf die Puderschachtel, den Kamm, den Lippenstift, die Klipse. Gedankenlos nahm er ein Fläschchen zur Hand, und es war eine Geste der Liebe. Wenn er Antonia liebte, dann in ihren Dingen.
»Laß das stehen«, sagte sie eifersüchtig, »du weißt, ich mag nicht, wenn du alles durcheinanderbringst.« Sie hatte sich erhoben und stand in dem Alkoven, als wäre sie vergessen worden.
Frank dachte: ›Sie ist lange nicht so hilflos, wie sie sich stellt.‹ Er wußte – es hätte nur einer Bewegung bedurft, und alles wäre in Ordnung gewesen. Er hätte sie nur in die Arme zu nehmen brauchen, aber sein eigenes Widerstreben machte ihn unfähig zur Zärtlichkeit. Er kannte seine Qualitäten als Liebhaber. Wie bei allen Männern, die besondere Qualitäten als Liebhaber haben, war auch bei ihm die Beziehung zu Frauen in irgendeinem Sinn verdorben, verbogen, beschädigt.
Antonia schloß das Fenster. Sie hütete sich, die Vorhänge zuzuziehen. Das Schließen der Vorhänge war das Zeichen für Bett, ein strenges Gebot, dem beide sich sofort unterwarfen.
Aber Frank hatte es gern, auch damit sein Spiel zu treiben. Als hätte er sich verändert, sprang er auf, lachte, stellte sich vor sie hin und sagte: »Wer macht die Vorhänge zu? Muß ich wieder alles tun?«
Sie hatte keine Antwort. Sie hätte viel dafür gegeben, ein paar duftige, anmutige Worte zu finden, und Frank erwartete diese mit dem Gefühl eines Menschen, der weiß, er bekommt nie, was er ersehnt. »Mein Süßes, mein Geliebtes, mein Goldengel«, flüsterte er und übersäte ihren Hals mit Küssen.
›Ob er weiß, wie hämisch das klingt?‹ dachte sie. Sie kränkte sich nicht, aber es kam ihr vor, als bestünde sie nur aus Schmerz. Sie rieb ihre Schläfe an seinem Kinn. Es wirkte fürchterlich. Sofort ließ Frank sie los, ging weg, warf sich aufs Bett, nahm eine Zeitung.
Die Vorhänge blieben offen. Das Spiel mit dem Gebot war zu Ende. Antonia setzte sich neben Frank. »Nimm dir die Zeitung mit, wenn du sie lesen willst«, sagte sie, »bist du gekommen, um Zeitung zu lesen?« Sie wußte, die Zeitung war ohne Bedeutung. Sie hätte nichts daran gefunden, wenn er aus Interesse stundenlang Zeitung gelesen hätte, aber das war nicht der Fall. In dem Augenblick, da sie die Zeitung als eines seiner Requisiten erkannte, war sie ein Greuel geworden, ein tückisches Ding, mit dem es fertig zu werden galt. Sie nahm ihm das Blatt weg. »Nimm sie mit. Ich habe alles gelesen.« Sie ging sogar hinaus und steckte die Zeitung in Franks Manteltasche. Auf dem Rückweg faßte sie den Entschluß, heiter zu sein. Mit einem Lächeln kam sie zurück.
Wenn sie lächelte, war sie sehr schön. Ihr Gesicht war ein wenig zu scharf. Sie hatte ungewöhnlich große blaue Augen und einen zu schmalen Mund. Auch der Lippenstift konnte darüber nicht hinwegtäuschen. Im allgemeinen wirkte ihr Gesicht ernst und sehr intellektuell. Aber manchmal – und meist dann, wenn sie lächelte – wurde es gelöst, kostbar, luxuriös.
Sie war vierzig, und ihr Aussehen näherte sich dem einer Frau, deren Alter man nur mehr schätzen kann. Jung hatte sie niemals gewirkt. Sie war den Leuten, die sie kennengelernt hatten, auch niemals besonders weiblich erschienen. Aber sie war es. Sie hatte die verborgene, ausweglose Weiblichkeit der Frauen, die ein wenig herrisch wirken, eine Weiblichkeit wie eine Folter, auf die sie ihr Leben lang gespannt war – die bittere Weiblichkeit kluger und sehr persönlicher Frauen.
Daß Frank jünger war als sie, quälte sie sehr, aber es war eine Qual unterhalb ihrer Existenz, uneingestanden, niemals in etwas gespiegelt, und daher ganz unerlöst.
Antonia setzte sich neben Frank. Sie hatte plötzlich Oberwasser bekommen, vielleicht, weil sie wußte, er liebte ihr Lächeln, vielleicht, weil sie sich ihres Sieges über die Zeitung freute. Sie nahm seine Hände und spielte mit ihnen.
Franks Hände waren besonders schön, nicht groß, aber sehr männlich, breit, hart und knochig. Männerhände, die so waren, hatten auf Antonia immer erregend gewirkt, aber sie hatte immer geglaubt, sich dieser Erregung schämen zu müssen. Als sie jedoch Franks Hände zum ersten Mal erblickt hatte, war dieser Zwang zur Scham auf einmal weggeblieben – ein Ereignis, das Antonia fast schon mit Liebe quittiert hatte. Frank erregte sie ungemein, vielleicht, weil er ein ganz ungewöhnlicher Typ war – aber die Erregung, in die er sie versetzte, hatte sie von Anfang an zutraulich, bereitwillig, hingebungsvoll gemacht.
Freilich waren alle diese Vorgänge auf ihr Inneres beschränkt geblieben. Sie nach außen zu bringen, um Frank damit zu erfreuen, war Antonia nie gelungen, außer im Bett.
Dies war die Wurzel des Unglücks in ihrer Beziehung. Nach außen hin war Antonia Frank immer herb, verschlossen, mokant erschienen. Daß sich ihm nur im Bett die aufgelöste, hingegebene, sonst unspürbare Frau in Antonia erschloß – das hatte er nicht zu deuten gewußt, und Antonia wieder war durch dieses sein Versagen der Mut, ihn zu einer Deutung zu bringen, abhanden gekommen.
Das Ergebnis war, daß sie beide die sexuellen Begegnungen suchten und sich daran klammerten. Frank, weil da Antonia so war, wie er sie wünschte, und Antonia, weil sie da – und nur da – so sein konnte, wie sie eigentlich immer sein wollte.
Eine Lösung war dies freilich nicht. Die Sexualität konnte nur beschwichtigen, wo es notwendig gewesen wäre, aufzulösen, nur vorübergehend zum Stocken bringen, wo es eines wirklichen Aufhaltens bedurft hätte. Die böse Bewegung, die die Beziehung zwischen Frank und Antonia war, ging unaufhörlich weiter und gebar die beständigen Spannungen, Ungereimtheiten, Kämpfe – die Unbehaglichkeit, an der sie litten und die sie manchmal auch verzweifelt auskosteten.
Vom Hof her hörte man Schritte und Stimmen. Sie schienen unverhältnismäßig laut. Der Frühling kam wie etwas Penetrantes.
Antonia floh mit den Augen in die Winkel des Zimmers, wo die Jahreszeit nicht hinkonnte, wo es immer dämmrig war und grau. ›Spinnwebenlicht‹, dachte sie, und sie sagte: »Mir ist kalt.«
»Ich wärme dich«, sagte Frank, und er dachte dabei an nichts. Sie hatten genug von ihren Quälereien, ihrem Unsinn, ihrem Leben. Müde preßten sie ihre Körper aneinander – bekleidete, verhängte Körper –, und sie empfanden ihre Wärme wie etwas Sinnloses, das sie traurig stimmte.
Während Tino die Stufen zu seinem Zimmer hinaufging, summte er ein Kinderlied vor sich hin. Es war französisch, und er überlegte, woher er es kannte, ob aus den Französisch-Stunden, die er während seiner Volksschulzeit privat gehabt, oder aus einem Film oder vom Radio.
Wenn er an seine Volksschulzeit dachte, schien sie ihm seit einer Ewigkeit vergangen. Er hatte noch die glückliche Gabe, ein paar Jahre für eine Ewigkeit halten zu können. Etwas, das vier oder fünf Jahre zurücklag, schien ihm historisch, urzeitlich, versunken. Es war seine Jugend, die ihm dieses Talent ließ, ein zauberisches, unbewußtes Talent, nicht entwickelbar und dem Verlieren geweiht.
Die Französisch-Stunden waren das große Abenteuer seiner Kindheit gewesen. Er entsann sich der Wohnung, wo die Kurse abgehalten worden waren, der Mütter, die nebenan Tee getrunken hatten, der Lehrerin, des Grammatikbuches.
Diese Gedanken erfüllten ihn mit brennendem Schmerz. Er war voll Sehnsucht nach dieser Kindheit, aber er wußte – eine Rückkehr war unmöglich. Mit dem Tod seiner Eltern hatte das nichts zu tun, es war unmöglich aus ihm selbst heraus. Er kam sich nicht nur erwachsen vor, sondern gereift, nahezu gealtert.
Voll gieriger Teilnahmslosigkeit machte er sich klar, daß er dem Leben der ›Großen‹ gegenüberstand – einem Leben, das ihm aufs äußerste mißfiel, das es aber zu ertragen galt.
Für ihn gab es noch keine Grenzen zwischen Sentimentalität und echter Trauer. Alle seine Gefühle waren von demselben Ernst, derselben Wildheit und derselben Reine. Immer hatte er die verschwenderischen Würgengel der Jugend um sich, die eifersüchtigen Hüter seines Alters.
Er war allein auf der Erde. Die Älteren, die er kannte, beschäftigten sich nicht mit ihm, oder sie fanden ihn ›überaus gereift für seine Jahre‹ und taten ihn damit ab, oder sie konnten ihn nicht leiden. Sie versagten alle. Ihrer eigenen Jugend entschlüpft, hatten die Instinkte in ihnen sich vergröbert, und die Witterung für die Jugend anderer besaßen sie überhaupt nicht mehr.
Die Gleichaltrigen suchte Tino nicht. Einzelgängerisch lebte er dahin, und einsam hatte ihn dieser Frühling getroffen, der ihm wie sein erster erschien.
Mit seinem Zimmer beschäftigte er sich nicht. Er brauchte noch keine Umgebung. Er hatte sein Milieu um sich, ein seltsames Tabernakel, in dem er lebte. Sobald er das Zimmer betrat, erfüllte es sich mit seiner Existenz. Ihm war niemals langweilig. Eigenbrötlerisch verstrickte er sich, war er allein, in ein Netz von Tätigkeiten. Er baute Selbstgespräche auf wie Moscheen, in denen er herumging, andächtig und vertieft – ein Beter, ein Gottsucher, ein Prophet. Darüber, was er betete, sich prophezeite, machte er sich keine Gedanken. Den Gott, den er suchte, kannte er nicht. Tinos Beschäftigungen ruhten in sich selbst, sie waren vollkommen und fehlerlos. Sie waren nie – wenigstens nicht die geistigen unter ihnen – in Verbindung gekommen mit der schmutzigen Substanz eines Zweckes. Also waren sie rein.
Hätten sie sich gestaltet – sie hätten nichts anderes werden können als Tau.
Er sang wieder das französische Lied. Es fiel ihm ein, daß er es im Radio gehört hatte, in einem Schlagerarrangement, in den Rhythmus eines südamerikanischen Tanzes übersetzt. Er hörte die Stimme des Chansonniers, die ihm wie eine Tierstimme vorkam, weich, scheinbar unausgebildet, sehr angenehm.
Mit dem Lied kam ein ganzer Erdteil zu ihm, den er nur von Landkarten und den Reklamefotos der Fluggesellschaften kannte. Es erschienen ihm nicht die Städte, Berge, Küsten und Wüsten jenes Erdteiles, nicht seine Menschen – wenngleich er sich diese braun, schön und in leuchtende Gewänder gekleidet vorstellte –, es erschien ihm das Wesentliche: der Zauber der Luft, der Meerdunst, der ungreifbare Atem über allem. Seine Phantasie zog das Unwirklich-Wirkliche hervor und beschäftigte sich damit, als wäre es wesenhaft und glücklich.
Er nahm den elektrischen Kocher, steckte ihn an, holte die Pfanne, das Fett und Eier und schnitt ein Stück Wurst in kleine Stückchen. Sein Hunger und seine Phantasie waren noch Geschwister.
Tinos Eltern waren seit Jahren tot. Nach dem Tod der Eltern war er in eine Provinzstadt zu Verwandten gekommen, die ihn aufgezogen hatten und, vor nunmehr einem Jahr, nach der Matura, wieder in diese Stadt, seine Geburtsstadt, zurückgebracht hatten, damit er seine Stellung, die ihm auch von ihnen verschafft worden war, antrete.
Er war nicht schön, doch sympathisch. Sein Haar war blond, und wenn die Sonne darauf schien, hatte es die unschilderbare Farbe des Goldes. Sein Gesicht war noch ganz offen und voll von jener bedenkenlosen Bereitschaft für das Leben, die den Zauber der Jugend ausmacht. Sein Lächeln erblühte gleichsam auf seinem Gesicht. Er wirkte immer, als käme er gerade aus einem hellen Regen oder einem soeben mit Wasser besprühten Garten.
Während er aß, beschäftigte er sich weiter mit Südamerika. Er entsann sich, daß er vor Jahren im Sommer in einem Gebüsch am Wegrand eine Zeitung mit einer Kinoannonce gefunden hatte. Die Annonce zeigte tanzende Gauchos und quer darüber die Namen der Stars und den Titel des Filmes. Das Papier hatte dagelegen, im prallen Sonnenlicht, leicht vergilbt, eine Feder der Phantasie, im Flug verloren – ein Stück Welt in einem staubigen Strauch am Wege. Die Magie dieser Zeitungsseite hatte weitergewirkt und nun, im Bund mit einem unbedeutenden Lied, einen Erdteil erschaffen, der Tino allein gehörte: er konnte ihn mit sich tragen, aufrollen wie einen Teppich, hingießen über sein Leben, seinem Schlaf umwerfen wie einen leuchtenden Schleier.
Die Talente von Tinos Gaumen waren eins mit den Talenten seiner Vorstellungskraft. Sein Leben ruhte schwerelos in sich selbst: eine Libelle, die reglos auf einem glühendheißen Felsen rastet.
»Haben Sie alles aufgegessen?« fragte Ida. Sie hatte wieder einmal nicht angeklopft. »Brauchen Sie noch etwas? Milch ist in der Küche. Ich habe sie unter die Wasserleitung gestellt …« Ida redete eine lange Weile. Sie war Tinos Quartiergeberin. »Haben Sie zugehört, Tino?« fragte sie dann.
»Ja.«
»Und eine Orange für das Frühstück liegt auf dem Tisch. Sie können auch den Salat essen, aber den müssen Sie sich herrichten, er steht im Fenster, wenn ich ihn jetzt mache, ist er ganz welk bis morgen …« Sie trat vor den Spiegel und rieb ihre Lippe, die sie heftig geschminkt hatte. Sie machte eine herrliche Grimasse, während sie das Rouge verrieb, und ihre Stimme war blökend wie die einer Idiotin. »Ich wollte Ihnen noch sagen, daß die Wäsche gekommen ist. Ich habe alles übereinandergelegt. Wenn Sie etwas wollen …« Sie war mit ihrer Lippe fertig und sprach wieder normal. »Werfen Sie nicht wieder alles durcheinander, das ist ja grauenvoll. Grauenvoll«, beharrte sie, »und wie es hier stinkt. Habe ich Sie nicht tausendmal gebeten, in der Küche zu kochen! Ich werde den Kocher verstecken, Sie werden schon sehen … Oder ist etwas in der Küche, von dem Sie annehmen, es bisse Sie?« Manchmal verfiel Ida in eine grammatikalische Wut. Dann befleißigte sie sich einer Sprache von penetranter Gepflegtheit. »Es stinkt wahnsinnig …« Sie riß das Fenster auf. Der Abend stürzte herein. »Ah«, schrie Ida, »sehen Sie diesen Abend … Riechen Sie … Atmen Sie tief.«
»Ich sehe und rieche und atme«, sagte Tino.
»Heute müssen Sie unbedingt noch spazierengehen. Diesen Abend müssen Sie gehabt haben – was heißt gehabt – besessen! Sie müssen ihn besessen haben, Tino! Aber jetzt muß ich gehen. An solchen Abenden denke ich immer an Springbrunnen. Springbrunnen sind diese Abende. Alles fällt und fällt, und man weiß nicht wohin.« Sie setzte sich. »Also, ich gehe jetzt weg. Wenn Sie wollen, nehme ich Sie mit zu meinen Freunden. Eine sehr interessante Frau. Eine Dame. Antonia. Privatisiert, hat Vermögen. Nachmittags geht sie zu Doktor Broßmann, dem berühmten Facharzt. Sie macht dort so … Kartei und betut sich ein bißchen. Sonst wäre es ihr gar zu langweilig.« Sie verdrehte die Augen. »Und Frank. Also Frank ist beim Film. Auch beim Theater. Also, ob er ein großes Licht ist, weiß ich ja nicht, aber jedenfalls ist er eine bemerkenswerte Type. Also, jetzt geh ich.« Ida erhob sich. »Lachen Sie nicht. Ich weiß, ich bin ein altes Greuel, aber ich habe Sie sehr gern, Tino, sehr gern, das wissen Sie.«
»Ich weiß es«, sagte Tino, »und ich werde die Wäsche nicht durcheinanderbringen.«
»Ach ja, die Wäsche. Wissen Sie, Unordnung ist ja etwas Zauberhaftes. Aber man soll sie nicht pflegen. Sie muß einem passieren. Dann ist sie richtig.«
»Ich pflege sie doch nicht.«
»O ja. Und wenn Sie sie nicht pflegen, dann haben Sie es noch nicht gelernt, wie man es anstellt, daß sie einem passiert.«
»Ich werde mich bemühen, es zu lernen.«
»Bemühen Sie sich, Tino, ja, ja – bin ich frisiert?« Sie hatte ihr graues Haar in die Wangen gekämmt. Sie war keineswegs frisiert, aber im ganzen gesehen, wirkte ihr Haarschopf gebändigt. »Wollen Sie morgen eine Roulade haben? Morgen abend werde ich kochen.« Kochen war für Ida immer etwas Wundervolles. »Ich nehme soviel Zwirn, daß es unmöglich sein wird, ihn zu lösen. Dann essen wir die Roulade als Brei und ziehen einen langen Faden heraus. Was brauche ich? Ich hole das Kochbuch.« Sie machte gleich wieder kehrt. »Nein, ich muß gehen. Morgen werde ich alles lesen.«
»Sie werden es wundervoll machen.«
»Ja, ganz wundervoll. Also spüren Sie doch diese Abendluft. Dabei hat es vor einer Stunde noch geregnet. Diese Luft …« Sie legte den Kopf zurück und lächelte verklärt. Sie war sechzig und bemühte sich nicht, jünger auszusehen. Aber sie wirkte sehr jugendlich. Eine verklärende Verrücktheit umgab sie und lieh ihr ihre zeitlosen Flügel. »Früher hätte ich aus diesem Abend einen Hut gemacht. Was heißt Hut! Einen chapeau!«
»Aber Sie machen doch auch heute noch wundervolle Hüte.«
»Aber es sind nur mehr Reproduktionen. Die Zeit der chapeaux ist vorbei. Die Zeit der Hüte ist angebrochen. Früher war jeder Hut für mich ein Erlebnis. Wissen Sie, Tino, aus einem Abend wie diesem hätte ich ein Wagenrad gemacht. Oben rauchblauen Tüll und Federn. Was für Federn? Reiher? Aber warum soll ich mich quälen? Sehen Sie, die Zeit der chapeaux ist vorbei …«
»Darf ich wieder einmal in ihr Geschäft kommen?« fragte Tino begierig.
»Aber ja, ja, wann immer Sie wollen.« Auf einmal war Ida eine Großmutter aus dem Märchen und Tino ein Enkel, der von ganz nahe in das Feuer im Küchenofen schauen wollte. Nur war das Feuer kein Feuer und die Küche keine Küche. Es handelte sich um ein Hutgeschäft. Aber Märchen sind nicht gebunden. Sie bleiben sie selbst, wo immer sie spielen. »Und die Roulade morgen, die mache ich ganz bestimmt. Früher, wenn ich ein paar chapeaux gemacht hatte, mußte ich gehen und kochen. Kochte ich gut, mußten die Hüte umkomponiert werden. Dann waren sie schlecht. Aber wenn das Essen nicht hinunterzubringen war, dann waren die chapeaux gelungen. Wie das Leben ineinanderspielt! Diese Zeichen stimmten immer. Aber –«
»Dann muß man hoffen, daß die Roulade morgen mißglückt.«
»Aber nein, mein Kind, nein – Sie vergessen, daß ich mein Leben gelebt habe. Heute ist dem nicht mehr so.«
»Wie ist dem heute?«
»Wie komisch Sie sich ausdrücken, nein, wie komisch. Heute ist das ganz anders. Ich reproduziere – vergessen Sie das nicht.«
Tino lächelte. Er hatte Ida sehr gern. Sie waren Geschwister, nur lagen zweimal zwanzig Jahre zwischen ihrer Geschwisterlichkeit. Tinos Phantasie und Tinos Hunger waren noch eines. Ida hielt schon dort, wo es nicht mehr der Ausgleiche bedarf, im Alter. Sie brauchte nicht mehr zu kochen, um ihre Hüte zu vergessen.
Sie war schon wieder einsam, und Tino war es noch immer.
Frank und Antonia standen im Vorzimmer. In diesem Raum, der kein Zimmer war und noch kein Gang, spielten ihre seltsamsten Liebesszenen.
Antonia stand im Schlafrock dicht vor Frank, und ihre Bemühungen, ihn zu umarmen, scheiterten. Sie fühlte sich, wie immer nach einem mißlungenen Zusammensein, schuldig und trostbedürftig zugleich. Sie kam sich unsagbar elend vor und mußte doch über sich lächeln.
Frank wußte genau, was nun geschehen würde. Wenn er von ihr fort war, auf dem Wege nach Hause, würde er anfangen, sie zu lieben. Er wußte nicht warum, aber es erstaunte ihn jedesmal, daß er, war er gegangen, eine seltsame Bewegung in der Gegend seines Herzens fühlte, schmerzhaft und einem Erbarmen ähnlich. Er konnte nicht umhin, dieses – Zucken, das jedesmal kam, als eine Äußerung von Liebe zu nehmen.
Beim Abschied verdichteten sich die Empfindungen dieser beiden. Die Luft, die sie atmeten, verpreßte sich in ihnen, und sie versuchten, durch Zärtlichkeit füreinander diesem Druck zu entkommen.
»Es war wieder einmal gar nichts, nicht wahr?« fragte Antonia. Sie lächelte und sah sehr schön aus und sehr klug. »Und ich hatte mich so nach dir gesehnt.«
Er zog sie an sich. Es wurde kein Kuß, aber die Berührung ihrer Wangen hatte mehr Gewicht, mehr Bedeutung, mehr Ausdruck. »Morgen werden wir uns sehen«, sagte er leise. Er hielt ihre Taille und spürte die Nähe ihrer Brüste. »Schlaf gut.«
Sie zögerte. Es war ihr zum Weinen, während sie glaubte, sich verspotten zu müssen. Es war ihr, als sähe sie den Atem, den sie ausstieß: schwebende Fäden, die von ihren Lippen flossen. »Du hast mich schon lieb, nicht?« fragte sie in einem Ton, der nur halb so dumm war, wie er ihr vorkam.
»Ja«, sagte Frank, »ja …« In jeder anderen Situation hätte eine solche Frage ihn aufgestachelt, abwehrend, bissig gemacht. Die Zwischenlandschaft des Vorzimmers schloß solche Reaktionen aus. Das Gesetz, das hier herrschte, hieß: sei sanftmütig. »Ich habe dich lieb.«
Antonia glaubte es nicht. »In der Zeitung sind Besprechungen über Dreharbeiten von Maxnitz, hast du die Zeitung?« Sie griff nach seiner Tasche. »Ärgere dich nicht, wenn du es liest.«
Er dachte nicht daran, sich zu ärgern. »Ach«, sagte er, »was dir einfällt –!«
Sie standen dicht nebeneinander. Tun konnten sie nichts. Ihren Tätigkeiten waren sie entkommen, oder sie hatten sie verlassen wie das Zimmer. Alles hing in der Luft, ein Zwischending in einem halben Vakuum.
»Leb wohl!« sagte Frank.
»Leb wohl!« sagte Antonia.
Er machte die Tür auf. »Spät ist es schon wieder. Bleib nicht zu lange auf.«
»Du hättest doch dableiben können. Ida hätte sich gefreut.«
»Ach nein, ich hätte euch gestört.«
»Du weißt«, flüsterte sie, »ich bin immer froh, wenn du da bist.«
Die Luft des Stiegenhauses kam durch die Türe. Die Szene verwischte sich, wurde undeutlich. Aber sie schwebte noch immer. Gedankenlos drückte Frank den Schalter des Stiegenlichtes, der nicht funktionierte, denn es war noch nicht dunkel. »Ich bin so daran gewöhnt, nachts wegzugehen«, sagte er lächelnd.
»Komm noch einmal zurück. Gib mir einen Kuß.«
Er ging die paar Schritte. Sie standen in der Tür, als kämen sie nicht voneinander los. Aus einiger Entfernung betrachtet, sahen sie aus wie Schatten.
»Leb wohl!«
»Leb wohl!«
Sie hielt die Türe offen, während er hinunterging. Als er schon ein Stockwerk tiefer war, rief sie noch: »Gute Nacht!« Sie sagte es ohne Stimme. Sie atmete es aus.
»Gute Nacht!« rief Frank von unten.
Die Tür klinkte ein. Die Szene war aus.
Frank ging rasch hinunter. Er fühlte sich erst erleichtert, als er auf der Straße war. Er war bereit, Antonia zu vergessen. Er wünschte die Situation hinter sich zu wissen – eine unvollendete Konstruktion, für die niemand verantwortlich war.
Aber die Szene wirkte nach wie immer.
Die Spuren des Regens waren schon verschwunden. Der Abend war warm und seltsam. Frank kannte jede Straßenecke des Heimweges. Er war ihn viele Male gegangen. Niemals hatte er ihn, wie den Hinweg, als einen Trott empfunden.
Da er seine Heimwege unter den geheimnisvollen Begleiterscheinungen einer Art Liebe zurücklegte, waren sie niemals eintönig. Jeder einzelne, so sehr sie einander glichen, hatte seine Färbung, sein Gesicht, seinen Schimmer. Die schuldbewußte Zärtlichkeit, die Frank spürte, war freilich immer dieselbe, aber sie besaß das bißchen Ungeklärte, das in allem, das Gefühlen entspringt, steckt – und so konnte sie nicht anders, als sich unaufhörlich erneuern.
›Ich hätte doch mit ihr ins Bett gehen sollen‹, dachte Frank, ›dann wäre alles besser gewesen.‹ Er wußte es aus Erfahrung, daß die Sexualität ihnen immer half. Er spürte eine jähe Begierde, nicht nach Antonia, sondern nach einer Frau überhaupt. Aber er gab nicht nach und wartete, bis ihm etwas einfiel, das sexuell und zugleich mit Antonia verbunden war. Dann atmete er ein wenig auf.
Die Hürde war genommen. Das schlechte Gewissen hatte freie Bahn. Er fing an, rascher zu gehen, und es wurde ihm leichter. Gewaltsam griff er auf, was an Zärtlichkeit und Güte in ihm erstand, riß es höher, schlang es um sich, verstrickte sich darin, ging damit einher und spürte dabei mit einer scheuen Freude, daß alles – wieviel er auch bewußt dazutun mochte – im Grunde ganz von selber geschah. Alles galt Antonia.
Manchmal hatte er den Wunsch, sie zu lieben, und dieser Wunsch war dann von derselben Heftigkeit wie der andere, von ihr loszukommen. Er wünschte nicht aus seinem Herzen, sie zu lieben, sondern aus Gründen einer inneren Konvention. Er war der Überzeugung, es sei notwendig, daß man jemanden liebe, daß man für diesen Jemand bereit sein müsse, alles zu tun oder alles zu lassen.
Antonia war dieser Jemand nicht. Aber Frank wußte niemand anderen. Er stellte sich manchmal eine Frau vor, die er lieben würde – ein Phantom, eine Schimäre, die er anzweifelte.
Zweimal hatte er Antonia betrogen. Sie hatte nie etwas davon erfahren, es waren nur kurze, belanglose Abenteuer gewesen. Er hatte sie verglichen mit seiner Beziehung zu Antonia, und der Vergleich war eindeutig zugunsten Antonias ausgefallen. Aber an der Situation hatte das nichts geändert.
Im Grunde wünschte er, frei zu sein. Seine Überzeugung aber, es sei wichtig, jemanden zu lieben, ließ ihn nicht los. ›Sie ist in mein Leben geraten, und ich weiß nicht wie‹, dachte er. ›Wie ein Wunder oder wie eine Mißbildung? Antonia ist überzeugt, wie ein Wunder!‹
Einen Moment lang erlosch seine Liebe. Dann flammte sie um so heftiger auf. Sie stieß ihren Stachel in ihn, und er erkannte den Schmerz wieder, die Bewegung in der Gegend seines Herzens, die immer wieder ersehnte.
Mit einem furchtbaren Jubel spürte er, daß er litt.
Die einzige Leistung, die Frank vollbrachte, war, daß er lebte und ein wundervoller Liebhaber war. Von Beruf war er Filmstatist. Auch die Theater holten sich ihn, wenn sie einen Komparsen brauchten, der besonders interessant aussehen sollte.
Ehrgeiz hatte Frank keinen. Er hatte auch kein Talent und wußte das. Er brachte nur die Fähigkeit mit, sich, wie überall, so auch auf der Bühne oder vor der Kamera locker, selbstverständlich und gut bewegen zu können.
Er wirkte sehr männlich und doch sehr anmutig. Er war als Typ nicht einzuordnen. Manche Leute fanden ihn schön, manche häßlich, aber alle markant.
Die Natur, die diese Erscheinung mit besonderer Sorgfalt hervorgebracht hatte, sorgte auch mit besonderer Sorgfalt für sie: Frank arbeitete nur zeitweise. Seine Beschäftigung war ihm ein Broterwerb, der ihm kaum etwas bedeutete – auch in diesem Punkt unterschied er sich von allen seinen Kollegen, die Karriere machen wollten und sich einbildeten, Talent zu haben.
Frank verdiente recht gut. Er konnte auch sehr gut wirtschaften. Er war weder besonders gut noch besonders böse und keineswegs dumm. Dort, wo er genial war, als Mann – dort war er manchmal gefährlich. Vermutlich würde nichts herauskommen bei seinem Leben, wenn man die Tatsache, daß Frank gelebt hatte, als »nichts« bezeichnen wollte.
»Grüß dich Gott, mein Süßes«, sagte Ida in der Tür, »schau, was ich dir mitgebracht habe. Hast du nicht so eine weiße Vase, die rasend komisch ist, schaut aus wie ein Fetisch. Hast du sie noch, sag, hast du sie noch?« Man hätte meinen können, Ida frage, ob es nicht vielleicht doch möglich sei, ihre Hinrichtung um eine Stunde zu verschieben – so flehentlich klang ihre Stimme.
»Ich habe sie noch«, sagte Antonia.
»Gut. Also dahinein mußt du diese Himmelsschlüssel geben. Weißt du, ich war unterwegs und dachte an etwas, wie soll ich sagen, etwas ganz Ausgefallenes, verbogen, aber doch anmutig, ich habe gesucht und gesucht, und wußte nicht was, bis mir einfiel, es war deine Vase. Natürlich habe ich dir Blumen dafür bringen müssen. Du weißt – nein, unterbrich mich nicht, es ist wichtig, daß alles seinen Zweck hat, aber es ist ebenso wichtig, Dinge, die einen Zweck haben, diesen Zweck entfremden zu können, siehe die Vase, aber jetzt kommen ja Blumen hinein. Verstehst du mich?«
»Ja«, sagte Antonia, »zieh dich aus.« ›Wenn ich Frank seinem Zweck entfremden würde‹, dachte sie, ›was wäre er dann?‹ Erst nach einer kleinen Weile fiel ihr ein, Frank war ja kein Ding. »Geh hinein, Ida, ich hole die Vase.«
Ida betrachtete das Zimmer. Sie schnupperte. ›Hier ist nichts passiert‹, dachte sie, ›aber warum ist nichts passiert?‹ Sie war überaus stolz auf ihren Spürsinn. Sie behauptete, sie wisse immer, ob in einem Raum etwas ›passiert‹ sei oder nicht. »War Frank da?« rief sie hinaus.
Antonia kam eben zurück. »Ja. Er ist schon weggegangen. Er wäre gern geblieben«, log sie.
»Ja, es paßt.« Ida meinte die Vase. Mit Frank beschäftigte sie sich nicht. Er war ihr nicht sehr sympathisch.
»Wohin soll ich sie stellen?« Antonia wußte, es war notwendig, ein Szenchen wegen der Blumen und der Vase zu machen. Aber Ida dachte schon nicht mehr daran. »Wohin du willst. Aufs Büchersims.«
»Ja.« Antonia stellte die Blumen hin. »Mach es dir bequem. Zigarette?« Sie rauchten. »Was ist mit Albert?« fragte Antonia.
»Aber, ich bitte dich! Ich bin doch schon zu alt. Und er … er ist so – ungeschickt.«
»Wieso?« sagte Antonia. »Und überdies könntest du ihn doch sozusagen führen. Der Arzt hat dir ja damals die Gefühle gelassen.«
»Führen! Einen Mann von vierundsechzig. Im Bett. Ich!«
›Allerdings‹, dachte Antonia, ›wenn er mit vierundsechzig noch nicht gelernt hat, wie man eine Bettszene einfädelt …‹ Frank fiel ihr ein, eine Sturmflut von Zärtlichkeiten und Brutalitäten. Sie hatte keinen Liebhaber wie ihn gehabt. Er war, das wußte sie, sie hatte Erfahrungen genug, ein seltenes Exemplar von einem Mann. »Das spricht doch für Albert, wenn er ungeschickt ist«, sagte sie.
»Du glaubst?«
»Sicher.« Antonia log. Sie hatte Männer mit zahllosen Erfahrungen gekannt, die trotzdem plump, unbeholfen, gräßlich waren. ›Warum habe ich das alles getan‹, dachte sie, ›ich habe nichts gefunden …‹
»Aber ich bin zu alt«, sagte Ida, »vergiß nicht, mein Mann ist seit zehn Jahren tot. Seither war gar nichts. Es hat mir auch gar nichts gefehlt. Aber diesmal, ich weiß nicht warum, da dachte ich, vielleicht sollte ich einen Mann haben. Na, und Albert war gerade da.«
»Eben.« Antonia fand die Sache komisch.
»Wir haben schon ausgemacht, daß wir uns nicht mehr sehen.«
»Gut. Und du hast ja auch die Erinnerung an deinen Mann.«
»Eben.«
»Jetzt mache ich uns Brote.«
Antonia hantierte in der Küche und dachte ununterbrochen an Frank. Sie hatte alles Hemmende abgestreift und fühlte sich klein, hingebungsvoll, zärtlich. Sie hatte nach Frank Sehnsucht wie nach etwas lange Verlorenem, dessen Häßlichkeit die Erinnerung genommen hat und dessen Schönheit weithin sichtbar leuchtet. ›Wenn ich jünger wäre‹, dachte sie, ›würde ich in einem Augenblick wie diesem den Entschluß fassen, ein neues Leben zu beginnen und eine ganz andere Frau zu werden.‹ Aber sie war zu klug, um einer Stimmung so weit nachzugeben, daß daraus ein, wenn auch scheinbarer, Entschluß entstand.
Sie wünschte sich brennend die Unbedenklichkeit irgendwelcher Frauen, die sie sich vorstellte und an deren Existenz sie trotzdem zweifelte.
Aber alle ihre Erwägungen kamen nicht so weit, daß sie hätten Schaden anrichten können. Ihr Leben erschien ihr nach dem Gespräch mit Ida wie eine Pflanze, die mitten in einer üppigen Vegetation wächst, zwar von anderen und gezwungen zu ständigem Kampf, aber doch auf glückliche Art mitten drin in der Erde, in der Sonne, im Regen. ›Ich bin im Spiel‹, dachte sie, ›was kann ich mir mehr wünschen? Man kann nichts Vollkommenes vom Leben verlangen. Ich habe meine Probleme zu lösen, aber in diesem Zwang, etwas lösen zu müssen, liegt alles, was eine Frau haben kann.‹
Ihr Blick fiel auf den Gasherd, auf das Backrohr, und sie entsann sich eines Winternachmittags, an dem sie und Frank aus dem ungeheizten Zimmer hierher gegangen waren, das Backrohr aufgedreht und sich am Boden davor ein Lager gemacht hatten. »Wie Zigeuner«, hatte Frank gesagt, und sie waren sehr glücklich gewesen.
Antonia zündete das Backrohr an und hielt die Hände vor die ausströmende Wärme. Der Geruch der brennenden Gasflammen, ihre trockene Wärme und ihr heimlicher Lärm erinnerten sie an jene Situation. Sie lächelte. ›Wie immer ich ihn habe‹, dachte sie, ›er ist doch da …‹ Sie war glücklich mit ihrem Leben, weil es Frank gab.
»Was ist denn das für eine Hitze, diese Hitze, das ist ja greulich, hast du denn den Verstand verloren, und was gedenkst du denn zu backen?« Ida stand in der Tür und sah Antonia an, als zweifle sie an deren Vernunft.
»Ich gedenke nicht zu backen«, sagte Antonia. »Die Brötchen sind schon fertig, wir können hineingehen.«
»Aber warum hast du denn das Backrohr angezündet, ich bitte dich …«
»Mußt du immer wissen, warum ich etwas tue? Ich habe mich an etwas erinnert.«
»An was?«
»Es heißt ›woran‹.« Antonia lachte. »Du bist doch sehr für Grammatik.«
»Also woran?«
»Du bist überzeugt, es ist etwas mit einem Mann?«
»Eben.« Ida hatte schon ›gewittert‹. »Deshalb will ich es ja wissen.«
»Also. Frank und ich haben es hier gemacht.«
»Was? In der Küche? Beim Kochen?«
»Nein.« Antonia lachte. »Glaubst du, ich kann dabei kochen?«
Sie fühlte sich frei und leicht. Sie wußte, es würde ein blödsinniger, totgeschlagener Abend werden und Mitternacht sein, bis Ida ginge, aber sie malte sich im voraus die Gesprächspausen aus und die Pausen zwischen irgendwelchen Worten, wenn die Gedanken an Frank emporwüchsen – ein Wald von kleinen weißen Wendeltreppen ins Blaue. »Ich habe Mayonnaise auf die Brötchen gestrichen, das hast du doch gern, Ida, und Tee ist auch gekocht. Wir werden noch lange plaudern, nicht?«
»Ja. Ich habe mich so gefreut …«
Sie gingen einträchtig zurück in das Zimmer. Sie würden essen und reden und rauchen und den Stoff ihrer Gespräche über die Nacktheit ihrer Geschicke werfen.
Draußen war die Frühlingsnacht angebrochen.
Frank ging nicht direkt nach Hause. Er war dort angelangt, wo er dem Stadium der Liebe entwuchs. Die starren Gebote, die unübertretbaren Vorschriften des Heimweges waren eingehalten.
Sein Weg löste sich auf in Schritte, Bereitschaften, Begegnungen. Er traf die Dunkelheit in all ihren Gestalten, die Laternen, die jungen Blätter der Bäume, den Abendstern – er traf sich selbst in allem Sichtbaren und wurde frei. An Antonia dachte er nicht mehr. Er fühlte sich leicht, aber seine Leichtigkeit kam aus ihm selbst und nicht aus seiner Beziehung zu Antonia. Dem Bannkreis Antonias entronnen, ging er unberührt über zur Ordnung dieses Abends, die er als sinnvoll empfand und als schön.
Die Straßen waren ziemlich belebt. Auch Frank fühlte sich ›im Spiel‹, wie er so zwischen Menschen, Schaufenstern und Portalen herumging. Aber sein Gefühl, dazuzugehören, entsprang – im Gegensatz zu dem bei Antonia – einem Lebensgefühl, das nicht die Existenz eines anderen Menschen brauchte, um erwachen zu können, sondern das von selbst emporkam, unabhängig und eigen.
So bedeutungslos Abendspaziergänge wie dieser für ihn auch waren, so sehr formten sie ihn, innen und außen: innerlich, weil sie ihm das Leben erschlossen wie eine Hülle von Sehnen, Muskeln und Haut, in die er nur zu schlüpfen brauchte – und äußerlich, weil sie sein Gesicht, dieses ›Abenteuer‹, wie Antonia es immer nannte, mit Mienen erfüllten, die, stets angewendet, jenen Ausdruck von Härte und Anmut hervorrufen, den man ›markant‹ zu nennen pflegt.
Für diesen Abend hatte Frank Antonia in des Wortes wahrster Bedeutung verlassen. Für diesen Abend war die Geschichte mit ihr für ihn aus, war von jener vollkommenen Gegenstandslosigkeit, an deren Ende die Freiheit steht.
Franks Leben war voll von solchen Brüchen mit Antonia, aber es gab immer noch überraschend viel Platz für neue Beendigungen. Das war wie ein Mosaik, schon in großen Flächen vorhanden, aber was es am Ende darstellen würde, wußte noch niemand. Frank dachte an nichts. Er vergaß immer alles, wenn er sich ›im Leben‹ fühlte wie jetzt. Er blickte glücklich in die klingelnde Helle einer Straßenbahn, die vorbeifuhr, und atmete tief.
Ihr Name war Melitta. Sie war siebzehn Jahre alt. Manchmal wollte sie etwas Großes werden und manchmal nicht. Ihre Gedanken waren wie Riesen, und sie hatte oft Angst vor ihnen.
Ihre Eltern waren geschieden und hatten sich nicht viel um sie gekümmert. Sie wußte wenig von ihnen und sah sie selten, und wenn, dann niemals miteinander.
›Wie war das‹, dachte sie zum tausendsten Male, ›als Tante damals auf Besuch kam und meine Mutter schluchzend in einem Zimmer saß und mein Vater schluchzend in einem anderen?‹
Sie war damals elf Jahre alt gewesen. Ihr Vater hatte eine Geliebte, die im Haus aus und ein ging. Die Mutter hatte davon schon lange gewußt, war aber zu unentschlossen gewesen, um etwas zu unternehmen. Erst mit dem plötzlichen Erscheinen der Tante waren die Dinge zur Sprache gebracht worden. Es gab eine große Szene, die Melitta nicht miterlebte. Sie wußte nur teilweise von den Ereignissen. Aber an das seltsame, schwirrende Gefühl jenes Abends erinnerte sie sich, und an den Beleuchtungskörper im Schlafzimmer der Eltern, eine orangefarbene, eiförmige Glocke, die den Raum in ein seltsames Licht tauchte. Auf dem Sofa unter der Lampe war die Mutter gesessen, weinend und ratlos.
»Ich werde von hier fortgehen, mein kleiner Liebling«, hatte die Mutter gesagt, »aber dich nehme ich mit. Oder ich werde sterben, dann nehme ich dich auch mit … Ja, ich werde sterben, und dich nehme ich mit.«
Der Tod der Mutter war für Melitta immer ein Schreckgespenst gewesen, das manchmal auftauchte aus einer Geschichte, die sie las, oder aus der Erzählung über Mitschülerinnen, denen die Mütter gestorben waren. Melitta erschauerte vor einem unschilderbaren Abgrund, über dem der orangefarbene Beleuchtungskörper hing. »Warum willst du sterben, Mama?« sagte sie.
Die Mutter gab keine Antwort, nur die Tante sagte einen Satz, in dem das Wort ›schrecklich‹ viele Male vorkam.
»Wo ist denn Papa?« fragte Melitta.
Sie bekam wieder keine Antwort. Die Mutter zog sie nur an sich und stieß schluchzend hervor: »Ich nehme dich mit … mit …«
›Wohin denn?‹ dachte Melitta, aber sie sagte nichts, sondern starrte nur in das orangene Licht wie in etwas Ungeheuerliches, das etwas Ungeheuerliches erhellte. Sie umarmte die Mutter und versuchte, auch zu weinen, aber sie brachte es nicht fertig.
»Geh in dein Zimmer«, sagte die Tante, »du verstehst das alles noch nicht.« Und zur Mutter: »Entsetzlich, das arme, arme Kind.«
Melitta wußte nicht, warum sie arm war, aber sie fühlte sich tatsächlich elend. »Wein nicht, Mama«, sagte sie leise und erschrak vor dem erstickten Schrei, den die Mutter ausstieß. Melitta dachte: ›Sie stirbt schon!‹ und bekam eine entsetzliche Angst.
Das Bild, welches ihr oft erschien, war wieder da: ein Bett, von hohen Kerzen umgeben, und darin eine bleiche gestorbene Frau und davor kniend ein Kind und in der Nähe ein offenes Fenster, vor dem Schwalben flogen und eine Turmuhr zu sehen war. Dieses Bild hatte Melitta in einem Kalender gefunden, auf der Seite des Mai, und darunter stand: ›Mutters Tod‹, Holzschnitt von –, Melitta wußte natürlich nicht den Namen, aber sie hatte niemals dieses Bild vergessen können.
Nun, da es ihr angesichts dieser aufgelösten Frau, die vom Sterben sprach, wieder erschien, war es so furchtbar, daß Melittas Herz sich zusammenkrampfte. ›Mutter soll nicht sterben‹, dachte sie und atmete eine Zeitlang nicht. Sie wollte sich der Mutter zu Füßen werfen und irgend etwas tun, aber die Tante war da und beugte sich über die Weinende, und Melitta starrte wieder in das Lampenlicht.
»Geh, mein Kind«, sagte die Tante, »zieh dich aus, ich komme dann noch hinüber.«
Im nächsten Zimmer saß Melittas Vater. Auch er weinte. Melitta hatte den Vater noch niemals weinen sehen. Mit einem großen Erstaunen bemerkte sie sein aufgequollenes, fremdes Gesicht. »Komm her«, sagte er mit einer fremden Stimme. Melitta fand die Aufgelöstheit seines Gesichtes komisch und näherte sich zögernd. »Du bist ein großes Mädchen, und ich kann schon mit dir reden. Paß auf. Deine Mutter glaubt, daß ich eine andere Frau habe und euch beide deswegen verlassen will. Glaubst du, daß dein Vater das tun würde? Traust du deinem Vater so etwas zu?«
Melitta fand es seltsam, daß er von sich sprach wie von einem Dritten. »Ich weiß nicht«, sagte sie ratlos. Sie dachte, sie müsse etwas Besseres sagen, als daß sie es nicht wisse. »Ich glaube es nicht. Aber ich denke, Mutter würde so etwas von dir nicht annehmen, wenn es nicht wahr wäre.«
»Das ist deine Tante«, sagte der Vater, »deine Tante hat ihr das eingeredet.« Seine Stimme war wieder stark, weil sie die Stütze des Hasses hatte. »Diese Kanaille. Nie hat sie mich gemocht, und jetzt erzählt sie diese Lügen.«
»Ist es Frau Irina?« fragte Melitta.
»Jetzt kommt sie hierher, und ich habe sie noch eingeladen, diese Bestie. Was hast du gesagt?«
»Ist es Frau Irina?«
»Ja.« Der Vater putzte sich die Nase. »Sie war doch immer gut zu uns, zu uns allen, nicht wahr?«
»Ja.« Melitta wußte nun, wer es war.
Hier hörte die Erinnerung auf.
Wenn Melitta an ihre Kindheit dachte, fiel ihr immer nur dieser Abend ein; das kam ganz von selbst, alles andere mußte sie sich erst zusammensuchen, herbeirufen.
Die Scheidung der Eltern war einige Zeit darauf vollzogen worden. Der Haushalt wurde aufgelöst, und Melitta kam in ein Pensionat. Die Eltern verzogen, jeder Teil in eine andere Stadt. Melitta verbrachte immer einen Sommer bei dem Vater und den nächsten bei der Mutter.
Als sie sechzehn war, äußerte sie dem Vater gegenüber den Wunsch, eine Modeschule zu besuchen. Der Vater stimmte zu. Melitta bezog ein Quartier in einer kleinen Pension, deren Inhaberin eine Freundin des Vaters war, bekam eine monatliche Geldüberweisung, trat in die Modeschule ein und fing zu leben an.
Dieses Leben, umhüllt von den Kapseln der Jugend, trat nur manchmal aus seiner Begrenzung heraus: durch die Flügeltüren der Filme, welche das Mädchen sah, der Illustrierten, die es las, der Beschäftigungen, die es erlernte.
›Er hat Haare wie ein Südseeinsulaner‹, dachte Melitta und schaute lange in die Augen des Filmstars, der ein wenig zynisch und voller Freundlichkeit aus der Zeitschrift blickte, welche sie vor sich liegen hatte.
Melitta trug ihr Haar wie eine Schönheitskönigin dieser Jahre und verfolgte gierig die Berichte über die Äußerungen von Modediktatoren, Schauspielerinnen, weiblichen Sportlern, um sie sich zu eigen zu machen. Pflanzenhaft nahm das Dasein des Mädchens alles an, was in der Umwelt sich bot, und sog es ein. Aber eine geheime Quelle speiste alles Angenommene und wertete es zu Eigenem um. Im Filter dieser Jugend wurde das Abgeschmackteste zu Eigenartigem und Einzelnem. Das Billigste wurde kostbar in der Umwertung, die es da fand. Der Stern der Jugend war von unauslöschlichem Feuer.
›Wenn er eine Frau küßt‹, dachte sie vor dem Bild des Filmstars, ›ob seine Augen dann anders werden?‹ Sie drehte das Blatt zur Seite und lachte. ›An einem Foto kann man das nicht sehen.‹
Wenn sie an Küsse dachte oder an das, was sie sich darunter vorstellte, kam sie sich allwissend vor. Aber ihr Körper war noch ganz still. Natürlich hatte sie viel gelesen über Begierde und Sexualität und stellte sich Leidenschaften vor wie langstielige rote Blumen, aus denen plötzlich Flammen brechen.
Feuerlilien! An einem regnerischen Sommertag hatte sie einmal lange in die Kelche dieser wilden Blumen geblickt. Sie entsann sich dieses Tages genau, obwohl er ihr kein Datum mehr war, nur ein Gebilde aus scheinbar näherkommendem Himmel, grauer Gartenluft und einem reglosen Wasserspiegel.
Auch in einem ihrer Bilderbücher hatte es Feuerlilien gegeben. ›Das Hinduweib tanzt nah dem Tode …‹ Sie wußte den Text nicht mehr, aber es war irgendwo das Wort Leidenschaft darin vorgekommen. Sie hatte ihren Vater gebeten, den Text zu erklären, und er hatte mißbilligend das Buch zugeschlagen, um den Titel zu sehen, und dann, gewiß, daß es ein Kinderbuch war, gesagt: »Ach, diese Seite, das ist nichts, nichts Besonderes …« Aber das Bild blieb voll geheimer, flammenhafter Bedeutung.