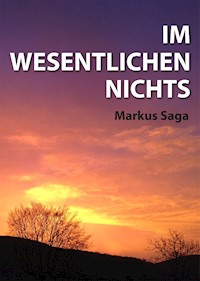Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 110th
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Kismet war gestern“ ist ein Roman über Spurensuche, Illusionen, wahre Liebe und unauslöschliche Dinge vor dem Hintergrund des 11. September 2001. Im Mittelpunkt stehen die türkische Gelegenheitsprostituierte Ayla und der desillusionierte Pharmalobbyist Philipp, die an jenem Tag in Berlin aufeinandertreffen. Gemeinsam verbringen sie eine Nacht und ziehen auch persönlich Bilanz: Was ist übrig geblieben von den Träumen und Hoffnungen ihrer Jugend in den 80ern? Ayla, die seit der Flucht aus ihrem Elternhaus nicht mehr bleiben kann, verlässt ihre große Liebe ein zweites Mal und taucht in Hamburg auf dem Kiez unter. Jahre später macht Philipp sich auf Spurensuche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kismet war gestern
Impressum
Cover: Karsten Sturm, Chichili Agency
© 110th / Chichili Agency 2015
Foto WTC: © Edgar de Evia
Foto Frau: fotolia.de
EPUB ISBN 978-3-95865-578-2
MOBI ISBN 978-3-95865-579-9
Die Printausgabe dieses Romans ist im Verlag Ralf Liebe, Weilerswist, erschienen
Urheberrechtshinweis:
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors oder der beteiligten Agentur „Chichili Agency” reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Inhalt
"Kismet war gestern" ist ein Roman über Spurensuche, Illusionen, wahre Liebe und unauslöschliche Dinge vor dem Hintergrund des 11. September 2001.
Für meine Familie
Teil I: Das anatolische Wirtschaftswunder
-1-
Kann die Seele fliegen, hast du mich gefragt, so wie mein roter Luftballon?
Du wolltest ihn behalten, aber noch lieber war dir, dass er fliegen durfte, wohin er wollte. Du hast ihm lange nachgeschaut, so wie du oft schaust: ernst und aufmerksam, mit deinen großen Augen in andere Welten weit weg. Dieser Blick tief hinein war immer dein ganz besonderer Blick. Du hast ihn von deiner Mutter.
Der rote Luftballon war frei und du zufrieden. Er schwebte lange über dem Kirmesplatz in die Höhe, trieb dann, von einem kräftigen Frühlingswind aus dem Westen mitgenommen, über die Dächer der angrenzenden Häuser immer weiter Richtung Rhein, wo du ihn mit den Schiffen zum Meer fahren sahst, da wo die Vögel herkamen, die um die Schiffe und die Uferpromenade kreisten. Bei einem Eis haben wir seine Reise weiter beobachtet, bis die Phantasie müde war und Karussell fahren wollte.
Was den Ballon anbetraf, so konnte ich dir alles erklären. Was die Seele anbetraf, war ich ratlos. Na gut, hast du gesagt, vielleicht weiß es ja der Opa. Opa weiß meist alles und das ist einer der Gründe, warum du so gerne bei ihm bist.
Das mit der Seele hat dich beschäftigt, wie dich alles beschäftigt, was in Mensch und Tier vor sich geht. Selbst in Bäumen, Blumen und Gräsern hast du eine Seele entdeckt und Opa, der Allwissende, hat nicht widersprochen. Damit war die Sache abgemacht: Es gab eine Seele. Aber wie sah die aus? Wie viel wog sie? Duftete sie süß und frisch oder gar nicht? Hatte sie eine Farbe? Vielleicht so wie das Rot des Luftballons, knallbunt und fröhlich, ja, das konnte sein, hast du dir die Frage selbst beantwortet, das war gut möglich. Die Seele musste fröhlich sein und leicht und sie roch gut, daran gab es gar keinen Zweifel, was denn sonst? Man konnte unmöglich dauernd traurig sein. Natürlich manchmal schon, das war ja jeder mal, aber nicht lange. Dann tröstete jemand einen oder man nahm die Maus, die schlaue Maus aus Stoff aus der Sendung mit der Maus, die natürlich auch eine Seele hatte, und was für eine, die flüsterte einem etwas zu und bald schon ging es einem dann wieder gut und man konnte draußen spielen und fröhlich sein.
Aber konnte die Seele auch fliegen, so wie der rote Luftballon? Musste sie doch, meintest du, wie sollte sie denn sonst in den Himmel kommen, der doch ganz oben war, über den Wolken noch. Darum mussten wir ja auf der Erde auch noch warten, bis wir gestorben waren, bis die Seele in den Himmel fliegen konnte. Im Himmel war es schön. Eine Hölle gab es nicht. Wer konnte sich denn so etwas nur ausdenken? Man durfte doch niemandem weh tun, jedenfalls absichtlich nicht. Auch wenn man ihn überhaupt nicht mochte, so wie du die Christiane, die immer rumschrie und einen roten Kopf bekam, die blöde Kuh. Da hatte der liebe Gott wohl noch ein bisschen Arbeit vor sich.
-2-
Der Billigflieger war diesmal sogar pünktlich. Eine Rarität zu den Zeiten, als ich es noch eilig hatte. Die Szenerie war ansonsten die gleiche, mit einer Ausnahme: Die Schlangen an den Sicherheitskontrollen schienen mir noch immer länger zu sein als vor jenem schicksalhaften 11. September, den ich noch in Berlin erleben musste. Seitdem war ich kaum noch geflogen, aber die Abläufe hatten sich nicht verändert. Also nach dem Einchecken bei der übernächtigt wirkenden Dame am Check-in weiter zur Sicherheitsschleuse, die gewohnheitsmäßig piepte, Abtastung, Durchleuchtung meines Handgepäcks, Latexhände und Bundespolizisten, die vor den Grenzöffnungen Grenzschützer hießen, aber noch genauso gelangweilt wie ehedem auf die einströmende Menge an Klimakillern blickten, die so früh am Morgen meist in Geschäftsanzügen unterwegs war. Als ich auch noch regelmäßig darin herumlief, war mein erster Gang nach der Kontrollprozedur immer der zum Zeitungsstand gewesen, um mich im Eiltempo auf den neusten Nachrichtenstand zu bringen.
Diesmal reichte mir meine Lokalzeitung, die in der kleinen Reisetasche an der Seite steckte. Es sollten nur drei Tage in Berlin werden und viel brauchte ich dazu nicht. Am wichtigsten war mein Lieblingsfoto von dir, das für den Kindergarten. Schon dafür musste man sich heutzutage bewerben. Kraft zeigt sich in deinen schmalen Schultern, aber beim Frühstück, wenn du noch müde bist von der langweiligen Nacht, legst du deinen Kopf gerne auf meinen Arm, der dir das Kissen ersetzen soll. Am Morgen hatte ich unser Ritual vermisst, auch wenn ich dich bei Oma und Opa in guten Händen wusste. Du mochtest Ferien in der Eifel und das Restaurant würde die drei Tage, noch dazu unter der Woche, auch ohne mich auskommen. Der Umsatz war soweit stabil, auch wenn es für einen anderen Urlaub als bei den Großeltern nur selten gereicht hatte. Dir machte das nichts, denn bei Opa gab es Schafe, Fischteiche, einen großen Garten und er nahm dich oft mit in den Wald auf Entdeckungsreise.
Die junge Frau an der Ticketkontrolle freute sich über mein lächelndes Gesicht, denn die meisten anderen Mundwinkel zeigten nach unten. Der Gegenflieger hatte Verspätung und die Geschäftswelt fürchtete um ihre Termine. Mein Gegenüber in der Wartehalle zog sein mausgraues Jackett aus und offenbarte unter dem gestressten Bluthochdruckkopf eine mausgraue Weste über der mausgrauen Hose. Daneben verteidigte einer lauthals seinen Zeitverlust ins Handy. Das vertraute Signal eines PC-Systems verkündete das Hochfahren des Arbeitsalltags.
Der General-Anzeiger servierte zum Frühstück das Chaos nach einer Unfallserie (ein Toter, zwei Schwer- und fünf Leichtverletzte), berichtete über Gewaltvideos und eine lange Liste internationaler Konflikte, sezierte auf der Lokalseite den Prozess wegen einer Massenvergewaltigung an einer jungen Frau und kam im Panorama endlich zur Charity-Gala von gestern Abend. Bild gegenüber meinte, die Bartmänner hätten uns den Krieg erklärt.
Ich schloss meine Augen und machte sie erst wieder auf, als wir unsere Reiseflughöhe erreicht hatten und ich nach meinen Wünschen gefragt wurde. Nicht zu erfüllen, befürchtete ich. Mein Sitznachbar war zum Glück eine Frau, roch sehr gut und blätterte im Spiegel, während ich demonstrativ an ihr vorbei nach draußen auf den weißen Wolkenteppich schaute, der im Morgenlicht vorbeischwebte. Sie war ausgesprochen hübsch. Ich hätte sie gerne angesprochen: Gestatten Philipp Küchler, hätten sie heute Zeit auf einen Kaffee? Gott wie peinlich und was für ein bescheuerter Name. Und was hätte ich ihr schon sagen können? Ein Kurzurlaub, einfach so, ich habe früher in Berlin gearbeitet und wollte die Stadt noch einmal besuchen. Sozusagen als Tourist. Lächerlich. Antworten auf Fragen, die mich schon lange beschäftigen. Zu intim. Sie lächelte wieder. Wie bezaubernd. Ganz weiße, ebenmäßige Zähne. Sehr gepflegt, aber nicht künstlich. Ihre Augen waren groß und blau und blickten auf die drohende Kulisse von Tegel unter uns. Sie nahm ein Taxi und ich stieg in den TXL, der mich nach Mitte bringen sollte.
Viele Straßen kannte ich noch. Den Saatwinkler Damm zum Beispiel, wo die Schrebergartenkolonie zur Rechten und die Gedenkstätte Plötzensee zur Linken lag. Auf dem Schifffahrtskanal schwammen im Winter manchmal kleine Eisschollen. Ein paar Jahre bin ich mit Laptop und Visitenkarten durch die neue alte Hauptstadt gefahren. Natürlich nicht im gewöhnlichen Bus. Im Taxi ging es damals vom Flughafen in das Zentrum der Macht, direkt mit der Abkürzung über den Aldi-Parkplatz, denn Zeit war Geld. Der Chauffeur kannte sich gut aus. Die Kreuzung am S-Bahnhof Beusselstraße war immer die reine Katastrophe. Luci is open, die Table Dance - Bar, der Hauptbahnhof, wo die Fassade später runterkam, Wirtschaftsministerium. Im Bus konnte ich meine damaligen Arbeitsstätten, den Reichstag und die Abgeordnetenbauten, noch einmal in Ruhe betrachten. Gegenüber dem Kanzleramt gingen die ersten Frühlingsgefühle spazieren. Die Bundespressekonferenz im Spreebogen grüßte die Reinhardtstraße, aber das Herz des Lobbyisten schlug am lautesten unter den Linden, wo auch wir unsere Stellung bezogen hatten, um den Dialog zwischen Wirtschaft und Politik zu fördern. Der Eingang war durch eine massive Holztür geschmückt und mit Code, Gegensprechanlage und neugierigem Kameraauge gesichert. Dem Einlass folgte eine stilecht knarrende Holztreppe mit rotem Teppich und die Begrüßung durch eine der zahlreichen hübschen Empfangsdamen, die sich vor Angeboten, vor allem zu später Stunde, kaum retten konnten. Der Fußboden entstammte irgendeinem antiken Gebäude, aufwändig restauriert, der Wein alten Eichenfässern.
Wir rumpelten weiter über die Staatsstraße an den Stätten zeitgenössischer Kunst und Kultur vorbei Richtung Alex. Franz Biberkopf wäre vermutlich kollabiert. Das schwer erträgliche Gemisch aus neudeutscher Kaufwut, reaktionären Punks und schlichtem Drogenkonsum jedweder Art hatte meinen ersten Besuch zu einer einzigen Enttäuschung gemacht. Naiv, natürlich. Was hatte ich erwartet? Leere Gesichter, wohin das Auge blickte. Ich flüchtete mich in die Arme eines bekannten amerikanischen Fastfood-Konzerns und entkam nur mit aufgeblähtem Bauch und dröhnendem Schädel.
An der Ecke Torstraße / Prenzlauer Allee folgte mein Lieblingsdenkmal der deutschen Geschichte: Das ehemalige jüdische Kaufhaus Jonas, das nach arischem Intermezzo zur SED-Parteizentrale mutierte, um schon kurz nach der Wende wieder zu verfallen. Ich habe mir immer vorgestellt, wie es drinnen wohl aussehen mag. Aber schon hatte ich meinen Bestimmungsort erreicht: ein kleines Hotel einer großen ausländischen Kette mit Tankstelle im Erdgeschoss, bunten Farben im Interieur und einem herrlichen Blick auf die Spitze des Fernsehturms am Alexanderplatz.
Auf dem alten Friedhof ganz in der Nähe der Prenzlauer Allee hatte der Frühling schon Einzug gehalten, obwohl es deutlich kälter war als am Rhein. Die ersten Blumen streckten ihre neugierigen Köpfe durch die noch winterkalte Bodendecke und erkundeten das Umfeld, das vertraute Ruhe ausstrahlte. Von einem Friedhof war eigentlich nicht viel zu erwarten gewesen. Tante Rosa hatte die ganze Trauerfeier über geheult und der Abschiedskuss für meine geliebte Omi war an der totenkalten Haut abgeprallt und konnte nicht mehr zu ihr durchdringen, das waren Friedhöfe. Die Kirche in dem kleinen Eifelort meiner Jugend war nüchtern gewesen, die Trauerfeier auch, es gab Streuselkuchen und Kaffee, alle gingen stumm und traurig auseinander. Ich hatte als kleiner Junge nicht so viel Hoffnung in mir wie du, was die Seele und den Himmel anbetraf. Außerdem gab es damals die Hölle noch und auch das Fegefeuer. Die Religionslehrer waren streng und hatten mich verunsichert, ängstliche Frömmigkeit ersetzte die frohen Farben deines Lebens. Trotzdem: Die teilweise auffallend großen Steinfiguren hatten mein Interesse geweckt, der in barocken Grabmonumenten ausufernde Totenkult betuchter Familien, vielleicht war es auch einfach nur der morbide Charme der Friedhofsanlage gewesen, der mich eines Tages zu einem vorsichtigen Besuch veranlasst hatte. Die Bank unter der großen Eiche war von Claras Eltern gestiftet worden, so stand auf einer kleinen goldenen Plakette an der Rückenlehne zu lesen, sonst nichts. Clara lag in dem Grab davor, bewacht von einer steinernen Grabsäule, die nur die spärlichen Daten ihres Lebens preisgab: geboren am 19. April 1965, gestorben am 03. Oktober 1984. Noch nicht mal halb so alt wie ich. Die Farbe der Inschrift: leuchtend rot. Die Seele kann fliegen. Was denn sonst? Gut, dass es fast Sechsjährige gibt, die nur kurz überlegen müssen, wenn die etwas komplizierten Erwachsenen nicht weiter wissen. Mach dir nichts draus, höre ich dich sagen, das ist mir auch schon mal passiert, dass ich die Antwort nicht wusste.
Ich habe immer gerne auf dieser Bank gesessen und nachgedacht. Auch über Clara, die ich nicht kannte, aber deren Eltern ich einmal bei der Grabpflege begegnet bin. Wer weiß, ob das mit dem Himmel am Ende nicht doch stimmt. Dann lächelt Clara von oben auf mich herab und der liebe Gott mit dem weißen Bart schüttelt hoffentlich nachsichtig den Kopf über den Ungläubigen auf Abwegen. Der liebe Gott hat übrigens Ähnlichkeiten mit Opa, wie du letztens festgestellt hast.
-3-
Rund 2.000 km entfernt, zu der Zeit, als Atatürk dem Paradies, das im Türkischen Cennet heißt, ein gutes Stück näher gekommen war, wurde in einem Dorf mit dem Namen Reines Wasser, in einem Haus an dem kleinen Fluss, der mitten durch das Örtchen führte, das zweite von sieben Kindern geboren. Viele Jahre später wurde dieser Junge Mehmet im selben Haus seinerseits auch Vater. Der Vater Mehmet schaute seine Tochter, die den Namen Ayla erhalten sollte, an und war sofort verliebt. Als Ayla alt genug war, erzählte er ihr nicht nur immer wieder von diesem ersten Augenblick, sondern brachte ihr auch alles bei, was ein kluges und so überaus neugieriges Mädchen wissen musste. Er hat mir immer alles erzählt, meinte Ayla einmal, sogar seine Gedanken und Gefühle, einfach alles. Da hatte sie Tränen in den Augen.
Mehmet genoss in seinem Dorf großes Ansehen. Er konnte beinahe besser lesen und schreiben als der Lehrer und war auch sonst sehr gebildet. Vor allem aber galt er als absolut vertrauenswürdig und gutherzig. Aus diesem Grunde wurde er oft gefragt, wenn es eines Rates bedurfte. Sogar der Imam persönlich kam ab und an zu ihm, um sich in schwierigeren Angelegenheiten von allgemeinem Interesse zu besprechen. Ayla war stolz auf ihren Vater.
„Mehmet“, sagte der Imam eines Tages lange nach der Geburt der Tochter Ayla bei einer solchen Unterredung, „Mehmet, ich bedauere es sehr, wenn du fortgehst. Mit wem soll ich mich dann beraten?“
Mehmet, dem sein Entschluss selbst noch nicht ganz geheuer war, schaute den bärtigen Imam lange an, bevor er antwortete.
„Du bist ein weiser Mann“, sagte Mehmet, „du brauchst meinen Rat so wenig und so viel wie den eines jeden Anderen. Höre auf dein Herz. Aber ich danke dir für die Ehre, die du mir mit deinen Worten erwiesen hast und für deine Freundschaft.“
Dann überließ Mehmet den Imam der Obhut seiner Frau Tülay, dem schwarzen Tee und viel süßem Gebäck, und machte sich alleine auf, um nachzudenken.
Ayla war ein Kind der Sonne und die Dorfstraße staubig, weil es länger nicht geregnet hatte. Dennoch führte der kleine Fluss immer noch genügend Wasser. Mehmet folgte dem Wasser, das langsam vor sich hin plätscherte und kam an der Dorfschule vorbei, die er selbst noch besucht hatte. Auf dem Pausenhof spielten die Kinder des Ortes. Ein paar von ihnen saßen auch am Flüsschen, während andere versuchten, kleine Fische zu fangen. Zwei Fußballmannschaften kämpften um Tore, die zwischen Kreidestrichen zu erzielen waren. Wenn der Ball zu weit geschossen wurde, musste ihn der Schütze aus den angrenzenden Feldern holen, denn Zäune gab es nicht. Am Brunnen erfrischte Mehmet sein Gesicht. Er betrachtete die Erde, mit der er aufgewachsen war, den Fluss, der nie über die Ufer trat und immer genügend Wasser führte, fühlte die Sonne auf seinem Gesicht und dachte an die Ernte. Es war Zuckerfest und aus allen Häusern drangen die Laute regen Treibens zur Vorbereitung des Essens. An solchen Festtagen gab es sogar Fleisch, denn es wurde geschlachtet und die Frauen hatten Fladenbrot im großen Ofen auf dem Dorfplatz gebacken. Er war früh im Garten und später auf dem Markt gewesen, um Paprika zu besorgen, scharfe Peperoni, Bohnen, eine Wassermelone und Pfirsiche, außerdem Rinderwurst, die sie morgens an solchen Festtagen zwischen das Fladenbrot steckten und mit Ziegenkäse, Tomaten und Gurken garnierten. Mehmet ließ seine Füße im klaren Wasser des reinen Flüsschens baumeln, während er darüber nachdachte, warum er sein Paradies verlassen wollte. Unter dem Blätterdach des Rastplatzes oberhalb vom Dorfbrunnen war es angenehm kühl. Er kam gerne hierher, um nachzudenken. Manchmal flüsterte ihm das Flüsschen etwas zu. Das Erdbeben hatte sein Haus verwüstet, die Behörden saßen untätig herum und die Hütte seiner Schwiegermutter, in der sie seitdem notdürftig alle zusammen wohnten, war viel zu klein. Auch über die Deutschen dachte er nach, die er in seinem Dorf kennengelernt hatte und die er für gute Menschen hielt, denn die waren mit Zelten, Decken und Medikamenten gekommen, nicht mit Panzern und Gewehren. Die Hunde hatten seinen Sohn gefunden und seinen Schwiegervater. Die Knochenbrüche waren verheilt, die Wunden seiner Seele nicht. Doch, er würde in das Land der Ungläubigen gehen. Allah hatte kein Recht, etwas anderes zu fordern, wo er schon seinen Sohn genommen hatte. Mehmet war ihm nichts mehr schuldig. Aber seine Tochter sollte mehr bekommen als eine Hütte. Und Allah würde diesmal besser aufpassen.
Die Schwiegermutter wollte sicher gehen und schenkte Ayla ein Auge aus Stein, um das Böse fernzuhalten.
„Meine Augen werden noch viel mehr auf unsere Tochter aufpassen“, sagte Tülay zu Mehmet.
Und er würde gut auf sich selbst Acht geben, das versprach Mehmet, während er die Tränen seiner Frau trocknete.
Die Frauen würden warten.
Das jedenfalls war der Plan.
Der Imam nickte mit dem bärtigen Kopf, blieb aber skeptisch. Die meisten anderen Männer auch, außer denen natürlich, die gehen wollten. Die Orte ihrer Zukunft hatten fremd klingende Namen und konnten kaum ausgesprochen werden. Köln klang noch am freundlichsten und lag in der Nähe von Mehmets künftigem Arbeitsplatz. Er konnte damals nicht ahnen, dass aus der Arbeit ein ganzes Leben werden sollte und blieb daher zuversichtlich.
Aber wenn er gewusst hätte, dass der Weg aus dem Ort am kleinen Fluss mit dem reinen Wasser seine Tochter Ayla einmal in ein Hotel einer großen ausländischen Kette mit Tankstelle im Erdgeschoss, bunten Farben im Interieur und einem herrlichen Blick auf die Spitze des Fernsehturms am Alexanderplatz führen sollte, dann hätte er sich ganz bestimmt nicht auf diesen Weg gemacht.
So aber stieg er eines sehr frühen Morgens in den Bus, der ihn nach Istanbul bringen sollte, von wo es dann mit einem anderen Bus und schließlich der Bahn über den Balkan weiter bis nach Deutschland ging, wo wieder ein Bus wartete. Später, nach vielen schlechten Nächten in einem Männerwohnheim seines Arbeitgebers, als Ayla und Tülay endlich bei ihm sein konnten, hat er ihnen von der Angst erzählt, die er nicht haben wollte, von den fremden Namen auf der Strecke, von der Rinderwurst, dem Ziegenkäse, den Gurken und den Tomaten, die in ihm die Heimat lebendig hielten und von dem unruhigen Schlaf in dem überfüllten Zug, der ihn an einen Viehtransport erinnerte. Der Balkanexpress benötigte fast 60 Stunden bis zu seinem Bestimmungsort und Mehmet wollte nichts lieber, als sofort wieder die Heimreise antreten. Die Gerüche waren ihm fremd, die Gesichter interessierten sich nicht für die Neuankömmlinge und die Sprache klang hart und unfreundlich. Er vermisste die lebendigen und fröhlichen Unterhaltungen beim Essen, wenn er abends auf seinem Bett im Männerwohnheim saß und sein Abendbrot zu sich nahm, als ob das Essen eine ärgerliche Notwendigkeit wäre. In den Antwortbriefen, die ihn am Leben hielten, versprach Tülay, für die der Imam schrieb, der immer mit einem frommen Wunsch endete, dass sie ihm ein gutes Essen kochen werde, wenn er wieder da sei. Aber sie freuten sich auch, dass mit dem Geld aus Deutschland der Grundstein für ein neues, richtiges Haus am kleinen Fluss mit dem klaren Wasser gelegt werden konnte.
-4-
Ich nahm meinen Blick vom Fernsehturm und packte den Inhalt meiner Reisetasche in den spartanischen Schrank. Das kleine Loch an der Decke neben dem Rauchmelder war immer noch da. Ich hatte mich gefreut, dass das Zimmer frei und für mich reserviert worden war. Die Rezeptionistin erkannte mich sogar wieder, ging aber fehl in der Annahme, dass dies die Neuauflage meiner Arbeit in der Hauptstadt bedeute. Nur ein Kurztrip, nicht mehr, versicherte ich.
Später, auf dem Friedhof, auf meiner Bank unter der großen Eiche, besuchte mich ein kleiner Vogel. Der kleine Vogel hüpfte neugierig im Gras hinter Carlas Grab auf und ab, als suchte er etwas.
„Was ist, kleiner Vogel“, sprach ich ihn an, „was suchst du?“
Er zilpte zurück und schaute mich mit seinem Köpfchen schräg an.
Wahrscheinlich wunderte er sich, warum ich nicht verstand.
Dann hüpfte er noch ein kleines Stück näher an mich heran und zalpte aufgeregt auf mich ein. Er wartete bestimmt auf ein paar Brotkrümel.
„Tut mir leid kleiner Vogel, ich habe gar nichts dabei.“
Er zilpte mit seinem beleidigten Kopf zurück. Saß ich vielleicht in der Nähe seines Nestes? Du hättest mir bestimmt sofort sagen können, um welche Art von Vogel es sich handelte, aber mit deinem fast sechsjährigen Wissen um Flora und Fauna kann ich nicht mithalten.
„Die kleine Ente, erinnerst du dich an die kleine, süße Ente, wie sie in den Gully gefallen ist?“
Noch Tage später hatte mir Leonie immer wieder von diesem Abenteuer erzählt.
„Du hattest solche Angst um das Kleine, dass du fast so aufgeregt warst wie die Entenmutter.“
„Sie wusste, dass du ihrem Kind helfen würdest und den Gullydeckel hochheben konntest.“
„Die kleine Ente war ganz weich und warm, ich wollte sie am liebsten gar nicht mehr aus der Hand geben.“
„Aber die Mami war ganz froh, als die kleine Ente wieder bei ihr war.“
„Wie sie dann alle weitergewatschelt sind und du mit deinem Fahrrad vorneweg, um ihnen den Weg durch die Straßen zum Wasser zu zeigen.“
Immer wieder hatte Leonie mich gefragt, ob es der Familie wohl gut gehe.
„Bestimmt geht es allen gut“, hatte ich sie beruhigt.
„Und am Ende der Reise wartet bestimmt der Papi auf die Familie, oder?“
„Natürlich wartet da der Papi. Der Papi weiß, dass die Mami es mit den Kindern schon alleine schafft.“
„Aber wenn du nicht da gewesen wärst, dann wäre das eine Kind vielleicht nie mehr aus dem Gully rausgekommen.“
Leonies Augen hatten sich mit Tränen gefüllt. So viel Unglück durfte nicht sein.
„Aber ich war ja da.“
„Ja, du warst da, mit deinen Mopsarmen und hast die kleine Ente gerettet.“
Meine kleine Ente hatte ihren Kopf ganz fest in mich reingedrückt.
„Und am Ende der Reise wartet der Entenpapi auf seine Familie, ja? So wie Mami auf uns wartet, ja?“
„So wie Mami auf uns wartet.“
„Dann ist gut.“
Als Leonie hinzugefügt hat, ich vermisse Mami aber doch ein bisschen, wusste ich auch nicht weiter und habe meine Tochter noch ein bisschen fester in die Arme genommen. Ich vermisse deine Mutter auch, kleine Leonie, ich vermisse sie auch.
Aber gut, dass die Phantasie immer einen Ausweg weiß und es deine große Mami gab, die Großmutter. Dann war man nicht so alleine, bis man endlich wieder bei der kleinen Mami sein konnte. Die Seele half einem dabei, denn die wusste immer, wie es der anderen Seele, die man liebte, ging. Deswegen war auch die kleine Mami nicht alleine. Die Seele konnte überall hin und wusste alles.
Für den Fall der Fälle musste man sich aber dennoch wappnen: Du wolltest gerne Minerva sein, klug, aber mit kriegerischer Rüstung. Andere Kinder waren Cowboy und Indianer, du warst Minerva. Du warst die Unerschrockenheit, die mir manchmal den Atem stocken ließ, wenn du wieder mal mit Beulen und Schrammen nach Hause kamst und stolz von den neuesten Abenteuern auf dem Spielplatz erzähltest. Deine Mutter hat die Jungs sogar verprügelt, das hat sie mir erzählt, wirklich und du wärst bestimmt stolz auf sie. Und natürlich ist sie die schönste Mutter von allen, das war immer klar. Ich musste sie nie so genau beschreiben. Du wusstest immer, wie sie aussah. Aber was mache ich, wenn die Fragen bohrender werden, genauer wissen wollen, hilfloser nach der Wahrheit suchen? Was kann ich dir sagen?
Der Zilp-Zalp schaute mich nachdenklich mit seinem verdrehten Köpfchen an und flog davon.
Ich verließ den Friedhof und wurde vom tosenden Verkehr der Prenzlauer Allee empfangen, der mir bestätigte, dass ich nicht mehr lange in meinem notdürftig zusammengezimmerten Paradies verweilen konnte. Auf der anderen Straßenseite stand ich wieder vor dem Kaufhaus Jonas. Die Agonie der grau-braunen Architektur endete zu meinen Füßen auf dem nüchternen Pflaster der ehemals wegweisenden Adresse Torstraße 1. Ich zählte die sieben Geschosse nach, über die ich mich vor meiner Reise im Internet informiert hatte. Mit den Baustilangaben konnte ich wenig anfangen, aber die Geschichte des Gebäudes entsprach meinen Ahnungen, die ich schon immer hatte. Die Anfänge waren hoffnungsvoll gewesen: Zwei jüdische Geschäftsleute hatten Ende der zwanziger Jahre dieses Warenhaus errichten lassen, damit auch ärmere Menschen einkaufen konnten.
Ich stieg in den nächsten Bus Richtung Reichstag, passierte einen sozialistischen Palast zu meiner Linken und ein feudales Schloss zu meiner Rechten, bevor ich an der Haltestelle Friedrichstraße ausstieg. Meine ersten Schritte lenkten mich in eine nahegelegene Buchhandlung, in der ich eine reiche Auswahl deiner und meiner Lieblingsautorin Astrid Lindgren vorfand. Ich wollte eigentlich gar nicht schreiben, hat sie einmal gesagt, nichts in meinem Leben war geplant, es ist einfach so passiert. Ich mag Karriereberater wie sie. Letzte Weihnachten hast du mir immer abends aus Kalle Blomquist vorgelesen. Die Detektivgeschichten haben uns beide gefesselt. Am Ende gewann immer das Gute. So musste es sein. Der kleine Philipp möchte jetzt vorgelesen haben. Das Rollenspiel hat dir gefallen, du warst ganz wild darauf.
In der Dorotheenstraße begann ich anschließend meine touristische Nostalgietour. Hier hatte ich nach dem Hotelintermezzo meine erste Berliner Wohnung. Eine Dorotheenstraße gab es auch in Bonn. Das weckte Erinnerungen, das klang vertraut. Nach Jugend und nach Freiheit. Nach einer Zeit, in der meine Schritte noch leicht waren, manchmal fast schwerelos. Einige nach vorn, dann wieder einige nach hinten, es ging alles ganz einfach. Der Weg war das Ziel und die Musik feuerte mich an. Auf meiner Brust prangte an einer Silberkette ein Amulett mit einem antiken Frauenkopf und dem Datum 1904 auf der Rückseite, ein Erbstück meiner Großmutter. Der Chill-out hieß damals Fete und fand nicht weit von der Dorotheenstraße bei einem Kommilitonen statt. Das Haus lag am alten Markt, einer verlassenen Gegend mit vielen heruntergekommenen Mietshäusern aus den fünfziger und sechziger Jahren. Ich erinnere mich an die angenehm warme Luft auf meiner Haut, auch nach Mitternacht noch und nach all den Jahren und in der Höhe im vierten Stock. Wir wollten uns spüren, mit aller Macht. Mark, der vor mir auf dem Balkonsims tanzte, hatte die Augen schon ein bisschen geschlossen vom Shit und das Lachen lief ihm quer über das ganze Gesicht. Ich hatte den ganzen Himmel über mir, die schwarze Nacht um mich herum und dünnes Eis unter meinen Füßen. Ayla lachte, auch bekifft, bekam es dann aber doch mit der Angst zu tun und holte mich aus meinem Luftschloss auf den Boden der Tatsachen zurück. Sie hat sich neben mich gesetzt und wir haben die halbe Nacht miteinander geredet. Das war der Anfang. Später haben wir uns die Sterne angeschaut, die ich ihr vom Himmel holen wollte.
-5-
Café Einstein, wo denn sonst. Mein Rastplatz bot einen geschichtsträchtigen Blick Richtung Brandenburger Tor, einen Latte Macchiato, der stets mit der Hoffnung auf fernsehbekannte Prominenz serviert wird und immer noch frühlingswarme Sonne in einem bequemen Bistrostuhl am Rande des Boulevards. Ich genoss das original italienische Flair in einer Horde Touristen. Das Paar neben mir hatte seinen Sohn mitgebracht, der seine Eltern aber fortwährend daran hinderte, locker und entspannt zu sein. Schließlich zerrten sie ihn weg, weil sie flanieren wollten. An ihre Stelle setzten sich drei junge Hühner mit großen Sonnenbrillen und schrillen Stimmen, später zwei Ostblocktouristen. Ich blickte Richtung Brandenburger Tor und musste an den Rotarmisten denken, der 1945 dort die Fahne seines Landes gehisst hatte.
Dein Opa, kleine Leonie, war zu der Zeit ungefähr so alt wie du.
Jawohl, auch Opas waren mal kleine Jungs.
Wie er aussah?
Neugierig, würde ich sagen, wenn nicht der Krieg gewesen wäre.