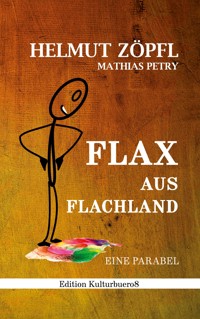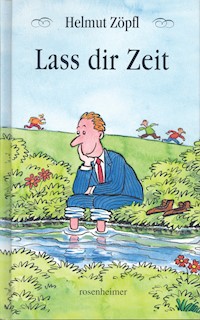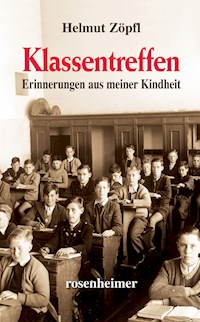
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der bekannte Schriftsteller Helmut Zöpfl erzählt über seine Kindheit: Kein Wunder, dass daraus eine höchst unterhaltsame Lektüre wird. Wir lernen eine längst vergangene Zeit aus dem Blickwinkel eines Münchner Buben kennen. Eine Zeit, in der man sich als stolzer Besitzer eines Fußballs noch wie ein König fühlen konnte. Auch über so manchen gelungenen Lausbubenstreich kann man schmunzeln. Aber auch der ernste Zeithintergrund, der Zeite Weltkrieg mit seinen Bombenangriffen und die Kriegsgefangenschaft des Vaters, kommen zur Sprache.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Olaf Maxrath, ChristianStobbe und Josef Zilchin Freundschaft
LESEPROBE ZU
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2007
© 2018 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titelfoto: Privatbesitz des Autors
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
eISBN 978-3-475-54795-9 (epub)
Worum geht es im Buch?
Helmut Zöpfl
Klassentreffen
Der bekannte Schriftsteller Helmut Zöpfl erzählt über seine Kindheit: Kein Wunder, dass daraus eine höchst unterhaltsame Lektüre wird. Wir lernen eine längst vergangene Zeit aus dem Blickwinkel eines Münchner Buben kennen. Eine Zeit, in der man sich als stolzer Besitzer eines Fußballs noch wie ein König fühlen konnte. Auch über so manchen gelungenen Lausbubenstreich kann man schmunzeln.
Aber auch der ernste Zeithintergrund, der Zweite Weltkrieg mit seinen Bombenangriffen und die Kriegsgefangenschaft des Vaters, kommen zur Sprache.
Inhalt
Gedanken vor einem Klassentreffen
»Rhabarber« war mein erstes Wort
Die ersten Schatten
Dem Winterhilfswerk verdankte ich mein Puppenhaus
Vom »Schulverweigerer« zum Pädagogen
Die Schule verliert ihre Schrecken
Auch Väter brauchen einen Schutzengel
Die Amerikaner kommen
Wie ich die »Schuster-Kath« zähmte
Jetzt gehe ich nicht mehr von euch fort!
Aller Anfang ist schwer – besonders beim Sport
Das neue Domizil in München – und das große Glück
Der Schulweg als Schule fürs Leben
Wie ich mich ins Ballspielen und in anderes verliebte
Erste »Ballerlebnisse«
Das Packerl
Unsere Nelly
Die »Hühnerfarm«
So erlebte ich die Währungsreform
Ein glückliches Weihnachtsfest
Fußball für Schlechtwettertage: das Schnippspiel
Eine feierliche Erstkommunion in karger Zeit
Ein Stück von meiner Kindheit geht zu Ende
Meine Lieblingsfächer: Biologie und Religion
Von Orientierungsschwäche und Geräteturn-Phobie
Meine musikalische Laufbahn
Mein Zusammenstoß mit dem Göttervater
Fahrt ins Blaue mit Onkel Jakob
Besuch aus Amerika – und neue Erkenntnisse über meinen Vater
Meine doppelte Aufholjagd – in Griechisch und Sport
Meine »Stunde der Wahrheit« als Torwart
Pauken unterm »Zamperl«
Meine literarischen Neigungen erwachen
Revolution im Deutschunterricht
Die Pfarrei als zweite Heimat
Meine romantische Ader
Das Ende meiner Kindheit
50 Jahre danach – ein dankbarer Blick zurück und ein nachdenklicher nach vorn
Gedanken vor einem Klassentreffen
Vor vielen Jahren erzählte mir der Münchner Schriftsteller Sigi Sommer einen netten Witz über ein Klassentreffen. Ich habe ihn in ein bayerisches Gedicht umgesetzt, und mein Freund Wolfgang Schmid-Arget hat es vertont. Das Lied ist sogar öfter im Rundfunk zu hören gewesen. Noch heute rufen da und dort Leute an und fragen mich, ob ich davon noch eine Kassette hätte, denn bei ihnen stünde ein Klassentreffen an, und da wär’s doch ganz nett, wenn man das Lied abspielen könnte.
Der Text lautet:
Am Straßrand steht a alter Mo
und fragt mi, ob er mitfahrn ko.
»Wohin«, so sag i drauf zu eahm,
»wo wolln Sie denn hingfahrn wern?«
»Fahrn S’ oiwei gradaus auf der Straß,
im nächsten Ort trifft sich mei’ Klass.«
»A Klassentreffen?«, frag i dann.
»Ja sagn S’ amal, wia alt Sie san!«
Er drauf, als wenns’n wundern daad:
»I bin jetzt vieraneunzge grad!«
»Ja so was«, sag i, »gibts des aa?
Sagn S’, wia vui san denn da no da?«
»Oh mei«, sagt er, »der Kreis is kloa.
De letztn Jahr war i alloa.«
Ganz so weit ist es bei mir nun noch nicht. Aber ich stelle mit einem Anflug von Wehmut fest, dass bald unser 50-jähriges Abiturtreffen ansteht. Ich erinnere mich noch genau, wie wir bei den großen Schultreffen, die das Münchner Theresiengymnasium damals schon regelmäßig veranstaltete und es heute noch tut, immer fast ehrfurchtsvoll auf die Jahrestafeln geschaut haben, die auf den Tischen standen. »Ui, schau hin, die haben vor 30 Jahren, die gar vor 40 Jahren und die – das gibt’s doch nicht – vor 50 Jahren ihr Abitur gemacht.«
Klassentreffen sind etwas Eigenartiges. In den ersten Jahren sind sie manchmal so eine Art Leistungsvergleich auf allen möglichen Gebieten. »Der ist mit seinem Studium schon fertig. Der andere hat gar schon promoviert.« – »Weißt du, was der X schon verdient?« Auch das Familiäre wird natürlich angesprochen: »Der ist lange verheiratet, der hat schon zwei Kinder!«
In den ersten Jahren, manchmal auch später noch, werden Lehrer mit eingeladen. Und man wundert sich, dass sie sich in der Regel noch an die Klasse, ja sogar einzelne Schüler erinnern können, selbst wenn sie nicht einmal Klassleiter waren.
Die Zeit vergeht, und die Klassentreffen finden nicht mehr so regelmäßig statt. Da kann es dann bereits vorkommen, dass man bei dem einen oder anderen überlegen muss, wer er ist. Manchmal liegt das auch nur daran, dass sich bei ihm Haarausfall eingestellt hat und er die verloren gegangene Pracht durch einen kleineren oder größeren Bart kompensiert. Was das Private betrifft, erfährt man dann beiläufig, dass die eine oder andere Ehe bereits gescheitert ist. Ja, und vielleicht hat sich der Kreis sogar durch einen frühen Todesfall verkleinert.
Das Hauptgespräch dreht sich natürlich um früher. Ein paar haben Klassenfotos mitgebracht, und unweigerlich kommt dabei wieder irgendwann die Frage: Wer war denn das? Man versucht sich zu erinnern, was man von ihm noch weiß. Schließlich hat sich die Klasse im Laufe der Schulzeit auch verändert. Wie viele sind damals schon nach den ersten Klassen des Gymnasiums weggegangen! Genauso sind viele dazugekommen, und so sind die, die von der ersten Klasse an dabei waren, in der Regel in der Minderheit. Bei mir waren es genau noch fünf Mitschüler.
Ja, und es wird viel erzählt. Manches weiß der eine, manches der andere besser. Begebenheiten, die man schon fast vergessen hat, fallen einem wieder ein, und man lächelt ein wenig melancholisch im Bewusstsein, wie schnell doch die Zeit vergeht.
Ich selber brauche im Anschluss an solche Treffen immer eine gewisse Zeit zum Verdauen. Was wird sein, wenn man sich das nächste Mal wieder sieht? Und vielleicht ist gar nicht mehr so weit hin, bis unser Kreis – die »Zehn kleinen Negerlein« lassen grüßen – wie in meinem Gedicht zusammengeschrumpft ist.
Jedes Klassentreffen ist eine Art Abschied. Und der Abschied ist nach Salvador Dalí die »Wiedergeburt der Erinnerung«. In zunehmendem Alter stellt man fest, dass es oft viel leichter fällt, sich an Ereignisse zu erinnern, die Jahrzehnte zurückliegen, als an die, die sich erst vor ein paar Tagen abgespielt haben. Das Kurzzeitgedächtnis wird schwächer, das Langzeitgedächtnis bleibt erhalten. Mein Gedächtnis ist eigentlich recht gut, wenn es um meine Kindheit geht. Bevor sich das vielleicht ändert, gehe ich nun daran, in meinen Erinnerungen zu kramen. Vielleicht interessiert ja das, was dabei zutage kommt, nicht nur meine Kinder, sondern auch andere Zeitgenossen.
»Rhabarber« war mein erstes Wort
Ich könnte mit dem Kalauer beginnen, den ich irgendwann einmal von einem Komiker gehört habe: »Als ich geboren wurde, war ich noch sehr jung.«
Nun, ich gebe zu, ich erinnere mich nicht mehr an meine Geburt. Aber – ob man es glaubt oder nicht – an einige ganz frühe Ereignisse meiner Kindheit. Meine Mutter und unsere Nachbarin, Maria König, für mich einfach die Marie – von ihr wird noch öfter die Rede sein –, waren verblüfft, wenn ich mit ihnen später darüber sprach. »Ja, weißt du das wirklich noch? Das gibt’s doch nicht«, pflegte die Marie meist zu sagen.
Ich bin am 25.11.1937 in der Volkartstraße 50 in München geboren. Die Volkartstraße liegt in Neuhausen, einem westlichen Stadtteil. Obwohl das Rotkreuzkrankenhaus ganz in der Nähe liegt, zog meine Mutter eine Hausgeburt mit einer Hebamme vor.
Das Haus Volkartstraße 50 war ein altes vierstöckiges Mietshaus, das meinen Großeltern mütterlicherseits gehörte. Um genau zu sein, war aber dieser Großvater mütterlicherseits nicht mein leiblicher. Denn der fiel schon in den ersten Tagen des Ersten Weltkriegs und hinterließ eine junge Witwe mit drei Kindern. Meine Mutter Anni war das jüngste davon. Später hat meine Großmutter dann den Bäckermeister Hiergeist geheiratet – ich nannte ihn übrigens nicht Opa, sondern »Umpapa«. Mit ihm hat sie noch einen Buben bekommen: Onkel Lambert, meinen Taufpaten. Von ihm habe ich meinen zweiten Vornamen bekommen – den ich allerdings selten jemandem verraten habe, weil ich dann meist mit der Verhohnepiepelung »Lamperl« gehänselt wurde. Meinen Paten nannten dagegen alle nur Bertl.
Mein Vater war zum Zeitpunkt meiner Geburt in Spanien, kam aber zwei Tage später ans Wochenbett meiner Mutter. Sie lachen mich bestimmt aus, wenn ich behaupte, noch eine ganz dunkle Erinnerung an seine damalige Freude zu haben.
Meine wirklich ganz frühen Erinnerungen aber sind Realität. Ich lag noch im Kinderwagen. Meine Großmutter mütterlicherseits – die Eltern meines Vaters waren verstorben – beugte sich über mich und machte eine Ziege nach, indem sie »Mäh, mäh« rief. Ich glaube, sie tat das, um mich zu »tratzen«, zu hänseln. Jedenfalls begann ich zu weinen, und sie lachte. Komischerweise habe ich dieses »Mäh, mäh« noch immer in den Ohren.
Natürlich weiß ich von den ersten Monaten fast nichts mehr. Ganz verschwommen sind da noch ein paar Töne gespeichert, die bei den späteren Erzählungen meiner Mutter und der Marie immer wieder aufleuchteten oder anklangen. So weiß ich, dass mein erstes Wort nicht »Mama« oder »Papa« war, sondern »Rhabarber«. Meine Mutter kaufte einmal in der Volkartstraße im Obst- und Gemüsegeschäft der Frau Schreier ein, und ich sagte das Wort nach.
Als der Zweite Weltkrieg begann, war ich, wie man leicht nachrechnen kann, noch keine zwei Jahre alt. Gleich zu Beginn des Krieges wurde mein Vater nach Frankreich eingezogen. Ich weiß noch genau, dass ich immer sehr glücklich war, wenn er auf Urlaub kam und mir dann eine Kleinigkeit mitbrachte. Einmal bekam ich von ihm eine Mundharmonika. Da gibt es ein Bild, auf dem ich vor dem Radio sitze, sie an den Lippen habe und versuche, ein Lied mitzuspielen. Meine Mutter erzählte mir später, was das erste Lied war, das ich lernte: »Die blauen Dragoner, sie reiten mit klingendem Spiel durch das Tor«. Im Radio waren damals immer mehr Kriegslieder zu hören, und manche davon geistern mir bis heute im Ohr herum.
Ganz genau erinnere ich mich noch an die ersten Bombenalarme. Es waren zunächst noch Probealarme. Irgendwann zur Abendstunde ertönten die Sirenen. Dann brachte mich meine Mutter in den Luftschutzkeller. Das war für mich eigentlich sehr erfreulich, denn ich brauchte nicht frühzeitig ins Bett zu gehen, und es waren die Kinder aus den Nachbarhäusern hier versammelt. Jedes hatte ein paar Spielsachen dabei, und wir verbrachten bis zur Entwarnung eine fröhliche Zeit. Meine Mutter erzählte mir später, dass ich gebetet haben soll: »Lieber Gott, lass wieder einen Bombenalarm kommen, damit wir einen schönen Abend haben.«
Die ersten Schatten
Bald aber wurde es ernst. In München schlugen die ersten Bomben ein. Bei einem Spaziergang mit meinen Eltern am Tag nach dem Angriff kam ich an einem Haus vorbei, das durch einen Treffer beschädigt worden war, und irgendwo hat es nach Brand gerochen. Ich sah den Schrecken in den Augen meiner Mutter und begann zu ahnen, dass Krieg etwas Furchtbares sein konnte.
Noch ganz genau erinnere ich mich an den Tag, als uns eine alte Bekannte besuchte, die Frau Frömke. Ich hatte sie bis dahin jedes Mal als einen sehr lustigen Besuch erlebt. An diesem Tag aber erschien sie in schwarzer Kleidung und hatte ganz rot geweinte Augen. Ich bekam nicht alles mit, was sie erzählte. Aber meine Mutter klärte mich, nachdem sie gegangen war, auf: »Oh Gott, weißt du, der einzige Sohn der Frau Frömke ist vor kurzem im Krieg gefallen.« Damals bekam ich zum ersten Mal dieses Wort »gefallen« zu hören, das uns dann im Verlauf des Krieges ständig begleiten sollte. Neugierig, wie ich immer war, fragte ich, was das bedeute. Meine Mutter erklärte mir, dass der junge Mann im Krieg gestorben war.
So wurde ich auch zum ersten Mal mit dem Wort »Sterben« und der Tatsache des Todes konfrontiert. Es ist für jedes Kind ein ganz einschneidendes Erlebnis, wenn es aus seiner fast paradiesisch todlosen Welt gerissen wird und von der Endgültigkeit erfährt, die unser Leben nun einmal hat. Ich weiß es noch ganz genau, wie ich weiter und weiter gefragt habe. Meine Mutter war ehrlich und machte mich mit der Tatsache vertraut, dass alle Menschen sterben müssen. »Heißt das, Mutti«, fragte ich besorgt, »dass auch du und Vati und die Marie sterben müssen?«
»Ja, wenn es einmal so weit ist«, sagte sie.
Ich war kaum noch zu beruhigen. »Aber da muss man doch etwas dagegen tun«, meinte ich. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich damals versuchte, aus allem Möglichen, was ich in der Küche vorfand, ein Mittel gegen den Tod herzustellen.
Ich formte aus dieser Mixtur ein paar kleine Kügelchen. »Da«, rief ich hoffnungsvoll, »iss es, Mutti, ich habe Tabletten gegen den Tod erfunden.«
Von da an tauchten immer wieder kleine Schatten in meiner Kindheit auf, die mit dem Gevatter Tod zu tun hatten.
Ich wurde in dieser Zeit zum ersten Mal ernsthaft krank. Mein Vater war noch immer im Krieg, da bescheinigte mir unser Hausarzt Dr. Bapst, dass ich Scharlach hätte.
Ich erfuhr die Krankheit nicht als schmerzlich, weiß lediglich noch, dass ich irgendwelche Flecken auf der Haut hatte und nicht aus dem Zimmer durfte. In der Zeit habe ich mich viel mit meinem Lieblingsspielzeug beschäftigt, den Baustöckln. In einer kleinen Kiste lagen die verschiedensten Bausteine, die ich stundenlang zu Häusern oder Burgen zusammenbaute. Dann ließ ich einen Bombenangriff kommen, und ein Flieger warf ein Bauklötzchen auf die eben erstellten Bauwerke, die mehr oder weniger beschädigt zusammenstürzten. Ich habe dann die »Verletzten« geborgen und wieder mit dem »Neuaufbau« begonnen.
In die Zeit meines Scharlachs fiel nun auch wieder ein wirklicher Bombenangriff. Meine Mutter war zunächst ratlos, denn ich durfte ja wegen der Ansteckungsgefahr nicht unter die Leute. Aber konnte man uns deswegen den Zugang zum Luftschutzkeller verwehren? Schließlich lösten meine Mutter und die Marie das Problem so, dass sie mich in viele Decken wickelten, bis mein Kopf kaum noch herausschaute. Dann setzten wir uns in die entlegenste Ecke des Kellers. Die Marie hatte mir ein paar kleine Papierschiffchen gefaltet, mit denen ich spielte.
Apropos Spielsachen. Natürlich war im Krieg Spielzeug knapp geworden, aber mein Vater brachte von Frankreich immer eine Kleinigkeit mit, kleine Autos, Flieger, Figuren, die meine Spielkiste auffüllten. Dazu kam der Teddybär von meiner Mutter, den ich noch immer besitze. Er ist unendlich oft geflickt worden und besteht heute mehr aus Flickwerk als aus seinem ursprünglichen Fell.
Und es gab auch noch eine merkwürdige Puppe, die nur mit viel Fantasie als solche zu erkennen war. Meine Großmutter, die offenbar in solchen Dingen keine große Künstlerin war, hatte sie zusammengenäht. Ich hatte diese Puppe Monika getauft. Jedes Mal, wenn meine Oma zu Besuch kam, hörte ich von ihr den seltsamen, mir bis heute rätselhaften Spruch: »Monika, Ogschwister ha«.
Dem Winterhilfswerk verdankte ich mein Puppenhaus
In meinem ersten Freundeskreis gab es zunächst nur Mädchen. Im Haus wohnte außer mir nur noch ein einziges anderes Kind: die Böhm-Traudl. Sie war drei Jahre älter als ich und die Enkelin unseres Hausmeisterpaares Böhm, das eine Strickerei betrieb. Manchmal besuchten mich noch die zwei Töchter meines Onkels Hans, die Anneliese – sie war drei Jahre älter als ich – und die Hildegard, die nur ein Jahr älter war. Später kam noch die Lieselotte – wir nannten sie einfach Lilo – dazu. Wir spielten vornehmlich Puppenhaus und Puppenküche. Die Böhm-Traudl hatte von ihrer Mutter (vielleicht war es auch die Großmutter) ein kleines Puppenhaus geerbt, um das ich sie sehr beneidete. So kam ich eines Tages auf die Idee, dass ich das kleine hölzerne Vogelhäuschen auf unserem Balkon zum Puppenhaus umfunktionieren könnte. Meine Mutter hatte nichts dagegen, und ich suchte in meiner Spielzeugkiste nach passenden Gegenständen, um es zum Puppenhaus einrichten zu können. Dass aber etwas Vernünftiges daraus wurde, verdanke ich einem anderen Umstand. Damals wurde immer wieder für das sogenannte Winterhilfswerk gesammelt. Für eine Spende erhielt man anstatt der heute meist üblichen Ansteckzeichen ein winzig kleines Puppengeschirr. So sind meine Mutter und ich immer wieder die Landshuter Allee auf und ab gegangen und haben nach den Leuten mit der Sammelbüchse Ausschau gehalten. Mit ein paar Mark Spenden bekamen wir eine kleine Sammlung von Tellern, Tassen, Kannen, und was man sonst noch so brauchte, zusammen. Wie stolz war ich, beim nächsten Spiel mit der Böhm-Traudl auch etwas einbringen zu können!
Apropos Landshuter Allee. Dort steht die Kirche St. Theresia, in der ich getauft wurde. Wenn mein Vater Urlaub bekam, führte uns meist unser erster Weg in dieses Gotteshaus. Das Schönste war darin für mich die kleine Kapelle hinter Glas, aus der beim Einwurf von 10 Pfennigen das Christkind mit Gebimmel herauskam, einen Halbbogen beschrieb und wieder hinter der Tür verschwand. Kaum hatte ich meinen heiß ersehnten Vati mit vielen Bussis begrüßt, klopfte ich schon an seine Hosentasche, von der ich wusste, dass da ein paar Zehnerl für diese Zeremonie bereitlagen.
Überhaupt sind die schönsten, aber auch traurigsten Erinnerungen an meine frühe Kindheit die an die Kurzurlaube meines Vaters. Schon beim Kommen zählte ich bang die Tage, wie lange es wieder bis zum Abschied dauern würde. Ich habe Überlegungen angestellt, wie ich meinen Vater festbinden könnte. Vielleicht mit Hilfe der großen, stabilen Strickmaschine bei den Böhms? Wie mir zumute war, davon erzählt ein Foto aus dieser Zeit: Ich sitze auf einer kleinen Nachbildung einer Gans am Winthirplatz mit Tränen in den Augen, weil mein Vater in ein paar Stunden nach Frankreich zurück muss.
Beinahe hätte ich meine erste große Sammelleidenschaft vergessen. Da in der Kriegszeit nur wenige Bilderbücher erhältlich waren, kannte ich die vorhandenen paar bald in- und auswendig. Es waren der Struwwelpeter, Max und Moritz und das Gegenstück dazu: Lies und Lene. Gierig stürzte ich mich auf alle neuen Bilder. Da entdeckte ich eines Tages in der Zeitung eine äußerst lustige Figur. Es war der Kohlenklau. Die Kohlenklau-Bilder sollten die Bürger darauf aufmerksam machen, dass sie sparsam mit den immer knapper werdenden Energiereserven umgehen mussten. Für mich aber waren sie begehrte Sammlerstücke. Voll Spannung blätterte ich in allen mir erreichbaren Zeitungen und schnitt jede neue Kohlenklau-Folge begeistert aus. Die kleine Papiermappe mit diesen Schätzen hütete ich wie meinen Augapfel.
Vom »Schulverweigerer« zum Pädagogen
Ja, und irgendwann kam ich in das Alter, in dem meine Mutter mir anvertraute, in einem Jahr müsste ich zur Schule gehen. Natürlich war ich mangels Angebot in keinem Kindergarten gewesen. Der Gedanke, dass meine bisherige Kinderwelt zerstört werden sollte und ich jeden Tag ohne meine Mama an einem Ort fern von zu Hause verbringen sollte, brachte mich aus dem Gleichgewicht. Immer wieder erklärte ich, dass ich auf gar keinen Fall in die Schule wolle. Mit dem Ergebnis, dass meine Mutter und die Marie mit allen möglichen Mitteln versuchten, sie mir irgendwie schmackhaft zu machen. Sie dachten sich die lustigsten Geschichten aus und malten mir in buntesten Farben aus, welche Freuden mich dort erwarteten. Vergeblich. Schon der Gedanke an diese fremde Welt ließ meine Tränen kullern.
In dieser Zeit geschah etwas, was wir nie zu hoffen gewagt hätten: Mein Vater wurde plötzlich von Frankreich in die Heimat zurückberufen. Er war Waffentechniker und sollte sich im Erdinger Fliegerhorst um die Flugabwehr kümmern. Als meine Mutter diese Nachricht erhielt, war gerade die Zeit der Schuleinschreibung. Ich hätte in die Schule am Dom-Pedro-Platz gehen müssen. Meine Mutter beschloss, beim Rektor vorstellig zu werden und mich, wo ich doch ohnehin am Jahresende geboren war, zurückstellen zu lassen. Selbstverständlich sollte ich sie bei diesem »Gang nach Canossa« begleiten. Nur mit größten Überredungskünsten brachte sie mich zunächst dazu, mitzugehen.
Der Weg führte durch die Landshuter Allee, die damals noch wirklich eine Allee war und noch nicht wie heute eine der meistbefahrenen Straßen in Deutschland. Mitten in dieser Allee bekam ich einen Anfall vorher nie gekannten Widerstandswillens. Meine Mutter versuchte es mit Schimpfen, mit Engelszungen, wieder mit Schimpfen. Alles vergeblich … Ich ging keinen Schritt weiter und setzte mich auf die nächste Bank. Meine Mutter resignierte und machte sich allein auf den Weg. Nach längerer Zeit kam sie etwas verstört zurück und nahm mich wortlos bei der Hand. Zu Hause erzählte sie mir dann, dass der Rektor der Schule ganz empört auf den Wunsch nach meiner Zurückstellung reagiert habe. Er habe gesagt: »Meinen Sie, dass unser Führer seinen Krieg gewinnen könnte, wenn alle Mütter dächten wie Sie?« Bekanntlich hat er ihn dann auch ohne meine Mitwirkung verloren.
Ich verlasse hier kurz diese Zeit, weil ich viel später nochmals mit dem gleichen Mann konfrontiert wurde. Vor ein paar Jahren bat mich ein Studienfreund, der inzwischen Schulleiter in der Dom-Pedro-Schule geworden war, ich möchte zu einer Jubiläumsfeier einen kleinen Vortrag halten. Als ich das getan hatte, zeigte er mir eine Chronik der Schule mit all seinen Vorgängern. Gespannt suchte ich das Jahr meiner Einschulung. Aber ich entdeckte in der besagten Zeit nur eine größere Lücke. Ich fragte meinen Freund, wie denn der Mann geheißen habe, der damals die Schule leitete.
»Weißt du«, sagte er etwas verschämt, »wir haben herausgefunden, dass das ein ganz penetranter Nazi war. Und so haben wir auf ihn in unserer ehrenvollen Chronik verzichtet.«
Damals wurde ich schließlich trotzdem zurückgestellt, denn wir zogen eilends an die neue Arbeitsstelle meines Vaters nach Erding, und dort entsprach man der Bitte meiner Mutter sofort.
In Erding begann für mich eine sehr bewegte Zeit. Wir bewohnten – unsere Münchner Wohnung gaben wir übrigens nicht auf – ein winziges Quartier in der Wäscherei Stadler in der Münchner Straße. Es bestand aus einem kleinen Zimmer unter dem Dach, einer Küche von etwa zwei Quadratmetern und einer genauso großen Abstellkammer. Toilette und eine uralte Badewanne befanden sich ein Stockwerk tiefer und wurden außer von uns noch von der zweiten Mieterin, der Frau Hupfer mit ihrer Tochter Irmgard, benutzt. Irmgard war zwei Jahre älter als ich.
Unsere Vermieterin war die Frau von Alfons Stadler, der eigentlich der Besitzer der Wäscherei war. Ich sage »eigentlich«, denn in diesem Haus hatte eindeutig sie die Hosen an. Frau Stadler war eine sehr resolute Person, mit der gar nicht gut Kirschen essen war. Mein Vater in seiner liebenswert diplomatischen Art verstand es aber bestens, sie immer bei guter Laune zu halten.
Herr Stadler hatte auch noch einen Bruder. Ferdinand war etwa 25 Jahre alt und leider auf der geistigen Entwicklung eines etwa fünfjährigen Kindes stehengeblieben. Irgendwie habe ich mitbekommen – verstand es allerdings erst später so richtig, was das bedeutete –, dass er als kleiner Bub eine Gehirnhautentzündung bekommen hatte und seitdem behindert war. Der Ferdinandi, wie ihn alle nannten – auch er sich selber –, war ein unglaublich liebenswertes Wesen. Er verrichtete in der Wäscherei ganz einfache Dienste, aber dies mit einer enormen Ausdauer. Von aller Herrgottsfrüh an bis in die Abendstunden stand er vor dem Prunkstück der Wäscherei, einer großen Mangel. Durch diese ließ er die Wäschestücke laufen und legte sie dann mit größter Genauigkeit zusammen.
Der Ferdinandi wurde zu meinem ersten Freund in Erding. Am Wochenende spielte er in seiner kargen Freizeit mit dem wenigen Spielzeug, das ich besaß, geduldig und mit größter Hingabe. Als ich dann in die Schule ging, fasste ich den Plan, dem Ferdinandi Lesen und Schreiben beizubringen, denn ich hatte erfahren, dass er weder das eine noch das andere konnte.
Zum Weihnachtsfest hatte ich damals etwas Großartiges bekommen. Ich weiß bis heute nicht, wie es mein Vater geschafft hatte, aber neben dem Christbaum stand eine kleine schwarze Schultafel, und sogar ein paar Kreiden waren dabei. Offensichtlich zeigte sich schon damals mein Interesse für Pädagogik. Unter der Woche gab es zum Unterricht allerdings nur wenig Möglichkeit, denn der Ferdinand blockte meine »Lehrangebote« fast immer pflichtgetreu mit dem Ausspruch ab: »Ferdinandi muss erst arbeiten!«
In Erding wurden die Bombenangriffe immer mehr. Weil sich dort der sogenannte Fliegerhorst befand, war diese Stadt ein bevorzugter Zielpunkt von Luftgeschwadern. Zunächst hatten wir zwar noch Glück, und es kam zu keinen größeren Angriffen; wir wurden lediglich immer wieder aufgefordert, die Luftschutzkeller aufzusuchen, wenn die Bomber im Anflug waren. Das spielte sich folgendermaßen ab: Im Radio erschollen plötzlich Kuckucksrufe, und es wurde gemeldet, wo sich die Flieger befanden. Wir alle hatten eine Art Landkarte erhalten. Darauf waren konzentrische Kreise eingezeichnet. Wenn die Flugzeuge in den kleinsten Kreis um München und Erding einflogen, bedeutete das akute Bedrohung. Wenn der Ort Laibach genannt wurde, wussten wir, dass sich das Geschwader bereits nahe der deutschen Grenze befand. Als ich nach Jahren einmal auf einer Reise durch Slowenien fuhr und nach Laibach kam, überkam mich im Nachhinein noch eine Gänsehaut.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com