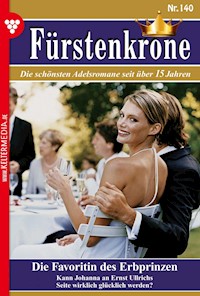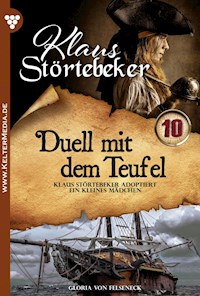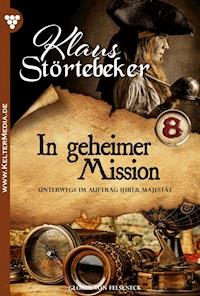Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Klaus Störtebeker
- Sprache: Deutsch
Die neue historisch verbrämte, romantische Abenteuerserie um das spannende, ruhelose Leben des großen Piraten Klaus Störtebeker gründet auf einem geschichtlichen Fundament. Er war der berüchtigtste Pirat am Wendepunkt des 14. zum 15. Jahrhundert. Leben, Lieben und Abenteuer des sagenumwobenen Piraten werden hautnah geschildert. Gleich der erste Roman liefert eine Erklärung, wie es den attraktiven Jungbauern aus Wismar auf die Meere verschlagen konnte, wie er seinen Kumpan Goedeke Michel kennenlernte und erste atemberaubende romantische Augenblicke erlebte. Sein Leben ist eine wahre Fundgrube zur Legende gewordener abenteuerlicher Geschichten. Josef Hitschler war in der letzten Nacht friedlich und im gesegneten Alter von 72 Jahren gestorben. Obwohl dünn wie eine Bohnenstange, hatte er zeitlebens alles in sich hineinstopfen können, was seine drei Frauen und seine Mägde gekocht und gebacken hatten. Kein einziges Pfund hatte er bei dieser Schlemmerei zugenommen und sich kurz vor seinem Ableben noch gebrüstet, kerngesund zu sein. Der Genuß von Gänseleberpastete, gebratenem Ziegenfleisch, eingelegter Ochsenzunge sowie Spanferkel mit Krabben, heruntergespült von zahlreichen Bechern Wein, war dann doch wohl zuviel für seinen Körper gewesen. Der Metzgermeister aus Nassenbach hatte im Anschluß an dieses Festmahl nur den Bauch pflegen und seinen Rausch ausschlafen wollen und war davon nicht wieder erwacht. Seine Familie – vier Kinder aus erster, drei aus zweiter Ehe, deren Familien sowie seine dritte, erst zwanzigjährige Frau – trauerten nicht um ihn, denn der Alte war ein Geizhals und ein Tyrann gewesen. Und doch hatten sie, wie es sich gehörte, den Verstorbenen im Eingangsbereich des Hauses, in der großen Diele, aufgebahrt, hatten Blumen gestreut und Kerzen angezündet, damit Dämonen und böse Geister vertrieben wurden, und jedermann von ihm Abschied nehmen konnte. Die Kunde vom Tod des Metzgers verbreitete sich wie ein Lauffeuer und zog auch zahlreiche Leute aus der Nachbarschaft ins Haus. Die meisten waren allerdings nur neugierig, denn Josef Hitschler hatte nicht nur eine Metzgerei besessen, sondern auch ein Gut vor den Toren der Stadt und mehrere Geschäfte. Er galt als sehr vermögend, und man wollte doch gar zu gern sehen, in welchem Luxus er gelebt hatte. Man wurde jedoch
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Störtebeker – 3–
Gestrandet vor Heiligland
Er trotzte gewaltigen Stürmen und allen Gefahren auf hoher See. Wenn eine schöne Frau in Not geriet, konnte er der galanteste Retter sein ...
Gloria von Felseneck
Josef Hitschler war in der letzten Nacht friedlich und im gesegneten Alter von 72 Jahren gestorben. Obwohl dünn wie eine Bohnenstange, hatte er zeitlebens alles in sich hineinstopfen können, was seine drei Frauen und seine Mägde gekocht und gebacken hatten. Kein einziges Pfund hatte er bei dieser Schlemmerei zugenommen und sich kurz vor seinem Ableben noch gebrüstet, kerngesund zu sein. Der Genuß von Gänseleberpastete, gebratenem Ziegenfleisch, eingelegter Ochsenzunge sowie Spanferkel mit Krabben, heruntergespült von zahlreichen Bechern Wein, war dann doch wohl zuviel für seinen Körper gewesen.
Der Metzgermeister aus Nassenbach hatte im Anschluß an dieses Festmahl nur den Bauch pflegen und seinen Rausch ausschlafen wollen und war davon nicht wieder erwacht.
Seine Familie – vier Kinder aus erster, drei aus zweiter Ehe, deren Familien sowie seine dritte, erst zwanzigjährige Frau – trauerten nicht um ihn, denn der Alte war ein Geizhals und ein Tyrann gewesen. Und doch hatten sie, wie es sich gehörte, den Verstorbenen im Eingangsbereich des Hauses, in der großen Diele, aufgebahrt, hatten Blumen gestreut und Kerzen angezündet, damit Dämonen und böse Geister vertrieben wurden, und jedermann von ihm Abschied nehmen konnte.
Die Kunde vom Tod des Metzgers verbreitete sich wie ein Lauffeuer und zog auch zahlreiche Leute aus der Nachbarschaft ins Haus. Die meisten waren allerdings nur neugierig, denn Josef Hitschler hatte nicht nur eine Metzgerei besessen, sondern auch ein Gut vor den Toren der Stadt und mehrere Geschäfte. Er galt als sehr vermögend, und man wollte doch gar zu gern sehen, in welchem Luxus er gelebt hatte.
Man wurde jedoch sehr enttäuscht. Nichts, aber auch gar nichts deutete darauf hin, daß in diesem Haus ein reicher Mann gewohnt hatte. Man kam allerdings auch nur bis in die schlichte Diele, in der es außer dem so sanft Entschlafenen nicht viel zu sehen gab. Der eine oder andere der mitfühlenden Besucher hatte gehofft, er würde von den Hinterbliebenen zu einem kleinen Umtrunk zu Ehren des Metzgers geladen, doch auch hier irrte man sich.
Rufus und Max Hitschler, die beiden ältesten Söhne, fanden zwar schöne Worte und schienen genauso wie die übrigen Kinder und Enkel fassungslos zu sein, die Gebote der Gastfreundschaft waren ihnen jedoch vollkommen entfallen.
»Wir hätten den Leuten etwas anbieten sollen«, sagte die junge Witwe eben zaghaft. »Als mein Vater gestorben ist, haben wir es so gehalten und…«
»So etwas hätte unser seliger Papa bestimmt nicht gewollt«, wurde sie von Rufus mit leiser Stimme unterbrochen. »Du weißt doch, liebe Martha, wie sehr er die Bescheidenheit und Mäßigkeit liebte.«
»Natürlich, Rufus«, antwortete sie mit belegter Stimme und setzte in einem Gemisch aus Bitterkeit und Spott hinzu: »Aber du erlaubst doch sicher, daß ich mich jetzt wieder zu meinem Mann setze und von ihm Abschied nehme?«
»Das ist dein Recht und deine Pflicht«, säuselte der fünfzigjährige Kaufmann. »Bete nur für das Seelenheil unseres lieben Vaters. Wir werden dich ganz gewiß nicht dabei stören.«
Martha erwiderte nichts. Sie stand auf und verließ den Kreis der Familie, die sowieso nicht ihre Familie war. Sie hatte niemanden mehr, der zu ihr gehörte. Der Vater war vor einem guten Jahr gestorben, und ihre Mutter hatte vor kurzem wieder geheiratet und war mit ihrem neuen Gemahl nach Franken gezogen. Eine Hilfe war sie ihr ohnehin nie gewesen. Sie hatte immer nur das gemacht, was ihr Mann anordnete und hatte auch nicht aufbegehrt, als dieser das einzige Kind mit einem alten Mann verheiratete.
Die junge Frau seufzte leise und setzte sich nun auf einen Schemel, der unmittelbar neben dem Sarg stand. Hier würde ihr Platz bis zur Beisetzung sein – und hier war sie auch meistens allein. Rufus, Max, Meta, Teresa und alle die anderen hielten sich in der zugigen Diele nur selten auf. Sie saßen lieber in der weiträumigen beheizbaren Kemenate und schienen dort zu trauern. Martha glaubte ihnen allen nicht so recht, waren sie doch dem verblichenen Familienoberhaupt im Wesen mehr oder weniger viel zu ähnlich.
Josef war ein Despot gewesen, in manchen Stunden jedoch geradezu besessen von ihr, seiner jungen Frau, und dann so zugänglich wie selten. Wenn er neben ihr gelegen und ihren Körper gestreichelt hatte, versprach er ihr oft, sie in seinem Testament großzügig zu bedenken, weit über das hinaus, was ihr gemäß Heiratsvertrag zustand. Hoffentlich hat er das nicht gemacht, dachte sie beklommen. Wenn er mich so bevorzugt haben sollte, dann werde ich hier im Haus die Hölle auf Erden haben.
*
Julius Havemann, Advokat und langjähriger Freund des Metzgers, hatte, wie es Brauch war, noch auf dem Friedhof den letzten Willen des Verstorbenen verlesen. Dabei war ihm nicht entgangen, daß die Gesichter seiner Kinder und Kindeskinder trotz der beträchtlichen Hinterlassenschaft immer länger geworden waren. Rufus hatte als ältester Sohn immerhin das Gut und die Metzgerei geerbt, hatte aber die übrigen Geschwister an den Einnahmen zu beteiligen. Es ging niemand leer aus und doch sah es so aus, als würde man den Aufschrei der Empörung nur mühsam unterdrücken können.
Der Rechtsgelehrte sah die verkniffenen Mienen, sah die Wut und die echte Fassungslosigkeit und fragte sich, was sich sein alter Freund bei diesem Testament wohl gedacht hatte. Nun, gedacht hatte er wahrscheinlich nicht allzuviel, er hatte wohl eher seine Sinne zu Rate gezogen. Lüstern, wie Josef zeitlebens gewesen war, war er anscheinend mit seiner jungen Frau in dieser Hinsicht so zufrieden gewesen, daß er ihr außer ihrem Witwenerbe noch einen großen Teil seines Vermögens und das Stadthaus, indem er in den letzten Jahren ständig gewohnt hatte, zu ihrer eigenen Verfügung hinterließ.
Vielleicht hatte er auch etwas ganz anderes zum Ausdruck bringen wollen. Doch wer wußte das schon? Aber es war in jedem Fall ein teuflisches Erbe und würde der jungen Frau wahrscheinlich nur Unheil bringen.
Schließlich kannte er, Julius Havemann, das neue Familienoberhaupt gut genug und wußte, daß dieses rücksichtslos vorgehen würde, wenn es sich benachteiligt fühlte. Aber es war nicht seine Sache, darüber zu richten oder sich einzumischen.
Martha stand wie erstarrt da und wagte nicht, Rufus und die anderen anzusehen. Sie, die aus bescheidenen Verhältnissen kam, die in der Ehe mit Josef Hitschler nur demütig und willig hatte sein müssen, war plötzlich reich und demzufolge unabhängig. Ihr gehörte das schöne Fachwerkhaus allein, der gesamte Hausrat, der schöne Schmuck, die Leinenvorräte und die Hälfte des Geldes.
Sie spürte die haßerfüllten Blicke ihres ältesten Stiefsohnes – Rufus war der Schlimmste von allen – und hoffte doch, daß er sich mit diesem Testament allmählich abfinden würde. Es blieb den Kindern doch noch genug übrig. Sie hatten alle hier in Nassenbach und Umgebung ihre Häuser und ihr Auskommen.
Ihre Hoffnung wurde jedoch schon am gleichen Abend zunichte gemacht, genau in dem Augenblick, als Max Hitschler verständnislos sagte: »Ich verstehe unseren Herrn Vater nicht. Was mag er sich nur dabei gedacht haben, uns – seine Kinder – beim Erbe so zu vernachlässigen?«
»Dafür gibt es nur eine einzige Erklärung«, erwiderte Rufus kalt. »Er war von Martha besessen, weil sie ihn verhext hat.«
»Onkel Rufus, wißt Ihr eigentlich, was Ihr da sagt?« rief Teresa, die jüngste Tochter von Max. »Der Großvater war vielleicht nur nicht richtig bei Verstand. Er war ja schon alt und hat nicht mehr gewußt, was er tat.«
»Genauso ist es«, bestätigte Rufus Hitschler und blickte jeden einzelnen in der Runde streng an. »Er war nicht bei Sinnen, weil er verzaubert worden ist. Und so etwas kann nur eine Hexe zustande bringen, eine Frau, die mit dem Teufel im Bunde ist. Martha war unserem verehrten Papa scheinbar ergeben, um so an seine Güter und sein Vermögen zu gelangen. Anschließend hat sie den zwar alten, aber völlig gesunden Mann mit ihren Zaubertränken vergiftet. Erinnert euch, Papa hat sich bis zu seinem letzten Tag gesund gefühlt. Und ihr wißt auch, was nun geschehen wird, wenn wir diesem Satansweib nicht Einhalt gebieten.«
Die Familienmitglieder, es waren insgesamt über dreißig, waren bestürzt, ängstlich, erschrocken und manche so naiv, daß sie gar nicht begriffen, was Rufus Hitschler eben ausgesprochen hatte.
»Was wird denn geschehen?« hauchte Meta, seine Frau, und wurde sehr blaß.
»Sie wird uns allen schaden, wo sie nur kann. Sie wird die Ernte und die Gartenfrüchte verderben, die Tiere sterben lassen, uns die Pest wünschen und den Teufel über uns bringen. Ihr werdet schon sehen.«
»Dieses Weib muß aus dem Haus…, sofort!« kreischte Konstanzia, die älteste von Josefs Töchtern, und bekreuzigte sich mehrmals. »Sie ist eine Hexe! Seht doch, sie hat die Zeichen des Satans bereits im Gesicht.«
Diese vermeintlichen Zeichen waren rote Flecken, die sich vor Angst und Aufregung auf Marthas Wangen und am Hals gebildet hatten. »Ich… bin doch… keine Hexe«, flüsterte sie mit ersterbender Stimme und blickte alle fassungslos an. »Hexen gibt es doch… gar nicht.«
»Natürlich gibt es die«, ereiferte sich Roderich, der mittlere Sohn. »Erst vor wenigen Wochen hat uns der Bischof eindringlich gewarnt, besonders vor Frauen mit einem schwachen Charakter und zügelloser Begierde. Die verfallen dem Teufel am schnellsten. Und du bist auch so eine. Rufus hat recht. Du bist nur unser Verderben und solltest im Gefängnis für deine Sünden büßen.«
»Onkel Roderich!« schrie Teresa aufgebracht. »So etwas könnt Ihr doch nicht wollen. Martha gehört doch zu uns. Und über Großvaters Erbe kann man sich doch einigen.«
»Mit so einer Gottesleugnerin macht man keine Geschäfte, meine liebe Nichte«, erwiderte Roderich Hitschler in belehrendem Ton. »Weißt du denn nicht, daß jeder angeklagt werden kann, der eine Hexe nicht ihrer gerechten Strafe zuführt?«
Das junge Mädchen sagte nun nichts mehr. Es wandte sich ab und verließ den Raum, während die anderen ohne jedes Mitleid zuschauten, wie Rufus und Max Hitschler die sprachlose und vollkommen verstörte Martha aus dem Zimmer zerrten. Sie sagten auch nichts, als die beiden sich kurz darauf zum Grafen von Brackmühlen fahren ließen, um die Hexe beim ihm, als zuständigem Gerichtsherrn, anzuzeigen.
*
Teresa war nicht nach Hause gegangen, wie sie es ursprünglich vorgehabt hatte. Nach kurzem Überlegen hatte sie geahnt, wohin man die arme Martha schaffen würde. Der Weinkeller war schon immer der Ort gewesen, wo störrische Familienangehörige, darüber nachzudenken hatten, wer hier der Herr im Haus war, und wem sie blinden Gehorsam schuldeten. Bis vor wenigen Tagen war es noch der Großvater gewesen, dessen Herrschaft man anzuerkennen hatte. Jetzt war es Onkel Rufus, den sie insgeheim verachtete, aber auch fürchtete.
Sie selbst hatte oft stundenlang in diesem Keller ausharren müssen, wenn sie sich geweigert hatte, die Befehle ihres Großvaters zu befolgen. Sie hatte jedoch bald eine Möglichkeit gefunden, sich die Haft erträglicher zu machen, nämlich einen Zweitschlüssel, den ihr der alte Jakob angefertigt hatte. So hatte sie ihr Gefängnis immer heimlich verlassen können, um zur Küche zu schleichen und sich dort wenigstens eine kleine Mahlzeit zu besorgen. Wie gut, daß sie diesen und inzwischen noch andere Zweitschlüssel immer noch bei sich trug. Niemand wußte, daß sie diese besaß, auch ihr Vater nicht.
Hinter einem Holzstapel verborgen, hatte sie vorhin beobachtet, wie Onkel Rufus die völlig gebrochene Martha in den Keller stieß, diesen verschloß und dann mit ihrem Vater wieder ging. Kurz darauf sah sie durch eines der Kellerfenster, wie die beiden wegfuhren. Sie konnte sich denken, wohin. Und sie wußte auch, was die anderen jetzt taten. Statt nach Hause zu gehen, saßen sie wahrscheinlich lamentierend, betend oder ängstlich zusammen und warteten darauf, daß die Schergen des Grafen die Hexe abholten. In den Keller würde so schnell niemand kommen. Man hatte ja Angst und konnte obendrein in Verruf kommen.
Zum Glück waren bis zur Burg mehrere Meilen zurückzulegen. Das war gut, weniger gut war, daß ihr noch nicht eingefallen war, wo sie Martha nach ihrer Befreiung verstecken konnte. Im Hause ihres Vaters war das unmöglich. Ja, wenn ihre Mutter noch leben würde, die hätte sicher einen Ausweg gefunden. Doch halt! Sie erinnerte sich plötzlich an Albrecht Warin, den Goldschmied und Juwelier, dessen Anwesen in unmittelbarer Nähe lag. Ihr Vater und Onkel Rufus mochten ihn nicht, weil er sie einmal öffentlich angeprangert hatte, ihr Gesinde außerordentlich schlecht zu behandeln und nicht ausreichend zu entlohnen. Vielleicht besaß dieser Mann auch genug Mut, um Martha zu helfen.
Inzwischen war es Abend geworden, ein milder Abend im beginnenden Frühling, der bald seine Dunkelheit über das Land breiten würde. Teresa verließ nun ihr Versteck, nahm sich eine scharfe Feile und eine Säge, die zum Glück hier lagen, und eilte zum Weinkeller. Die Tür war schnell aufgeschlossen. Und ebensoschnell war sie
bei Martha, die damit begonnen hatte, sich das Gewand zu zerreißen.
»Was soll denn das?« flüsterte Teresa schockiert.
»Ich will mich aufhängen. Das ist besser, als unter der Folter oder auf dem Scheiterhaufen zu sterben.« Martha sagte das tonlos und riß einen weiteren Streifen von ihrem Kleid ab.
»Laß das! Hilf mir lieber! Wir haben nicht viel Zeit.« Teresa nahm ihr die Stoffstreifen fort, drückte ihr statt dessen die Feile in die Hand und ordnete resolut an: »Wir müssen das Fenster wenigstens soweit kaputt machen, damit es so aussieht, als wärest du geflohen.«
»Du willst mir helfen? Warum?« Martha starrte sie an, als wäre sie nicht von dieser Welt.
»Weil ich ein Gewissen habe. Und weil du unschuldig bist.«
»Man wird dich auch anklagen.«
»Wird man nicht, wenn wir uns beeilen. Nun mach schon!« Teresa hatte bereits zwei Holzleisten durchgesägt und ermunterte Martha, endlich die Feile einzusetzen. Nun doch überzeugt, daß es noch Hilfe gab, arbeitete die junge Witwe schnell und gründlich, so daß es nicht lange dauerte, bis man durch das Fenster hätte kriechen können.
»So, das reicht.« Teresa legte das Werkzeug wieder dorthin, wo sie es gefunden hatte, nahm dann Martha bei der Hand, verließ mit ihr den Weinkeller und schloß diesen ab. Danach eilten die beiden Frauen durch die Hintertür aus dem Haus. In der Dunkelheit waren sie nur Schatten, die niemand beachtete.
*
Albrecht Warin hatte vor wenigen Minuten zu Abend gegessen und schlenderte nun durch den Garten, so wie er es oft zu tun pflegte. Er dachte über seine Geschäfte nach und war so in Gedanken versunken, daß er die beiden Frauen erst sah, als sie nur wenige Schritte von ihm entfernt waren.
»Jesus…, Maria…, was wollt Ihr denn?« stammelte er und starrte Martha und Teresa Hitschler entgeistert an.
»Bitte helft uns und habt Erbarmen!« flehte Teresa leise. »Die Verwandten wollen die Witwe meines Großvaters als Hexe auf den Scheiterhaufen bringen. Versteckt sie, wenn Ihr könnt…, bis ich eine Lösung gefunden habe, sie vor diesem Schicksal zu bewahren.«
Der Goldschmied blickte in Marthas bleiches Gesicht, er sah Angst, Grauen und Entsetzen darin. Und er sah Teresa, eine junge Frau, die ihm nicht gleichgültig war, und die sich jetzt ebenfalls in große Gefahr begeben hatte.
»Kommt«, sagte er ruhig zu Martha. »In meinem Haus seid Ihr sicher. Das schwöre ich bei unserem Herrgott. Und Ihr«, er wandte sich nun an Teresa, »Ihr kehrt unverzüglich nach Hause zurück. Und kommt erst wieder, wenn ich Euch ein Zeichen gebe.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: