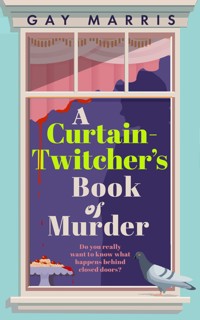9,99 €
Mehr erfahren.
Wie gut kennen Sie Ihre Nachbarn wirklich? London, 1968. Die Ära der Miniröcke und der Beatles ist angebrochen. Nicht jedoch in der Atbara Avenue. Denn hier legt man noch Wert auf die guten alten Manieren: Man grüßt seine Nachbarn, kümmert sich ansonsten aber um seine eigenen Angelegenheiten. Der Kirchenbesuch ist nicht wegzudenken, der Tee wird penibel warmgehalten und die Autos werden wöchentlich gewaschen. Doch wenn man etwas genauer hinsieht, entdeckt man, dass sich selbst hinter den gestärkten Gardinen der beschaulichen Vorstadtstraße und einem freundlichen Lächeln die dunkelsten Geheimnisse verbergen können: uralte Flüche, verblasster Glamour und mehr als ein kaltblütiger Mörder. Herzlich willkommen in der Atbara Avenue! Not-so-cosy-Crime made in Britain: Dieses Romandebüt steckt voller grandios-grausamer Figuren und feinstem britischen Humor
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Wie gut kennen Sie Ihre Nachbarn wirklich?
London, 1968. Die Röcke sind kurz und die Beatles beliebter als Jesus. Nicht jedoch in der Atbara Avenue. Denn hier legt man noch Wert auf die guten alten Manieren: Der sonntägliche Kirchgang ist Pflicht, der Tee wird penibel warmgehalten und die Autos werden wöchentlich gewaschen. Doch sieht man etwas genauer hin, verbergen sich selbst hinter den gestärkten Gardinen der beschaulichen Vorstadtstraße und einem freundlichen Lächeln die dunkelsten Geheimnisse: uralte Fehden, verblasster Glamour und mehr als ein kaltblütiger Mord.
Gay Marris
Kleine Morde erhalten die Nachbarschaft
Roman
Aus dem Englischen von Barbara Ostrop
Für Mum und Dad
Prolog
Der erste Backstein des ersten Hauses in der Atbara Avenue wurde in der Zeit gelegt, als die verwitwete Queen Victoria sich durch die Dämmerung ihrer Herrschaftszeit trauerte; das letzte Haus erhielt seinen letzten Backstein, als ihr Sohn Edward ein Jahr auf dem Thron gesessen hatte. Der Mörtel, der die Steine hielt, war getränkt mit der Selbstzufriedenheit eines Imperiums und der Zuversicht eines Playboy-Königs. Jedes der neu erbauten, schönen Häuser mit den großen Erkerfenstern und dem Satteldach war mit einem nüchternen Eisenzaun und einem fröhlich schwarz-weiß gefliesten Zugangsweg versehen. Rasch zogen Londoner Familien ein, brachten ihre Cockerspaniels und Hausmädchen mit, froh, ihre Suppenterrinen und ihre Ambitionen in einer so großzügig ausgestatteten Unterkunft auspacken zu können. Sie waren so grün hinter den Ohren und so aufstrebend wie die Lindenbäumchen, die vor jedem dritten Haus gepflanzt wurden. An einem Ende der Avenue gab es einen Blumenladen. Am anderen stand die bescheidene Kirche St Francis in the Fields, zu der ein hässliches Gemeindehaus und ein noch hässlicheres Pfarrhaus gehörten. In jener Zeit waren frische Schnittblumen in einem Haushalt unverzichtbar, und es verstand sich von selbst, dass Gott ein Engländer der Edwardischen Epoche war.
Doch das liegt zwei Weltkriege zurück, und seitdem wurde ein Hund in den Orbit geschossen. Beinahe seit siebzig Jahren stehen die Häuser in der Atbara Avenue Schulter an Schulter wie bei einer Parade. Die Eisenzäune sind verschwunden, sie wurden eingeschmolzen, um zu Munition gegossen zu werden, und die harlekinesken Fliesen haben Risse. Auch die Hausmädchen gibt es nicht mehr. Mit Nylonbürsten und Liquid Gumption bewaffnet schrubben die Hausherrinnen dieser Tage ihre Vortreppen selbst. Einige Häuser wurden umgebaut und bergen nun eine Anzahl von Einzimmerwohnungen. Hinter anderen Häusern wurden mehrere Gärten durch ein unregelmäßiges Pflaster ersetzt. Unbeschädigt und so hässlich wie nur je säumen das Pfarrhaus und das Gemeindehaus den Vorhof der Kirche, aber St Francis ist häufiger halb leer als halb voll. Der Blumenladen ist einem Eckladen gewichen, der von Mr und Mrs Singh geführt wird. Sie verkaufen alles, was für die schöne neue Welt wichtig ist: Beano-Comics, Sherbet-Dips-Brauselutscher, Instant-Whip-Dessert und Spam-Frühstücksfleisch. Die Pferdetränke aus Granit, die den Eingang des Atbara Parks ziert, ist mit Lobelien bepflanzt. Unter den Fundamenten der Häuser rumpeln U-Bahn-Züge. Von den Linden, inzwischen große, ausgewachsene Bäume, tropft Honigtau auf Ford Escorts und Vauxhall Vivas, die in ihrem klebrigen Schatten parken.
In der Carnaby Street mögen die Sechziger in vollem Schwung sein – dort sind die Röcke kurz, die Hemden aus Musselin und die Beatles beliebter als Jesus –, doch die Atbara Avenue übt sich da in Zurückhaltung. Als wäre etwas in die Steine selbst eingedrungen, das noch die Erinnerung an seine nicht gar so zynischen Wurzeln in sich trägt. Zweifellos schon ein wenig abgestoßen und vielleicht nicht mehr superschick, bietet jede pastellfarben gestrichene Fassade ihrem lächelnden Gegenüber auf der anderen Straßenseite doch noch ein mehr oder weniger achtbares Antlitz. Und zumindest nach außen hin hat es den Anschein, als färbte diese Anständigkeit auf die derzeitigen Anwohner ab. Es stimmt, wohlhabend, gebildet oder englisch muss man nicht mehr sein, um in der Atbara Avenue zu wohnen, aber man muss doch einen gewissen Standard halten. Picobello wie die Blumenkästen vor den Fenstern warten die Anwohner mit ihrem besten Benehmen auf. Gott bewahre, dass in dieser Gegend irgendwelche BHs verbrannt werden könnten. Hier hören Kinder im Radio Listen with Mother, der Vater isst ein Ei zum Frühstück wie in der Werbung, und im Fernsehen schlürfen Schimpansen aus Porzellantassen Tee, der mit Teebeuteln von PG Tips zubereitet wurde. Viele Anwohner leben schon seit zahllosen Jahren in der Avenue und schmoren miteinander im selben vorstädtischen Saft. Tatsächlich haben manche von ihnen niemals anderswo gewohnt. Es überrascht, wie viele Menschen, die in der Avenue geboren wurden, dort auch sterben. Sie winken und nicken einander im Vorbeigehen selbstbewusst zu, müssen dann aber schnell weiter.
Sollten Sie jemanden fragen, wie gut er seine Nachbarn kennt, wird er mit einem »Gut« antworten, ohne zu zögern. Schließlich sehen sie sich auf dem Weg durch das Auf und Ab ihrer Existenz täglich. Ihre Gesichter sind einander inzwischen so vertraut wie der Margeritendruck auf den Rollos in der Küche. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Menschen einander kaum kennen. Sie können unmöglich tiefere Einblicke haben, da die Schicklichkeit verlangt, dass sie die wirklich wichtigen Einzelheiten ihres Lebens vor Außenstehenden verbergen.
Die Anwohner der Atbara Avenue beobachten einander über die weite Entfernung hinweg, die durch große räumliche Nähe entsteht, und so ist es wahrscheinlich am besten.
1Keines Verdachts würdig
Von fern gesehen, könnte man Mrs Muriel Dollimore fälschlich für eine reizende alte Dame halten. Der zarte weiße Haarkranz um das runde, faltige Gesicht macht sofort klar, dass die mollige, gebeugt gehende Dame fortgeschrittenen Alters ist. Wenn sie mit ihrer kleinen, untersetzten Gestalt fast die Hornknöpfe ihres Tweedmantels sprengt, wirkt sie eher ausgestopft als bekleidet. Sie ist das Inbild einer nach Lavendel duftenden Omi, die, so denken ihre Nachbarn, zweifellos in ihrer Stube sitzt und strickt. Regelmäßig wie die Uhr sehen sie sie jeden Nachmittag auf der Straße vor ihren Fenstern vorbeigehen. Ticktack, ticktack, ticktack machen ihre klackenden Gehstöcke in flottem Tempo auf dem Asphalt, während sie zum Eckladen schlurft, um Katzenfutter und Büchsenmilch zu kaufen. Sie sieht immer genau gleich aus. Und immer reizend. Behüt’ sie Gott.
Mrs Dollimore wohnt von allen Anwohnern am längsten in der Atbara Avenue. Keiner, der ihren Einzug verfolgt hat, ist noch am Leben, und so kann man aus Sicht der heutigen Nachbarn sagen, dass sie schon immer da war. Eine geschätzte Konstante im Bühnenstück des örtlichen Lebens.
Als Muriel vor einem halben Jahrhundert einzog, war der Erste Weltkrieg vorbei, doch London befand sich noch immer im Schockzustand. Pferde waren üblich, junge Männer selten, und die Damen trugen Handschuhe zum Tee. Es war ihr Hochzeitstag, doch sollte sich jetzt jemand vorstellen, ein einst kraftstrotzender und heute toter Ernest Dollimore habe seine errötende Braut stolz über die Türschwelle getragen, liegt er falsch. Er war nicht für schweres Tragen geschaffen, und ihr war es lieber, wenn er sie nicht anfasste. Vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Sobald ihre Droschke vor der Nummer 17 hielt, stieg sie aus, und ihre schmalen Füße trugen sie direkt über den gefliesten Weg ins Haus. Getrödelt wurde nicht.
Vor ihrer Hochzeit war Muriel Edwards eine Profisängerin. Mit einer Figur wie der einer Nymphe und der Fähigkeit, den Rauch ihrer Zigarette gnadenlos nur in Richtung der nützlichsten Männer zu blasen, verkörperte niemand Glamour besser als sie. Nach den bescheidenen Maßstäben der damaligen Zeit war sie unter ihrem Bühnennamen Dolores ein aufgehender Stern am Himmel über den Jazzclubs der südenglischen Seebäder, und zu der Zeit, als sie den zuverlässigen Bankangestellten Ernest kennenlernte, fiel sie auch dem Entrepreneur Vincent Grünblatt ins Auge, Talentscout mit Haifischblick und Türöffner für einen Erfolg im Westend. Vincent versprach seiner kleinen Lerche den Mond und die Sterne. Doch zu ihrer nachhaltigen Enttäuschung sollte sie niemals in den Genuss dieser hart erarbeiteten Belohnungen kommen. Als klar wurde, dass sie ein Kind erwartete, verflüchtigte sich alles Interesse, das Vinny an seinem frei fliegenden Singvogel gehabt haben mochte, und nun flog er selbst weg. Mit eisernem Überlebensinstinkt nahm die verzweifelte Dolores den erneuten Heiratsantrag des liebeskranken Ernest rasch an. Ernest holte sie in diese Großstadt, wo sie auf dem Standesamt von Hammersmith die Formalitäten erledigten. Ernest war außer sich vor Glück; Muriel vor Groll.
Die Anwohnerin, die am zweitlängsten in der Straße lebt, ist Pauline Dollimore, Muriels Tochter. Sie wurde im hinteren Schlafzimmer von Nummer 17 geboren, und abgesehen von einem kurzen Zwischenspiel in ihrer Zeit als junge Erwachsene hat sie immer unter dieser Adresse gewohnt. Sie hat den Zweiten Weltkrieg, die Rationierung und die Bombardierung durchgestanden. Sie hat miterlebt, wie die Pferde verschwanden und die von Kugeln und Bomben getroffenen Generationen sich allmählich erholten, aber nie kam sie in die Lage, wegen einer schicken Umgebung beim Teetrinken Handschuhe anziehen zu müssen. Über viele Jahre hat sich diese bedauernswerte Frau langsam von der Welt um sie herum abgewandt, und jetzt ist sie so weit in den Hintergrund zurückgewichen, dass sie kaum mehr als eine Zuschauerin ihrer eigenen Geschichte ist. Aus welcher Distanz man sie auch betrachtet, von fern oder von ganz nah, es ist unmöglich, Pauline Dollimore fälschlich für etwas anderes zu halten als das, was sie ist: eine nervöse, übergewichtige alte Jungfer, die bei ihrer verwitweten Mutter lebt. Sie sieht immer gleich aus. Und zwar erbärmlich.
Deirdre, die Frau des Reverends Desmond O’Reilly, bringt eine Reihe zu Ende und lässt das Strickzeug dann auf den Schoß sinken. Da das Wohnzimmer des Pfarrhauses nur noch vom sanften Schimmer der untergehenden Sonne erhellt wird, ist es zu dunkel, um ihre Arbeit zu sehen. Zwar ist sie stolz darauf, »blind« stricken zu können, doch inzwischen tun ihr die Augen weh. Sie wirft einen Blick auf ihren Mann, der im Sessel gegenüber sitzt und schläft. Der Kopf ruht auf dem Schonbezug, der Mund steht offen und seine Augen sind geschlossen. Das neueste Krimitaschenbuch liegt mit dem Gesicht nach unten auf seiner Brust. Die langen, mageren Beine hat er vor sich ausgestreckt.
Sanft stupst sie seinen Fuß mit ihrer Pantoffelspitze an. »Desmond«, flüstert sie sehr laut. »Schläfst du?«
Der Pfarrer stößt ein leises Grunzen aus und schlägt die Augen auf. »Jetzt nicht mehr.«
»Oh, das ist gut. Ich möchte nämlich mit dir über etwas reden.«
»Nur zu«, antwortet er, ohne seine Körperhaltung zu verändern. »Vielleicht schließe ich wieder die Augen, aber ich höre dir ganz bestimmt zu.«
»Du musst dich richtig hinsetzen«, entgegnet Deirdre und schaltet eine Stehlampe ein. »Sonst schläfst du nur wieder ein und verpasst das Wesentliche.«
»Ja, du hast wohl recht.« Er gähnt, richtet sich auf und zieht die Beine heran. Dann klappt er sein Buch zu, legt es auf die Armlehne und setzt die Brille auf. »Du hast meine ganze Aufmerksamkeit.«
Deirdre schiebt die Hüften ein wenig tiefer in den Sessel, streicht sich die Strickjacke glatt und beginnt. »Ich habe die Befürchtung, eine bestimmte Nachbarin – sagen wir mal rein theoretisch: ein Mitglied des Frauenvereins – könnte ein Problem haben, aber nichts davon erzählen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die betreffende Person ein besonders selbstloser Mensch ist.«
»Wieso glaubst du, dass sie sich nicht einmal dir anvertrauen würde? Du bist eine ausgezeichnete Zuhörerin.«
»Leider könnte ein natürliches Widerstreben sie daran hindern, sich alles von der Seele zu reden. Sie fürchtet, wenn sie einer anderen Frau ihr Problem anvertraute, müsste sich nun auch diese deswegen sorgen. Die Vertrauensperson wäre also gezwungen, eine neue Bürde zusätzlich zur eigenen Last zu tragen. Und natürlich gibt es Grenzen, wenn es um die Nachbarschaft geht.«
»Wie meinst du das?«
»Es mag in Ordnung sein, die engsten Verwandten mit emotionalem Matsch zu bespritzen, aber dasselbe auch seinen Nachbarn zuzumuten, wäre extrem …«, Deirdre zögert, findet dann aber genau das richtige Wort, »unschicklich. Gute Nachbarn belästigen sich nicht damit, dass sie ihre Schwierigkeiten ausbreiten. Gute Nachbarn halten sich für sich.«
»Was für eine enttäuschende Beschreibung.« Der Pfarrer schüttelt betrübt den Kopf.
»Enttäuschend, aber wahr«, antwortet sie gereizt.
»Woran merkst du, dass deine geheimnisvolle Bekannte etwas verbirgt?«
Deirdre hält inne, bevor sie antwortet. Sie kann nicht behaupten, es liege am Aussehen der Frau, denn wenn sie jetzt recht darüber nachdenkt, hat sie sie niemals so genau betrachtet. Wenn die sanftmütigen Anwohner der Atbara Avenue sich begegnen, starren sie einander nicht in die Augen, riskieren keine ganz und gar unnachbarschaftliche Intimität. Sie würden ja auch nicht in jemandes Vorgarten treten und durchs Wohnzimmerfenster spähen. »Ich weiß nicht. In ihrer Nähe bekomme ich einfach nur ein so unbehagliches Gefühl. Natürlich beklagt sie sich niemals, die tapfere Frau. Aber es muss belastend für sie sein, immer noch mit ihrer Mutter im selben Haus festzusitzen, praktisch Wange an Wange.«
»Statt herumzuraten, könntest du sie ja vielleicht einfach fragen, wo der Schuh drückt.«
»Ausgeschlossen!«, ruft Deirdre aus. »Und wie schon gesagt, ich glaube ohnehin nicht, dass sie es mir erzählen würde.«
Sie verfallen beide in ein gereiztes Schweigen. Statt aufgemuntert wie erhofft, fühlt Deirdre sich jetzt getadelt. Als wären Mutmaßungen über die Probleme einer Nachbarin nichts als müßiger Klatsch am offenen Kamin. Gehört es nicht zur menschlichen Natur, die Personen in unserer Umgebung mit Neugier zu betrachten? Und ist ihr Mann nicht genauso ein Mensch wie sie? Vielleicht hat sie nicht viel Zeit damit verbracht, diese Frau im Auge zu behalten – oder auch sich anzuhören, was sie sagt –, aber selbst die beiläufigste Beobachtung ermöglicht es einem doch, eine Menge über eine andere Person zu vermuten. Deirdre nimmt das, was sie auf einen Blick erkennen kann, und füllt die Lücken dann mit Vermutungen aus. Der hochgewachsene Polizist muss mutig sein; schmuddelige Jungs sind freche Affen; die tätowierten Jugendlichen haben vermutlich Desmonds Fahrrad gestohlen. Und so weiter und so fort. Diese Porträts ihrer Nachbarn, die in den Galerien ihres stets regen Geistes hängen, mögen mit den Pinselstrichen Tausender flüchtiger Blicke gezeichnet sein, doch Deirdre ist mit ihnen durchaus zufrieden. Sie weiß, dass die Menschen nicht unbedingt sehr offen sind, ist aber überzeugt, dass sie noch niemals falschgelegen hat.
»Tut mir leid, Desmond.« Sie seufzt. »Ich wollte nicht wie eine Klatschbase klingen. Ich möchte wirklich helfen.«
»Das spricht für dich«, antwortet der Pfarrer. »Ich habe auch nie etwas anderes gedacht.«
»Danke, Darling.« Deirdre fängt wieder an zu stricken. »Und je früher ich mit Pauline Dollimore reden kann, desto besser.«
»Pauline Dollimore?« Der Pfarrer schnaubt. »Du lieber Himmel!«
»Natürlich. Was dachtest du denn, wen ich meine?«
»Die gute alte Muriel. Sie ist diejenige, mit der ich Mitleid habe.«
Es ist ein schöner Aprilnachmittag, sonnig und ein wenig windig. Die gewissenhaften Hausfrauen der Atbara Avenue haben ihre Lockenwickler aus dem Haar genommen, sich ihre Schürzen umgebunden und sind nach draußen geströmt, fest entschlossen, diesen gut geeigneten Tag zu nutzen, um ihre Dash-weiße Bettwäsche in der kohlerauchgeschwängerten Luft zu trocknen. Pauline Dollimore bleibt im Haus. Sie sitzt gerade in ihrem Schlafzimmer und schreibt den Abschiedsbrief noch einmal neu, als ihre Mutter aus dem Laden nach Hause kommt.
»Mum? Bist du das?«, ruft sie fröhlich aus dem Treppenhaus herab.
Sie hört, wie die alte Dame brummelnd unten herumschlurft, kann aber kein Wort verstehen.
Pauline versucht es ein weiteres Mal. »Hast du alles bekommen, was du wolltest?«
Erneut keine direkte Antwort, nur ein fortgesetztes gedämpftes Geschimpfe. »Sixpence? Für zwei Unzen Kokosflocken? Das ist Diebstahl … aber es überrascht mich nicht … Ich weiß noch, was mich Waschen und Legen bei diesem verdammten Friseur in der Hauptstraße gekostet hat … Ach, von wegen, Friseur, ein richtiger Flittchenladen … Da gondeln sie mit ihren Beehives herum. Vogelnester, wenn du mich fragst. Jeder hält die Hand auf …«
»Ich wollte gerade Wasser aufsetzen, Mum. Bestimmt hast du Lust auf etwas Warmes.«
»Du hast nie einen Mann gefunden, und jetzt ist es viel zu spät. Schau dich doch an! Komisch, dass du es noch erträgst, anderen dein Gesicht zu zeigen … Selbst dieser Dummkopf Ernest wäre voll Abscheu, wenn er dich jetzt ansehen müsste. Hörst du? Er wäre VOLLABSCHEU!«
Wie immer reagiert Pauline nicht auf diese Bemerkungen. Sie hat sich nicht gewehrt, als sie heranwuchs, und sie wehrt sich noch immer nicht, wie verletzend die Worte ihrer Mutter auch sind oder was für tiefe unsichtbare Wunden sie auch hinterlassen. Wozu sollte eine Entgegnung gut sein? Das Ergebnis wäre nur eine Schimpftirade und das Krachen zugeschlagener Türen. Ihr Vater hat ihr gezeigt, wie es geht. Bring nicht das Boot zum Kippen, in dem du sitzt. Stich nicht ins Wespennest. Wecke keine schlafenden Hunde. Du kleiner Frechdachs! So viele Jahre lang hat Pauline zugelassen, dass ihr Hass lautlos in seinem galligen Saft köchelt. Was auch immer sie hört oder empfindet, es ist ihr zur zweiten Natur geworden, ihrer Mutter eine ungerührte Fassade zu zeigen.
»Lieber heiße Schokolade oder lieber Tee?«, fragt sie fröhlich.
Da sie keine vernehmbare Antwort erhält, stapft sie die Treppe hinunter. Als sie sich der Küche nähert, fällt ihr die Uhr im Flur ins Auge. »Mum«, ruft sie erneut. »Es ist fast schon Zeit.«
»Dann mach mal dalli mit meiner heißen Schokolade, kapiert?«
Pauline nimmt das gefüllte Einkaufsnetz, das Muriel achtlos auf die Küchentheke geworfen hat, und verstaut den Inhalt ordentlich in der Speisekammer. Sie braucht ein paar Versuche, um den Brenner des rauchenden alten Gasherds in Gang zu setzen. Als das Gas sich endlich entzündet, schießt die Flamme mit einer solchen Wucht hoch, dass sie zurücktritt, damit sie ihr nicht die Augenbrauen versengt. Sie erhitzt einen Topf Milch und macht erst das Getränk ihrer Mutter fertig, bevor sie sich selbst eine Tasse Tee zubereitet. Hastig legt sie Plätzchen, die sie aus einer Dose auf der Anrichte nimmt, auf einen Teller und schafft es gerade noch rechtzeitig ins Wohnzimmer. Dort findet sie ihre Mutter in ihrem Lieblingssessel vor, eine Decke über die Knie gebreitet und den Blick auf den Fernseher geheftet.
Pauline stellt ihr beladenes Tablett auf einen Beistelltisch – »du stehst mir im Bild mit deinem fetten Arsch …« – und setzt sich neben der alten Dame in einen Sessel. »Du hast diese Woche sehr schön gebacken, Mum«, sagt sie und nimmt sich zwei feste, feuchte Makronen. »Ich kann ihnen niemals widerstehen.«
»Das weiß ich«, blafft ihre Mutter sie an und wirft ihr einen besonders gemeinen Blick zu. Gleichzeitig stellt sie den Fernseher lauter, gerade rechtzeitig für die Titelmelodie ihrer Lieblingssendung: The Galloping Guzzler.
Pauline hat keinerlei Interesse an dieser Show, doch sie wird sich alles ansehen, solange es ihr nur die alte Schrulle eine Weile vom Hals hält. Die aktuelle Folge orientiert sich am üblichen Schema. Der Moderator im Samtanzug, ein unglaublich braun gebrannter Mann namens Julian LeCheval, lädt zwei ahnungslose Wettkämpferinnen, die er aus seinem gänzlich weiblichen Studiopublikum ausgewählt hat, in seine Studioküche ein. Beide Frauen, ganz außer sich vor Aufregung, halten einen Korb mit Zutaten an sich gepresst, während ihre Schürzenbändel von einem Studioassistenten gebunden werden. Dann fordert Küchenchef LeCheval sie auf, ein Originalgericht, »eines Königs würdig«, zuzubereiten, und zwar innerhalb von nur dreißig Minuten. Nach einer hektischen und emotionsgeladenen halben Stunde des Hackens und Flambierens wird der Erfolg oder Misserfolg der kulinarischen Bemühungen beurteilt. Allerdings nicht durch einen Angehörigen des Königshauses, sondern von einem Promi. Jemand aus der Welt des Showbusiness schnüffelt und fingert an den liebevoll zubereiteten Gerichten herum, während die verschwitzten, von dem Star beeindruckten Wettkämpferinnen das Urteil nervös erwarten. Der heutige Preis, ein topmoderner Servierwagen, macht sie richtig gierig.
Gähnend mustert Pauline ihre Mutter. Vorgebeugt und keinen Meter vom Fernseher entfernt, ist sie auf den Bildschirm fixiert. Mit leuchtenden Augen nickt und applaudiert die alte Schachtel zusammen mit dem Studiopublikum. Sie leckt sich die Lippen, als die Gerichte gekostet, bewertet und bewundert werden. Pauline hat keinen Zweifel, dass sie sich vorstellt, auf dem Set zu stehen, endlich wieder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
»Kommen Sie herunter, Wettkämpferin Nummer 2, Dolores!« [langer Applaus] »Willkommen in der Show.«
»Danke, Julian. Ich freue mich riesig, hier zu sein.«
»Dann sagen Sie uns doch einmal, liebe Dolores, wie lange interessieren Sie sich schon fürs Kochen und Backen?«
»Gleich von Beginn meiner Ehe an, Julian.«
»Und was bringen Sie am liebsten auf den Tisch?«
»Kuchen.«
»Also, Ihr Mann ist ein Glückspilz, Dolores. Jetzt wird es Zeit, den Zuschauern zu Hause zu verraten: Was bereiten Sie heute Abend für uns zu?«
»Heute Abend mache ich mein Glanzstück: Kokosnuss-Surprise.«
»Ich kann es kaum erwarten. Applaus für unsere reizende Wettkämpferin. Ladys, Ofenhandschuhe an und Kochlöffel raus! Alle zusammen, auf mein Kommando. Es ist Zeit für den GUZZLER!«
Wenn Pauline ihre Mutter jetzt ansieht, kann sie sich kaum vorstellen, wie sie in ihrer besten Zeit ausgesehen haben mag. Keiner stellt sie sich jemals anders vor als alt. Und reizend. Pauline seufzt. Sie weiß, ihre Nachbarn haben nicht die leiseste Ahnung, dass Muriels Äußeres einfach nur eine attraktive Patina ist. Nicht durch ein langes Leben der Freundlichkeit hat sie sie erworben, sondern durch eine glückliche Weichzeichnung, mit der der Alterungsprozess wesentlich schärfere Gesichtszüge korrigiert hat. Sanft gerundete Wangen, so rosig und schwabbelig wie Marshmallows, verbergen eine scharfe, aggressive Kieferpartie. Fein eingegrabene Runzeln haben ihren einst gemeinen Mund zu einem breiten Fleck verschwimmen lassen, dessen Erscheinungsbild jetzt als ein warmherziges Lächeln durchgeht. In ihrer Jugend glühte ihr zynischer Blick unter sinnlichen Lidern. Heutzutage trägt sie, wann immer sie aus dem Haus geht, eine freizügig aufgetragene Schicht kornblumenblauen Lidschatten, die ihrem Gesicht etwas clownesk Leutseliges verleiht. Gemeinsam schaffen diese Veränderungen eine überzeugende Fassade.
Wenn die Leute einmal einen Moment lang innehalten, von ihrem eigenen Leben aufschauen und mehr als einen kurzen Blick auf ihre Mutter werfen würden, könnten sie vielleicht etwas anderes sehen. Vielleicht würden sie das gehässige Glitzern in ihren vogelartigen Augen wahrnehmen, die hin und her schießen und die Umgebung nach allem und jedem absuchen. Gott weiß, dass sie sich keinen Vorteil entgehen lässt. Wenn jemand zuhören würde, würde er vielleicht die bittere Tirade erlauschen, die zwischen den stets murmelnden Lippen hervorquillt. Ein geflüsterter, bösartiger Kommentar. Aber die Nachbarn lassen sich so gern täuschen. In ihren Augen versteht es sich von selbst, dass gebrechliche alte Damen, die hausbacken wirken und merkwürdiges Make-up tragen, in Gedanken und Taten vollkommen harmlos sein müssen. Und so schaut keiner je richtig hin und keiner hört auf das, was sie sagt. Das heißt: keiner außer Pauline.
»Du hässlicher, überflüssiger Kloß.«
Ein Blick auf ihre Armbanduhr ruft Pauline in Erinnerung, dass Reverend O’Reillys Frau ihre Mutter um fünf zur Chorprobe abholt. Gott sei Dank. Sobald sie im Haus allein ist, kann sie einen anderen Sender wählen. Dann kann sie ganz allein ihre eigene Lieblingssendung schauen.
Detectivesat Work setzt dramatische Rekonstruktionen wahrer kriminalistischer Ermittlungen ins Bild. Die Namen der Opfer wurden zwar geändert, »um die Unschuldigen zu schützen«, doch die mit den Ermittlungen betrauten Polizisten spielen sich selbst. Die meisten Folgen handeln von Mord, meist in den USA. Ihr gefallen die texanischen Beamten, die alle weiblichen Verdächtigen »Ma’am« nennen – selbst die Prostituierten. Pauline seufzt erwartungsvoll. Ihr gefällt die Vorstellung, Ma’am genannt zu werden.
Während sie am Rand einer dritten Makrone zupft, fragt sie sich, wovon der heutige Fall wohl handeln wird. Wieder ein Amoklauf? Hoffentlich nicht. Solche Verbrechen sind so plump. Die Storys, die sie mag, erzählen von Morden an Angehörigen, die sorgfältig bis ins kleinste Detail geplant wurden und bei denen die Mordwaffe etwas so Normales, zum Alltag Gehörendes ist, dass ihre tödliche Funktion noch nicht einmal erkannt wird. Nicht Tod durch einen langweiligen Kugelhagel, sondern durch eine Falte im Teppich. Was die Identität der Mörder angeht, gefallen Pauline diejenigen Fälle am besten, bei denen das Opfer den Täter kannte, dieser aber so bedeutungslos ist, dass keiner ihn je eines Verbrechens für fähig gehalten hätte. Bei der Erinnerung an ihre liebste Folge aller Zeiten muss sie lächeln. Das Hundefutter-Gemetzel. »Unfassbar, dass er das getan hat«, riefen die erstaunten Mitbürger, als sie erfuhren, dass ein Mitglied ihrer gottesfürchtigen Gemeinde seine Frau erwürgt und dann ihre klein gehackten Überreste an ihren eigenen Chihuahua verfüttert hatte. »Aber er war ein wunderbarer Nachbar, niemals lästig.«
Pauline hat großen Respekt vor derart heimtückischen Mördern. Nicht Menschen, die über jeden Verdacht erhaben sind, sondern so gering geachtete Individuen, dass keiner sie eines Verdachts für würdig hält.
Die Frau des Pfarrers kommt zu spät.
»Die lahme Kuh.«
Wie üblich fegt Deirdre O’Reilly durch die Nummer 17 wie eine Dosis Riechsalz, von einer riesigen Bugwelle der Effizienz hinein- und wieder hinausgetragen. Pauline kommt es so vor, als berührte die Frau in der Eile, eine weitere gute Tat auf ihrer To-do-Liste abzuhaken, kaum jemals die Wände des Flurs. »Oh Ladys, Ladys!«, trötet Deirdre. »Sie werden sich schon gefragt haben, wo ich abgeblieben bin. Ich bin von Mr Smiths schlimmem Fuß aufgehalten worden. Das ist eine lange Geschichte. Und dann hatte Brown Owl ein Problem mit dem Mülleinsammeln auf dem Friedhof. Aber jetzt bin ich endlich hier, um Sie schnell mitzunehmen, Muriel. Na, wo sind Ihre Stöcke? Und Ihr Mantel?« Während sie noch hantiert und kommandiert, wendet sie sich an Pauline. »Ob Sie wohl so gut wären, mir die gebackene Spende Ihrer Mum für das Abendessen im Obdachlosenheim zu holen? Dann kann ich sie mit derselben Fuhre mitnehmen.«
Daran gewöhnt, Anweisungen zu befolgen, tut Pauline schnell, wie ihr geheißen. In der kurzen Zeit, in der sie weg ist, schafft Deirdre es zu ihrer Überraschung, ihre Mutter anzuziehen und zum Aufbruch bereit zu machen. Als Pauline zurückkehrt, stehen beide schon bei der Tür und warten.
»Hier, Deirdre.«
»Sehen Sie nicht wundervoll aus? Sie haben sich selbst übertroffen, Muriel.«
»Ich habe darauf gespuckt.«
»Köstlich! Direkt nach der Chorprobe bringe ich Sie ins Wohnheim. Wir wissen alle, dass es nichts Altbackeneres gibt als altbackene Teilchen. Und denken Sie daran«, ruft Mrs O’Reilly über die Schulter zurück, während sie nach draußen segelt und Muriel am Ellenbogen neben sich her steuert, »der Chor kann immer noch einen Sopran gebrauchen.«
»Pauline? Singen?«
Sobald sie die Haustür hinter ihnen geschlossen hat, geht Pauline ins Wohnzimmer zurück und schaltet ihre Sendung ein. Zu spät. Sie hat den Anfang verpasst. Doch als sie merkt, dass es sich um eine Wiederholung der Folge Die Kalaschnikow-Morde handelt, schaltet sie den Fernseher lieber aus und beschließt, ihre vorübergehende Einsamkeit bestmöglich zu nutzen. Sie spielt mit dem Gedanken, es noch einmal mit dem Abschiedsbrief zu versuchen, entscheidet sich aber dagegen. Stattdessen lehnt sie sich in ihrem Sessel zurück, dem Sessel, der einmal ihrem Vater gehörte, und genießt die Stille. Sie schließt die Augen und gestattet den Erinnerungen an Dad, die nie weit weg sind, in den Vordergrund zu treten.
Sie vermisst ihn auch jetzt so sehr wie nur je. Von Geburt an war sie sein Augenstern. Das sagte er immer. Außerdem weiß sie, dass ihre Mutter sie gleich bei ihrem Eintritt in die Welt als eine lästige Plage betrachtet hat – eine Tatsache, an die die alte Frau sie bis heute ständig erinnert.
Wenn Pauline über die Reihe von Kindermädchen nachdenkt, die sie in ihren ersten Jahren versorgten, erinnert sie sich bei einigen immer noch an die Namen. Es gab eine »Nanny Sarah«, eine »Nanny Susan« und eine »Nanny Hetty«. War da nicht sogar eine »Nanny Nancy«? Sie lacht trocken. Diese Frauen, die schneller kamen und gingen als die Jahreszeiten, hatten sich um ihre alltäglichen Bedürfnisse gekümmert, während ihr Vater sein Bestes gab, sie mit Gefühlen zu versorgen. Er war mit ihr in den Park gegangen, hatte ihr Gutenachtgeschichten vorgelesen und den Weihnachtsbaum geschmückt.
Wenn sie dagegen versucht, sich die Gesichter der Nannys in Erinnerung zu rufen, tritt ihr keines vor Augen. Sie scheinen zu einer einzigen zusammengesetzten Gestalt zu verschmelzen – weiblich, tüchtig und dafür bezahlt, nach ihr zu schauen, während ihre Mutter hinter den Kulissen verschwand. Irgendwann in Paulines Kindheit zog Dolores sich praktisch aus dem Familienleben zurück. Sie verkroch sich in der Küche, deren Tür sie fest verrammelte. In diesem gekachelten Kokon verbrachte sie ihre Tage wie besessen mit Backen, weder von Ehemann noch Tochter gestört, und kam nur selten heraus. So war es, bis Pauline etwas älter und geringfügig weniger »abstoßend« wurde.
Aus einer Zeit, als sie vielleicht sechs war, hat Pauline eine unbestimmte Erinnerung, ihre Mutter beim Mischen und Messen aus voller Kehle singen zu hören; Melodien, die, wie Pauline später erfuhr, Liebeslieder aus ihrer Zeit auf der Bühne waren. »Let me call you sweetheart, I’m in love with you …«
Sie ruft sich ihren Vater vor Augen, wie er sehnsüchtig an der Küchentür lauschte. Der arme Mann. Er tat so, als sänge Mum von ihm. »Let me hear you whisper … that you love me too.«
Doch im Verlauf der Jahre hörte das Singen auf. Stattdessen begann ihre Mutter, mit sich selbst zu reden. Was hatte sie noch immer gesagt? »Warum bist du ohne mich gegangen?« Das war es. »Warum bist du ohne mich gegangen, Vinny?« Mein Gott. Sie hatte immer so wütend geklungen, sogar schon damals. Beim Reden hatte sie mit den Backformen geklappert. »Ich gehöre nicht hierher. Für immer hier gefangen, was für ein Grauen.«
Ihr Vater versuchte nicht mehr, die Worte seiner Frau zu erlauschen. Stattdessen bemühten Pauline und er sich, ihre Ohren davor zu verschließen. Als noch mehr Jahre vergingen, wurde aus dem Reden zum Glück ein Gemurmel und schließlich ein Flüstern. Das machte es den beiden viel leichter, so zu tun, als könnten sie es nicht hören.
»Das Leben muss doch mehr zu bieten haben als diesen Ort und diese Menschen. Ich bin DOLORES!«
Ganz nach dem Vorbild ihres Vaters hatte Pauline sich immer bemüht, es ihrer Mutter recht zu machen. Gemeinsam standen sie ihre Wutanfälle durch, überhörten ihre Beleidigungen und aßen die endlose Flut von Kuchen, die sie ihnen vorsetzte. Er ermutigte Pauline immer, »ein braves Kind zu sein und den Teller leer zu essen«. Und Pauline wusste warum. Ob sie nun hungrig waren oder nicht, sie erkannten beide, dass diese im Heiligtum der Küche erzeugten und selbstständig aufgegangenen Gebäckberge alles waren, was ihre Mutter ihnen als Ersatz für Liebe bieten konnte. Keiner von ihnen ließ einen einzigen Krümel umkommen.
Eine schmerzhafte Traurigkeit erfüllt Paulines Brust, und sie holt angestrengt Luft. Sie hat, weiß Gott, versucht, ein braves Kind zu sein. Und sie versucht es, weiß Gott, noch immer.
Pauline schilt sich und beschwört Gedanken an bessere Zeiten herauf. In der Schule war sie gut. Und im Sekretärinnenkurs hat sie ganz ordentlich abgeschnitten. Nach dem Krieg fand sie mühelos eine Stelle im Büro und arbeitete für Frank. Und da sie nun vier Pfund wöchentlich in ihrer persönlichen Schatulle hatte, war sie so klug, sehr schnell von zu Hause auszuziehen. Sie mietete sich etwas Eigenes.
Erneut schließt sie die Lider und ruft sich ihr bescheidenes Zimmerchen über der Bäckerei in der Hauptstraße vor Augen. Ein Paradies. Die Einzelheiten stehen ihr deutlich vor Augen. Ein einziges Zimmer mit Ausziehbett, und in der Ecke, hinter einem Vorhang verborgen, Herd und Spüle. Das winzige Badezimmer mit dem Duschaufsatz aus rosafarbenem Gummi für die Wasserhähne. Eine Fensterbank, die gerade so breit war, dass ein Topf mit Geranien darauf passte. Zwar war sie nur ein paar Hundert Meter von der Atbara Avenue weggezogen, doch sie war dem monolithischen Schatten ihrer Mutter entronnen und in eine wie von Chrom blitzende Welt getreten. Sie war frei.
Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht, als sie an das wundervolle Vergnügen denkt, das ihr der eigene Haushalt bereitete. Sie bleichte ihre Gardinen, bis sie so weiß waren wie der reinste Schnee. Das Beste aber war, dass sie in dieser Wohnung Frank empfangen konnte. Er kam gern vorbei. Sie lud ihn zum Essen ein. Manchmal brachte er eine Flasche Liebfrauenmilch mit, weiß und süß, und dann saßen sie zusammen auf ihrem Bettsofa, hielten sich an den Händen und tranken ihn. Dabei hörten sie Bing Crosby. Ihr Lächeln wird breiter, als sie in Gedanken durch die Jahre dorthin zurückfliegt.
»Darf ich dich küssen, Pauline?«
»Oh ja, Frank, das darfst du.«
Sie hatte Frank geliebt, und sie glaubte, dass er ihre Liebe erwiderte. Warum denn auch nicht? In jener Zeit war sie durchaus attraktiv. Vielleicht nicht schön – nicht wie Dolores –, aber sie machte das Beste aus sich. Damals. Sie war eher stämmig gewesen, hatte keine schmale Taille, aber sie hatte gewusst, was sie anziehen musste, um das Maximum aus ihrer Figur herauszuholen. Die Mode jener Zeit hatte ihr gestanden. Das glaubt sie wirklich.
Sie berührt ihre angegrauten Schläfen und denkt an den Aufwand, den sie damals mit ihrem braunen Haar getrieben hat. Jeden Monat hat sie es beim Friseur waschen und legen lassen. Jetzt kann sie sich gar nicht mehr vorstellen, in so einen Laden hereinzuschauen.
Frank und sie gingen gern ins Kino und picknickten im Park. Manchmal holte er sie am Wochenende zu einem Tagesausflug ab … in seinem sportlichen silberfarbenen Wagen.
»Ein Renault«, haucht Pauline. Der Name klingt so charmant. Er hatte ein Armaturenbrett aus Walnussholzimitat und einen eingebauten Zigarettenanzünder. Bei der Erinnerung an den Duft der blauen Kunstledersitzbezüge, der sich mit Franks Eau de Cologne vermischte, einem Geburtstagsgeschenk von ihr, atmet sie tief ein. Wenn das Wetter schön war, fuhren sie vielleicht sogar zur Küste hinaus und hielten auf dem Rückweg in einem Dorf zum Tee. In seinem Anzug, Zivilausstattung der nach Kriegsende aus dem Dienst ausgeschiedenen Soldaten, sah er so schick aus. Die Krawatte verlieh ihm Ähnlichkeit mit Clark Gable. Sie beschloss, »Ja« zu sagen, sollte Frank ihr einen Antrag machen.
Ihr Lächeln verblasst. Es erscheint ihr unmöglich, dass sie jemals so glücklich gewesen ist. Und unfassbar grausam, dass eine so glückliche Zeit von so kurzer Dauer gewesen sein soll. Wie viel Zeit verging nach Paulines Auszug, bis Dads Gesundheit den Bach runterging? Weniger als ein halbes Jahr. Zwei Herzanfälle, einer nach dem anderen. Er war gezwungen, seine Stelle in der Bank aufzugeben. Natürlich hatte ihre Mutter keinerlei Neigung, ihn zu pflegen.
»Diese verdammte miese, jämmerliche Nervensäge. Mir immer im Weg.«
Also kam Pauline nach Hause. Nur vorläufig. Nicht dauerhaft. Nur bis es ihm besser ginge. Aber ihrem armen, am Boden zerstörten Vater ging es niemals mehr besser. Sein Verfall schritt rasch voran und endete mit dem Tod. Ihr letztes Gespräch gehört zu Paulines schmerzlichsten Erinnerungen. Es war sein Todestag, auch wenn sie das damals noch nicht wusste. Er saß im Bett, von Kissen gestützt, und plötzlich ergriff er ihre Hand, packte sie so unvermittelt, dass es wehtat.
»Au, Dad! Nicht so fest. Mir laufen ja die Finger blau an.«
»Versprichst du mir etwas, Prinzesschen?«
»Natürlich, Dad. Alles, was du willst.«
»Lass sie nicht allein, hörst du? Versprich mir, dass du bei Mum bleibst, wenn ich einmal tot bin.«
»Aber du stirbst doch nicht, Dad.«
»Du warst immer so ein liebes Kind, Pauline. Wer sonst soll sich um sie kümmern? Versprich es mir einfach. Versprich es deinem alten Dad.«
Sie sah in sein Gesicht. In seine flehenden Augen. »Ja, Daddy, ich verspreche es.« Im nächsten Moment hatte ihr vom Tod gezeichneter Vater das Gesicht zur Wand gedreht, geseufzt und war verschieden.
Der Gedanke an diese so leicht dahingesagten fünf Wörter macht, dass Pauline sich innerlich krümmt. Herr im Himmel, wie hätte sie wissen sollen, was kommen würde?
In den ersten Wochen nach dem Tod ihres Vaters, als Pauline noch stark genug war, sich gegenüber ihrer Mutter taub zu stellen, fand sie Möglichkeiten, mit der Situation zurechtzukommen. Sie hatte ihr Zimmerchen über der Bäckerei und zog sich gelegentlich dorthin zurück, und sei es auch nur für ein oder zwei Stunden. Sie goss ihre Geranien. Traf sich mit Frank. Das Leben in Nummer 17 war unangenehm, aber nicht unmöglich. Doch dann zog die Firma, in der sie gearbeitet hatte, auf ein größeres Gelände in einem anderen Bezirk. Sie konnte nicht mitkommen, ohne ihre Mutter im Stich zu lassen. So verlor sie ihre Stelle. Da das ihrem Vater gegebene Versprechen noch in ihren Ohren klang und ihr das Geld für die Miete fehlte, gab sie ihr Zimmer auf. Kurz darauf hörte Frank auf, sich mit ihr zu treffen. Und da setzte die schreckliche Selbstgenügsamkeit ein. Wie Feuchtigkeit stieg sie in ihr auf.
Ihr Selbstvertrauen versickerte, und ihre Selbstzweifel wurden durch das ständige Geflüster im Hintergrund bestätigt. Obgleich sie sich gut darauf verstand, die gemeinen Bemerkungen ihrer Mutter auszublenden, die sotto voce aber ungemildert ausgeteilt wurden, trafen genug bösartige Splitter ihr Ziel, um ihr wenigstens eine Wunde täglich zuzufügen.
»Hoffnungslose Platzverschwendung. Ich weiß, warum du noch immer hier bist. Zu erbärmlich, um auf eigenen Füßen zu stehen, darum nämlich. ›Wann kommst du wieder zu mir?‹ Hahaha. Am Ende wollte er dich nicht. Am Ende wollen sie einen nie.«
Als sie jetzt allein dasitzt, nur in Gesellschaft all dessen, was sie bereut, sehnt Pauline sich nach Erholung von ihrer Mutter. Abgesehen von der Pfarrersfrau bei ihren Blitzbesuchen kommt kaum jemals jemand bei ihnen vorbei. Von Zeit zu Zeit klopft der eine oder andere wohlmeinende Nachbar an. Zwar nimmt die alte Frau manchmal Reginald Pyles’ Angebot an, den Rasen zu mähen, und hat dem jungen Robert Watts aus der weiter entfernten Nachbarschaft erlaubt, die Hecke zu schneiden, aber sie bittet diese Leute niemals ins Haus. Pauline ist zu klug, um eigene Einladungen auszusprechen. Das steht ihr nicht zu. Ihr ist schmerzlich bewusst, dass dies nicht ihr Haus oder ihr Wohnzimmer oder ihr Teegeschirr ist. Alles innerhalb dieser Wände gehört ihrer Mutter.
Muriel hat recht. Pauline hat keine Freunde, die sie einladen könnte. Und auch keine Feinde. Zu ihrem tiefsten Kummer musste sie sich schon vor langer Zeit eingestehen, dass sie nicht genug Raum auf Erden einnimmt, um auch nur eines von beidem zu verdienen. In ihrer geschrumpften Welt lebt sie einfach von Tag zu Tag. Keiner zwingt sie, in Nummer 17 zu bleiben, doch in ihrem Elend ist sie zu keinem Aufbruch fähig. Diese Tatsache ist die deprimierendste von allen. Irgendwie wurden aus Wochen Monate, aus Monaten Jahre, und heute, mehr als zwei Jahrzehnte später, ist sie immer noch da. Ihr bleibt nichts anderes zu tun, als sich Gebäck in den Mund zu stopfen, das sie nicht tröstet – eine endlose Folge von Felsenkeksen und Melting Moments, die sich auf ihre dicken, altjüngferlichen Hüften setzen, ein Ballast, der sie dauerhaft im Haus ihrer Mutter festgesetzt hat.
Die schmerzhafte Traurigkeit kehrt in ihre Brust zurück, bedrängt sie schlimmer denn je und droht ihr tatsächlich das Herz zu brechen.
Die Pfarrersfrau zieht die Wohnzimmervorhänge mit einem so energischen Ruck zu, dass ihr Mann zusammenfährt. Sie wirkt bekümmert.
»Bereitet dir irgendetwas Sorgen, mein Herz?«, fragt er und klopft dabei die Asche aus seiner Pfeife in den Papierkorb.
»Ich musste an die arme Pauline Dollimore denken. Also ehrlich, Desmond«, unterbricht sie sich missbilligend und leert den Inhalt des Papierkorbs in die leere Feuerstelle des offenen Kamins. »Eines Tages wirst du noch das Pfarrhaus in Brand stecken.« Sie reicht ihm eine Keramikuntertasse, in die das Bild von Jeanne d’Arc eingeprägt ist und die ihm als Aschenbecher dient.
»Was genau hast du gedacht?« Er nimmt eine großzügige Prise frischen Tabak und stopft seine Pfeife.
»Wie niedergeschlagen sie wirkt. Weißt du, als ich Muriel Dollimore heute Abend heimgebracht habe, saß Pauline ganz allein im dunklen Wohnzimmer. Und ich konnte sehen, dass sie geweint hatte. Es ist so traurig. Sie sieht in letzter Zeit so bemitleidenswert aus.« Sie setzt sich zu ihm aufs Sofa, greift nach ihrem Strickzeug und nimmt eine neue Reihe in Angriff.
»Bemitleidenswert ist ein ziemlich hartes Wort.«
Seine Frau nimmt es nicht zurück. »Ich meine das wirklich buchstäblich. So wie sie derzeit wirkt, bemitleide ich sie. Und außerdem«, fügt sie wissend hinzu, »tut sie mir wegen einiger Dinge leid, die ich über ihre Vergangenheit gehört habe.«
»Du weißt, dass wir uns gegen den Impuls zu tratschen wehren müssen, wie mächtig die Versu…«
Sie unterbricht ihn rasch. »Ich habe nicht getratscht. Sondern mich mit einem anderen besorgten Mitglied unserer Gemeinde ausgetauscht. Und während dieses Austauschs habe ich herausgefunden – ist es zu fassen? –, dass Pauline einmal kurz vor einer Heirat stand. Nun ja, so gut wie. Sagen wir einmal, sie stand kurz vor der Verlobung. Ob es dir nun passt oder nicht.«
»Wer hat dir das erzählt?« Seine Neugier ist geweckt.
»Ich gebe meine Quellen nicht gern preis«, neckt sie ihn, »aber da es dich interessiert: Es war Ursula Peabody.«
»Woher weiß sie es? Hat sie erzählt, was passiert ist?«
»Keine Ahnung, und ich habe auch nicht danach gefragt. Denk dran, wir wollen ja nicht herumschnüffeln!« Sie lächelt. »Es genügt zu wissen, dass etwas schiefgelaufen ist. Daraufhin ist Pauline zur Mutter zurückgekrochen und seitdem immer bei ihr geblieben.«
»Nun, es ist ein Segen, dass Muriel die Möglichkeit hatte, ihr ein Dach über dem Kopf zu bieten«, erklärt er ernsthaft und saugt dabei an seiner frisch entzündeten Pfeife.
»Ja, das stimmt. Ohne ihre alte Mum wäre Pauline verloren.«
»Sollten wir nicht etwas unternehmen, um ihr zu helfen? Du bist so geschickt darin, Leute aus ihrem Panzer herauszulocken.«
»Ich habe versucht, sie dazu zu bringen, bei Gemeindeaktivitäten mitzumachen. Beim Women’s Institute, beim Quilt-Club … Heute Abend habe ich übrigens noch einmal den Chor erwähnt. Aber es interessiert sie einfach nicht.« Deirdre seufzt und beginnt mit erneutem Schwung zu stricken. »Ich werde es definitiv weiter versuchen. Nicht zuletzt, damit sie Muriel nicht ständig im Weg ist. Aber wer weiß? Vielleicht versteht Pauline es, sich auf eine Weise bei Laune zu halten, von der wir gar nichts wissen.«
»Ich hoffe, dass du recht hast, Deirdre. Lass uns beten, dass du recht hast.«
Pauline weiß nicht, wann genau sie den Entschluss gefasst hat, ihre Mutter zu ermorden. Es begann als ein winziges Samenkorn von Idee und versteckte sich in den geheimsten Windungen ihres Gewissens. Zunächst konnte sie sich nicht einmal selbst eingestehen, dass sie einen so schmutzigen kleinen Gedanken hatte. Und so drückte er sich eine Zeit lang einfach nur in ihrem Kopf herum, versteckt in der Menge anderer unfertiger Pläne, die in ihrem Inneren um Aufmerksamkeit rangen: Sie würde aus dem grässlichen Haus ihrer Mutter ausziehen und im Neubaugebiet eine helle, geräumige Wohnung finden. Sie würde nach ihren alten Schulfreundinnen suchen, aber auch nach Frank, und ihm sagen, dass sie ihn noch immer liebe. Sie würde wieder die Kontrolle über ihr Leben übernehmen.
Irgendwann waren alle diese Pläne zu Staub zerfallen. Im Laufe der zurückliegenden Jahre wurden die Wohnungen im Neubaugebiet verkauft und weiterverkauft, alte Freundinnen machten sich zu neuen Ufern auf … und Frank heiratete eine andere Frau. Doch die Mordidee schwärte weiter und legte mit jeder Enttäuschung an Größe und Glanz zu wie eine schwarze Perle. Jetzt ist sie riesig. Sie ist alles.
Noch dämmert der Tag nicht heran, doch Pauline ist hellwach. Im Bett und von Dunkelheit umgeben, geht sie den Plan erneut durch. Er ist zwar einfach, doch im Geist klopft sie ihn mindestens einmal täglich ab und überprüft ihn auf Schwachstellen. Er läuft auf Folgendes hinaus: Sie wird ihre Mutter ins Jenseits befördern und es so aussehen lassen, als wäre es Selbstmord. Schlicht, aber effektiv.
Vor einigen Wochen hat sie mit ihren Vorbereitungen begonnen und am Abschiedsbrief gearbeitet, der bei der Leiche gefunden werden soll. Sie hat es mit verschiedenen Versionen versucht, doch obwohl die Handschrift ihrer Mutter der ihren ähnelt, hat sie beschlossen, den Inhalt knapp zu halten. Je weniger Worte, desto weniger gibt es zu überprüfen. Die abschließende Version, die sie erst gestern Abend fertiggestellt hat, liest sich am Ende recht einfach: »Ich war lange genug eine Last.« Nicht dass Pauline erwartet, jemand könnte den Selbstmord als Todesursache bezweifeln. Es muss ja selbst dem oberflächlichsten Beobachter klar sein, dass die alte Frau für die Tochter, die in den letzten zwanzig quälenden Jahren bei ihr geblieben ist und ihr eigenes Leben zurückgestellt hat, damit ihre Mutter niemals allein ist, nichts als eine Belastung darstellt. Wenn die widerwärtige Hexe auch nur einen Hauch von Anstand hätte, hätte sie sich schon vor Jahren das Leben genommen.
Pauline ist froh, dass der Abschiedsbrief endlich geschrieben ist. Doch nachdem das erledigt ist, muss sie die nächste Phase des Plans angehen. Sie setzt sich im Bett auf und mustert das Zimmer, das sie von Kindheit an bewohnt hat: oben auf dem Kleiderschrank das Puppenhaus, das ihr Vater ihr gebastelt hat, mit Fensterscheiben aus Plexiglas, die ungerührt zu ihr hinunterstarren, ihre alten Schulbücher im Regal, die Ringschatulle aus Perlmutt, die Frank ihr geschenkt hat, für immer leer – auf der lächerlichen, kleinmädchenhaften Frisierkommode setzt sie Staub an. Gerade als der vertraute Schmerz sich in ihrer Brust ausbreiten will, rüttelt das Quietschen eines Milchwagens auf der Straße sie aus ihrer Versunkenheit. Sie hört das ferne Rumpeln des Busses Nummer 7, des ersten des Tages, der auf dem Weg ins Stadtzentrum ist. Sichere Anzeichen, dass der Rest der Welt aufwacht, um sich dem Tag zu stellen.
Auch Pauline rafft ihre Kraft zusammen. Genug getrödelt. Sie weiß, auch wenn es Mut erfordert: Nun ist es Zeit, zum Kern der Sache zu kommen. Der Mordwaffe.
Als Deirdre O’Reilly Pauline Dollimore im Haushaltswarengeschäft entdeckt, stürzt sie sich sofort auf sie. »Pauline, wie schön, Sie zu sehen. Bei uns im Pfarrgarten richten die Schnecken ebenfalls schreckliche Verwüstungen an.« Als sie Paulines Verwirrung bemerkt, fügt sie zur Erklärung hinzu: »Sie halten ein Päckchen Schneckenkorn in der Hand, daher nahm ich an …«
»Oh ja, tut mir leid, Deirdre.« Pauline stellt die Schachtel rasch ins Regal zurück. »Ich war tief in Gedanken. Eigentlich bin ich mit dem Einkaufen fertig. Aber dann bin ich noch einmal umgekehrt, um Schnur zu besorgen … und«, fügt sie leichthin hinzu, »ein wenig Tapetenkleister. Also, Sie sehen schon, nichts Giftiges. Keine Ahnung, wie ich mich so vergreifen konnte.«
»Ach, wissen Sie, Tapetenkleister könnte tatsächlich giftig sein.«
»Wirklich?« Ein Funke von Interesse erhellt kurz Paulines matten Blick.
»Na ja, vielleicht wenn man genug davon isst. Aber wir würden ihn nicht auf unseren Porridge streuen wollen, oder?«, fragt Deirdre kichernd und stupst Pauline an. Sie späht in Paulines Einkaufskorb und begutachtet kurz seinen Inhalt. »Grundgütiger, Sie legen sich aber wirklich Vorräte zu. Anscheinend sind alle Plagen Ägyptens über Nummer 17 hereingebrochen. Ameisengift, Unkrautvernichtungsmittel und Wespenspray. Was kommt wohl als Nächstes? Heuschreckentod? Aber wissen Sie, auf die Packung Drano würde ich verzichten. Es wirkt nur halb so gut wie pures Ätznatron. Das schütte ich in die Abflüsse des Pfarrhauses, und unsere Rohre sind immer wunderbar sauber. Fragen Sie den Verkäufer hier einfach danach.« Sie will ihn herbeiwinken.
Pauline hält sie auf. »Oh nein, bitte, Deirdre. Ich möchte ihm keine Mühe machen. Außerdem bin ich, wie gesagt, für heute mit meinem Einkauf fertig. Wenn es Ihnen also recht ist …«
»Ach, dann nehmen Sie doch eine Schachtel von meinem!«, bietet Deirdre an und wirft ein Päckchen Kristalle in Paulines Korb. »Ich habe mir gerade zwei gekauft.«
»Nein wirklich. Das geht nicht.«
»Ach was. Betrachten Sie es als ein kleines Geschenk von mir.«
Pauline protestiert nicht weiter, tritt aber leicht von einem Bein aufs andere.
Als Deirdre bemerkt, dass Pauline zur Ladentür schaut und ihre Flucht plant, schlägt sie erneut schnell zu. »Jedenfalls freue ich mich riesig, dass ich Ihnen über den Weg gelaufen bin. Ich wollte Sie schon länger fragen, ob Sie nicht Lust haben, zu meinem Nähkreis zu stoßen. Wir treffen uns alle vierzehn Tage im Pfarrhaus. Nur Frauen von hier.«
Pauline zögert, als dächte sie über das Angebot nach.
»Und natürlich müssen Sie Ihre Mutter mitbringen.«
»Nein«, antwortet Pauline energisch. »Aber vielen Dank, dass Sie an mich gedacht haben. Jetzt müssen Sie mich aber leider entschuldigen.«
»Was ist mit dem Tapetenkleister?«
»Ich brauche jetzt doch keinen«, erwidert Pauline, ihr Tonfall plötzlich distanziert und matt.
»Ist mit Ihnen alles in Ordnung?« Deirdre fällt auf, dass Pauline sehr bleich ist und so aussieht, als wäre sie den Tränen nahe. »Ich könnte Sie kurz nach Hause begleiten.«
»Oh nein. Danke. Es geht mir gut«, nuschelt sie und taumelt zum Ausgang. »Mir geht es immer gut.«
»Grüßen Sie Muriel von mir.«
Pauline kehrt nach Hause zurück. Wie immer geht sie dicht an den Vorgartenmauern entlang und nicht in der Mitte des Bürgersteigs. So hält sie es immer, um Kinderwagen, schwanzwedelnden Hunden und den Haufen abgefallener Kirschblüten auszuweichen, die sie auf ihrem altjüngferlichen Weg verspotten.
Die Entscheidung für einen vorgetäuschten Selbstmord war ja gut und schön, doch die Ausführung erweist sich als kniffelig. Obwohl sie schon viel darüber nachgedacht hat, haben bisher alle ihre Ideen inakzeptable Nachteile. Gift kam ihr anfangs wie eine gute Lösung vor. Doch jetzt hat sie es sich noch einmal überlegt. Ihr fällt keine Möglichkeit ein, im Laden etwas zu kaufen, das giftig oder ätzend genug wäre, um ihre Mutter zu töten, ohne dass es zu ihr, Pauline, zurückverfolgt werden könnte. Sie bereut es, den Verkäufer im Baumarkt gefragt zu haben, welcher Vertreter der überraschend großen Auswahl an Rattengiften sich am leichtesten in Milch auflösen lässt. Daraufhin versuchte der Mann, ihr eine Mausefalle zu verkaufen. Und die verdammte Pfarrersfrau! Deirdre hat alle ihre heutigen Erwerbungen gesehen und sie sich zweifellos unauslöschlich eingeprägt, was heißt, dass Pauline keine von ihnen verwenden kann. Was für eine Geldverschwendung!
Sie denkt an das Ätznatron, das Deirdre ihr aufgenötigt hat. Es sieht aus wie Zucker und könnte zweifellos ernsthaften Schaden anrichten, sollte jemand es »versehentlich« schlucken. Aber Pauline hat keine Ahnung, wie sie ein so unglückliches Missgeschick arrangieren sollte. Natürlich könnte sie einen Haufen Kristalle in eine Schale mit der Aufschrift Zucker kippen und mitten auf den Küchentisch stellen, ihrer Mutter vorschlagen, sich eine schöne, süße Tasse Tee zu kochen, und sie dann das Getränk zubereiten lassen. Aber das würde zu nichts führen. Die faule Trine hat schon seit zwanzig Jahren kein heißes Wasser mehr aufgesetzt.
Außerdem, selbst falls es Pauline gelingen sollte, eine angemessen giftige Substanz in die Hände zu bekommen, ohne die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, und ihre Mutter zu bewegen, sie zu schlucken, wie kann sie sich sicher sein, dass sie ihr eine tödliche Dosis verabreicht? Wie viele Löffel Schneckenkorn oder Tapetenkleister oder Rohrreiniger wären für die Aufgabe nötig? Einer? Zwei? Zweiundzwanzig? Mit Schrecken erinnert sie sich an eine Folge von Detectives at Work, in der ein Opfer das mit Frostschutzmittel versetzte Getränk überlebte, weil die Möchtegernmörderin die nötige Menge verfehlte und ihr Mann von dem Zeug nur Bauchkrämpfe bekam. Man stelle sich nur vor, ihr selbst unterliefe ein ähnlicher Fehler. Sie könnte auf frischer Tat ertappt werden, oder, schlimmer noch, sie hätte Mum immer noch am Hals, aber zusätzlich wäre ihre Mutter vielleicht noch blind oder inkontinent, biestiger und gemeiner denn je. Was für ein Albtraum! Dieses Risiko kann sie nicht eingehen.
Pauline weiß, dass sie es nicht schaffen wird, die elektrischen Leitungen so zu manipulieren, dass ein Stromschlag die Arbeit übernehmen könnte. Außerdem, wer begeht denn dadurch »Selbstmord«, indem er den Finger in die Steckdose steckt? Keiner würde recht glauben wollen, dass die alte Frau sich auf diese Weise das Leben genommen hätte. Und zudem möchte Pauline es auch vermeiden, das Haus in Brand zu stecken. Was aber das Ertrinken in der Badewanne oder das Erhängen angeht, gibt es Tausend Gründe, die etwas körperlich so Ehrgeiziges ausschließen.
Sie trifft wieder in der Nummer 17 ein, noch ein bisschen mutloser als bei ihrem Aufbruch.
»Huhuu!«, ruft sie beim Aufschließen der Tür. »Da bin ich wieder.«
Als sie keine Antwort erhält, huscht sie in die Küche und räumt ihre nun überflüssigen Einkäufe rasch weg. Das Drano verstaut sie unter der Küchenspüle, Ameisengift, Unkrautvernichtungsmittel und Wespenspray im Schränkchen unter der Treppe. Und Deirdres verdammtes Ätznatron? Sie kippt es in eine alte Blechdose und schiebt diese auf dem obersten Regalbrett der Speisekammer ganz nach hinten. Aus den Augen, aus dem Sinn.
»Bist du da, Mum?«, ruft sie erneut. Als sie immer noch nichts hört, nicht einmal ein Flüstern, hebt sich ihre Stimmung. Zwar hat sie einen Berg von Haushaltspflichten zu erledigen, aber wenigstens hat sie die Räume für sich. Ausnahmsweise einmal kann sie in Frieden arbeiten.
Nicht nur muss sie die grenzenlose Gehässigkeit ihrer Mutter erdulden, sie muss auch noch gegen deren Schlampigkeit ankämpfen. Da Muriel seit jeher daran gewöhnt ist, ständig bedient zu werden, erst von ihrem Mann und dann von ihrer Tochter, tut sie absolut nichts, um das Haus in Ordnung zu halten. Die alte Dame wandert rastlos aus einem Zimmer ins andere und lässt Chaos hinter sich zurück. Die schlimmste Sauerei macht sie immer in der Küche. Als Kind durfte Pauline hier niemals eintreten, doch da ihre Mutter inzwischen älter und fauler geworden ist, duldet sie die Anwesenheit ihrer Tochter in einem Raum, der einmal ausschließlich ihr eigenes Reich war. Aber nur, soweit es unerlässlich ist. Mit ihrem Backen erzeugt sie tägliche Chaosstürme, und Pauline ist diejenige, die die Töpfe und Schüsseln abwäscht und den Boden fegt.
Wenn ihre Mutter nicht backt, kramt sie ständig in Schränken und Schubladen. Sie murmelt und kramt, kramt und murmelt und erinnert Pauline damit an ein nach Essbarem wühlendes Schwein. Ihre liebste Beute besteht aus Fotos von sich selbst, von denen sie zahllose Exemplare besitzt. Sie scheint des Betrachtens alter Werbefotos der blendend schönen Dolores, Königin der Bühne, niemals überdrüssig zu werden. Bei anderen Gelegenheiten sucht sie nach aus Zeitschriften ausgeschnittenen Rezepten. Jede Schublade des Hauses ist mit klebrigen Zetteln vollgestopft. Nichts ist sortiert oder in irgendeine Ordnung gebracht. Kontoauszüge und Rechnungen sind mit dem Abraum der mütterlichen Erinnerungen vermischt. Es macht Pauline wahnsinnig, dass ständig wichtige Unterlagen verschwinden. In Nummer 17 ist jeder Tag ein Kampf, um zumindest einen Anschein von Ordnung zu wahren.
Pauline zieht ihr abgetragenes Hauskleid an, schlüpft in ihre abgenutzten Hausschuhe und bewaffnet sich mit Staubtuch und Bohnerwachs, um die Arbeit zu beginnen. Als sie das Esszimmer betritt, entfährt ihr ein Keuchen. Zu ihrer Bestürzung befindet ihre Mutter sich bereits in dem Raum und blättert eifrig in einem alten Theaterprogramm, einem von vielen Dutzenden, die vor ihr auf dem Esstisch ausgebreitet liegen. Um ihren Hals liegt eine mottenzerfressene Federboa, und sie hat sich mit einer Vielzahl von Schmuckstücken behängt – manche sind echt, andere falsch, doch alle sind Geschenke, die Dolores’ Bewunderer ihr am Hintereingang des Theaters gemacht haben. Nach den vielen roten Federn zu schließen, die ihre Mutter in den Teppich getreten hat, muss sie sich schon eine ganze Weile im Esszimmer aufhalten.
»Mum! Was hast du mich erschreckt! Ich hatte keine Ahnung, dass du hier drinnen bist.«
Ihre Mutter sieht sie nicht direkt an, wirft ihr aber einen gemeinen Seitenblick zu.
»Vielleicht gehe ich hier ja mal schnell mit dem Staubsauger durch«, fährt Pauline fort, nun schon wieder fest entschlossen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. »Bringe alles ein bisschen in Ordnung.«
»Wozu denn? Falls jemand dich besuchen kommt? Haha.«
»Vielleicht fange ich einfach in der Küche an, um dich nicht zu stören.«
»Aufräumen? Putzen? Die Kohle für den Ofen holen? Mit dieser Aschenputtel-Show legst du mich nicht herein. Aschenputtel war nämlich schön.«
»Übrigens lässt die Pfarrersfrau dich grüßen.«
In den folgenden Wochen macht Deirdre O’Reilly Pauline zahlreiche Angebote. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit, häufig scheinbar zufällig in den Gängen des Haushaltswarengeschäfts, spricht sie eine Einladung für diese oder jene Aktivität aus. Sie bietet ihr an, sie und natürlich auch ihre Mutter zu Bridge, Blumenstecken oder sogar Messingpolieren mitzunehmen. Doch alle Vorschläge solcher geselligen Aktivitäten werden höflich abgelehnt.
»Ganz ehrlich, Desmond«, seufzt Deirdre, »Pauline Dollimore ist zurzeit ein absolutes Wrack.So elend, dass sie krank aussieht. Manchmal frage ich mich, wie Muriel das aushält.«
Es ist Mai. Der Frühling tänzelt dem Sommer entgegen. Die Tage werden länger, und nach der Schule spielen die Kinder der Atbara Avenue auf der Straße. In den nachmittäglichen Sonnenschein entlassen, rasselt ein lärmendes Jungstrio in seinen selbst gebastelten Seifenkisten auf dem Bürgersteig hin und her. Dabei fliegen Kappen, Jacken, Schulranzen und Splitter von Orangenkisten auf den Weg. Eine Schar kleiner Mädchen hat unmittelbar vor Nummer 17 ein Hüpfspiel auf den Boden gezeichnet. Hops, hops, hops, beide Beine, hops! Pauline, die im dunklen Wohnzimmer ihrer Mutter schmort, hört das Schlagen der Springseile auf dem Pflaster und den nervenden rhythmischen Singsang.
»Johnny gab mir Äpfel,
Johnny gab mir Obst,
Johnny gab mir Pennys,
›Oh küss mich auf der Treppe‹.
Zurück gab ich ihm Äpfel,
Zurück gab ich ihm Obst,
Zurück gab ich ihm Pennys
Und stieß ihn von der Treppe.«
Sie seufzt vor sich hin. Dann schaut sie zu der alten Dame, die in ihrem Sessel schläft, ein gerahmtes Foto von Dolores auf der Brust. Sie von der Treppe stoßen? Wäre es nur möglich!
Pauline hat über ihre Optionen nachgegrübelt, aber nach viel hin und her überlegen, ist sie kein bisschen weiter. Sie ist entschlossen, den Mord zu begehen, doch ohne eine feste Vorstellung von einem Modus Operandi steckt sie fest. Wenn sie bei Detectives at Work irgendetwas gelernt hat, dann dass das Fundament eines Mordes, der erfolgreich als Selbstmord durchgeht, »ein todsicher geplanter Tathergang ist, Leute«.
Diese Unfähigkeit, sich für eine Strategie zu entscheiden – die Sache durchzuziehen und abzuhaken –, hat viel zu ihrer erbärmlichen Verfassung beigetragen. Sie kann kaum noch schlafen, isst mehr Kuchen denn je und fürchtet, dass der Mordplan vielleicht niemals Erfolg haben wird. Vielleicht ist sie wirklich nichts anderes als eine »hoffnungslose Versagerin«. Mit den Nerven am Ende hat Pauline sich in ihrem ganzen elenden Leben noch nie so jämmerlich gefühlt.
Zu ihrer großen Beunruhigung hat es in letzter Zeit Gelegenheiten gegeben, bei denen ihre Unruhe so offensichtlich war, dass sie ungewollte Aufmerksamkeit erregt hat. Bei ihrer letzten Begegnung mit Deirdre O’Reilly hat die verdammte Wichtigtuerin sie praktisch angefleht, ärztliche Hilfe zu suchen.
»Pauline«, säuselte sie mit einer von Mitleid durchweichten Stimme, »Sie sollten wirklich jemanden konsultieren.«
»Danke für Ihre Sorge, Deirdre, aber ich kann Ihnen versichern …«
»Die Sache ist die, meine Liebe, was immer Ihnen Sorgen bereitet …« Sie hob die Hand, damit Pauline sie nicht unterbrechen konnte. »Was immer Ihnen Sorgen bereitet – und sagen Sie mir nicht, dass da nichts ist, denn ich sehe es ja –, macht Sie krank.«
Diese Bemerkungen haben Pauline damals beunruhigt, und sie beunruhigen sie immer noch. Wenn die Leute sehen, dass sie wirr und abgelenkt ist, dass sie dunkle Gedanken wälzt, vielleicht kommen sie dann sogar dahinter, was das für dunkle Gedanken sind. Vielleicht muss sie Schritte ergreifen, um munterer aufzutreten, sonst riskiert sie noch, Verdacht zu erregen.
»Gehen Sie zu einem Arzt, Pauline«, war Deirdre fortgefahren. »Bitten Sie ihn, etwas zu tun, damit Sie sich besser fühlen. Wenn nicht um Ihrer selbst, dann um Muriels willen.«
Die Erinnerung an diese letzte Bemerkung bringt Pauline zu einem kurzen, verzagten Lächeln. Darauf bedacht, ihre Mutter nicht zu wecken, steht sie auf, schlüpft leise in den Flur und greift nach dem Telefon.
Als Deirdre O’Reilly Pauline das nächste Mal zufällig begegnet, ist sie begeistert von der Neuigkeit. Sie kann es kaum abwarten, sie ihrem Mann zu erzählen. Sie findet ihn im Friedhofsgarten der Kirche, wo er auf den Knien liegt und Unkraut zupft.
»Desmond!«, sprudelt es aus ihr hervor. »Du wirst niemals erraten, was Pauline Dollimore getan hat.«
»Sie hat die Gehstöcke ihrer Mutter gestohlen und ist im Woolworth Amok gelaufen?«, neckt der Pfarrer sie.
»Wie albern von dir!«, schnauft sie. »Pauline ist wohl der ängstlichste Mensch, den ich kenne. Nein«, fährt sie triumphierend fort, »sie hat meinen Rat angenommen und sich hier in der Arztpraxis einen Termin geben lassen.«
»Ach wirklich? Gut gemacht.« Lächelnd richtet er sich auf und klopft ihr auf die Schulter. »Ich verstehe, wieso dich das freut.«
»Danke. Es tut gut zu wissen, dass man einer Freundin in Not wirklich weitergeholfen hat, selbst wenn es nur mit einer Kleinigkeit war.«
Als sich der Tag von Paulines Termin nähert, erwartet sie, auf ihre übliche Ärztin zu treffen, eine schroffe Frau, die Patientengespräche kurz hält und mit Mitgefühl sparsam umgeht. Pauline hat sich bereits seelisch auf eine lange Wartezeit vorbereitet, der eine kurze, aber gründliche Untersuchung folgen und mit dem Rat enden wird, sich zusammenzureißen. Danach wird sie sich genauso elend wie zuvor nach Hause schleppen. Tatsächlich fürchtet sie, dass ihr die ganze Übung nichts anderes einbringen wird als eine Unterbrechung ihrer zermürbend monotonen Routine. Doch an diesem strahlend schönen Morgen, von dem sie sich so wenig versprochen hatte, erfährt sie, dass Dr. Gwendoline Berry-Bowness weggerufen wurde. Zu ihrer Überraschung wird Pauline stattdessen von einem Vertretungsarzt empfangen.
Der junge Mann hat jüngst sein Medizinstudium abgeschlossen, praktiziert dementsprechend erst seit Kurzem und ist ein wundervoll mitfühlender Mensch, wie Pauline feststellt. Er erkundigt sich eingehend nach ihrem Leben zu Hause, und Pauline verhält sich vollkommen untypisch und platzt mit der ganzen Geschichte heraus. Den Teil über die Mordpläne lässt sie – natürlich – aus, aber sie erzählt ihm, wie lange sie schon bei ihrer Mutter lebt, von der Art, wie ihre Mutter mit sich selbst spricht, und von ihrem eigenen Gefühl, in der Falle zu sitzen. Der gut aussehende junge Arzt ist ein großartiger Zuhörer. Pauline fällt auf, dass er während der ganzen Zeit, in der sie spricht, kein einziges Mal auf die Uhr schaut. Als sie zu weinen beginnt, drückt sein Gesicht echtes Mitgefühl aus.
»Danke, dass Sie so freimütig über Ihre Situation zu Hause berichtet haben, Miss Dollimore«, sagt er, als sie fertig ist. »Ich verstehe, dass es nicht leicht für Sie war, über all diese Dinge zu reden.«