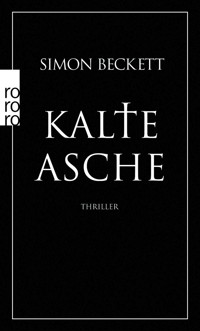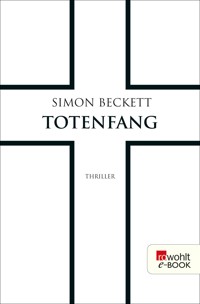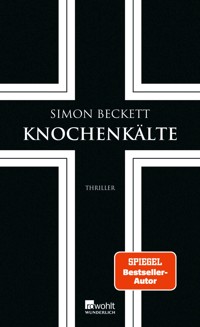
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: David Hunter
- Sprache: Deutsch
Ein unheimliches Hotel und ein Wald voller Knochen. Der packende siebte Teil der David-Hunter-Reihe von Bestsellerautor Simon Beckett. Das Skelett hängt in den Wurzeln einer mächtigen Fichte, die das Unwetter zu Fall gebracht hat. Das Wurzelwerk scheint über die Jahre in den verwesenden Körper hineingewachsen zu sein und hält ihn fest umklammert wie in einer Umarmung. Dr. David Hunter ist während eines Wintersturms in einer kleinen Ortschaft in den Cumbrian Mountains gestrandet. Er ist hier unerwünscht, daran lassen die Bewohner von Edendale keinen Zweifel. Beim Versuch, den grausigen Fund bei der Polizei zu melden, stellt der forensische Anthropologe fest, dass der Sturm das Dorf von der Außenwelt abgeschnitten hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Simon Beckett
Knochenkälte
Thriller
Über dieses Buch
Ein Wald voller Knochen
Das Skelett hängt in den Wurzeln einer mächtigen Fichte, die das Unwetter zu Fall gebracht hat. Das Wurzelwerk scheint über die Jahre in den verwesenden Körper hineingewachsen zu sein und hält ihn fest umklammert wie in einer Umarmung.
Dr. David Hunter ist während eines Wintersturms in einer kleinen Ortschaft in den Cumbrian Mountains gestrandet. Er ist hier unerwünscht, daran lassen die Bewohner von Edendale keinen Zweifel. Beim Versuch, den grausigen Fund bei der Polizei zu melden, stellt der forensische Anthropologe fest, dass der Sturm das Dorf von der Außenwelt abgeschnitten hat …
David Hunters siebter Fall
Vita
Simon Beckett ist einer der erfolgreichsten englischen Thrillerautoren. Seine Serie um den forensischen Anthropologen David Hunter wird rund um den Globus gelesen und wurde für Paramount+ als sechsteilige Serie verfilmt: «Die Chemie des Todes», «Kalte Asche», «Leichenblässe», «Verwesung», «Totenfang» und «Die ewigen Toten» waren allesamt Bestseller, ebenso sein atmosphärischer Psychothriller «Der Hof». «Die Verlorenen», der Auftakt einer neuen Thrillerserie um den ehemaligen Polizisten Jonah Colley, stand mehrere Wochen auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste. Simon Beckett ist verheiratet und lebt in Sheffield.
Sabine Längsfeld übersetzt bereits in zweiter Generation Literatur verschiedenster Genres aus dem Englischen in ihre Muttersprache. Neben Simon Beckett zählen zu den von ihr übertragenen Autor:innen Chan Ho-kei, Hannah Richell, Viktoria Lloyd-Barlow, Sara Gruen, Glennon Doyle, Malala Yousafzai, Roddy Doyle und viele andere.
Karen Witthuhn übersetzt nach einem ersten Leben im Theater seit 2000 Theatertexte und Romane, u.a. von Simon Beckett, D.B. John, Ken Bruen, Sam Hawken, Percival Everett, Anita Nair, Alan Carter und George Pelecanos. 2015 und 2018 erhielt sie Arbeitsstipendien des Deutschen Übersetzerfonds.
Impressum
Die englische Originalausgabe erscheint 2026 unter dem Titel «The Bone Garden» bei Orion Publishing Group, UK.
Die Übersetzerinnen danken Hans Christian Küchelmann für die fachliche Beratung bei forensischen Fragen. www.knochenarbeit.de
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«The Bone Garden» Copyright © 2026 by Hunter Publications Ltd.
Redaktion Christin Ullmann
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung ohne
ISBN 978-3-644-00497-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Hilary
Prolog
Knochen überlebt.
Wie Ziegel und Mörtel eines alten Hauses überdauern die Knochen das Leben, das einst in ihnen war. Sie sind auch dann noch erhalten, wenn der Rest des Körpers – Haut, Fleisch, Organe, Knorpel und Sehnen – das Zeitliche gesegnet hat. Das, was dem Gewebe als Gerüst dient, kann es um Hunderte von Jahren überdauern. Unter bestimmten Bedingungen auch länger. Saurer Boden beispielsweise erhält eher Weichgewebe und löst Knochen schneller auf, während alkalischer Boden das Gegenteil bewirkt und die Zersetzung des Knochens nahezu unendlich in die Länge zieht.
Aber nichts besteht für immer. Irgendwann zerfällt auch Knochen in die leblosen Mineralstoffe, aus denen er geformt wird. Staub wird unausweichlich zu Staub. Bis dahin bleibt das Skelett, sich selbst überlassen, zurück, der fossilisierte Überrest eines längst vergangenen Lebens.
Knochen überlebt.
Er spürte den Zweig unter seinem Stiefel nachgeben und erstarrte. Vorsichtig verlagerte er das Gewicht auf den anderen Fuß. Zu dieser Jahreszeit wimmelte es im Wald von natürlichen Fallen, die Bäume waren kahl, nachdem eisige Winde und Regenschauer über sie hinweggezogen waren. Der Winter war ungewöhnlich nass gewesen, der Boden unter dem Teppich aus Fichtennadeln matschig, die darauf liegenden Zweige und Äste feucht und elastisch.
Der Zweig knarzte leise, als er den Fuß hob, aber brach nicht.
Das war knapp. Er fluchte innerlich und betrachtete den Boden. Die Nachtsichtbrille verwandelte den dunklen Wald in eine fremdartige, grünliche Landschaft. Mit angehaltenem Atem suchte er die aufrechten Stämme ab. Der Regen hatte aufgehört, aber die eiskalten Tropfen hingen noch in den Ästen und prasselten auf seine Kapuze und Jacke. Bitte lass sie nichts gehört haben. Lass sie noch da sein.
Das war sie.
Halb hinter einem Fichtenstamm verborgen stand seine Beute nichts ahnend und entspannt am Ufer des Bachs. Er atmete lautlos aus. Die Luft war kalt und roch würzig nach Fichten und Lehm. Er wagte den nächsten Schritt und setzte den Fuß so sanft ab, als würde er auf Eis treten. Noch wenige Meter, dann war er in Schussweite. Vorsicht jetzt. Vorsicht.
In der dunklen Jacke und Regenhose war er nahezu unsichtbar. Selbst bei Tageslicht wäre er kaum zu sehen gewesen, in einer mondlosen Nacht wie dieser war er nur ein Schatten.
Wenn er sich nicht verriet.
Fast war er in Schussweite. Langsam und gleichmäßig atmend schlich er weiter und setzte jeden Schritt mit Sorgfalt. Der Boden war uneben, unter dem Teppich aus Fichtennadeln lagen Steine und knorrige Wurzeln. Ein falscher Tritt konnte alles zunichtemachen, konnte dazu führen, dass er hier mit gebrochenem Knöchel lag, auf sich allein gestellt.
Noch einige Zeitlupenschritte mehr, dann blieb er regungslos stehen. Der kalte Wind kniff ihm ins Gesicht, er ignorierte die eisigen Tropfen und ließ die schlanke Gestalt zwischen den Bäumen nicht aus den Augen. Sie war etwa fünfundzwanzig Meter entfernt, hinter einem schief liegenden Fichtenstamm gerade sichtbar. Kein leichter Schuss, aber näher wagte er sich nicht heran.
Jetzt lag es an ihm.
Langsam setzte er den Pfeil ein und hob den Jagdbogen. Er spürte sein Herz pochen, als er den Arm zurückzog und alles ausblendete, bis es nur noch seine Beute gab und die Spannung in seinem Bogen. Er liebte diesen Moment voller Möglichkeiten. Jetzt ganz ruhig.
Sie hob den Kopf. Sah ihn direkt an.
Er ließ los.
Mit einem eher gefühlten als hörbaren Schnarren verließ der Pfeil die Sehne. Ein Schrei durchbrach die Stille, gefolgt vom krachenden Geräusch eines fallenden Körpers. Er rannte los, dem Pfeil hinterher. Dass er ins Schwarze getroffen hatte, wusste er schon, bevor er sie sah. Die Ricke lag seitlich im Bachlauf, die braunen Augen schmerzvoll und verwirrt aufgerissen, der rasselnde Atem hing als Nebel in der kalten Luft. Der Pfeil steckte tief in ihrer Brust und zitterte leicht. Neben der schiefen Fichte kletterte er zum Ufer herab, sein Triumphgefühl verflog bereits, wie jedes Mal. Er zog sein Messer – scharf und gezackt – und brachte es zu Ende. Die Ricke holte noch einmal keuchend Luft, dann lag sie still da.
Leben und Schönheit waren vergangen. Nur noch Fleisch, aus dem die Wärme wich.
Als er das Messer im schnell dahinfließenden Wasser abspülte, verfärbte die Nachtsichtbrille das rote Blut in leuchtendes Grün. Das Ufer unter der schiefen Fichte hinter ihm war ausgewaschen, die Baumwurzeln lagen frei. Sie waren dick und sehnig, wie ein Schlangennest. Oder alte Knochen.
Der Gedanke machte ihn nervös. Nach der Jagd fühlte er sich immer leer. Angewidert richtete er sich auf und wollte die Brille hochschieben, um sich die müden Augen zu reiben. Doch da fiel ein Mondstrahl durch eine Wolkenlücke und ließ die nackten Wurzeln der Fichte deutlicher hervortreten.
Aus dem Spiel der Schatten starrte ihn ein Gesicht an.
«Scheiße!»
Er wich zurück, stolperte über den Kadaver der Ricke und fiel in den eiskalten Bach. Das Wasser strömte über ihn hinweg, er kam taumelnd auf die Beine und blickte panisch zu den Baumwurzeln hinüber.
Das Gesicht war weg. Lediglich ein Gewirr von nackten Wurzeln war zu erkennen. Er war bis auf die Haut durchnässt und durchgefroren und zweifelte schon daran, dass er überhaupt etwas gesehen hatte.
Dann, als würde ein unscharfes Bild Konturen annehmen, erschien wieder das Gesicht.
«Gott im Himmel …»
Er drehte sich hektisch um, zog den dampfenden Tierkadaver aus dem Bach, holte einen Tragegurt aus seiner Tasche und wickelte ihn um die Ricke. Mit Mühe hob er sie auf seine Schultern und machte sich stolpernd auf den Weg.
Er musste hier weg, sofort. Trotzdem drehte er sich ein letztes Mal um.
Dann, unter dem Gewicht der Ricke gebeugt, lief er, so schnell er konnte, davon.
Kapitel 1
Das Schaf hatte keine Beine.
Das war mein erster Gedanke, was allerdings auch am Schlafmangel und am Eisregen liegen konnte. Im Scheinwerferlicht leuchteten die Augen des Tieres in der Finsternis des Wintersturms unheimlich auf. Zwischen dem Hin und Her der Scheibenwischer versuchte ich, mir einen Reim auf den Anblick zu machen. Der Körper berührte den Boden, doch das Schaf schien nicht zu liegen. Ich konnte erkennen, dass die Beine nicht unter dem Leib zusammengefaltet waren. Es wirkte lebendig und keineswegs verstört.
Und es versperrte die Straße.
Die Fahrt war schon vorher unangenehm genug gewesen. Am späten Nachmittag war ich in London aufgebrochen, um in Carlisle bei einer Vermisstensuche zu helfen. Ich war schon lange als forensischer Berater für die Polizei tätig und an spontane Reisen quer durchs Land gewöhnt, aber diesmal hatte ich mich verschätzt. Die Besprechung für die Suchaktion war erst für morgen Nachmittag anberaumt, ich hätte also bis zum nächsten Tag warten, mich früh ins Auto setzen und die gut dreihundert Meilen nach Cumbria bei Tageslicht und besserem Wetter auf mich nehmen können. Stattdessen war ich an einem zunehmend düsteren Winternachmittag bei drohender Sturmwarnung aufgebrochen.
Ich hatte mir Zeit für die unbekannte Strecke lassen und einen Abend früher im Hotel ankommen wollen, um für die anstrengenden nächsten Tage ausgeruht zu sein. Zumindest hatte ich mir das eingeredet. Ehrlich gesagt hatte mich der Anruf der Polizei in einem schlechten Moment erwischt. Ich war schon vorher angespannt und rastlos gewesen, von einer anderen Nachricht am Tag zuvor bereits aus dem Gleichgewicht gebracht. Als ich ans Telefon ging, war mir die Ablenkung gerade recht gekommen.
Möglicherweise hatte ich das Ganze nicht gut durchdacht.
Mit einsetzender Dunkelheit wurde das Wetter immer schlechter. Laut Kalender mochte der Frühling nah sein, die Natur hatte andere Pläne. Der Regen prasselte auf den Asphalt und erzeugte einen Dunst, der die Straße in ein Meer aus verschwommenen Scheinwerfern verwandelte. Am oberen Ende des Lake District National Park kam der Verkehr auf der Autobahn fast zum Erliegen. Durch das regennasse Fenster sah ich Blaulicht aufblitzen, weiter vorn hatte es wohl einen Unfall gegeben. Ich war nicht wild darauf, an einer Tragödie aus Blut und zerbeultem Blech vorbeizufahren, daher wartete ich, bis ich im schleichenden Verkehr die nächste Ausfahrt erreichte, und fuhr von der Autobahn ab.
Schon bald wurde mir mein Fehler klar. Ich hatte ein Stück weiter auf die Autobahn zurückkehren wollen, aber mein Navi führte mich in ein Gewirr von engen Landstraßen, die mit jeder Meile steiler und kurvenreicher wurden. Und nirgendwo Licht im Dunkel. Das Navi war auf Nachtmodus umgesprungen und stellte die Straße als mäandernde Linie dar. Es gab keinerlei Schilder oder Markierungen, aber dem Auf und Ab der Straße nach befand ich mich wahrscheinlich irgendwo in den Cumbrian Mountains. Dunkelheit und Sturm machten es unmöglich, die Landschaft zu erkennen.
Inzwischen goss es wie aus Kübeln. Die Regentropfen glänzten wie silberne Fäden im Scheinwerferlicht, trommelten auf das Autodach und legten sich wie eine Ölschicht auf die Fenster, obwohl die Scheibenwischer ihr Bestes gaben. Noch schlimmer war der Wind, der am Wagen zerrte, als wäre er ein Spielzeug, und mir das Lenkrad aus der Hand zu reißen drohte. Ich saß vorgebeugt da und versuchte, die Windungen und Kurven der Straße zu erkennen. Die Welt schrumpfte auf die Strahlen meiner Scheinwerfer zusammen, der Anblick des unaufhörlich dahinfegenden Regens im Licht hatte eine gefährlich hypnotische Wirkung. Meine Gedanken schweiften ab, ich schien zu fallen …
Und riss die Augen auf. Pass auf! Ich streckte mich, zwang mich, wach zu bleiben, aber die Fahrt bei diesem Unwetter zehrte an meinen Kräften. Widerwillig musste ich mir das Offensichtliche eingestehen: dass ich es heute Abend nicht mehr nach Carlisle schaffen würde. Nicht unter diesen Bedingungen.
Ich brauchte eine Pause, konnte aber nirgendwo anhalten. Die Straße führte an steilen Hängen und windzerzausten Bäumen entlang. Ich beschloss, im nächsten Dorf oder am nächsten Pub haltzumachen, und warf einen Blick auf das Navi.
Der Bildschirm war leer.
Nein, bitte nicht … Ich tippte mit dem Finger auf das Navi ein und versuchte, dabei die Straße im Auge zu behalten. Nichts passierte. Der Bildschirm leuchtete zwar, blieb aber bis auf den Pfeil, der den Wagen darstellte, leer. Nicht einmal die Straße wurde angezeigt. Nichts wies darauf hin, wo ich mich befand.
Ich hatte von einem Phänomen gehört, das man «Regendämpfung» nennt: Es tritt ein, wenn die atmosphärischen Bedingungen so schlecht sind, dass die Satellitensignale blockiert werden. Auch das GPS von Navigationssystemen. Aber ich hatte es noch nie selbst erlebt.
Glückwunsch. Jetzt schon.
Mein Handy steckte in der Halterung am Armaturenbrett, aber ich ahnte, dass es mir nichts nützen würde. Die Cumbrian Mountains waren berühmt für ihre Abgeschiedenheit und Unberührtheit. Hier Handyempfang zu haben, würde an ein Wunder grenzen, und ein schneller Blick auf das Display bestätigte meine Befürchtung. Frustration stieg in mir auf. Seit Wochen hatte ich vorgehabt, mir ein neues Handy mit Satellitenempfang zu besorgen, war aber nicht dazu gekommen. Zu spät. Im Kofferraum lag ein Straßenatlas, aber auch der half nicht weiter, solange ich nicht wusste, wo ich war. Als mich eine weitere Sturmbö traf, konnte ich es nicht länger leugnen.
Ich hatte mich verirrt.
Die Straße führte schon seit geraumer Zeit nach oben und wand sich an einem steilen Hang entlang. Jetzt wurde sie flacher. Im vom Regen zersplitterten Licht der Scheinwerfer sah ich, dass die Landschaft auf der einen Seite steil anstieg, auf der anderen abrupt abfiel. Anhalten war unmöglich, dann hätte ich den Weg versperrt. Zwar konnte ich mir kaum vorstellen, dass noch andere so blöd waren, sich bei diesem Unwetter aus dem Haus zu wagen, aber da die Sichtweite kaum ein paar Meter betrug, wollte ich kein Risiko eingehen. Erst recht nicht, wenn auf einer Seite der Abgrund lauerte.
Inzwischen führte die Straße wieder bergab. An einer Stelle war sie mit schlammigem Wasser überspült, ich drosselte das Tempo. Das Wasser strömte aus einer Schlucht am Abhang über mir, verwandelte ein breites Stück der Straße in einen Fluss und lief auf der anderen Seite ab. Ein Kanal, der unter der Straße durchführte, schien entweder verstopft oder den Regenmassen nicht gewachsen zu sein. Ich fuhr noch langsamer. Schon einmal war ich mit dem Wagen im Wasser stecken geblieben, ein Erlebnis, das ich nicht wiederholen wollte.
Allerdings war das überflutete Straßenstück zwar breit, aber das Wasser schien nicht tief zu sein. Ich murmelte ein leises Stoßgebet und fuhr langsam weiter. Das Wasser drückte gegen die Reifen und zog mich zur Seite, der Wagen rumpelte über angespülte Steine und Schotter.
Dann hatte ich es geschafft, seufzte erleichtert auf und entspannte mich ein wenig. Vor mir lag eine blinde Kurve, der Rest der Straße verschwand hinter einem dunklen Felsvorsprung. Kaum hatte ich ihn umrundet, trat ich auf die Bremse. Mitten auf der Straße lag etwas Großes und Helles im Scheinwerferlicht. Einen schwerelosen Moment lang verloren die Reifen auf der Wasserschicht den Halt, ich schwamm auf den Abgrund zu und dachte kurz: Das war’s. Dann griffen die Reifen wieder, das Auto kam zum Stehen.
Ich saß mit klopfendem Herzen da und hielt das Lenkrad umklammert. Regen trommelte auf das Dach des Wagens.
Ein beinloses Schaf starrte mich an.
Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich verstand, was ich vor mir sah, und halb ungläubig, halb erleichtert zu lachen begann. Das ist ein Witz … Das Schaf war nicht beinlos.
Es steckte in einem Viehgitter fest.
Ich rieb mir die Augen und wusste, was auf mich zukam. Das Schaf konnte sich nicht befreien, und ich konnte es nicht einfach sich selbst überlassen. Seufzend löste ich den Sicherheitsgurt und holte meine wetterfeste Jacke vom Rücksitz. Dabei rutschte etwas aus der Innentasche und fiel in den Fußraum. Der Anblick des hellen Umschlags mit meinem Namen in sauberer, vertrauter Handschrift fühlte sich an wie ein Schlag in die Magengrube.
Ich nahm ihn an mich, steckte ihn wieder in die Tasche und stieg aus dem Wagen.
Eine eiskalte Regenbö traf mich und riss mir fast die Tür aus der Hand. Ich zog mir die Kapuze über den Kopf und rannte zum Viehgitter. Alle vier Beine des Schafs steckten sauber zwischen den Metallstäben. Es war kein Blut zu sehen, das Schaf wirkte unverletzt. Und schien sich auch nicht besonders viel aus seiner misslichen Lage zu machen.
Ich sah mich um in der Hoffnung, irgendwo die Lichter einer nahe gelegenen Farm zu erkennen.
Aber die Nacht blieb dunkel und leer. Regentropfen prasselten auf meinen Rücken, als ich mich über das Schaf beugte und versuchte, es irgendwie zu packen. Den Gestank musste ich verdrängen. Das verfilzte Fell hatte sich vollgesogen. Wer hätte gedacht, dass Schafe so schwer sein können, dachte ich. Und so stinken.
Das Tier half weder sich noch mir. Sobald die Beine befreit waren, wand es sich und trat nach mir. Mühevoll schleppte ich es ein Stück weg vom Viehgitter. Als ich es absetzte, schüttelte es sich, bespritzte mich mit Schlamm und Wasser und trottete ohne einen weiteren Blick von dannen. Ich rieb mir die Nackenmuskeln und sah es in der schwarzen Nacht verschwinden.
Gern geschehen.
Ich drehte mich um, da leuchtete plötzlich der Himmel auf, als hätte es hinter dem Horizont eine lautlose Explosion gegeben. Im Flackern des Wetterleuchtens erhaschte ich einen ersten Blick auf die weitläufige Bergwelt, in der ich mich verirrt hatte. Die Straße führte an einem steilen, felsigen Abhang entlang, unten lag ein Tal, von hohen Bergen umschlossen, deren schneebedeckte, baumlose Gipfel bedrohlich in den Himmel aufragten. Weiter unten wuchsen dichte Wälder. Der Anblick war unheimlich, als hätte ein Kamerablitz finstere Gestalten in einem Zimmer sichtbar gemacht.
Dann erstarb das Wetterleuchten, die Dunkelheit kehrte zurück, als wäre ein Vorhang gefallen.
Ich lief zum Wagen zurück, dankbar, ins Warme zu kommen, und zog den nassen Mantel aus. Sofort beschlugen die Fensterscheiben. Um Abhilfe zu schaffen, drehte ich das Gebläse auf, dessen Rauschen mit dem Prasseln des Regens verschwamm, als ich die Fahrt auf der abschüssigen Straße fortsetzte. Zuerst waren im Scheinwerferlicht nur kahle Felsen zu sehen, einige Minuten später führte die Straße in einen Wald hinein. Hohe, gerade Nadelbäume, wahrscheinlich Tannen oder Fichten, standen zu beiden Seiten wie riesige Weihnachtsbäume. Sie sahen alle gleich aus und wuchsen so dicht, dass es mir vorkam, als würde ich durch einen Tunnel fahren. Offenbar war dies eine Plantage, kein natürlicher Wald, und tatsächlich kam ich ein Stück weiter an einem Gelände vorbei, das nach einem Holzlager aussah. Hinter einem Metallzaun waren schattenhaft Baucontainer und schwere Fahrzeuge zu sehen. Danach wurde ich wieder vom Wald umschlossen.
Dennoch schöpfte ich Hoffnung. Es war weit und breit das erste Gebäude gewesen, und wo eins war, konnten noch mehr kommen. Tatsächlich endete der Wald kurz darauf, und hinter der regennassen Windschutzscheibe leuchteten vereinzelte Glühwürmchen in der Dunkelheit auf.
Ein Dorf.
Gott sei Dank … Die Glühwürmchen verwandelten sich in Straßenlaternen. Jetzt konnte ich auch steinerne Cottages und Bungalows ausmachen. Hinter den Gardinen schimmerte es behaglich. Kurz darauf erreichte ich einen winzigen Dorfplatz. Auf einer Seite befand sich ein unbeleuchteter Laden, gegenüber ein größeres Gebäude, über dessen Tür ein Schild leicht im Wind schwankte.
Ein Pub.
Ich hielt davor, stellte den Motor aus und blieb sitzen, bis die Anspannung in meinen Muskeln langsam nachließ. Der Regen trommelte noch immer auf den Wagen. Das schwingende Pubschild wurde von oben beleuchtet und erzeugte wilde Schatten. Die verwitterte Bemalung stellte einen Schlägel und einen Meißel dar, darunter stand der Name des Pubs.
The Perseverance.
Die Tür war geschlossen, aber durch die Gardinen hinter den Milchglasfenstern mit den Namen alter Biersorten schimmerte Licht. Der Pub schien geöffnet zu sein, ich konnte also zumindest herausfinden, wo ich mich befand. Falls es kein Hotelzimmer gab und ich die Nacht im Auto verbringen musste, dann lieber in einem Dorf als auf einer einsamen Bergstraße. Endlich, dachte ich, als ich meine Jacke und den Laptop von der Rückbank nahm und aus dem Wagen stieg, endlich hat sich das Blatt gewendet.
Kapitel 2
Die massive Holztür ließ sich nur schwer öffnen, als sie endlich nachgab, schob mich eine nasse Bö ins Innere. Nach der Kälte der Nacht kam mir der Pub unerträglich warm vor. Der Geruch von schalem Bier überlagerte das nach Harz riechende Kaminfeuer. Während ich mich bemühte, die Tür hinter mir zu schließen, fiel mir etwas auf.
Die Stille.
Als ich mir die Kapuze vom Kopf zog, fielen Tropfen auf den steinernen Fußboden. Ich drehte mich um und schaute in neugierige Gesichter. An einem der fünf oder sechs besetzten Tische in dem niedrigen Schankraum saßen Teenager, die kaum alt genug für den Pub aussahen. An einem anderen hatte eine Dominorunde die Köpfe gehoben. Ein großer, korpulenter Mann stand allein vor der Dartscheibe, das Arbeitshemd spannte über dem Bauch, als er den Arm zum Wurf hob. Über dem Kamin hingen zwei alte, rissige Boxhandschuhe und gerahmte schwarz-weiße Fotos von Boxern.
An einem großen Tisch neben dem Kamin saß ein hagerer alter Mann, neben ihm eine elfenhafte Frau mit scharfen Gesichtszügen und ein gestresst wirkender Mann, beide in den Vierzigern, vermutlich ein Ehepaar. Im Mund des Alten klemmte jeglichen Rauchverboten zum Trotz eine gerade Pfeife, auf dem Tisch stand eine Handvoll Geburtstagskarten, darauf in bunten Farben die Zahl 90. Man sah ihm sein Alter an, die Tweedjacke schlackerte um seine früher wahrscheinlich beeindruckende Gestalt, die kräftigen Knochen in seinem Gesicht drückten sich durch die papierene Haut. Doch bei aller Gebrechlichkeit umklammerte sein Kiefer unbarmherzig den Pfeifenstiel, und die Augen, die mich unter buschigen Augenbrauen betrachteten, wirkten hart und gnadenlos.
Die beiden großen, borstigen Hunde, die zu seinen Füßen dösten, hoben die Köpfe und starrten mich ebenfalls an.
Die Frau hinter der Bar lächelte höflich, aber in dem Blick, mit dem sie meine vom Schaf verdreckte Jacke beäugte, lag Misstrauen.
«Sie sind ja patschnass. Was kann ich Ihnen bringen?»
Der Dartspieler grinste. «Am besten eine saubere Jacke.»
Er war ein großer Mann über fünfzig, mit Bartstoppeln und Bierbauch. Ich war mir des Geruchs, den meine Jacke abgab, wohl bewusst, als ich der Frau antwortete.
«Einen Kaffee, bitte, wenn Sie welchen haben.»
«Tut mir leid, Heißgetränke haben wir nicht.»
«Dann nur einen Orangensaft.» Ich hätte gern etwas Stärkeres bestellt, wusste aber nicht, wie weit ich noch fahren musste. «Haben Sie was zu essen?»
«Nur Snacks. Chips, Nüsse oder Pork Scratchings.» Sie holte eine Flasche Orangensaft aus dem Kühlschrank und griff nach einem Glas. «Sie klingen nicht, als wären Sie von hier. Woher kommen Sie?»
«London. Ich bin unterwegs nach Carlisle.»
«Carlisle?» Sie hielt inne und starrte mich an. «Sie sind meilenweit vom Weg abgekommen. Haben Sie sich verfahren? Sonst wären Sie kaum hier gelandet.»
«Mein Navi ist ausgefallen.» Ich zögerte. «Wahrscheinlich klinge ich wie ein Trottel, aber können Sie mir sagen, wo ich hier bin?»
Das dumpfe Geräusch eines in der Dartscheibe einschlagenden Pfeils, gefolgt vom bellenden Lachen des Dartspielers. «Mann, der hat wohl Freigang.»
«Sie sind in Edendale», sagte die Frau hinter der Bar, die Unterbrechung ignorierend. «Das Dorf liegt am oberen Ende der Cumbrian Mountains, und ich sage Ihnen gleich, dass Sie uns auf dem Navi nicht finden werden. Blöde Dinger, wenn Sie mich fragen.»
Ich war noch mehr von meiner Route abgekommen als gedacht. «Wie weit ist es nach Carlisle?»
«Oh, etwa dreißig Meilen, in der Richtung, aus der Sie gekommen sind. Aber in einer Nacht wie dieser …»
Sie brach ab, als das Licht schwächer wurde und ausging. Stöhnen erklang und wurde zu gedämpftem, ironischem Jubel, als es flackernd wieder hell wurde.
«Verdammter Sturm», zischte die Frau, besann sich und lächelte. «Keine Sorge, man gewöhnt sich dran. Wo war ich stehen geblieben?»
«Der Weg nach Carlisle.»
«Stimmt. Tja, das ist schon bei schönem Wetter nicht leicht. Die Straße führt durch die Berge, ziemlich kniffelig, wenn man die Strecke nicht kennt. Ich an Ihrer Stelle würde es bei diesem Wetter nicht wagen, wenn ich nicht unbedingt müsste.»
Toll. «Wohin führt die Straße von hier aus weiter?»
«Nirgendwohin.»
«Wie bitte?»
«Sie führt nirgendwohin. Ein paar Meilen weiter ist sie zu Ende.» Sie verschränkte die Arme. «Es gibt nur einen Weg rein und raus, und auf dem sind Sie gerade gekommen.»
Während ich das verarbeitete, trat jemand an die Bar. Es war der gestresst wirkende Mann, der bei der Frau und dem Alten gesessen hatte.
«Noch eine Runde, Stella. Wenn es passt», fügte er mit entschuldigendem Lächeln hinzu.
Aus der Nähe sah er älter aus, als ich zuerst angenommen hatte, wohl eher über fünfzig. Er hatte ein rundes, freundliches Gesicht, glatt und faltenlos bis auf die tiefen Furchen auf der Stirn, die ihn ängstlich und sorgenvoll wirken ließen, selbst wenn er lächelte.
«Schon gut, ich hab’s nicht eilig», sagte ich. Ich musste erst mal überlegen, was ich tun sollte.
«Danke, das ist sehr …» Er schaffte es, ein, zwei Sekunden lang Blickkontakt zu halten, dann zog er den Kopf ein und wandte sich wieder an die Barfrau. «Ähm, ein Stout für Wynn, Tonic für Evie, und ich nehme … ach, nur ein halbes Pint, bitte. Danke, Stella.»
Ein Bierglas wurde auf die Theke geknallt. Der große Dartspieler hatte sich zu uns gesellt. Er wirkte aufdringlich und dominant und roch streng nach Öl und kaltem Schweiß.
«Noch ein Pint, Stella.»
«Warte, bis du dran bist, ich bediene gerade.»
Er legte einen fleischigen Arm um die Schulter des gestressten Mannes. «Schon gut, Eddie gibt einen aus. Stimmt doch, Eddie?»
Das Lächeln des Kleineren wirkte wie ein Abwehrreflex. «Ähm … ja, natürlich. Bitte auch ein Bier für Vic.»
«Guter Junge.» Der Dartspieler zog den Arm um Eddies Hals an und zerrte ihn fast von den Beinen, bevor er wieder losließ. «Und noch eine Tüte Chips, Stella.»
«Gibt es in der Nähe ein Hotel? Ein B&B, irgendwas?», fragte ich, als Stella anfing, Bier zu zapfen.
Sie zog die Mundwinkel nach unten. «Nein. Früher schon, aber wir sind nicht mehr auf Touristen eingestellt.»
«Stella ist nicht verheiratet. Wenn Sie nett fragen, können Sie bei ihr schlafen, stimmt’s, Stella?» Der große Dartspieler grinste anzüglich. «Aber es gibt nur ein Bett, es wird also kuschelig.»
Er lachte schallend über seinen Witz. Niemand sonst wirkte amüsiert, nur einer der Teenager am Nebentisch grinste ebenfalls.
«Halt dich zurück, Vic, sonst landet das nächste Pint auf deinem Kopf.» Stella sah ihn böse an und wandte sich wieder an mich. «Eigentlich soll ich das nicht, aber ich kann Ihnen ein Käsesandwich und einen Kaffee machen. Sie sehen aus, als könnten Sie’s brauchen.»
«Ich hätte auch gern ein Sandwich», sagte der große Mann und rieb sich den Bauch.
«Dich hab ich nicht gefragt. Und du bist fett genug.» Sie stellte ihm das Glas Stout hin und fragte mich: «Ist Käse in Ordnung? Was anderes haben wir nämlich nicht.»
«Danke, das wäre wunderbar.» Ich deutete auf meine dreckige Jacke. «Haben Sie auch irgendwas, womit ich mich ein bisschen säubern kann? Ich, äh, musste einem Schaf aus einem Viehgitter helfen.»
Der große Dartspieler lachte höhnisch. «Das sollen wir Ihnen glauben?»
Er stieß dem kleineren Mann, dessen Lächeln wie eine Grimasse wirkte, den Ellbogen in die Rippen.
Stella seufzte müde. «Hör jetzt auf, Vic.» Sie gab mir einen löchrigen Spüllappen. «Auf dem Herrenklo sind Papierhandtücher. Schmeißen Sie den Lappen hinterher in den Mülleimer.»
Die Toilette war unbeheizt und spartanisch, aber makellos sauber. Ich wischte so viel Schlamm weg wie möglich, trocknete mich mit den Papierhandtüchern ab und ging wieder in den Schankraum. Gedämpfte Unterhaltungen waren zu hören, aber das lauteste Geräusch war immer noch das knisternde Feuer. Der große Mann stand wieder vor der Dartscheibe und zielte mit dem Pfeil, den Vorderfuß hatte er ein gutes Stück vor die Markierung gesetzt. Die Frau mit den scharfen Gesichtszügen, die bei dem alten Mann gesessen hatte, war zu der Teenagergruppe gegangen. Obwohl sie neben dem Jungen, der über den Witz des Dicken gegrinst hatte, schmal und zierlich wirkte, war ihm das Lachen vergangen. Er saß vornübergebeugt und schmollte, und seine Freunde wanden sich vor Unbehagen, während die Frau ihn leise, aber bestimmt zurechtwies.
«… an seinem Geburtstag bei deinem Großvater sitzen, nicht hier bei deinen Freunden –»
«Aber, Tante Evie …»
«Keine Widerworte, sonst –»
Sie brach ab, als ich an ihr vorbeiging. Der Teenager warf mir einen trotzigen Blick zu. Er hatte die gleichen scharfen Gesichtszüge wie die Frau, aber was an ihr elfenhaft wirkte, sah an ihm hinterlistig und wölfisch aus. Die Frau wartete ab, bis ich vorbeigegangen war, dann sprach sie so leise weiter, dass ich nichts hören konnte. Aber es zeigte Wirkung. Der Teenager stand widerwillig auf, schlurfte an den Tisch des alten Mannes und ließ sich auf einen Stuhl plumpsen.
Ich suchte mir einen freien Tisch, hängte den nassen Mantel zum Trocknen über eine Stuhllehne, nahm dann den Laptop aus der Tasche und klappte ihn auf. Ich hatte vor, mir die von der Polizei in Carlisle zugesandten Informationen über die Suchaktion noch einmal anzusehen, bekam aber keine Gelegenheit dazu. Der Laptop war noch nicht ganz hochgefahren, als der große Dartspieler angestapft kam und den Stuhl mir gegenüber zu sich heranzog.
Ich seufzte innerlich, als er sich niederließ. Sein Bierbauch hing zwischen den fleischigen Beinen. Das Bierglas wirkte in seinen schwieligen Händen geradezu mickrig.
«Was isn das? Bisschen Büroarbeit?», fragte er und nickte mit fiesem Grinsen in Richtung Laptop. «Hier gibt’s kein WLAN, Kumpel. Und auch keinen Handyempfang.»
«Macht nichts.»
Ich wollte sowieso nicht ins Internet gehen. Meine Arbeit war zu vertraulich für ein offenes Netz. Ich starrte auf den Bildschirm des Laptops und hoffte, der Dicke würde den Hinweis verstehen, doch er machte es sich auf dem Stuhl bequem.
«War nur Spaß, das mit dem Schaf. Man wird ja wohl noch lachen dürfen.» Sein Grinsen reichte nicht bis zu den kleinen Augen. «Hab gehört, wie Sie gesagt haben, dass Sie aus London sind. Schon mal den König getroffen?»
«Ein, zwei Mal.» Ich verspürte kleinkarierte Genugtuung, als sein Grinsen verschwand. «War nur Spaß.»
«Der war gut.» Das Grinsen war wieder da und wirkte fieser. Ich bereute meinen Scherz. Er zog seinen Stuhl so dicht heran, dass sich unsere Knie fast berührten. «Was wollen Sie denn in Carlisle?»
Ich unterdrückte ein Seufzen und klappte den Laptop zu. «Arbeiten.»
«Was machen Sie denn? Lassen Sie mich raten. Sie sind Dichter. Nein, Tierarzt. Deswegen mögen Sie Schafe.»
«Ich bin Arzt.»
Das stimmte auch, ursprünglich hatte ich Medizin studiert und in einer sehr dunklen Phase meines Lebens sogar als Hausarzt gearbeitet. Mein neuer Bekannter trank einen Schluck und beobachtete mich, während er das Bier in seinem Mund herumspülte und geräuschvoll herunterschluckte.
«Ein Arzt.» Er klang enttäuscht, als hätte er auf eine bessere Vorlage gehofft. «Dafür brauchten Sie doch bestimmt eine Menge Qualifikationen.»
«Ein paar.»
«Verirrt haben Sie sich trotzdem, stimmt’s?» Sein Grinsen erinnerte mich an einen Hund, der mit wedelndem Schwanz die Zähne fletscht. «Meine einzige Qualifikation ist der Führerschein. Haben Sie auf dem Weg hierher die Fichtenplantage gesehen? Die ganzen hohen, spitzen Scheißbäume? Da arbeite ich. Früher hab ich die Dinger abgeholzt, jetzt fahre ich sie durch die Gegend. Ein Scheißbaumtaxifahrer, das bin ich.»
Er warf den Kopf zurück und grölte so, dass ich Speicheltropfen und Biergeruch abbekam. Im Pub war es wieder still geworden. Der alte Mann am Tisch neben dem Kamin starrte uns mit hartem Blick an, sein grobknochiges Gesicht wirkte so unerbittlich wie eine Osterinsel-Statue. Andere Gäste warfen ihm nervöse Blicke zu, aber der große Mann bemerkte es nicht.
«Mögen Sie Bäume?» Er beugte sich vor. Sein Gesicht war vom Alkohol gerötet und ließ mich vermuten, dass es keinen Unterschied machte, was ich antwortete.
«Schon.»
«Dann wird es Ihnen bei uns gefallen. Wir sind hier zwar am Arsch der Heide, aber wenn wir eins in rauen Mengen haben, dann Bäume. Wollen Sie einen Witz hören? Wissen Sie, warum die Straße hier endet? Weil, als Gott Eden schuf, hat er –»
«Keine Blasphemie!»
Die Stimme des alten Mannes dröhnte durch den Raum, ein heiseres Brüllen, das nicht seiner Gebrechlichkeit entsprach. Es war, als würde ein elektrischer Schlag durch die Anwesenden gehen. Der große Mann riss die Augen auf, seine Unterlippe zitterte, als wäre er geohrfeigt worden.
«Tut mir leid, Wynn, ich wollte nicht –»
«Ich lasse nicht zu, dass der Name des Herrn missbraucht wird! Nicht in meinem Pub!»
Die elfenhafte Frau legte ihm eine Hand auf den Arm. «Schon gut, Dad, reg dich nicht –»
«Sag mir nicht, was ich tun soll!», schnauzte er und zog den Arm weg.
Seine Tochter presste die Lippen zusammen, unternahm aber keinen zweiten Versuch. Der kleine Mann neben ihr, Eddie, vermutlich ihr Mann, schien sich noch kleiner machen zu wollen. Niemand sprach, als der Alte den Dicken böse ansah.
«Hier herrscht Gottesfurcht!» Er verlieh seinen Worten mit heftigem Pfeifenfuchteln Nachdruck. «Hast du gehört? Gottesfurcht!»
«Ich weiß, ich wollte nicht …» Die Pausbacken des Dicken wackelten, als er hastig nickte. «Du hast recht, Wynn. Gottesfurcht.»
Mein Erscheinen hatte alle verstummen lassen, aber jetzt lag eine ganz andere Spannung im Raum. Nur dem Teenager, der an den Kamintisch beordert worden war, schien sie nichts auszumachen. Er saß mit manisch glitzernden Augen da und verbarg sein Grinsen hinter seinem Bierglas.
Dann wurde hinter der Bar eine Tür geöffnet, und der Bann war gebrochen.
Ein großer Mann mit rasiertem Kopf trat heraus und wischte sich die Hände an einem dreckigen Handtuch ab. Er war sicher Ende fünfzig, hatte aber immer noch den grobschlächtigen, kräftigen Körperbau eines Boxers; die Nase war irgendwann gebrochen gewesen und schlecht verheilt, das Gesicht dadurch schief. Die Ähnlichkeit mit dem alten Mann am Kamin fiel sofort ins Auge. Sie schienen aus einem Guss zu sein, hatten beide breite Schultern, starke Knochen und finstere Mienen. Zweifellos Vater und Sohn, doch auch wenn der Jüngere körperlich überlegen war, fehlte ihm die Autorität des Alten. Es war, als würde man zwei Versionen desselben Menschen sehen, hier das Original, dort die unvollkommene Kopie.
«Das Schlimmste konnte ich verhindern, aber ein bisschen Wasser kommt immer noch durch», sagte er und warf das Handtuch hinter die Bar. Sogar seine Stimme war eine etwas weniger grollende Version des alten Mannes. «Ich schau mir das morgen noch mal an, aber …»
Er hielt inne, nahm die Stimmung auf und sah sich um. An mir blieb sein Blick kurz hängen, über Eddie ging er hinweg, als wäre er nicht da.
«Was ist hier los?»
«Vic hat uns gerade einen Witz erzählt», sagte die Tochter des alten Mannes. «Nicht wahr, Vic?»
Das Gesicht des Dicken war noch röter als vorher, was vermutlich nicht mehr nur am Alkohol lag. «Ich mach nur Spaß, Alun. Kennst mich ja.»
Dem Blick des kahl rasierten Mannes war das Bedauern darüber anzusehen. Er wandte sich an Stella, die das Ganze mit Unbehagen beobachtete.
«Soll ich übernehmen?»
Sie lächelte. «Nein, schon gut. Geh und setz dich zu deiner Familie.»
«Bist du sicher?» Er schien nicht erpicht darauf zu sein.
«Ja, ich wollte dem Herrn hier gerade ein Sandwich machen.» Sie nickte in meine Richtung. «Ich kann noch mehr machen, wenn dein Dad was essen möchte.»
«Nicht nötig», sagte der alte Mann barsch und biss wieder auf seine Pfeife. «Ich gehe nach oben.»
Er griff nach zwei Gehstöcken, die am Tisch lehnten, und begann, mühsam und unter Schmerzen aufzustehen. Seine Tochter machte eine Bewegung. «Lass mich helfen –»
«Ich komme zurecht. Ich bin nicht invalide.»
«Ich wollte nur –»
«Ich komme zurecht, habe ich gesagt!»
Sie presste die Lippen zusammen, setzte sich und versuchte kein weiteres Mal, dem Alten auf die Beine zu helfen. Die Hunde sprangen auf, gähnten und streckten sich. Es waren Lurcher, Jagdhunde, die borstigen Windhunden ähnelten. Ihre Krallen klickerten über den Steinboden, als sie dem alten Mann aus dem Raum folgten. Respektvolles Gute-Nacht-Murmeln erklang von den anderen Tischen.
Sobald sich die Tür hinter dem Alten geschlossen hatte, begann der Teenager, sein Enkel, leise zu singen.
«Happy birthday to you, happy birthday to –»
«Halt den Mund», schnauzte ihn der Mann mit dem geschorenen Schädel an.
«Ach, Dad, ich hab doch nur –»
«Ich sag’s nicht noch mal.»
Der Teenager gab nach, aber ein hinterlistiges Lächeln blieb in seinem Gesicht. Als die leisen Gespräche wieder aufgenommen wurden, schob der große Mann mit einem kratzenden Geräusch den Stuhl zurück, erhob sich und ging nach einem letzten abfälligen Blick in meine Richtung zu den Dominospielern. Ich überlegte, noch ein bisschen zu arbeiten, entschied mich dagegen und packte den Laptop wieder ein, um mich notfalls schnell aus dem Staub machen zu können. Man ließ mich in Ruhe, trotzdem war ich froh, als Stella zurückkam und mir eine Tasse dampfenden Kaffee und einen Teller mit säuberlich geschnittenen Sandwiches hinstellte.
«Ich hoffe, Sie mögen Ploughman’s Pickle», sagte sie.
Als ich wieder nach draußen trat, war der Sturm noch schlimmer geworden. Der Regen hatte sich in Graupel verwandelt, das Pubschild über meinem Kopf schwang so heftig hin und her, dass die Ketten zu reißen drohten. Wetterleuchten riss den Himmel über den Straßenlaternen auf, als ich zu meinem Wagen rannte. Nach den Sandwiches und dem Kaffee fühlte ich mich gestärkt und wollte mir einen Platz zum Übernachten suchen, der nicht direkt neben dem Pub lag. Der dicke Dartspieler wirkte auf eine Art brutal, die sich mit jedem weiteren Bier nur verschlimmern würde.
Als ich auf den Autoschlüssel drückte, rief jemand mir nach.
«Halt!»
Eine stämmige Gestalt stürmte vom Pub her auf mich zu, als ich sie erkannte, wurde mir mulmig. Der Dicke trug eine gelbe Neonjacke, das regennasse, rote Gesicht steckte unter der Kapuze.
«Scheißwetter, was?» Er wischte sich Tropfen aus dem Gesicht und warf mir ein schmeichelndes Lächeln zu. «Ich hab gedacht, Sie brauchen einen Platz zum Übernachten. Nicht weit weg gibt’s einen.»
Ich misstraute seiner plötzlichen Fürsorglichkeit. «Ich dachte, hier ist weit und breit nichts.»
«Na ja, unter uns gesagt, Stella mag die Besitzer nicht besonders. Wahrscheinlich hat sie deswegen nichts gesagt. Sie ist manchmal ein bisschen komisch, Sie wissen ja, wie Frauen in dem Alter sind. Die Wechseljahre und so.» Als wäre das Erklärung genug, drehte er sich um und zeigte die Straße entlang.
«Fahren Sie aus dem Dorf raus, geradeaus über die Kreuzung und dann den Berg hoch. Die Straße wird ziemlich schmal, aber nach etwa einer halben Meile kommt die Abzweigung zu einem Hotel. Können Sie nicht verfehlen.»
Ich schaute in die Richtung, in die er zeigte. Hinter den letzten Straßenlampen lag nichts als Finsternis. «Ich dachte, die Straße führt nirgendwohin.»
«Nur zum Hotel. Weiter kommt man nicht. Ende.» Wasser tropfte von seinen Bartstoppeln, als er listig lächelte. «Sagen Sie denen, Vic hat Sie geschickt.»
Er schaffte es nicht, sich das Grinsen zu verkneifen, als er zum Pub zurückrannte. Ich sah ihm nach und überlegte, ob er wirklich ein so miserabler Lügner war. Offensichtlich wollte er mir einen Streich spielen. Ich glaubte keine Sekunde, dass dort ein Hotel existierte, aber ich musste ohnehin einen Stellplatz für die Nacht finden. Selbst wenn er mich in die Irre schicken wollte, war mir eine ruhige Straße ins Nirgendwo ganz recht.
Auf der Fahrt durchs Dorf kämpften meine Scheibenwischer hektisch gegen den Eisregen an. Viel Dorf war da nicht. Schon ein kleines Stück weiter standen keine Straßenlaternen mehr, und ich fuhr wieder durch die Dunkelheit. Noch ein paar warm beleuchtete Fenster, dann ließ ich die Ortschaft hinter mir. Ich erreichte eine kleine Kreuzung und fuhr geradeaus den Berg hoch. Schon bald wurde die Straße zu einem überwucherten einspurigen Weg, Zweige und Unkraut strichen flüsternd an den Seiten des Wagens entlang. Ich zuckte zusammen, als etwas über den Lack kratzte und es klang, als würde man mit den Fingernägeln über eine Tafel fahren. Jetzt verstand ich den Witz. Ich hatte hier oben kein Hotel erwartet, aber die Pointe lag darin, dass es auch keine Möglichkeit zum Wenden gab. Und rückwärts konnte ich in der Dunkelheit nicht fahren, ohne irgendwo stecken zu bleiben.
Mir blieb keine andere Wahl, als weiterzufahren.
Wütend auf mich selbst, weil ich auf den albernen Streich hereingefallen war, beugte ich mich vor, starrte in den schräg fallenden Eisregen und rechnete ständig damit, dass die Straße entweder endete oder so überwuchert war, dass ich nicht weiterkam. Ich überlegte gerade, einfach anzuhalten und das Tageslicht abzuwarten, da tauchte im Scheinwerferlicht etwas auf.
Halb zwischen Bäumen verborgen standen zwei schiefe steinerne Torpfosten. Dazwischen klaffte die Einfahrt wie ein dunkler Schlund. An einem Pfosten hing ein altes Schild.
Hillside House Hotel & Spa.
Ich hielt an. Der Dicke hatte also nicht gelogen. Es gab hier tatsächlich ein Hotel.
Nur war es nicht geöffnet.
Wie witzig. Saukomisch. Ich fluchte leise. Ein weiterer Punkt auf der immer länger werdenden Liste der schlechten Entscheidungen des heutigen Tages. Trotzdem war dies vielleicht ein besserer Platz zum Übernachten als auf offener Straße. In jedem Fall konnte ich hier wenden.
Langsam fuhr ich zwischen den Torpfosten hindurch auf die Einfahrt. Die Scheinwerfer beleuchteten hohe, nasse Büsche mit dicken, gefächerten Blättern, entweder Lorbeer oder Rhododendron, die auf beiden Seiten dicht an dicht wuchsen und mir die Sicht versperrten, als ich den steilen Weg hinunterfuhr, der kein Ende zu nehmen schien. Nach langer, kurvenreicher Fahrt endeten die Büsche plötzlich, und vor mir ragte ein großes Gebäude im Scheinwerferlicht auf. Die Fenster waren dunkel, und die riesige, von verzierten Säulen eingefasste Holztür sah aus, als habe sie vergessen, wie sie aufging. Die hohen Steinwände wirkten im Regen schwarz, Türme und Spitzen ließen das Ganze wie die Nachahmung einer schottischen Burg aussehen.
Eine verlassene Burg.
Meine Reifen knirschten über kaputten Asphalt, als ich vor das Haus fuhr und anhielt. Ich hatte auf ein warmes Bett gehofft. Stattdessen würde ich eine kalte Nacht vor einem verlassenen Hotel mitten im Nirgendwo verbringen. Keine gute Vorbereitung auf den morgigen Tag, der sicher hart werden würde. Ich stellte den Motor ab, saß im Dunkeln da und versuchte mich dazu aufzuraffen, nach meinem Laptop zu greifen.
Plötzlich zerriss gleißendes Licht die Dunkelheit.
Zuerst hielt ich es für einen Blitz, aber als das Licht blieb und die Schatten von der Vorderseite des Hotels vertrieb, wurde mir klar, um was es sich handelte.
Flutlicht.
Etwas schlug gegen die Scheibe des Wagens. Ich sah eine Gestalt und fuhr zusammen. Ein Mann, im Sturm hatte ich ihn nicht bemerkt. Das Gesicht war unter einer Parkakapuze verborgen, aber das war es nicht, was mich erstarren ließ.
Sondern das Gewehr in seiner Hand.
Kapitel 3
Wasser lief über den Doppellauf und tropfte von den beiden dunklen Mündungslöchern. Das Gewehr war nicht direkt auf mich gerichtet, wurde aber so gehalten, dass es jederzeit angelegt werden konnte. Ich schaute den Mann an. Unter der Kapuze konnte ich lediglich einen entschlossen zusammengepressten Mund in einem dichten Bart erkennen. Er bedeutete mir mit einer Geste, das Fenster zu öffnen. Die nasse Scheibe bot wenig Schutz vor einer Schusswaffe, trotzdem hätte ich sie gern zugelassen.
Aber mir blieb keine Wahl. Die Scheibe glitt quietschend nach unten, kalter Wind blies Regen ins warme Innere. Auf halbem Weg stoppte ich. Als ich aufschaute, blickte ich unter der Kapuze in feindselige Augen. Im Vergleich zum dunklen Bart waren sie auffällig hell, wie die eines Huskys.
«Was wollen Sie hier?»
Ich versuchte, so zu klingen, als wäre dies ein normales Gespräch. «Ich bin auf der Suche nach einer Unterkunft. Mir wurde gesagt, es gibt hier ein Hotel.»
«Blödsinn. Wer hat das gesagt?»
«Jemand im Pub. Hat sich wohl einen Spaß erlaubt, tut mir leid, dass ich Sie gestört habe.»
Ich wollte das Fenster schließen, aber er machte einen Schritt auf mich zu.
«Halt, ich bin noch nicht fertig.»
Durch die Bewegung hob sich der Gewehrlauf. Vielleicht war es keine Absicht, aber ich nahm die Hand vom Fensterknopf, atmete kurz durch und schaute erst das Gewehr, dann den Mann an.
«Sie müssen das Ding anders halten.»
Ich war überrascht, wie ruhig ich klang. Er sah die Waffe an, als würde ihm jetzt erst klar werden, was er da tat. Nach kurzem Zögern senkte er sie.
«Sie haben mir immer noch nicht gesagt –»
«Jon?»
Eine Frau lief über den zerborstenen Asphalt auf uns zu, sie trug ebenfalls einen Parka, den sie vor sich zusammenhielt.
«Was ist hier los?», rief sie.
Ihre Aussprache mit den breiten Vokalen war typisch für Lancashire. Sie war groß, hatte dunkle Haut und sah den Mann mit unnachgiebiger Miene an.
«Ich versuche rauszufinden, was der hier will.» Der Mann bemühte sich, selbstsicher zu klingen, aber es lag eine Rechtfertigung darin.
«Ach, Herrgott noch mal, Jon!» Sie deutete wütend auf die Waffe. «Und was hast du mit dem Scheißding vor?»
«Ist nicht geladen», murmelte er und richtete das Gewehr auf den Boden.
«Das kann er aber nicht wissen, oder?» Sie wandte sich an mich. «Es tut mir so leid. Sie müssen meinen Mann entschuldigen. Wir haben Ärger mit Wilderern gehabt, deswegen sind wir etwas … mehr auf Sicherheit bedacht.»
Etwas? Was immer das für Ärger gewesen war, ich wollte das Gespräch beenden und mich vom Acker machen.
«Tut mir leid wegen der Störung. Ich wusste nicht, dass das Hotel geschlossen ist», sagte ich. «Im Pub meinte jemand, ich könnte für eine Nacht hier unterkommen.»
«Blödsinn», wiederholte der Mann.
«Er hieß Vic», fuhr ich an seine Frau gewandt fort. «Ein großer Mann, schon älter. Ich soll sagen, dass er mich geschickt hat.»
Die beiden wechselten einen Blick.
«Scheiß Hooley», sagte der Mann. «Verdammt, langsam reicht’s mir –»
«Jon!»
Der Tonfall seiner Frau ließ ihn verstummen, aber seine Miene blieb mordlüstern. Ich atmete tief durch. Eisregen blies mir ins Gesicht.
«Tja, ich mache mich wieder auf den Weg. Nochmals, entschuldigen Sie die Störung.»
«Nein, warten Sie», sagte die Frau schnell, als ich das Fenster schließen wollte. Wasser tropfte von ihrer Kapuze wie ein Vorhang aus Perlen. «Wo wollen Sie hin?»
«Nach Carlisle.»
«Das ist heute Nacht viel zu weit.» Sie schob eine schwarze Haarsträhne zurück, die der Regen ihr auf die Wange geklebt hatte. «Hören Sie, das ist zwar kein Hotel mehr, aber es gibt jede Menge leerer Zimmer –»
«Hey, jetzt mal halblang!», unterbrach ihr Mann sie.
«Sie können heute Nacht hierbleiben», fuhr sie fort, als hätte er nichts gesagt. «Das ist wirklich kein Problem.»
«Danke, aber ich komme schon klar.»
Sie betrachtete stirnrunzelnd den Eisregen. «Mir wäre wohler, wenn Sie blieben. Bei dem Wetter sollte man nicht auf der Straße sein.»
«Du hast den Mann gehört, er will nicht bleiben», sagte Jon.
«Wundert dich das?», fuhr sie ihn an und wandte sich wieder an mich. «Bitte. Das zumindest können wir tun, nachdem wir Sie mit der Waffe in der Hand empfangen haben.»
Ich wollte ablehnen. Sturm hin oder her, das Risiko war es mir wert. Aber bevor ich etwas sagen konnte, rissen Blitze den Himmel auf, die heller waren als das Flutlicht. Sie flackerten und erstarben, dann dröhnte ohrenbetäubendes Donnern durch die Nacht, das sogar im Wagen spürbar war.
«Jetzt ist Kiran bestimmt wach geworden», sagte die Frau nervös und sah sich kurz zum dunklen Hotel um. «Tut mir leid, unser Baby schläft da drinnen. Wenn er aufwacht und wir nicht da sind, gibt das eine Katastrophe. Sag ihm, dass er bleiben muss, Jon.»
«Was? Nisha, warte …»
Aber sie rannte schon zurück zum Hotel und verschwand in der Dunkelheit außerhalb des Flutlichts. Er starrte ihr nach, das Gewehr hing wie eine vergessene Requisite in seiner Hand, dann seufzte er.
«Hören Sie …» Er schien nach Worten zu suchen. «Sie hat recht, Sie sollten bleiben. Fahren wäre nicht sicher.»
«Danke, aber es geht schon.»
«Ihre Entscheidung.» Er wandte sich ab und ging, zum Schutz gegen den Regen vornübergebeugt. Über die Schulter rief er mir zu: «Falls Sie sich’s anders überlegen, gehen Sie hinten ums Haus rum.»
Ich schloss erleichtert das Fenster, als auch er in der Dunkelheit verschwand. Aber schnell stellte sich Unsicherheit ein. Allerdings auch eine gewisse Fassungslosigkeit. Ich würde jeden für verrückt erklären, der überlegte, bei einer Person zu übernachten, die ihn gerade mit einer Schusswaffe bedroht hatte. Die Annahme, Tod und Gewalt würden nur anderen zustoßen, war ein Irrglaube, das wusste ich aus erster Hand.
Trotzdem hatte ich seltsamerweise nicht das Gefühl, in Gefahr zu sein. Der Schock über den Blick in zwei Mündungslöcher war fast vergessen, von einem einzigen Satz entschärft.
Unser Baby schläft da drinnen.
Es mochte irrational sein, aber der Satz beruhigte mich. Wenn die beiden mir schaden wollten, hätten sie ausreichend Gelegenheit dazu gehabt. Und was war gefährlicher? Bei Fremden zu übernachten oder bei diesem Wetter weiterzufahren, müde und orientierungslos?
Plötzlich ging das Flutlicht aus, die Welt versank im Dunkeln. Entweder rechneten die beiden nicht mehr mit mir, oder es gab eine Zeitschaltung. Egal, ich konnte nicht die ganze Nacht hier sitzen. Wie um mich zu einer Entscheidung zu drängen, zuckten wieder Blitze über den Himmel, gefolgt von lautem Donner. Mir fiel der Brief in meiner Jackentasche ein, und plötzlich hatte ich mich entschieden.
Ich nahm meine Laptoptasche und die Jacke von der Rückbank und begab mich hinaus in den Sturm.
Mein Bürostuhl quietschte, als ich mich zurücklehnte, um die Fotos auf meinem Laptop zu betrachten. Der Kaffee, der auf meinem Schreibtisch stand, wurde kalt, er war nicht vergessen, aber nicht mehr gewollt. Die Bilder auf dem Monitor waren drastisch. Sie zeigten verweste menschliche Überreste in einem Graben, von verschiedenen Seiten fotografiert. Die Identität des Toten war nicht bekannt, ebenso wenig Alter, Geschlecht oder Herkunft. Der Körper befand sich im Zustand der Verwesung und war aufgebläht von Gasen, die bei der Zersetzung von Zellen und Gewebe durch Bakterien und Verdauungssäfte entstehen. Die Haut war nachgedunkelt und hatte die Farbe von Karamell, was zu Lebzeiten nicht unbedingt der Fall gewesen sein musste. Sie hatte begonnen, sich wie altes Packpapier abzuschälen, und Schmeißfliegenlarven – Maden – sammelten sich um natürliche wie unnatürliche Öffnungen herum wie verschüttete Reiskörner.
Die Fotos hatte mir ein ehemaliger Kollege geschickt, zusammen mit dem Obduktionsbericht. Der äußere Zustand des Leichnams schien den Laborergebnissen zu widersprechen, was zu einem Streit über den Todeszeitpunkt geführt hatte. Da bekannt war, dass ich an ähnlichen Fällen gearbeitet hatte, war ich um eine zweite Meinung gebeten worden.
Normalerweise interessierte ich mich sehr für solche Fragen. Als forensischer Anthropologe befasste ich mich hauptsächlich damit, was nach dem Tod mit Knochen passiert. Aber schon am Anfang meiner beruflichen Laufbahn hatte ich den Blick geweitet, um die gesamte Metamorphose zu verstehen, die mit dem Lebensende einsetzt: die physischen Prozesse, durch die ein atmendes Individuum, das zu Liebe und Fantasie fähig war, zu kalzifizierten Überresten wird. Normalerweise hätte ich große Lust gehabt, einen derart komplizierten Fall zu entwirren.
Aber nicht heute.
Die Nachricht, die mich am Tag zuvor erreicht hatte, wirkte nach. Als ich von der Uni nach Hause gekommen war, hatte zwischen Werbesendungen und Flyern ein Brief auf dem Fliesenboden meiner Wohnung in Camden gelegen. Ich hatte die Schrift erkannt und gelächelt, auch wenn ich mich verdutzt fragte, warum sie einen Brief schrieb, anstatt eine Mail zu schicken oder anzurufen.
Als ich ihn las, verstand ich.
In der Nacht hatte ich kaum geschlafen. Als ich am Morgen ins Forensische Institut kam, bemühte ich mich, den Brief zu verdrängen, aber mein Hirn weigerte sich. Selbst beim Anblick der schrecklichen Bilder auf meinem Laptop schweiften meine Gedanken ab.
Dann klingelte das Telefon, die Nummer war unbekannt. Froh über die Ablenkung griff ich zum Hörer.«David Hunter.»
Am anderen Ende meldete sich eine Frauenstimme. «Entschuldigen Sie, dass ich so überfallartig anrufe, Dr. Hunter. Ich bin Detective Sergeant Chaudry von der Cumbria Police. Hätten Sie kurz Zeit für ein Gespräch?»
Hatte ich.
«Wir bereiten eine Suchaktion nach einem Teenager vor», sagte Chaudry. «Sechzehnjähriger Junge aus Carlisle, seit sechs Monaten vermisst. War schon früher ein paarmal ausgerissen, daher hat sich niemand allzu große Sorgen gemacht. Aber wir haben einen Hinweis bekommen, dass er an einer Überdosis gestorben ist und der Dealer den Leichnam in einem verlassenen Industriegebiet am Rand von Carlisle vergraben hat. Wir brauchen für die Suche einen forensischen Anthropologen, und Sie sind uns empfohlen worden.»
Fast hätte ich auf der Stelle zugesagt, aber praktische Überlegungen hielten mich ab. Cumbria war weit weg. «Gibt’s bei Ihnen niemanden in der Nähe, der das übernehmen kann?»
Als ich angefangen hatte, waren forensische Anthropologen noch eine recht seltene Spezies gewesen. Damals war ich in alle Ecken und Winkel des Landes gerufen worden, aber da in den letzten Jahren viele neue Kollegen und Kolleginnen nachgerückt waren, wurde normalerweise jemand einbestellt, der oder die in der Nähe war. Auch wenn ein guter Ruf noch etwas zählte.
«Nicht so kurzfristig», sagte Chaudry. «Und DCI Perry, die leitende Ermittlerin, hat schon mal mit Ihnen zusammengearbeitet. In den Grampian Mountains, bevor sie hierher versetzt wurde. Damals war sie erst Police Constable, vielleicht erinnern Sie sich nicht, meint sie.»
Das stimmte. Ich erinnerte mich, an einer Suche in den kalten Bergen Schottlands beteiligt gewesen zu sein, aber nicht an eine PC Perry. Allerdings war das auch lange her. Sehr lange, wenn Chaudrys leitende Ermittlerin inzwischen zur Detective Chief Inspector befördert worden war.
«Wann brauchen Sie mich denn?», fragte ich und versuchte, mich nicht alt zu fühlen.
«Das Briefing findet morgen Nachmittag statt, das sollte für die Anreise reichen. Wenn Sie nicht mit dem Auto fahren wollen, gibt es jede Menge Zugverbindungen.»
Ich war an so lange Fahrten nicht mehr gewöhnt. Aber dann stellte ich mir vor, stundenlang mit meinen Gedanken in einem Zugwaggon eingesperrt zu sein.
«Schon gut, ich nehme das Auto …»
Ich riss die Augen auf. Einen Moment lang wusste ich nicht, wo ich war. Anstatt in meinem Büro im Institut saß ich aufrecht in einem fremden Raum. In einer Küche, die ich nicht kannte. Dann kehrte die Erinnerung zurück.
Ich war im Hotel. Hillside House.
Ich rieb mir den verspannten Nacken. In der großen, hell erleuchteten Küche war es so warm, dass mir der Kopf dröhnte. Es roch nach hausgemachtem Auflauf oder Eintopf. Der Raum diente außerdem als Ess- und Wohnzimmer, in der einen Hälfte standen ein durchgesessenes Sofa und mehrere Sessel um einen auf stumm gestellten Fernseher herum, die Küche und ein alter Esstisch, an dem ich saß, nahmen die andere Hälfte ein. Altmodische Utensilien, Resopalschränke aus den Siebzigern und ein mit Holz befeuerter gusseiserner Aga-Herd, der noch älter aussah. Aus dem Rahmen fielen zwei große Computermonitore auf einem alten, zum Homeoffice umfunktionierten Schulpult. Davor stand ein Küchenstuhl mit einem großen Kissen, das für Sitzkomfort sorgen sollte.
Ich war allein.
Im Dunkeln hatte ich mich vom Auto auf den Weg gemacht.
Das Flutlicht war nicht wieder angegangen, daher hatte ich die für Carlisle gepackte Reisetasche geschultert und war im Schein meiner Handy-Taschenlampe durch den Eisregen gestapft. Ein schlammiger Kiesweg führte um das Gebäude herum. Ich musste mich an einem neben dem Haus parkenden Fahrzeug vorbeidrängen. Von der Umgebung konnte ich wegen der hohen Wände und der wild im Wind schwankenden Büsche nicht viel erkennen. Hinter dem Haus erhellte die Taschenlampe etwas, das nach einem zerzausten Nutzgarten aussah, die Äste der Obstbäume ähnelten im Sturm Skelettarmen. Dahinter lag nichts als schwarze Finsternis.
Der Pfad führte zu einem niedrigen Anbau, dessen Licht mir vorkam wie eine Bake in der Dunkelheit, dennoch hatte ich an der Tür gezögert. Der Wind zerrte an meiner Winterjacke, Graupel prasselte auf die Kapuze, als ich unschlüssig vor dem Milchglas stand.
Bist du sicher, dass du das willst?
Die Antwort lautete nein, aber die Alternativen waren auch nicht besser. Ich klopfte, und ein paar Sekunden später wurde die Tür geöffnet. Der Mann machte eine Kopfbewegung und trat beiseite.
«Kommen Sie rein.»
Er klang über mein Erscheinen so erfreut, wie er aussah. Aber als ich eintrat und er hinter mir die Tür schloss, lächelte die Frau mich mit echter Wärme an.
«Hi, ich bin froh, dass Sie bleiben wollen! Ich habe mir schon Sorgen gemacht.»
Sie hielt ein Baby auf dem Arm, noch nicht ganz ein Kleinkind, und wiegte es sanft hin und her. Der kleine Junge betrachtete mich verdrossen aus tränennassen, dunklen Augen. Seine Mutter beruhigte ihn. Ihr schwarzes Haar war zu einem losen Pferdeschwanz gebunden.
«Alles gut, Kiran, das ist ein Gast.»
Kiran war nicht beeindruckt und vergrub das Gesicht in der Schulter seiner Mutter.
«Ich hoffe, ich habe ihn nicht geweckt.»
«Keine Sorge, das war der Donner, nicht Sie.» Sie lächelte, wieder wurden ihre harten Gesichtszüge weicher.
«Ich bin übrigens Nisha. Und das ist Kiran.»
«David. David Hunter.»
«Sag Hallo, Kiran.» Nisha versuchte, ihren Sohn dazu zu bewegen, den Kopf zu heben, aber er wollte nichts davon wissen.
«Kiran ist etwas ungnädig, wenn man ihn weckt», sagte sie und gab auf.
«Sind wir das nicht alle?», murmelte ihr Mann im Vorbeigehen.
«Hast du dich schon vorgestellt oder warst du zu beschäftigt?», fragte seine Frau schnippisch.
Er sah sie böse an, bevor er mir widerwillig zunickte. «Jon Reese.»
Ohne den Parka sah er jünger aus, wie Mitte oder Ende dreißig vielleicht. Seine Haut war blass, die Farbe, die immer windverbrannt aussieht, das kurz geschnittene Haar und der zerzauste Bart waren rostbraun. Er war muskulös und knochig, und seine breiten Schultern ließen vermuten, dass er auch ohne Schusswaffe Schaden anrichten konnte.
«Danke für die Einladung», sagte ich und stellte meine Tasche ab. «Ich bin froh, dass mir die Übernachtung im Wagen erspart bleibt, und zahle gern für das Zimmer.»
«Auf keinen Fall! Das ist das Mindeste, was wir tun können, nachdem …» Nisha wand sich. «Na ja. Sie wissen schon.»
Nachdem wir Sie mit einer Schusswaffe bedroht haben, wollte sie sagen. Sie bemerkte, dass mein Blick auf das Gewehr fiel, das neben der Tür an der Wand lehnte.
«Jon wollte es gerade wegräumen», sagte sie schnell. «Nicht wahr, Jon?»
«Es muss erst getrocknet werden.»
«Das kannst du später machen.»
Reese zog schweigend Stiefel und Parka an und nahm das Gewehr. «Zufrieden?», fragte er, öffnete die Tür und verschwand.
Die Tür knallte hinter ihm zu.
Das Lächeln seiner Frau konnte die Spannung nicht übertünchen, als sie sich wieder an mich wandte und ihren Sohn in eine bessere Position schob.
«Sie müssen kurz warten, bis ich Ihr Zimmer hergerichtet habe, Sie können sich also setzen. Möchten Sie Tee oder Kaffee oder was zu essen? Es ist Auflauf aus Limabohnen und Wurzelgemüse da, falls Sie Hunger haben.»
«Danke, ich habe schon im Pub ein Sandwich und einen Kaffee bekommen.»
Ich setzte mich an den Küchentisch und versuchte, nicht allzu auffällig zu den beiden Computermonitoren in der Ecke hinüberzuschauen. Auf beiden war dasselbe Bild, ein junger Mann mit nacktem, muskulösem Oberkörper an einem Sportgerät, darüber komplizierte Grafiken und Buchstaben.
«Das ist bloß Arbeit, nichts Verruchtes», sagte Nisha, ging zu den Monitoren und versetzte sie in den Ruhemodus. «Ich designe eine neue Webseite für einen Fitnessclub. Und habe versprochen, morgen fertig zu sein.»
«Lassen Sie sich von mir nicht stören …»
«Schon gut, ist sowieso Zeit für eine Pause. Den Rest kann ich morgen früh fertig machen.» Sie lächelte, als ihr Sohn ihr die pummelige Hand ins Gesicht stupste, und tat so, als würde sie reinbeißen, was ein ansteckendes Glucksen auslöste. «Ich bringe das kleine Monster ins Bett und richte dann Ihr Zimmer her. Machen Sie sich’s bequem.»
Das hatte ich getan, mehr als beabsichtigt. Der klobige Herd gab eine Bullenhitze ab, in der ich eingedöst war, allerdings nur für ein paar Minuten, wie ein Blick auf die Uhr zeigte. Ich rieb mir die Augen und war froh, dass niemand es mitbekommen hatte. Jon war noch nicht zurück, aber bevor ich darüber nachdenken konnte, wo er wohl steckte, ging die Tür auf, und Nisha kam in die Küche.
«Ist Jon noch nicht wieder da?», fragte sie und schaute sich um.
«Ich habe ihn nicht gesehen.»
Etwas, das Sorge oder Verärgerung hätte sein können, huschte über ihr Gesicht, aber sie verbarg es schnell. «Er kramt bestimmt in der Werkstatt rum.»
Sie bemühte sich, entspannt zu klingen, wirkte aber nervös. Ich fragte mich, ob sie es inzwischen bereute, einen fremden Mann in ihr Haus eingeladen zu haben. Aber ihr Lächeln wirkte herzlich, als sie die Tür aufhielt, durch die sie gerade hereingekommen war.
«Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer, ja?»