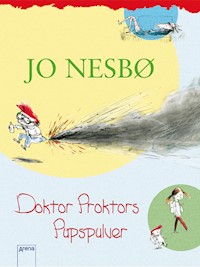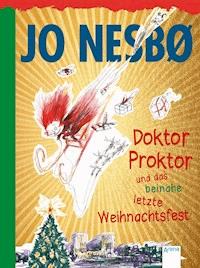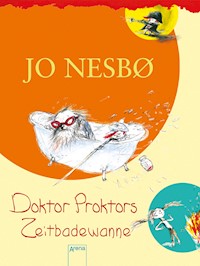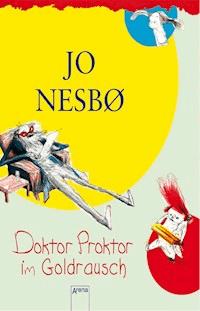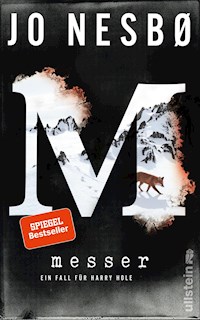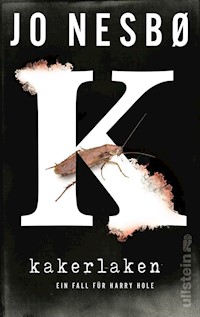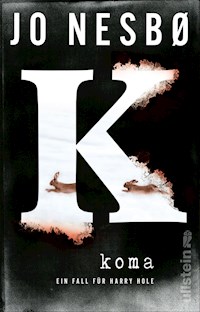
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Ein junges Mädchen wird tot im Wald gefunden. Sie wurde brutal vergewaltigt. Zehn Jahre später wird an derselben Stelle ein Polizist getötet, sein Gesicht ist grausam entstellt. Eine Sonderkommission ermittelt unter Hochdruck. Doch es geschehen weitere Morde. Die Polizei hat keine Spur, und ihr bester Ermittler Harry Hole fehlt. In einem Krankenhaus liegt ein schwerverletzter Mann im Koma. Das Zimmer wird von der Polizei bewacht. Niemand soll erfahren, wer der geheimnisvolle Patient ist. Denn er hat einen Feind. Und der ist überall. Spannung pur – der beste Harry Hole aller Zeiten! Entdecken Sie auch MESSER, den neuen großen Kriminalroman um Kommissar Harry Hole!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Ein junges Mädchen wird tot im Wald gefunden. Sie wurde brutal vergewaltigt. Zehn Jahre später wird an derselben Stelle ein Polizist getötet, sein Gesicht ist grausam entstellt. Eine Sonderkommission ermittelt unter Hochdruck. Doch es geschehen weitere Morde. Die Polizei hat keine weitere Spur, und ihr bester Ermittler Harry Hole fehlt.
Der Autor
Jo Nesbø, 1960 geboren, ist Ökonom, Schriftsteller und Musiker. Er gehört zu den renommiertesten und erfolgreichsten Krimiautoren weltweit. Sein Roman Schneemann wird von Martin Scorsese verfilmt. Jo Nesbø lebt in Oslo.
Von Jo Nesbø sind in unserem Hause bereits erschienen:
Fledermausmann (Harry Holes 1. Fall)Kakerlaken (Harry Holes 2. Fall)Rotkehlchen (Harry Holes 3. Fall)Fährte (Harry Holes 4. Fall)Das fünfte Zeichen (Harry Holes 5. Fall)Erlöser (Harry Holes 6. Fall)Schneemann (Harry Holes 7. Fall)Leopard (Harry Holes 8. Fall)Larve (Harry Holes 9. Fall)Koma (Harry Holes 10. Fall)Durst (Harry Holes 11. Fall)Messer (Harry Holes 12. Fall)
Außerdem:
HeadhunterDer SohnBlood on Snow. Der Auftrag · Blood on Snow. Das Versteck
Jo Nesbø
Koma
Kriminalroman
Aus dem Norwegischenvon Günther Frauenlob
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Die Originalausgabe erschien 2013unter dem Titel Politi bei Aschehoug, Oslo.
ISBN 978-3-8437-0627-8
© 2013 by Jo Nesbø
© der deutschsprachigen Ausgabe2013 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Published by agreement with Salomonsson Agency
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Titelabbildung: plainpicture/© Jim Brandenburg (Hasen); Shutterstock / © Le Panda (Ausfransung); © Archiv Büro Jorge Schmidt (Hintergrund)
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung,
Verbreitung, Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich
verfolgt werden.
eBook: LVD GmbH, Berlin
Prolog
Sie lag hinter der Tür und schlief.
Der Eckschrank roch im Innern nach altem Holz, Pulver und Waffenöl. Schien die Sonne durch das Fenster des Raums, fiel ein dünner Streifen Licht durch das Schlüsselloch und ließ die Pistole auf dem mittleren Brett matt aufblitzen. Es war eine russische Odessa, eine Kopie der etwas bekannteren Stetschkin-Pistole.
Die Waffe hatte ein bewegtes Leben hinter sich. Sie war mit den Kulaken von Litauen nach Sibirien gezogen, war zwischen den verschiedenen Hauptquartieren der Urkas in Südsibirien hin und her gewandert, hatte einem Ataman gehört – einem Anführer der Kosaken, der mit seiner Odessa in der Hand von der Polizei getötet worden war –, bevor sie schließlich in den Besitz eines waffensammelnden Gefängnisdirektors in Tagil gelangt war. Zu guter Letzt war die hässliche, kantige Maschinenpistole von Rudolf Asajev, der vor seinem Verschwinden den Osloer Drogenmarkt an sich gerissen und mit seinem neuen Opioid Violin ein Monopol aufgebaut hatte, nach Norwegen gebracht worden. Und hier befand die Waffe sich noch immer, genauer gesagt im Holmenkollveien in Oslo, im Haus von Rakel Fauke. Das Magazin der Odessa umfasste zwanzig Kugeln des Kalibers Makarov 9x18 mm, und sie schoss sowohl Einzelschüsse als auch Salven. Jetzt waren noch zwölf Kugeln im Magazin. Drei Patronen waren für Kosovo-Albaner verwendet worden, die Asajev Konkurrenz auf dem Drogenmarkt gemacht hatten, doch nur eine davon hatte Fleisch zu schmecken bekommen.
Zwei weitere Schüsse hatten Gusto Hanssen getötet, einen jungen Dieb und Dealer, der Geld und Drogen von Asajev unterschlagen hatte. Die letzten drei Kugeln waren erst vor kurzem abgefeuert worden, die Pistole roch noch immer danach. Sie hatten den früheren Polizisten Harry Hole, der im Mordfall Gusto Hanssen ermittelte, in Brust und Kopf getroffen, am gleichen Tatort, in der Hausmanns gate 92.
Die Polizei hatte den Hanssen-Fall noch nicht gelöst. Der 18-jährige Junge, der zuerst festgenommen worden war, musste wieder auf freien Fuß gesetzt werden, unter anderem weil es der Polizei nicht gelungen war, ihn mit der Mordwaffe in Verbindung zu bringen. Dieser Junge hieß Oleg Fauke. Er schrak jede Nacht aus dem Schlaf auf und starrte ins Dunkle, weil er wieder und wieder die Schüsse hörte. Nicht die, mit denen er Gusto getötet hatte, sondern die anderen, die er auf den Polizisten abgefeuert hatte, der in seiner Jugend so etwas wie ein Vater für ihn gewesen war. Harry Hole. Von dem er sich gewünscht hatte, dass er seine Mutter Rakel heiratete. Harrys Blick brannte vor Oleg im Dunkeln, und die Gedanken des Jungen wanderten immer wieder zu der Pistole im Eckschrank, die er niemals wiedersehen wollte. Die niemand je wiedersehen durfte. Die für alle Ewigkeiten dort drinnen schlafen sollte.
Er lag hinter der Tür und schlief.
Das bewachte Krankenhauszimmer roch nach Medizin und Farbe. Neben dem Bett stand ein Monitor, der jeden Herzschlag aufzeichnete.
Isabelle Skøyen, Sozialsenatorin im Osloer Rathaus, und Mikael Bellman, der frisch ernannte Polizeipräsident, hofften, dass sie ihn niemals wiedersehen müssten.
Dass niemand ihn je wiedersah.
Dass er für alle Ewigkeit dort drinnen schlief.
Teil I
Kapitel 1
Ein langer, spätsommerlicher Septembertag ging zu Ende. Das Licht verwandelte den Oslofjord in geschmolzenes Silber, und die Hügel ringsherum, die bereits den nahenden Herbst ankündigten, glühten in warmen Farben. Es war einer dieser Tage, an denen die Osloer darauf schworen, dass sie diese Stadt niemals, niemals verlassen würden. Die Sonne ging langsam hinter dem Ullern unter, und die letzten Strahlen strichen flach über die Landschaft und fielen auf niedrige, bescheidene Mietshäuser, die noch die ärmlichen Ursprünge der Stadt erkennen ließen, auf toprenovierte Penthousewohnungen mit Terrassen, von denen fast das Öl tropfte, welches das Land ganz plötzlich zu einem der reichsten der Welt gemacht hatte, und auf die Junkies am oberen Ende des Stensparks. Die Stadt war klein und wohlgeordnet, und doch gab es dort mehr Drogentote als in anderen europäischen Städten, die achtmal größer waren. Das Licht fiel auf Gärten mit Trampolinen, die mit Netzen gesichert waren und auf denen nie mehr als drei Kinder gleichzeitig hüpften, weil dies so in der Gebrauchsanweisung stand. Und auf die bewaldeten Hügel, die den Osloer Kessel, wie er genannt wurde, einrahmten. Die Sonne konnte sich noch nicht von der Stadt trennen und streckte ihre Strahlenfinger aus, als wollte sie den Abschied in die Länge ziehen.
Der Tag hatte kalt und klar begonnen, und das Licht war fast wie in einem Operationssaal gewesen. Im Laufe des Tages waren die Temperaturen gestiegen, der Himmel war tiefblau geworden, und die Luft hatte die angenehme Stofflichkeit bekommen, die den September zum schönsten Monat des Jahres machte. Und als die Dämmerung sich weich und vorsichtig über die Stadt legte, duftete es im Villenviertel an den Hängen hinauf zum See Maridalsvannet nach Äpfeln und sonnenwarmen Kiefernwäldern.
Erlend Vennesla näherte sich dem höchsten Punkt der letzten Steigung. Er spürte die Milchsäure in seinen Muskeln, konzentrierte sich aber weiter darauf, vertikal und mit leicht nach innen zeigenden Knien seine Klickpedale zu treten. Die richtige Technik war wichtig. Erst recht, wenn man müde wurde und das Hirn plötzlich Lust verspürte, die Position zu ändern, um weniger erschöpfte, aber eben auch weniger effektive Muskeln zu belasten. Er spürte, wie der Fahrradrahmen jedes Watt, das er trat, absorbierte und ausnutzte, wie er beschleunigte, wenn er einen größeren Gang einlegte, sich aufrichtete und im Stehen fuhr, um die Frequenz beizubehalten, etwa neunzig Tritt pro Minute. Er sah auf seine Pulsuhr. Hundertachtundsechzig. Dann richtete er das Licht seiner Stirnlampe auf das am Lenker befestigte GPS, das über eine Detailkarte des Großraums Oslo und einen aktiven Sender verfügte. Das Fahrrad hatte inklusive Sonderausstattung mehr gekostet, als ein frisch pensionierter Kriminalbeamter sich eigentlich leisten konnte. Aber jetzt, wo das Leben andere Herausforderungen bot, war es wichtig, sich in Form zu halten.
Weniger Herausforderungen, wenn er ehrlich war.
Die Milchsäure biss immer fester in seine Schenkel und Waden, aber der Schmerz weckte bereits die Vorfreude auf das Fest der Endorphine, das auf ihn wartete, wenn er es geschafft hatte. Die mürben Muskeln. Das gute Gewissen. Das Bier auf dem Balkon gemeinsam mit seiner Frau, vorausgesetzt, die Temperaturen gingen nach Sonnenuntergang nicht gleich wieder so drastisch in den Keller.
Und dann war er oben. Die Straße wurde flacher, und vor ihm lag der See Maridalsvannet. Er ließ das Rad rollen. Mit einem Mal war er auf dem Land. Es war schon absurd, dass man nach fünfzehn Minuten schnellem Radfahren aus dem Zentrum einer europäischen Hauptstadt plötzlich von Feldern, Höfen und Wald umgeben war, durch dessen abendliches Dunkel zahllose Wege führten. Der Schweiß ließ seine Kopfhaut unter dem koksgrauen Bell-Fahrradhelm jucken, der so viel gekostet hatte wie das Fahrrad, das er seiner Enkelin Line Marie zum sechsten Geburtstag geschenkt hatte. Aber Erlend Vennesla behielt den Helm auf. Die meisten tödlichen Fahrradunfälle waren auf Kopfverletzungen zurückzuführen.
Er sah auf seine Pulsuhr. Hundertfünfundsiebzig. Hundertsiebenundsiebzig. Ein willkommener, leichter Windhauch trug entfernten Jubel aus der Stadt zu ihm nach oben. Das musste aus dem Ullevål-Stadion kommen, in dem an diesem Abend ein wichtiges Länderspiel lief, Slowakei oder Slowenien, aber Erlend Vennesla stellte sich einen Moment lang vor, der Jubel gelte ihm. Es war eine Weile her, dass ihm zuletzt applaudiert worden war. Vermutlich war das bei seiner Verabschiedung im Hauptsitz des Kriminalamts oben in Bryn gewesen. Es hatte Sahnekuchen gegeben, und sein Chef, Mikael Bellman, der seitdem die Karriereleiter immer weiter nach oben geklettert war, hatte ihm zu Ehren eine Rede gehalten. Erlend hatte den Applaus entgegengenommen, alle Blicke erwidert, sich bedankt und gespürt, wie sein Hals sich zusammengezogen hatte, als er, ganz den Traditionen des Kriminalamts entsprechend, seine einfache, kurze und auf Tatsachen basierende Dankesrede gehalten hatte. Als Ermittler hatte er seine Höhen und Tiefen erlebt, wobei ihm die ganz großen Fehler erspart geblieben waren. Auf jeden Fall soweit er wusste, ganz sicher konnte man sich ja nie sein. Ein paar Fragen waren nie endgültig beantwortet worden. Fragen, auf die man jetzt, da die DNA-Analysetechnik so weit fortgeschritten war, dass die Polizeileitung angedeutet hatte, ein paar alte Fälle wieder aufrollen zu wollen, Antworten zu bekommen riskierte. Unerwartete Antworten. Ergebnisse. Solange es sich um ungeklärte Fälle handelte, war das natürlich in Ordnung, aber Erlend verstand nicht, wieso man Ressourcen darauf verwenden wollte, in alten, längst aufgeklärten und erledigten Fällen herumzuwühlen.
Trotz des Lichtes der Straßenlaternen wäre er fast an dem Holzschild vorbeigefahren, das in den Wald zeigte. Da war es. Genau so, wie er es in Erinnerung hatte. Er bog von der Straße ab, kam auf einen weichen Waldweg und fuhr so langsam, wie es ging, ohne das Gleichgewicht zu verlieren, weiter. Der Lichtkegel seiner Stirnlampe, die er außen auf dem Helm angebracht hatte, schweifte über den Weg und blieb an den dunklen Kiefern auf beiden Seiten hängen. Schatten huschten vor ihm her, ängstlich und scheu, verwandelten sich und verschwanden im Dickicht. Genau so hatte er es sich vorgestellt, als er sich in ihre Situation zu versetzen versucht hatte. Rennend, mit einer Lampe in der Hand, auf der Flucht, eingesperrt und vergewaltigt, drei lange Tage.
Als Erlend Vennesla das Licht sah, das in diesem Moment vor ihm eingeschaltet wurde, dachte er für den Bruchteil einer Sekunde, dass es ihre Taschenlampe war, dass sie wieder auf der Flucht war und er auf einem Motorrad saß und ihr immer näher kam. Das Licht vor Erlend flackerte, bevor es auf ihn gerichtet wurde. Er blieb stehen, stieg vom Rad ab und richtete die Stirnlampe auf seine Pulsuhr. Unter hundert. Nicht schlecht.
Er löste den Kinnriemen, zog den Helm ab und kratzte sich am Kopf. Mein Gott, wie gut das tat. Dann schaltete er die Stirnlampe aus, hängte den Helm an die Lenkstange und schob sein Fahrrad auf das Licht der Taschenlampe zu. Der baumelnde Helm stieß gegen sein Handgelenk.
Als das Licht nach oben zuckte, blieb er stehen. Die hellen Strahlen blendeten ihn. Und geblendet dachte er, dass er doch noch ziemlich keuchte, erstaunlich, bei dem niedrigen Puls. Er ahnte eine Bewegung hinter dem großen, zitternden Kreis aus Licht. Dann ging ein Pfeifen durch die Luft und im selben Moment schoss ihm durch den Kopf, dass er den Helm nicht hätte absetzen sollen. Die meisten tödlichen Fahrradunfälle …
Der Gedanke geriet ins Stocken, die Zeit hakte, die Bildleitung wurde für einen Augenblick unterbrochen.
Erlend Vennesla starrte überrascht nach vorn und spürte einen warmen Schweißtropfen über seine Stirn laufen. Er sprach, aber seine Worte ergaben keinen Sinn, als gäbe es einen Kopplungsfehler zwischen Hirn und Mund. Wieder hörte er das leise Pfeifen. Dann nichts mehr. Alle Geräusche waren weg, nicht einmal seinen eigenen Atem hörte er noch. Und er bemerkte, dass er kniete und das Fahrrad langsam in den Graben kippte. Vor ihm tanzte das gelbe Licht, verschwand aber, als die Schweißtropfen seine Nasenwurzel erreichten, ihm in die Augen flossen und ihm die Sicht nahmen. Erst jetzt begriff er, dass das kein Schweiß war.
Der dritte Schlag fühlte sich an, als würde ein Eiszapfen durch seinen Kopf in seinen Hals, ja bis in seinen Körper getrieben. Alles gefror.
Ich will nicht sterben, dachte er und versuchte, schützend einen Arm zu heben, doch er konnte sich nicht bewegen, nicht ein Glied, er war gelähmt.
Den vierten Schlag registrierte er nicht mehr, aber aus dem Geruch der nassen Erde schloss er, dass er inzwischen am Boden lag. Er blinzelte mehrmals und konnte plötzlich auf einem Auge wieder sehen. Direkt vor sich erkannte er ein paar große, dreckige Stiefel im Schlamm. Die Absätze lösten sich vom Boden, dann die ganzen Stiefel. Und landeten wieder. Dieser Prozess wiederholte sich, erst gingen die Absätze hoch, dann die Sohlen. Als ob sich derjenige, der schlug, vom Boden abstieß, um noch mehr Kraft in seine Schläge legen zu können. Der letzte Gedanke, der ihm durch den Kopf ging, war, dass er nicht vergessen durfte, wie seine Enkelin hieß, er musste ihren Namen behalten.
Kapitel 2
Anton Mittet nahm den halbvollen Plastikbecher aus der kleinen roten Nespresso-D-290-Maschine, bückte sich und stellte ihn auf den Boden. Einen Tisch gab es nicht. Dann drehte der Polizist die längliche Schachtel um, fischte eine weitere Kapsel heraus, überprüfte automatisch, ob die dünne Metallfolie des Deckels auch nicht perforiert war, und steckte sie in die Espressomaschine. Er stellte einen leeren Plastikbecher unter den Hahn und drückte auf einen der leuchtenden Knöpfe.
Während die Maschine zu prusten und stöhnen begann, sah er auf die Uhr. Es war bald Mitternacht. Wachablösung. Er wurde zu Hause erwartet, wollte die Neue aber trotzdem erst noch in ihre Aufgabe einweisen, schließlich kam seine Kollegin direkt von der Polizeischule. Er glaubte sich zu erinnern, dass sie Silje hieß. Anton Mittet starrte auf den Hahn. Hätte er auch für einen männlichen Kollegen Kaffee gemacht? Er wusste es nicht, aber eigentlich war es ihm auch egal, er dachte schon lange nicht mehr über solche Fragen nach. Es war so still geworden, dass er die letzten, klaren Tropfen in den Plastikbecher fallen hörte. Eigentlich hatte das, was am Schluss kam, weder Farbe noch Geschmack, aber es war wichtig, alles mitzunehmen, schließlich würde es für die junge Frau eine lange Nacht werden. Ohne Gesellschaft, ohne Abwechslung, einzig mit der Aufgabe, an die kahlen farblosen Betonwände des Reichshospitals zu starren. Wahrscheinlich war er deshalb auf den Gedanken gekommen, vor seinem Nachhauseweg noch einen Kaffee mit ihr zu trinken. Er nahm die beiden Becher und ging zurück. Seine Schritte hallten von den Wänden wider. Er passierte verschlossene Türen, hinter denen nichts anderes war als weitere kahle Wände, das hatte er überprüft. Mit dem Reichshospital hatten die Norweger für die Zukunft geplant, wohl wissend, dass die Bevölkerungszahl wuchs und es irgendwann mehr ältere, kränkere und anspruchsvollere Menschen geben würde. Man hatte Weitsicht gezeigt, wie die Deutschen mit ihren Autobahnen und die Schweden mit ihren Flughäfen. Aber hatten die wenigen Autofahrer, die in den dreißiger Jahren in einsamer Majestät über die mastodontischen Betontrassen durch das bäuerliche Deutschland gefahren waren, oder die schwedischen Passagiere, die in den sechziger Jahren durch die überdimensionierten Hallen Arlandas gelaufen waren, auch das Gefühl gehabt, dass es spukte? Dass irgendetwas umging, obwohl alles neu und unbesudelt war und noch niemand bei einem Verkehrsunfall oder Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war? Dass das Licht der Scheinwerfer jeden Augenblick eine Familie am Straßenrand einfangen konnte, die ausdruckslos ins Licht starrte? Blutig, blass, der Vater durchbohrt, die Mutter mit verdrehtem Kopf und das Kind mit auf einer Seite abgerissenem Arm und Bein? Dass durch den Plastikvorhang des Gepäckbandes in der Ankunftshalle von Arlanda plötzlich verbrannte, noch immer glühende Leichen kamen, die mit dem Gummi verschmolzen und aus deren weit aufgerissenen, dampfenden Mündern stumme Schreie drangen? Keiner der Ärzte hatte ihm sagen können, wofür dieser Flügel verwendet werden sollte, sicher war nur, dass hinter diesen Türen einmal Menschen sterben würden. Die unsichtbaren Körper mit ihren ruhelosen Seelen waren längst da.
Anton bog um eine Ecke, und ein neuer Flur erstreckte sich vor ihm, notdürftig beleuchtet, ebenso kahl und weiß und sich symmetrisch nach hinten verjüngend, so dass die uniformierte, junge Frau auf dem Stuhl am Ende des Flurs wie ein Miniaturbild auf einer großen weißen Leinwand aussah.
»Hier, ich habe Ihnen einen Kaffee mitgebracht«, sagte er, als er vor ihr stand. War sie zwanzig? Zweiundzwanzig?
»Danke, aber ich habe selbst welchen dabei«, antwortete sie und nahm eine Thermoskanne aus dem kleinen Rucksack, den sie neben ihren Stuhl gestellt hatte. In ihrer Stimme war eine kaum hörbare Melodie, die Reste eines nördlichen Dialekts?
»Der hier ist besser«, sagte er noch immer mit ausgestreckter Hand.
Sie zögerte und nahm den Becher.
»Und gratis«, sagte Anton, legte die Hand hinter den Rücken und rieb diskret die heißen Fingerkuppen an dem kalten Stoff der Jacke. »Die Maschine ist nur für uns, sie steht hinten im Flur beim …«
»Ich weiß, ich habe sie gesehen, als ich gekommen bin«, sagte sie. »Aber in der Dienstanweisung steht, dass wir die Tür des Patienten unter keinen Umständen aus den Augen lassen sollen, weshalb ich mich selbst versorgt habe.«
Anton Mittet nahm einen Schluck aus seinem Becher. »Richtig gedacht, aber es führt nur ein Flur hierher. Wir sind im dritten Stock und zwischen hier und der Kaffeemaschine gibt es keine Türen, die zu anderen Treppen oder Eingängen führen. Es ist unmöglich, an uns vorbeizukommen, selbst wenn wir Kaffee holen.«
»Gut zu wissen, ich werde mich trotzdem an die Vorschrift halten.« Sie lächelte ihn kurz an, nahm dann aber einen Schluck aus dem Plastikbecher, als wollte sie damit die unausgesprochene Zurechtweisung abmildern.
Anton fühlte sich ein wenig auf den Schlips getreten und wollte gerade sagen, dass man mit genügend Erfahrung durchaus auch einmal selbständig denken durfte, doch bevor er sich die Worte richtig zurechtgelegt hatte, ging sein Blick nach hinten in den Flur. Eine weiße Gestalt schwebte auf sie zu. Er hörte, dass Silje sich erhob. Die Gestalt nahm klarere Formen an und wurde zu einer üppigen blonden Frau im Kittel des Pflegepersonals. Er wusste, dass sie Nachtschicht hatte und morgen Abend freihaben würde.
»Guten Abend«, sagte die Schwester mit verschmitztem Lächeln, hielt zwei Spritzen hoch, ging zur Tür und legte die Hand auf die Klinke.
»Moment«, sagte Silje und trat vor. »Ich muss Sie bitten, mich einen Blick auf Ihr Schild werfen zu lassen. Und könnten Sie mir das heutige Passwort nennen?«
Die Schwester sah Anton überrascht an.
»Außer mein Kollege hat Sie schon überprüft«, sagte Silje.
Anton nickte: »Geh nur rein, Mona.«
Die Schwester öffnete die Tür, und Anton blickte ihr nach. In dem schwach beleuchteten Raum konnte er die Apparate, die um das Bett herumstanden, und die Zehen des Mannes erkennen, die am Fußende unter der Bettdecke hervorragten. Der Patient war so groß, dass sie ein längeres Bett hatten beschaffen müssen. Die Tür schloss sich.
»Gut«, sagte Anton und lächelte Silje an, sah aber gleich, dass seine Kollegin das nicht mochte. Fühlte sie sich benotet? Hielt sie ihn für einen Chauvinisten? Aber verdammt, sie war ja noch nicht mal mit der Ausbildung fertig, und bei den ersten Praxiseinsätzen war es doch wohl in Ordnung, von erfahrenen Kollegen zu lernen. Er blieb stehen und wippte auf den Füßen, unsicher, wie er mit der Situation umgehen sollte.
Sie kam ihm zuvor.
»Keine Sorge, ich habe die Dienstanweisung studiert. Und Sie werden doch wohl von Ihrer Familie erwartet.«
Er setzte den Becher an die Lippen. Was wusste sie sonst noch über ihn? War das eine Andeutung, eine Anspielung auf Mona und ihn? Wusste sie etwa, dass er sie ein paarmal abends nach der Schicht nach Hause gefahren hatte und dass es dabei nicht geblieben war?
»Der Bärchenaufkleber auf Ihrer Tasche«, erklärte sie lächelnd.
Er nahm einen großen Schluck und räusperte sich. »Ich habe Zeit, und das ist Ihre erste Wache. Vielleicht sollten Sie die Gelegenheit für Fragen nutzen, wenn Sie irgendetwas wissen wollen. Es steht nicht immer alles in der Dienstanweisung, wissen Sie.« Er verlagerte sein Gewicht auf das andere Bein. Hoffte, dass sie den Text zwischen den Zeilen verstand.
»Wie Sie wollen«, sagte sie mit dem irritierenden Selbstvertrauen, das man in dieser Form nur mit Anfang zwanzig hatte. »Der Patient da drinnen, wer ist das eigentlich?«
»Das weiß ich auch nicht. In der Dienstanweisung steht, dass er anonym ist und es auch bleiben soll.«
»Aber Sie wissen etwas?«
»Tue ich das?«
»Mona. Sie duzen niemanden, mit dem Sie nicht auch länger geredet haben. Was hat sie Ihnen erzählt?«
Anton Mittet sah sie an. Sie war recht hübsch, aber ohne Wärme oder Charme und für seinen Geschmack zu dünn. Ihre Haare waren ungekämmt, und ihre Oberlippe sah aus, als würde sie von zu kurzen Sehnen nach oben gezogen, so dass zwei ungleiche Schneidezähne zu sehen waren. Aber sie strahlte Jugend und Frische aus. Und in ihrer schwarzen Uniform steckte ein straffer, austrainierter Körper, das roch er förmlich. Sollte er ihr sagen, was er wusste? Weil das seine Chancen, bei ihr zu landen, um null Komma null eins Prozent erhöhte oder weil Frauen wie Silje im Laufe von nur fünf Jahren zur leitenden Hauptkommissarin oder Spezialermittlerin und damit zu seiner Vorgesetzten avancierten? Er würde wegen der Sache in Drammen für immer und ewig einfacher Polizist bleiben. Der Vorfall bremste seine Karriere wie eine unüberwindbare Mauer, war wie ein Fleck, der nicht wegzuwischen war.
»Mordversuch«, sagte Anton. »Hat viel Blut verloren, hat bei der Einlieferung kaum noch Puls gehabt und liegt seither im Koma.«
»Und warum wird er bewacht?«
Anton zuckte mit den Schultern. »Ein potentieller Zeuge. Wenn er überlebt.«
»Und was weiß er?«
»Ach, irgendwelche Drogensachen. Aber auf hohem Niveau. Wenn er aufwacht, kann er mit seinen Informationen vermutlich wichtige Leute im Osloer Heroingeschäft zu Fall bringen. Und natürlich sagen, wer ihn zu töten versucht hat.«
»Die glauben also, dass der Täter zurückkommt, um seinen Job zu Ende zu bringen?«
»Wenn bekannt wird, dass er noch am Leben ist und wo man ihn finden kann: Ja. Vermutlich sind wir deshalb hier.«
Sie nickte. »Und? Wird er überleben?«
Anton schüttelte den Kopf. »Sie gehen davon aus, ihn noch ein paar Monate am Leben erhalten zu können, aber die Chancen, dass er jemals wieder aus dem Koma aufwacht, sind gering. Egal …« Anton verlagerte das Gewicht wieder auf das andere Bein, ihr musternder Blick war auf die Dauer unangenehm. »Bis dahin müssen wir auf ihn aufpassen.«
Anton Mittet verließ sie mit einem Gefühl der Niederlage. Er ging die Treppe hinunter zur Rezeption und trat nach draußen in den Herbstabend. Als er sich auf dem Parkplatz in sein Auto setzte, klingelte sein Handy.
Es war die Einsatzzentrale.
»Mord im Maridalen«, sagte Null eins. »Ich weiß, dass Sie eigentlich für heute fertig sind, aber die brauchen da oben dringend Hilfe bei der Absicherung des Tatorts. Und da Sie ohnehin schon Uniform tragen …«
»Wie lange?«
»Sie werden in spätestens drei Stunden abgelöst, allerspätestens.«
Anton war überrascht. Eigentlich unternahmen sie zurzeit alle nur erdenklichen Anstrengungen, um Überstunden zu vermeiden. Die Kombination aus korrekter Regelauslegung und begrenztem Budget ließ normalerweise keine praktische Lösung zu. Also musste dieser Mord etwas Besonderes sein, vermutete er. Hoffentlich war das Opfer kein Kind.
»Okay«, sagte Anton Mittet.
»Ich schicke Ihnen die GPS-Koordinaten.«
Das war eine Neuerung. Durch das GPS mit der Detailkarte vom Großraum Oslo und den aktiven Sender konnte die Einsatzzentrale jeden sofort orten. Vermutlich hatten sie deshalb ihn angerufen. Er war am nächsten.
»Gut«, sagte Anton. »Drei Stunden.«
Laura war schon im Bett, aber sie mochte es, wenn er nach der Arbeit gleich nach Hause kam, weshalb er ihr eine SMS schickte, bevor er sich ins Auto setzte und in Richtung Maridalsvannet fuhr.
Anton brauchte kein GPS. An der Einfahrt des Ullevålseterveien standen bereits vier Polizeiwagen und dahinter wies ihm das orangeweiße Absperrband den Weg.
Anton nahm die Taschenlampe aus dem Handschuhfach und ging zu dem Beamten, der an der Absperrung stand. Im Wald huschten Lichter hin und her, und ein Teil des Weges war von den festmontierten Scheinwerfern der Kriminaltechniker hell erleuchtet, bei denen er immer an Filmaufnahmen denken musste. Eine gar nicht so abwegige Assoziation, denn seit neuestem machten sie nicht nur Fotos, sondern filmten das Opfer und den Tatort auch mit einer HD-Videokamera, um auch nachträglich noch den Tatort absuchen und verschiedene Bereiche, die ihnen zuvor nicht als relevant erschienen waren, einzoomen zu können.
»Was ist passiert?«, fragte er den Kollegen, der mit vor der Brust verschränkten Armen zitternd vor der Absperrung stand.
»Mord.« Die Stimme des Mannes war belegt, und seine rotgeränderten Augen unterstrichen die Blässe seines Gesichts.
»Das habe ich gehört. Wer leitet den Einsatz?«
»Die Kriminaltechnik. Lønn.«
Anton hörte Stimmen aus dem Wald. Sie waren zahlreich. »Sonst ist noch keiner da? Weder Kripo noch Leute vom Kriminalamt?«
»Die kommen schon noch. Nachher wimmelt es hier bestimmt von Leuten. Der Tote ist gerade erst entdeckt worden. Sind Sie meine Ablösung?«
Noch mehr Leute? Und trotzdem soll ich Überstunden machen? Anton musterte den Kollegen genauer. Er trug einen dicken Mantel, zitterte aber trotzdem immer mehr. Dabei war es gar nicht kalt.
»Waren Sie als Erster hier?«
Der Beamte nickte stumm und sah zu Boden. Stampfte mit den Füßen auf.
Verdammt, dachte Anton. Also doch ein Kind. Er schluckte.
»Ah, Anton, hat Null eins Sie geschickt?«
Anton blickte auf. Er hatte die beiden nicht gehört, die aus dem dichten Wald gekommen waren.
»Ja, ich soll irgendjemanden ablösen«, sagte Anton zu der Frau. Er wusste, wer sie war. Es gab wohl niemanden, der sie nicht kannte. Beate Lønn, die Leiterin der Kriminaltechnik, hatte den Ruf einer Art Rain Man-Frau, was sie ihrer seltenen Fähigkeit zu verdanken hatte, Gesichter wiederzuerkennen. Die Polizei nutzte das, um Kriminelle auf körnigen, schlechten Überwachungsvideos zu identifizieren. Es hieß, sie könne selbst maskierte Täter erkennen, wenn sie früher schon mal verhaftet worden waren, und die Datenbank in ihrem kleinen blonden Kopf umfasse mehrere Tausend Bilder. Dieser Mord war definitiv etwas Besonderes, normalerweise schickten sie nicht mitten in der Nacht ihre Chefs los. Neben dem blassen Gesicht der schmächtigen Frau wirkte das ihres Kollegen beinahe feuerrot. Seine sommersprossigen Wangen zierte ein knallroter Backenbart. Die Augen standen ein wenig vor, als herrschte in seinem Kopf ein etwas zu hoher Druck, was seinem Gesicht einen staunenden Ausdruck verlieh. Aber das Auffälligste war die Mütze, die zum Vorschein kam, als er sich die weiße Kapuze vom Kopf zog: eine große Rastamütze in Grün, Gelb und Schwarz, den Farben Jamaikas.
Beate Lønn legte dem zitternden Beamten die Hand auf die Schulter. »Fahr nach Hause, Simon. Du musst ja niemandem sagen, dass ich dir das empfohlen habe, aber am besten gönnst du dir einen starken Drink und gehst dann ins Bett.«
Der Beamte nickte und war drei Sekunden später mit hängendem Kopf in der Dunkelheit verschwunden.
»Ist es schlimm?«, fragte Anton.
»Sie haben nicht zufällig Kaffee dabei?«, fragte die Rastamütze und öffnete eine Thermotasse.
»Nein«, sagte Anton.
»Es ist immer klug, Kaffee mitzubringen, wenn man an einen Tatort fährt«, sagte die Rastamütze. »Da man nie weiß, wie lange man bleiben muss.«
»Ist gut, Bjørn, das ist nicht sein erster Mordfall«, sagte Beate Lønn. »Drammen, oder?«
»Stimmt«, sagte Anton und wippte auf den Füßen. Jedenfalls in etwa, dachte er und hatte das unangenehme Gefühl zu wissen, warum Beate Lønn sich an ihn erinnerte. Er holte tief Luft. »Wer hat die Leiche gefunden?«
»Das war er«, sagte Beate Lønn und nickte in Richtung des Beamten, der gerade den Motor seines Wagens angelassen hatte.
»Ich meine, wer hat den Mord gemeldet?«
»Die Frau des Toten hat angerufen, weil er nach einer Fahrradtour nicht nach Hause gekommen ist«, sagte die Rastamütze. »Er wollte eine Stunde weg sein, und als er nicht kam, hat sie sich Sorgen um sein Herz gemacht. Er hatte ein GPS mit aktivem Sender dabei, so dass sie ihn schnell gefunden haben.«
Anton nickte langsam und sah vor sich, wie zwei Polizisten, ein Mann und eine Frau, an einer Tür klingeln. Wie sie sich räuspern und die Frau mit ernstem Blick ansehen, um ihr schon anzudeuten, was sie dann mit Worten, unsäglichen Worten wiederholen. Wie das Gesicht der Frau sich gegen das Gehörte wehrt, dann den Kampf verliert, sich vor Schmerz verzerrt, das Innere nach außen kehrt und nichts mehr zurückhalten kann.
Das Bild von Laura, seiner eigenen Frau, tauchte auf.
Ein Krankenwagen kam ohne Sirene oder Blaulicht auf sie zu. Allmählich dämmerte es Anton. Die schnelle Reaktion auf eine gewöhnliche Vermisstenmeldung. Das GPS mit Sender. Die vielen Leute. Die Überstunden. Der erschütterte Kollege, den sie nach Hause hatten schicken müssen.
»Es ist ein Polizist«, sagte er leise.
»Ich tippe, dass die Temperatur hier etwa anderthalb Grad niedriger als unten in der Stadt ist«, sagte Beate Lønn und wählte mit ihrem Handy eine Nummer.
»Könnte stimmen«, murmelte die Rastamütze und nahm einen Schluck aus der Thermotasse. »Noch keine Verfärbung der Haut. Irgendwann zwischen acht und zehn?«
»Ein Polizist«, wiederholte Anton. »Deshalb sind alle hier, nicht wahr?«
»Katrine?«, sagte Beate. »Kannst du was für mich überprüfen? Es geht um den Sandra-Tveten-Fall … Richtig.«
»Verdammt!«, platzte die Rastamütze heraus. »Ich habe gesagt, ihr sollt warten, bis der Leichensack da ist.«
Anton drehte sich um und sah zwei Männer aus dem Dickicht kommen. Sie trugen eine der Bahren der Kriminaltechnik zwischen sich. Ein paar Fahrradschuhe ragten unter der Decke hervor.
»Er kannte ihn«, sagte Anton. »Deshalb hat er so gezittert, nicht wahr?«
»Ja, sie haben in Økern zusammengearbeitet, bevor Vennesla zum Kriminalamt gegangen ist.«
»Hast du das genaue Datum?«, fragte Lønn ins Telefon.
Ein Aufschrei war zu hören.
»Ja, verdammt noch mal …«, schimpfte die Rastamütze.
Anton drehte sich um. Einer der Träger war am Wegrand ausgerutscht, der Lichtkegel seiner Lampe fiel jetzt auf die Bahre, auf die zur Seite gerutschte Decke und auf … ja auf was? Anton riss die Augen auf. War das ein Kopf? War das, was da am oberen Ende eines zweifelsohne menschlichen Körpers hing, tatsächlich mal ein Kopf gewesen? In den Jahren vor seinem Fehler, als Anton noch im Morddezernat gewesen war, hatte er viele Leichen gesehen, aber keine wie diese. Die sanduhrförmige Masse ließ Anton an sein sonntägliches Frühstück denken, an Lauras hartgekochte Eier mit Resten von Schale und dem am Rand verkleckerten und auf dem Eiweiß angetrockneten Eigelb. Konnte das wirklich ein … Kopf sein?
Anton stand da und blinzelte ins Dunkel, während er die Rücklichter der Ambulanz verschwinden sah. Und ihm ging auf, dass er die Szenerie hier erst vor kurzem schon einmal gesehen hatte. Die weißgekleideten Gestalten, die Thermotasse, die Füße, die unter der Decke herausragten, alles genau wie im Reichshospital. Als wäre das eine Art Vorwarnung gewesen.
Der Kopf …
»Danke, Katrine«, sagte Beate.
»Was ist denn?«, fragte die Rastamütze.
»Ich habe mit Erlend genau hier gearbeitet«, sagte Beate.
»Hier?«, fragte die Rastamütze.
»Ja. Genau hier. Er war damals Leiter der taktischen Ermittlung. Das ist bestimmt zehn Jahre her. Sandra Tveten. Vergewaltigt und ermordet. Noch ein Kind.«
Anton schluckte. Kind. Wiederholung.
»Ich erinnere mich an den Fall«, sagte die Rastamütze. »Seltsames Schicksal, an seinem eigenen Tatort zu sterben. War dieser Sandra-Fall nicht auch im Herbst?«
Beate antwortete nicht, sondern nickte nur langsam.
Anton blinzelte immer wieder. Es stimmte nicht, er hatte doch schon einmal eine solche Leiche gesehen.
»Verdammt!«, fluchte die Rastamütze leise, »du meinst doch nicht etwa, dass …?«
Beate Lønn nahm ihm die Thermotasse ab, trank einen Schluck, gab sie ihm zurück und nickte.
»Scheiße«, fluchte die Rastamütze.
Kapitel 3
»Déjà-vu«, sagte Ståle Aune und starrte in das dichte Schneetreiben über der Sporveisgata, auf der das morgendliche Dezemberdunkel einem kurzen Tag wich. Dann drehte er sich wieder zu dem Mann um, der vor seinem Schreibtisch saß. »Ein Déjà-vu ist das Gefühl, etwas zu sehen, das man vorher schon einmal gesehen hat. Wie genau das im Hirn abläuft, wissen wir aber nicht.«
Mit »wir« meinte er generell alle Psychologen, nicht bloß Therapeuten. »Manche glauben, dass es müdigkeitsbedingt zu einer Verzögerung der Informationsübertragung im bewussten Teil unseres Gehirns kommt, so dass die Information, wenn sie ankommt, im Unterbewusstsein schon eine Weile da ist. Das äußert sich dann als das Gefühl, etwas wiederzuerkennen. Das mit der Müdigkeit könnte erklären, warum Déjà-vus meistens am Ende der Arbeitswoche auftreten, aber im Grunde ist die Tatsache, dass der Freitag der Déjà-vu-Tag schlechthin ist, auch schon alles, was die Forschung dazu erbracht hat.«
»So ein Déjà-vu meine ich nicht«, sagte der Patient. Klient. Kunde. Die Person, die in etwa zwanzig Minuten am Empfang zahlen und damit ihren Beitrag zur Finanzierung der psychologischen Gemeinschaftspraxis in dem vierstöckigen, charakterlosen und trotzdem unmodernen Gebäude in der Sporveisgata in Oslos mittelfeinem Westen leisten würde. Ståle Aune erschlich sich einen Blick auf die Uhr hinter dem Kopf des Mannes. Achtzehn Minuten.
»Es ist eher wie ein Traum, den ich wieder und wieder habe.«
»Wie ein Traum?« Ståle Aunes Blick glitt wieder über die Zeitung, die aufgeschlagen auf der geöffneten Schreibtischschublade lag, so dass der Patient sie nicht sehen konnte. Die meisten Therapeuten saßen heutzutage auf einem Stuhl unmittelbar vor ihrem Patienten. Als der massive Schreibtisch in Ståles Praxis geliefert worden war, hatten es sich seine Kollegen denn auch nicht verkneifen können, ihn grinsend daran zu erinnern, dass es laut moderner Therapietheorie am besten war, keine physische Barriere zwischen sich und dem Patienten zu haben. Ståles Antwort war sehr knapp ausgefallen: »Am besten für den Patienten, das kann sein.«
»Es ist ein Traum. Ich träume ihn immer wieder.«
»Dass sich Träume wiederholen, ist ganz normal«, sagte Aune und fuhr sich mit der Hand über den Mund, um ein Gähnen zu unterdrücken. Sehnsuchtsvoll dachte er an seine geliebte alte Couch, die aus seiner Praxis entfernt worden war und jetzt im Gemeinschaftsraum unter einer Hantelstange stand und nur noch als psychotherapeutischer In-Joke diente. Als die Patienten noch auf der Couch lagen, war es nämlich viel leichter gewesen, Zeitung zu lesen.
»Ich will diesen Traum aber nicht haben.« Dünnes, selbstbewusstes Lächeln. Dünnes, wohlfrisiertes Haar.
Willkommen beim Traumexorzisten, dachte Aune und versuchte sich an einem ebenso dünnen Lächeln. Der Patient trug Nadelstreifenanzug, einen grauroten Schlips und schwarze, glänzende Schuhe. Aune saß in einer Tweedjacke da und hatte sich eine bunte Fliege unter sein Doppelkinn gebunden. Seine braunen Schuhe hatten schon lange keine Bürste mehr gesehen.
»Wenn Sie mir erzählen würden, worum es in diesem Traum geht?«
»Das habe ich doch gerade gesagt.«
»Schon, aber vielleicht könnten Sie noch etwas mehr ins Detail gehen?«
»Er fängt wie gesagt da an, wo Dark Side of the Moon endet. »Eclipse« verklingt mit dem Gesang von David Gilmour.« Der Mann spitzte die Lippen, ehe er in ein derart manieriertes Englisch wechselte, dass Aune förmlich vor sich sah, wie er sein Teetässchen mit abgespreiztem kleinem Finger an die gespitzten Lippen führte. »And everything under the sun is in tune but the sun is eclipsed by the moon.«
»Und das träumen Sie?«
»Nein! Das heißt, doch. Also, auch die Platte hört so auf. Optimistisch. Nach einer Dreiviertelstunde Tod und Wahnsinn. Wahrscheinlich soll man denken: Ende gut, alles gut. Alles wieder in bester Harmonie und Ordnung. Aber dann, ganz am Ende des Albums, hört man im Hintergrund eine Stimme murmeln. Ganz leise. Man muss die Lautstärke richtig aufdrehen, um die Worte verstehen zu können, aber dann hört man sie richtig deutlich: There is no dark side of the moon, really. Matter of fact, it’s all dark. Alles ist dunkel. Verstehen Sie?«
»Nein«, sagte Aune. Laut Lehrbuch hätte er jetzt fragen müssen, ob es ihm wichtig wäre, dass er ihn verstand, aber er konnte sich nicht dazu aufraffen.
»Das Böse gibt es nicht, weil alles böse ist. Der Weltraum ist dunkel. Wir sind von Natur aus böse. Das Böse ist der Ursprung, das Natürliche. Aber manchmal, manchmal gibt es irgendwo ein bisschen Licht. Nur dass das nur vorübergehend ist. Wir müssen alle zurück ins Dunkel. Und genau das passiert in meinem Traum.«
»Reden Sie weiter«, bat Aune, drehte seinen Stuhl um und sah nachdenklich aus dem Fenster. Er war diesen Patienten so leid, diese Mischung aus Selbstmitleid und Selbstzufriedenheit. Der Mann erachtete sich allem Anschein nach als einzigartig, ein Ansatzpunkt, in den man sich als Psychologe richtiggehend verbeißen konnte. Er hatte ganz sicher schon einmal eine Therapie gemacht. Aune sah einen Knöllchenjäger breitbeinig wie einen Sheriff unten über die Straße laufen und fragte sich, zu welchen anderen Berufen er, Ståle Aune, sich eignen würde. Die Antwort lag auf der Hand. Zu keinem. Außerdem liebte er die Psychologie und navigierte nur allzu gern durch den Grenzbereich zwischen Bewusstem und Unbewusstem, wobei er den schweren Ballast seines Fachwissens ebenso nutzte wie seine Intuition und Neugier. Das redete er sich auf jeden Fall immer wieder ein. Aber warum wünschte er sich dann nichts mehr, als dass sein Gegenüber endlich den Mund hielt und aus seinem Büro verschwand? Aus seinem Leben? Lag das an der Person selbst oder an seiner Arbeit als Therapeut? Ingrids unausgesprochenes, schlecht verstecktes Ultimatum, endlich weniger zu arbeiten und mehr für sie und ihre Tochter Aurora da zu sein, hatte Veränderungen erfordert. Er hatte die zeitraubende Forschung ebenso an den Nagel gehängt wie die Beratungstätigkeit für das Morddezernat und die Vorlesungen an der Polizeihochschule und arbeitete nun stattdessen nur noch als Therapeut mit festen Arbeitszeiten. Auf den ersten Blick schien er die Prioritäten damit richtig gesetzt zu haben. Denn was vermisste er an dem, was er aufgegeben hatte? Fehlte es ihm, die Seelen kranker Menschen zu ergründen, die andere auf derart grausame Weise umgebracht hatten, dass es ihm den Schlaf raubte, um dann – wenn er irgendwann doch eingeschlafen war – von Hauptkommissar Harry Hole geweckt zu werden, der ihm wieder und wieder unmögliche Fragen stellte? Vermisste er es, wie Hole ihn nach seinem eigenen Verständnis in einen ausgehungerten, übernächtigten, monomanen Jäger verwandelt hatte, der alle und jeden anfauchte, die ihm bei seiner Arbeit in die Quere kamen und der dabei Kollegen, Familie und Freunde mehr und mehr von sich stieß? Ja, verdammt, er vermisste das. Er vermisste das Wesentliche dieser Arbeit.
Er vermisste das Gefühl, Leben zu retten. Nicht das Leben eines rational denkenden, potentiellen Selbstmörders, bei denen er sich manchmal zu der Frage hinreißen ließ, warum so ein Mensch nicht einfach sterben konnte, wenn er das Leben so leid war und man ihm doch nicht zu helfen vermochte. Er vermisste es, ein Aktivposten zu sein, derjenige, der eingriff, der einen Unschuldigen aus den Klauen eines Schuldigen riss und tat, was niemand sonst tun konnte, weil er – Ståle Aune – der Beste war. So einfach war das. Ja, er vermisste diesen Harry Hole. Er vermisste die Stimme des mürrischen, versoffenen Mannes mit dem großen Herzen am Telefon, die ihn aufforderte – oder besser gesagt, ihm befahl –, seinen Dienst für die Allgemeinheit zu leisten und Familienleben und Nachtschlaf zu opfern, um einen der Elenden dieser Gesellschaft zu retten. Aber am Osloer Dezernat für Gewaltverbrechen gab es keinen Hauptkommissar Harry Hole mehr, und die anderen hatten ihn nie angerufen. Sein Blick huschte wieder über die aufgeschlagene Zeitungsseite. Es ging um eine Pressekonferenz. Der Mord an dem Polizisten im Maridalen lag jetzt schon fast drei Monate zurück, und die Polizei hatte noch immer keine Spur, geschweige denn einen Verdächtigen. Solche Fälle waren es gewesen, bei denen er früher angerufen worden war. Der Mord hatte am gleichen Ort und Datum stattgefunden wie ein alter, ungeklärter Fall. Das Opfer war ein Polizist, der an den damaligen Ermittlungen beteiligt gewesen war.
Stattdessen musste er sich um die Schlaflosigkeit eines überarbeiteten Geschäftsmanns kümmern, den er noch nicht einmal leiden konnte. Gleich würde Aune die nötigen Fragen stellen, um ein posttraumatisches Stresssyndrom ausschließen zu können. Der Mann vor ihm war durch seine Alpträume nicht in seiner Funktion eingeschränkt, es ging ihm nur darum, seine eigene Produktivität wieder auf ein Topniveau zu bringen. Danach würde Aune ihm etwas zu lesen geben, eine Kopie des Artikels »Imagery Rehearsal Therapy« von Krakow und – an die anderen Namen erinnerte er sich plötzlich nicht mehr –, und ihn bitten, seine Alpträume aufzuschreiben und diese Aufzeichnungen beim nächsten Mal mitzubringen. Dann würden sie sich zusammen eine Alternative ausdenken, einen glücklichen Schluss für den Alptraum, den sie dann mental einüben würden, bis der Traum ihm entweder angenehmer erschien oder ganz einfach verschwand.
Aune hörte das monotone, einschläfernde Schnarren der Stimme seines Patienten und dachte, dass die Ermittlungen des Mordes im Maridalen vom ersten Tag an auf der Stelle getreten waren. Nicht einmal die auffälligen Übereinstimmungen mit dem Sandra-Fall, was Datum, Ort und Person betraf, hatten das Kriminalamt oder das Morddezernat vorangebracht. Und jetzt forderten sie die Bevölkerung auf, noch einmal über den Tag nachzudenken und mögliche Hinweise zu geben, so irrelevant diese ihnen auch erscheinen mochten. Das war das Thema der gestrigen Pressekonferenz gewesen. Aune hatte den Verdacht, dass das bloß ein Spiel für die Galerie war, um den Eindruck zu erwecken, dass sie etwas taten und nicht bloß paralysiert in der Ecke saßen. Wobei es genau danach aussah: nach einer hilflosen und hart kritisierten Ermittlungsleitung, die sich nun resigniert an ein Publikum wandte, in der Hoffnung, dass die es vielleicht besser konnten.
Er sah sich die Bilder der Pressekonferenz an. Erkannte Beate Lønn wieder und Gunnar Hagen, den Chef des Morddezernats, dessen kräftige, dichte Haare seine Glatze wie eine Mönchstonsur umrahmten. Sogar Mikael Bellman, der neue Polizeipräsident, hatte teilgenommen, schließlich ging es ja um einen Mord an einem Kollegen. Sein Gesicht war angespannt. Schmaler, als Aune es in Erinnerung hatte. Die medienfreundlichen, etwas zu langen Locken hatten irgendwann auf dem Weg nach oben, zwischen seinem Job als Leiter des Dezernats OrgKrim und Chef des gesamten Präsidiums, fallen müssen. Aune dachte an Bellmans fast androgyne Schönheit, unterstrichen von den langen Wimpern und dem bronzenen Teint mit den charakteristischen weißen Pigmentflecken. Nichts davon war auf den Bildern zu sehen. Ein unaufgeklärter Polizistenmord war natürlich der schlechtmöglichste Start für einen neuen Polizeipräsidenten, dessen Blitzkarriere auf Erfolg basierte. Dass er unter den Drogengangs in Oslo aufgeräumt hatte, konnte schnell wieder in Vergessenheit geraten. Der pensionierte Erlend Vennesla war formell gesehen zwar nicht im Dienst getötet worden, aber den meisten war zweifelsohne klar, dass der Mord an ihm irgendetwas mit dem Sandra-Fall zu tun haben musste. Deshalb hatte Bellman absolut jeden seiner Leute, der kriechen oder laufen konnte, mobilisiert und sogar externe Kreise eingeschaltet. Nur nicht ihn, Ståle Aune. Er war von ihren Listen gestrichen worden. Nicht weiter verwunderlich, er hatte selbst darum gebeten.
Und mit dem Eintritt des frühen Winters hatte sich Schnee auf die Spuren gelegt. Spuren, die längst erkaltet waren. Wenn es überhaupt noch Spuren waren. Beate Lønn hatte auf der Pressekonferenz das auffällige Fehlen konkreter Spuren angesprochen. Natürlich hatten sie alle Personen überprüft, die irgendwie mit dem Sandra-Fall in Verbindung gestanden hatten. Verdächtige, Angehörige, Freunde, ja sogar Venneslas Kollegen, die gemeinsam mit ihm an dem Fall gearbeitet hatten. Aber auch da hatte es keine Resultate gegeben.
Es war still geworden im Raum, und Ståle Aune erkannte an dem Gesichtsausdruck seines Patienten, dass dieser gerade eine Frage gestellt haben musste und jetzt auf die Antwort des Psychologen wartete.
»Hm«, sagte Aune, stützte das Kinn auf seine Faust und begegnete dem Blick seines Gegenübers. »Was denken Sie selbst darüber?«
Der Blick des Mannes war verwirrt, und einen Augenblick lang fürchtete Aune, er könnte nach einem Glas Wasser oder irgendetwas Ähnlichem gefragt haben.
»Was ich darüber denke, dass sie lächelt? Oder über das starke Licht?«
»Beides.«
»Manchmal glaube ich, dass sie lächelt, weil sie mich mag. Andere Male glaube ich, dass sie es tut, weil sie will, dass ich irgendetwas mache. Aber wenn sie aufhört zu lächeln, erlischt dieses starke Licht in ihren Augen, und dann ist es zu spät, denn dann sagt sie nichts mehr. Deshalb glaube ich, dass es der Verstärker ist. Oder was meinen Sie?«
»Äh … Verstärker?«
»Ja.« Pause. »Davon habe ich doch erzählt. Der, den Vater immer ausgeschaltet hat, wenn er in mein Zimmer gekommen ist und gesagt hat, dass ich diese Platte jetzt lange genug gespielt habe, dass man von der Musik sonst noch wahnsinnig wird. Ich habe Ihnen doch erzählt, wie das kleine rote Lämpchen neben dem Schalter immer dunkler und dunkler wurde. Und in diesem Moment war ich überzeugt, dass ich sie verloren hatte. Dass sie deshalb am Ende des Traums so stumm ist. Sie ist der Verstärker, der keinen Ton mehr von sich gibt, nachdem Vater ihn ausgestellt hat. Und dann kann ich nicht mehr mit ihr reden.«
»Sie haben Platten gehört und an sie gedacht?«
»Ja. Immer. Bis ich etwa sechzehn war. Und nicht Platten. Die Platte.«
»Immer nur Dark Side of the Moon?«
»Ja.«
»Aber sie wollte Sie nicht?«
»Das weiß ich nicht. Vermutlich nicht. Damals nicht.«
»Hm. Unsere Zeit ist zu Ende. Ich gebe Ihnen bis zum nächsten Mal etwas zu lesen mit. Und dann möchte ich, dass wir einen Schluss für die Geschichte in Ihrem Traum finden. Sie soll reden. Sie soll Ihnen etwas sagen. Etwas, das Sie von ihr hören möchten. Vielleicht, dass sie Sie mag. Können Sie sich dazu bis zum nächsten Mal ein paar Gedanken machen?«
»Okay.«
Der Patient stand auf, nahm seinen Mantel von der Garderobe und ging zur Tür. Aune setzte sich an den Schreibtisch und warf einen Blick auf den Kalender, der ihm deprimierend voll vom Computerbildschirm entgegenstrahlte. Und ihm wurde bewusst, dass es wieder passiert war: Er hatte den Namen seines Patienten komplett vergessen. Zum Glück stand er im Kalender. Paul Stavnes.
»Nächste Woche, gleiche Zeit, Paul?«
»Ja, klar.«
Ståle notierte sich den Termin. Als er wieder aufsah, war Stavnes bereits gegangen.
Er stand auf und nahm die Zeitung mit ans Fenster. Wo zum Henker blieb eigentlich die so lange versprochene globale Erwärmung? Er sah auf die Zeitungsseite, wollte aber nicht mehr lesen und warf sie weg. Die immer gleichen Schlagzeilen der Zeitungen reichten jetzt langsam. Ermordet. Grobe Gewalt gegen den Kopf des Opfers. Erlend Vennesla hinterlässt Frau, Kinder und Enkelkinder. Freunde und Kollegen geschockt. »Er war so ein netter Mensch, hatte ein so warmes Herz.« »Man musste ihn einfach mögen.« »Freundlich, ehrlich und tolerant, dieser Mann hatte keine Feinde.« Ståle Aune holte tief Luft. There is no dark side of the moon, not really. Matter of fact, it’s all dark. Er blickte auf sein Telefon. Sie hatten seine Nummer. Aber es blieb stumm. Genau wie das Mädchen in dem Traum.
Kapitel 4
Der Leiter der Mordkommission, Gunnar Hagen, fuhr sich mit der Hand über die Stirn, hoch zu der lagunenartigen Öffnung im Haaransatz und weiter über das dichte Haaratoll an seinem Hinterkopf. Vor ihm saß seine Ermittlungsgruppe. Bei einem normalen Mord hätte es sich um etwa zwölf Personen gehandelt. Aber ein Mord an einem Kollegen war nicht normal, so dass das K2 bis zum letzten Platz gefüllt war. Knapp fünfzig Personen, die krankgemeldeten Mitarbeiter mitgerechnet exakt dreiundfünfzig Beamte, arbeiteten an dem Fall. Es würde sicher nicht lange dauern, bis weitere krank wurden – der Druck der Medien war für alle eine große Belastung. Das Positivste, was man über diesen Fall sagen konnte, war, dass er die beiden Ermittlungseinheiten des Landes – die Kriminalpolizei und das Kriminalamt, Kripos – zusammengeschweißt hatte. Die Rivalität war beiseitegeschoben worden, und man zog an einem Strang, um endlich den Täter zu finden, der einen ihrer Kollegen ermordet hatte. In den ersten intensiven, hochmotivierten Wochen war Hagen überzeugt gewesen, den Fall schnell lösen zu können. Auch wenn technische Spuren ebenso fehlten wie Zeugen, mögliche Motive, Verdächtige oder auch nur Anhaltspunkte. Einfach weil Wille und Bereitschaft so groß waren und sie über nahezu unbegrenzte Ressourcen verfügten.
Die Apathie, die ihm jetzt aus den grauen, müden Gesichtern entgegenblickte, war in der letzten Zeit immer deutlicher geworden. Und die gestrige Pressekonferenz – die mit ihrer Bitte um Hilfe jedweder Art einer Kapitulation verdammt nahegekommen war – hatte die Kampfmoral nicht unbedingt erhöht. Neben dem Vennesla-Fall hatten sie auch beim Gusto-Hanssen-Fall den Status von aufgeklärt zu ungelöst ändern müssen, nachdem Oleg Fauke entlassen worden war und Chris »Adidas« Reddy sein Geständnis zurückgezogen hatte. Ein Positives hatte der Vennesla-Fall aber doch: Der Polizistenmord überschattete den Mord an dem Drogenabhängigen Gusto so vollständig, dass die Presse nicht ein Wort darüber verloren hatte, dass auch dieser Mordfall noch immer ungelöst war.
Hagen blickte auf das Blatt, das vor ihm auf dem Rednerpult lag. Zwei Zeilen. Zwei Zeilen für die Morgenbesprechung.
Gunnar Hagen räusperte sich. »Guten Morgen. Wie die meisten von Ihnen bereits wissen, sind nach der gestrigen Pressekonferenz eine ganze Reihe von Hinweisen eingegangen, denen wir nun nachgehen müssen. Insgesamt sind es bis jetzt neunundachtzig Tipps. Einige davon sind wirklich interessant.«
Er brauchte nicht auszusprechen, was alle längst wussten: Nach bald drei Monaten Ermittlungen waren sie zu der frustrierenden Erkenntnis gelangt, dass fünfundneunzig Prozent der Hinweise reiner Bullshit waren. Sie kamen von ihren alten Bekannten, die immer anriefen, von Besoffenen, von Leuten, die den Verdacht auf jemanden lenken wollten, der ihnen die Freundin ausgespannt oder die Treppe nicht geputzt hatte. Ein Scherz oder einfach nur der Versuch, ein wenig Aufmerksamkeit zu erhaschen oder jemanden zu haben, der ihnen zuhörte. Mit »einige davon« meinte er exakt vier Hinweise. Und dass diese wirklich interessant waren, war eigentlich eine Lüge, da man ihnen bereits nachgegangen war. Und auch diese Hinweise hatten nur ins Leere geführt.
»Wir haben heute hohen Besuch«, sagte Hagen und hörte selbst, dass man das als Sarkasmus deuten konnte. »Der Polizeipräsident möchte ein paar Worte an Sie richten. Mikael …«
Hagen klappte die Mappe zu und klopfte damit gegen das Rednerpult, als enthielte sie einen ganzen Stapel interessanter Dokumente und nicht bloß diesen einen Zettel. Er hatte Bellman extra beim Vornamen genannt, um seine sarkastische Bemerkung zu überspielen, und nickte dem Mann zu, der weiter hinten neben der Tür stand.
Der junge Polizeipräsident, der mit verschränkten Armen an der Wand lehnte, wartete einen kurzen Augenblick, bis alle sich umgedreht hatten und ihn sahen. Dann stieß er sich mit einer ebenso kraftvollen wie geschmeidigen Bewegung von der Wand ab und trat mit raschen, entschlossenen Schritten ans Rednerpult. Auf seinen Lippen lag der Anflug eines Lächelns, als dächte er an etwas Amüsantes, und als er entspannt vornübergebeugt die Unterarme aufs Pult legte und sie direkt ansah, um anzudeuten, dass er kein fertig geschriebenes Manuskript hatte, dachte Hagen, dass Bellman nun bitte schön auch servieren sollte, was sein Auftritt versprach.
»Einige von Ihnen wissen vielleicht, dass ich klettere«, sagte Mikael. »Und wenn ich an Tagen wie heute aufwache und aus dem Fenster sehe, in den Nebel starre und im Radio höre, dass es noch mehr Schnee geben und auch der Wind noch zunehmen soll, denke ich an einen Berg, den ich einmal besteigen wollte.«
Bellman machte eine Pause, und Hagen stellte fest, dass die ungewohnte Einleitung ihre Wirkung nicht verfehlte. Bellman hatte ihrer aller Aufmerksamkeit. Bis auf weiteres. Hagen wusste aber, dass die Bullshit-Toleranz der überarbeiteten Gruppe minimal war und dass niemand sich Mühe geben würde, das zu verbergen. Bellman war zu jung, war noch nicht lang genug ihr Chef und war die Karriereleiter zu schnell aufgestiegen, um von ihnen viel Geduld erwarten zu können.
»Der Berg hat zufällig den gleichen Namen wie dieser Raum oder der Vennesla-Fall: K2. Der zweithöchste Berg der Welt. The Savage Mountain. Zum Besteigen der härteste Berg, den es gibt. Auf jeden vierten Bergsteiger, der es geschafft hat, kommt einer, der bei dem Versuch umgekommen ist. Wir wollten damals den südlichen Teil des Berges besteigen, auch The Magic Line genannt. Das ist bis jetzt erst zweimal gelungen und wird von vielen als eine Art ritueller Selbstmord eingeschätzt. Beim geringsten Wetterwechsel sind Sie und der Berg eingehüllt in Schnee und Temperaturen, für die kein Mensch geschaffen ist, zumindest nicht, wenn einem weniger Sauerstoff als unter Wasser zur Verfügung steht. Und weil es sich um den Himalaya handelt, ist allen klar, dass es Wetterwechsel gibt. Und zwar andauernd.«
Kurze Pause.
»Warum wollte ich also ausgerechnet diesen Berg besteigen?«
Neue Pause. Dieses Mal länger, als wartete er auf eine Antwort. Noch immer umspielte dieses Lächeln seine Lippen. Die Pause wurde lang. Zu lang, dachte Hagen. Polizisten sind keine Anhänger von theatralischer Effekthascherei.
»Weil …«, Bellman klopfte mit dem Zeigefinger auf die Platte des Rednerpults, »… weil es der härteste Berg der Welt ist. Physisch und mental. Mit dem Aufstieg ist nicht eine Sekunde Freude verbunden, nur Probleme, totale körperliche Anstrengung, Angst, Höhenkrankheit, Sauerstoffmangel, lebensgefährliche Panik und eine noch gefährlichere Apathie. Und auf dem Gipfel angekommen, geht es nicht darum, den Triumph des Augenblicks zu genießen, sondern sich bloß den Beweis zu sichern, dass man wirklich dort war, und ein oder zwei Bilder zu machen. Man darf sich nicht dem Irrglauben hingeben, das Schlimmste überstanden zu haben, und abschalten, sondern man muss voll konzentriert bleiben, seine Arbeit machen, systematisch und programmiert wie ein Roboter und dabei die ganze Zeit die Situation einschätzen. Die ganze Zeit. Wie ist das Wetter? Welche Signale gibt der Körper? Wo befinden wir uns genau? Wie lange sind wir schon unterwegs? Wie geht es den anderen im Team?«
Er trat einen Schritt vom Rednerpult zurück.
»Denn der K2 leistet Widerstand und stemmt sich dir die ganze Zeit entgegen. Auch wenn es nach unten geht. Widerstand und Gegenwehr. Und genau deshalb wollten wir diesen Berg bezwingen.«
Es war still im Raum. Vollkommen still. Kein demonstratives Gähnen oder Fußgescharre unter den Stühlen. Mein Gott, dachte Hagen, er hat sie.
»Zwei Worte«, sagte Bellman. »Ausdauer und Zusammenhalt. Ursprünglich wollte ich noch Ambition nennen, aber dieses Wort ist nicht wichtig genug, hat im Vergleich zu den beiden anderen nicht genug Bedeutung. Vielleicht fragen Sie sich, was Ausdauer und Zusammenhalt nützen, wenn es weder ein Ziel noch Ambition gibt. Kampf um des Kampfes willen? Ehre ohne Belohnung? Ja, genau das. Kampf um des Kampfes willen. Ehre ohne Belohnung. Wenn in ein paar Jahren über den Vennesla-Fall geredet wird, dann wegen der Widrigkeiten und Hindernisse. Weil alles so unmöglich schien. Weil der Berg zu hoch war, das Wetter zu schlecht, die Luft zu dünn. Weil alles schiefging, was schiefgehen konnte. Und es wird die Geschichte dieser Widrigkeiten sein, die den Fall auf ein fast mystisches Niveau heben und zu einer der die Zeit überdauernden Lagerfeuergeschichten machen wird. Genau wie die meisten Bergsteiger es nicht einmal an den Fuß des K2 schaffen werden, kann man ein ganzes Leben als Ermittler führen, ohne jemals auf einen Fall wie diesen zu stoßen. Wäre dieser Fall nach wenigen Wochen gelöst gewesen, würde man sich schon in wenigen Jahren nicht mehr daran erinnern. Denn was haben alle legendären Kriminalfälle der Geschichte gemeinsam?«
Bellman wartete. Nickte, als hätte man ihm die gewünschte Antwort gegeben, die er nun verkündete.
»Sie haben Zeit erfordert, Widerstand geleistet.«
Eine Stimme flüsterte neben Hagen: »Churchill, eat your heart out.« Er drehte sich zur Seite und sah Beate Lønn, die sich mit einem schiefen Lächeln auf den Lippen neben ihn gestellt hatte.
Er nickte kurz und sah in die Runde. Alte Tricks, vielleicht, aber sie wirkten noch immer. Wo er vor wenigen Minuten nur schwarzes, verkohltes Holz gesehen hatte, glühte es dank Bellman jetzt wieder. Hagen wusste aber, dass es nicht lange brennen würde, wenn die Resultate weiterhin ausblieben.
Drei Minuten später war Bellman mit seiner Motivationsrede fertig und verließ breit grinsend und unter Applaus das Rednerpult. Auch Hagen klatschte pflichtbewusst, während ihm davor graute, wieder auf das Podium zu müssen. Ihm stand der ultimative Showstopper bevor, denn er musste ihnen sagen, dass die Ermittlungsgruppe auf fünfunddreißig Mann reduziert werden würde. So lautete Bellmans Order. Und sie hatten sich darauf geeinigt, dass diese Info nicht von ihm kommen sollte. Hagen ging nach vorn, legte seine Mappe ab, öffnete sie, räusperte sich und tat so, als blätterte er darin. Dann hob er den Blick, räusperte sich noch einmal und lächelte schief. »Ladies and gentlemen, Elvis has left the building.«
Stille, kein einziger Lacher.
»Okay, es stehen ein paar Änderungen an. Einige von Ihnen werden anderen Aufgaben zugeteilt werden.«
Verloschen. Eiskalt.
Als Mikael Bellman im Atrium des Präsidiums aus dem Aufzug trat, sah er gerade noch jemanden im Nachbarfahrstuhl verschwinden. War das Truls? Unwahrscheinlich, er war nach der Asajev-Sache doch noch immer in »Quarantäne«. Bellman ging durch den Haupteingang nach draußen und kämpfte sich durch das Schneetreiben bis zu seinem wartenden Wagen. Als er den Chefsessel des Präsidiums übernommen hatte, war ihm erklärt worden, dass er theoretisch Anspruch auf einen Fahrer hätte, dass seine drei Vorgänger diesen Luxus aber abgelehnt hatten. Sie waren der Meinung gewesen, so etwas würde in Zeiten allgemeiner Kürzungen falsche Signale aussenden. Bellman hatte sich davon nicht beeindrucken lassen und sich klar gegen die kleinliche, sozialdemokratische Sparsamkeit entschieden. Er wollte seine Arbeit so effektiv wie nur möglich gestalten und außerdem allen in der Hierarchie unter ihm Stehenden zeigen, dass harte Arbeit und beruflicher Aufstieg gewisse Vorteile mit sich brachten. Der Chef der Öffentlichkeitsarbeit hatte ihn anschließend zur Seite genommen und ihm vorgeschlagen, nur auf die Effektivität zu setzen und das mit den Vorteilen wegzulassen, sollte die Presse ihn auf diese Frage ansprechen.
»Rathaus«, sagte Bellman, als er sich auf den Rücksitz setzte.
Der Wagen löste sich vom Straßenrand, umrundete die Kirche in Grønland und steuerte in Richtung Plaza und Posthochhaus, das trotz all der neuen Gebäude rund um die Oper noch immer die Skyline von Oslo dominierte. Doch an diesem Tag gab es keine Skyline, sondern nur Schneetreiben. Drei vollständig unabhängige Gedanken gingen Bellman durch den Kopf: Verfluchter Dezember. Verfluchter Vennesla-Fall. Und verfluchter Truls.
Mikael hatte Truls weder gesprochen noch gesehen, seit er seinen Schulfreund und Untergebenen Anfang Oktober suspendiert hatte. Letzte Woche allerdings glaubte er ihn vor dem Grand Hotel in einem geparkten Auto entdeckt zu haben. Die großen Bargeldeinzahlungen auf Truls’ Konto hatten ihn gezwungen, seinen treuen Mitarbeiter zu suspendieren, da Truls sich zu der Herkunft dieses Geldes nicht hatte äußern können – oder wollen. Dabei wusste Mikael natürlich, woher das Geld stammte. Es war der Lohn für seine Arbeit als Brenner – als Beweissaboteur – für die Drogenliga von Rudolf Asajev. Truls war blöd genug gewesen, dieses Geld direkt auf sein Konto einzuzahlen. Sein einziger Trost war, dass es weder über das Geld noch über Truls irgendeine Verbindung zu Mikael gab. Nur zwei Personen auf dieser Welt wussten über Mikaels Zusammenarbeit mit Asajev Bescheid. Die eine war Sozialsenatorin und mitschuldig und die andere lag im Koma in einem abgesperrten Flügel des Reichshospitals, dem Tode nah.
Sie fuhren durch das Viertel Kvadraturen. Bellman betrachtete fasziniert den Kontrast zwischen der schwarzen Haut der Prostituierten und dem weißen Schnee auf ihren Haaren und Schultern. Und er sah, dass neue Dealer das nach Asajev entstandene Vakuum gefüllt hatten.