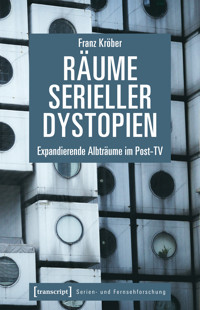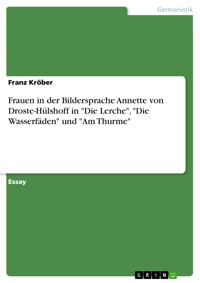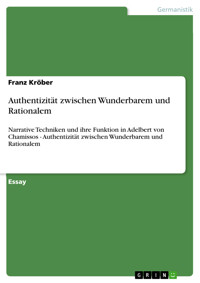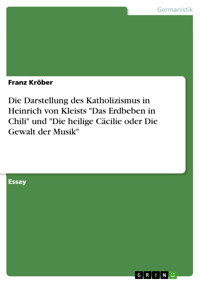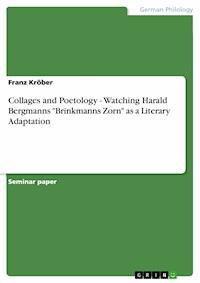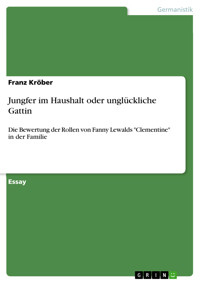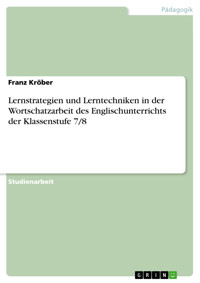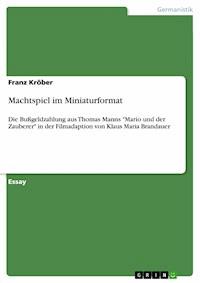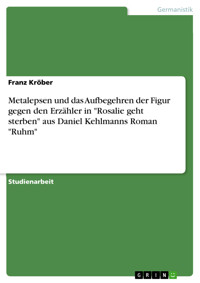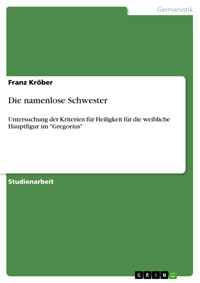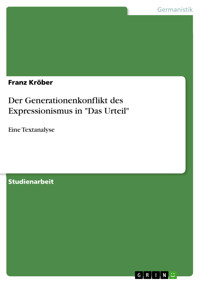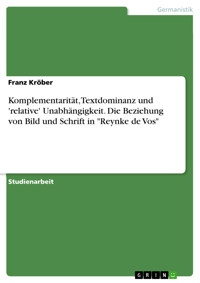
Komplementarität, Textdominanz und 'relative' Unabhängigkeit. Die Beziehung von Bild und Schrift in "Reynke de Vos" E-Book
Franz Kröber
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Germanistik - Ältere Deutsche Literatur, Mediävistik, Note: 1,0, Freie Universität Berlin (Zentrum für Lehrerbildung), Veranstaltung: S 16710 „Reineke Fuchs seit der Frühen Neuzeit in komparatistischer Perspektive“, Dr. Susanne Warda, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit werden ebenso wie bei Raimund Vedder und Beatrix Zumbült die Bild-Schrifttext-Beziehungen im Reynke aus semantischer Sicht betrachtet und kategorisiert; jedoch stehen hierbei die Interaktion zwischen Schrift und Bild innerhalb des Rezeptionsprozesses stärker im Fokus. Aus dieser Perspektive soll eine Typologie der Schrifttext-Bild-Beziehungen im "Reynke" entwickelt werden. Die These dieser Arbeit ist, dass im Tierepos drei unterschiedliche Beziehungen zwischen Schrifttext und Bild vorliegen: eine gegenseitige Abhängigkeit des Schrifttextes vom Bild (Typ 1), eine Abhängigkeit des Bildes vom Schrifttext (Typ 2) und eine ‚relative‘ Unabhängigkeit des Bildes vom Schrifttext (Typ 3). Der eigentlichen Entwicklung und Prüfung dieser Typologie ist ein Abschnitt mit theoretischen Grundlagen vorgeschaltet, der die Basis für die Klassifizierung der Bild-Schrifttext-Beziehungen bildet. Er enthält einen kurzen Überblick zur Interaktion von Schrifttext und Bild vor dem Hintergrund des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit sowie Erläuterungen zu drei ausgewählten Typen von Schrifttext-Bild-Beziehungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Schrifttext-Bild-Beziehungen im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit
2.2 Formen der Schrifttext-Bild-Beziehungen
2.2.1 Komplementarität
2.2.2 Textdominanz und Illustrationen
2.2.3 Bilddominanz und Polyphasen-Einzelbilder
2.3 Zwischenfazit
3. Schrifttext-Bild-Beziehungen in Reynke de Vos
3.1. Komplementarität (Typ 1)
3.2 Textdominanz (Typ 2)
3.3 ‚Relative‘ Unabhängigkeit des Polyphasen-Einzelbildes vom Schrifttext (Typ 3)
4. Zusammenfassung und Ausblick
5. Bibliographie
5.1 Primärliteratur Reynke de Vos. Lübeck 1498. Hamburg: Kötz 1976 [Nachdruck der 1498 in der Lübecker Mohnkopfdruckerei erschienenen Ausgabe].
5.2 Sekundärliteratur
6. Anhang
1. Einleitung
„Seit Anbeginn“ steht nach Norbert H. Ott „Literatur – d.h. Wissen und Unterhaltung in Texten geronnen – in steter Wechselbeziehung zu Bildern, verschränken sich das Textmedium mit dem Bildmedium“.[1] Diese Verschränkung wird laut Anneliese Schmitt auch nicht im „Zeitalter der technischen Buchherstellung“ aufgebrochen.[2] Stattdessen werden auch im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit „Schrift und Bild“ als Sprachsysteme begriffen,[3] welche in Verbindung miteinander „als integrative Einheit intendiert“ sind.[4] Dies gilt auch für das niederdeutsche Versepos Reynke de Vos (1498): Zur Vermittlung der Geschichte um den anthropomorphisierten Fuchs und dessen Missetaten bedient es sich nicht nur des Mediums der Schrift, sondern enthält auch 89 Holzschnitte, welche ausgewählte Szenen der Handlung abbilden.
Eine Kategorisierung der verschiedenen Bilder im Reynke nach ihrer jeweiligen Beziehung zum Schrifttext lässt sich bereits in Arbeiten von Raimund Vedder und Beatrix Zumbült finden. Vedder bringt den Gedanken auf, die Holzschnitte im Tierepos nach den Begriffen „‚textnah‘“, „‚textkongruent‘“ oder „‚bedingt textnah‘“ zu klassifizieren, stellt jedoch zu Recht fest, dass dieses Vorgehen problematisch ist, da die „Abgrenzung“ zwischen diesen Kategorien „kaum exakt definierbar“ ist.[5] Allerdings spiegeln sich eben jene Kategorien in seiner Untersuchung der Bilder „im Text-Zusammenhang“ wieder.[6] Während Vedders Klassifikation nach „semantischen Gesichtspunkten“[7] erfolgt, er also den Inhalt des Schrifttextes mit dem des Bildes vergleicht, ordnet Zumbült die Holzschnitte sowohl nach inhaltlichen als auch nach formalen Kriterien: Sie unterscheidet zwischen Bildern, die „Hoftagsszenen“ darstellen, zwischen Bildern, die „distinguierende[]“ bzw. einzelne „Szenen“ zeigen und denen, die „simultane[] Darstellungen zweier oder mehrerer Szenen in einem Bild“ vereinen.[8] Dabei bezieht sie das Medium der Schrift aber ebenso wie Vedder nur soweit ein, als dass es als Folie verwendet wird, vor der Kongruenzen oder Interferenzen zwischen Schrifttext und Bild sichtbar werden.
In dieser Arbeit werden ebenso wie bei Vedder und Zumbült die Bild-Schrifttext-Beziehungen im Reynke aus semantischer Sicht betrachtet und kategorisiert; jedoch stehen hierbei die Interaktion zwischen Schrift und Bild innerhalb des Rezeptionsprozesses stärker im Fokus. Aus dieser Perspektive soll eine Typologie der Schrifttext-Bild-Beziehungen im Reynke entwickelt werden. Die These dieser Arbeit ist, dass im Tierepos drei unterschiedliche Beziehungen zwischen Schrifttext und Bild vorliegen: eine gegenseitige Abhängigkeit des Schrifttextes vom Bild (Typ 1), eine Abhängigkeit des Bildes vom Schrifttext (Typ 2) und eine ‚relative‘ Unabhängigkeit des Bildes vom Schrifttext (Typ 3). Der eigentlichen Entwicklung und Prüfung dieser Typologie ist ein Abschnitt mit theoretischen Grundlagen vorgeschaltet, der die Basis für die Klassifizierung der Bild-Schrifttext-Beziehungen bildet. Er enthält einen kurzen Überblick zur Interaktion von Schrifttext und Bild vor dem Hintergrund des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit sowie Erläuterungen zu drei ausgewählten Typen von Schrifttext-Bild-Beziehungen.
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Schrifttext-Bild-Beziehungen im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit
Im Hinblick auf Schrifttext-Bild-Verbindungen geht Ott von einem „Wechselspiel zwischen beiden Medien“[9] aus. Auch Monika Schmitz-Emans konstatiert, „dass Texte und Bilder überall dort, wo sie aufeinandertreffen, miteinander interagieren, und zwar […] so lange und wo immer sie gemeinsam wahrgenommen werden“.[10] Nach Susanne Warda ist es
[i]n diesem Sinne […] auch nicht von Belang ob […] Text und Bild sozusagen ursächlich zusammengehören oder ob zum Beispiel ein schon vorhandener Text mit bereits älteren Holzschnitten anderer Herkunft zusammengestellt wird. Entscheidend ist, dass die beiden Medien in dem Moment, in dem sie gemeinsam rezipiert werden, ein Ensemble bilden, so daß – wenn auch nur im Auge des Betrachters – eine Relation zustande kommt.[11]