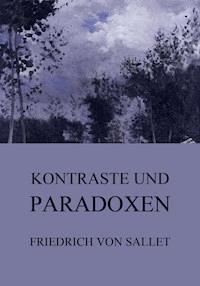
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Novelle "Kontraste und Paradoxen" ist reich an tiefen Gedanken, an treffenden und scharfen Ausfällen gegen die Schäden der Zeit, auch an ergreifenden Geständnissen über eigene Seelenkämpfe. Der zum Dichter geborene Knabe Junius hat mit allen Hindernissen zu kämpfen. Sein Vater Habich ist ein Geldsack, die Mutter eine im Weibergeklatsch und wüster Romanleserei verkommene Frau. Nur der Onkel Holofernes versteht den Knaben und sucht ihn nach seiner Art zu bilden. Sein wunderbares Guckglas gewährt ihm Einblick in das Leben der Natur: in ihr lernt er Gott erkennen und die "dumpfe Kirche" derer fliehen, die als eine "Seligkeitsversicherungsanstalt" die Religion betrachten. Die Umgebung hemmt jedoch allen Aufschwung, der Onkel erscheint nur selten im Hause, und so ist der junge Dichter auf den Umgang mit einer jüngeren Schwester beschränkt, die ihn ganz versteht. Wenn Holofernes erscheint, kommt er in Konflikt mit den Seinigen und ihrem Umgang...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kontraste und Paradoxen
Friedrich von Sallet
Inhalt:
Friedrich von Sallet – Biografie und Bibliografie
Kontraste und Paradoxen
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII.
Kapitel XXIV.
Kontraste und Paradoxen, F. von Sallet
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849639075
www.jazzybee-verlag.de
Friedrich von Sallet – Biografie und Bibliografie
Dichter, geb. 20. April 1812 in Neiße, gest. 21. Febr. 1843 in Reichau bei Nimptsch in Schlesien, trat 1824 in ein Kadettenkorps, kam 1829 als Leutnant nach Mainz, 1830 nach Trier und ging 1835 nach Berlin auf die Kriegsschule, um sich zu einer Lehrerstelle an einer Kadettenanstalt vorzubereiten. Gegen Ende 1838 nahm er seinen Abschied und wendete sich nach Breslau. Nachdem er sich bereits durch mehrere Sammlungen von Gedichten bekannt gemacht, erschien 1842 sein Hauptwerk, das »Laienevangelium« (9. Aufl., Hamb. 1879; auch in Meyers Volksbüchern), durch das er die Gottwerdung des Menschen als die höchste Aufgabe des Christentums darstellen und zu diesem Zweck ein neues System der Sittlichkeit begründen wollte, weshalb es freilich von den orthodoxen Kreisen als »atheistisch« abgelehnt wurde. Seine »Sämtlichen Werke« erschienen Breslau 1845–48 in 5 Bänden; die »Gesammelten Gedichte« in 4. Auflage Hamburg 1864. Vgl. »Leben und Wirken Fr. v. Sallets« von Gottschall, Paur u.a. (Bresl. 1844).
Wichtige Werke:
Gedichte (1835)Funken (1838)Schön Irla. Märchen (1838)Die wahnsinnige Flasche. Epos (1838)Contraste und Paradoxen (1838)Laienevangelium (1842)Gesammelte Gedichte (1843)Die Atheisten und Gottlosen unserer Zeit (1844)Erläuterung zum zweiten Teile vom Goetheschen Faust für Frauen (1844)Kontraste und Paradoxen
Kapitel I
Es war einmal in einer großen Stadt ein sehr reicher Bankherr, der hieß Herr Habichs, und weil er so reich war und noch alle Tage reicher wurde, so hielt er sich zwölf Schreiber, die immerfort rechnen und ihm seine Bücher vollschreiben mußten. Mit denen saß er jeden Tag zwölf Stunden lang in einem breiten und dicken zwölf eckigen Turme, der mit der einen Ecke an sein Wohnhaus stieß. Der Turm hatte bloß ein einziges Fenster oben in der Kuppel, die zwölf Seitenwände aber gähnten und dehnten sich langweilig, fensterlos und kahl, von der Decke zum Fußboden herab. Und von jeder Ecke des Turmes aus ging eine hohe durchsichtige Wand, von Eisendraht geflochten, nach der Mitte zu, so daß zwölf Zellen abgeteilt waren, in denen saßen die zwölf Schreiber, wie wilde Tiere, die man den Leuten zeigt. Aber wie die Führer solcher Tiere bei jedem einzelnen ausrufen: »Trotz aller möglichen Mühe ist es noch nicht gelungen, dieses wilde Tier zu zähmen«, so hätte man hier bei jedem einzelnen Schreiber im Gegenteil ausrufen können: »Trotz aller möglichen Mühe ist es noch nie gelungen, dieses zahme Tier wild zu machen«. Denn wirklich, die wildesten Tiere im ganzen Turm waren die zwölf ledernen Esel, auf denen die zwölf Schreiber rittlings saßen, wobei übrigens schwer zu bestimmen, wer am ledernsten gewesen, die Reiter oder die Esel. Jeder Schreiber aber hatte vor sich auf einem hohen Pulte ein ungeheures Buch aufgeschlagen, das er vollschreiben mußte. Einer, der sehr klein und etwas bucklig war, mußte sich immer erst zwanzigmal auf dem Lederesel herum und in die Höhe schrauben, so daß er zuletzt oben schwankte, wie ein Rohrsperling auf einem Rohre, ehe er mit dem Kinn über den Rand seines Buches reichte, und dann sah er aus wie ein furchtsam geducktes Kaninchen, das mit der Nase witternd in die Höhe schnoppert und die Ohren nach hinten niederklemmt. Ein anderer, der sehr lang und mager war, hatte, wenn er auf dem Lederesel die Riesenblätter seines Buches umschlug, genau dasselbe Ansehen, wie der sinnreiche und berühmte Junker Don Quixote, wenn solcher, auf seiner Rosinante hängend, mit einer gehenden Windmühle sich herumbalgte. In der Mitte des Turmes aber endeten die Drahtwände alle in einem zwölfeckigen Bauer, auch von Drahtwänden, darin saß, wie die Kreuzspinne im Mittelpunkte ihres Netzes, der Herr Habichs selbst auf dem größten Lederesel und hatte auch das allergrößte Buch vor sich; denn das war so ungeheuer, daß es sich unter den Büchern der Schreiber ausnahm, wie die Muttersau unter ihren Ferkeln, und es hätte recht gut die andern zwölf alle auffressen können, ohne merklich an Korpulenz zuzunehmen.
Aus jeder der zwölf Schreiberzellen ging eine Drahtgittertür in das Eulengebauer des Herrn Habichs, so daß die Schreiber keinen andern Ausgang hatten und einer nicht zum andern konnte; der Herr Habichs selber aber mußte, um in sein Wohnhaus zu kommen, aus seiner Zelle durch einen schmalen Drahtgittergang gehen, der den beiden Schreiberzellen, die rechts und links zunächst daran stießen, abgeknapst war, so daß selbige etwas schmaler ausgefallen waren, als die übrigen zehn, weshalb auch immer die beiden jüngsten und schlanksten Schreiber sich in sie hineinklemmen mußten.
So saßen nun die dreizehn, immerfort und immerfort, in ungeheurer Stille, die nur selten durch das leise Rauschen beim Umwenden eines Blattes oder durch das Kritzeln und Spritzeln einer schlechtgeschnittenen Feder unterbrochen wurde. Wenn einmal eine Spinne sich eine Fliege gefangen hatte und mordete, und diese, grimmig und jammervoll dröhnend, ihr langgedehntes Todeslied absang, so war dies im stillen Turm nichts anderes, als wenn auf ruhiger See plötzlich ein tobender Orkan losbricht. Und so regungslos saßen sie alle, daß wenn sie abends nach getaner Arbeit aus dem Turm gingen, bei mehreren der Schreiber, welche große Stutzer waren und die sich am Morgen sorgfältig und zierlich behaarkräuselt hatten, jedes Löckchen, ja jedes Härchen ganz genau noch dieselbe Biegung, Schmiegung, Krümmung und Lage hatte, wie solches am frühen Morgen, vor zwölf Stunden, mit kunstreichen, säuberlichen Fingern von ihnen angeordnet, geschlichtet, gerichtet, gelichtet, abgeteilt und abgezielt worden war.
Kapitel II
In solcher Stille saßen sie einst wieder da, als plötzlich die Tür aufgerissen wurde, und hervor stürzte des Herrn Habichs Stubenmagd ganz atemlos, rauschte auf ihn zu und rief, indem die Hast fast ihre Stimme erstickte: »Herr Habichs, es ist da, es ist da!«
»3066 Rtlr. 6 Gr. 3 Pf. – Was da?« sprach Herr Habichs ärgerlich, daß er gestört wurde, ohne sich umzusehen.
»Die gnädige Frau ist in diesem Augenblicke glücklich entbunden worden.«
»Transport: 8736 Rtlr. 15 Gr. 9 ¼ Pf. – Ist's ein Junge?« sprach Herr Habichs, das Blatt im Buche umwendend.
»Ja! Ach! und so ein schöner, munterer, herziger dicker ...«
»Ist mir lieb, sehr lieb, unterbrach Herr Habichs, kann einmal das Geschäft fortsetzen. – 150 Rtlr. 6 Gr. ...« die Pfennige aber murmelte er schon wieder leise für sich und fiel ins alte Schweigen zurück.
Die Magd stand noch da. Als sie sah, daß der Herr sie nicht mehr bemerkte, hustete sie leise, scharrte mit dem Fuß; aber er blieb bewegungslos. Endlich sprach sie ganz kleinlaut: »Herr Habichs«. – »... 6 ½ Pf. – Schon gut, schon gut. Geh Sie nur!« –
»Gnädiger Herr, wollen Sie sich Ihr Kind nicht ansehn kommen?« – »Den 31. Dezember 80 Rtlr. 22 Gr. – Ist Sie noch da? Ansehn? Dummes Zeug! Um acht Uhr, wenn die Bureaustunden aus sind. Geh Sie! Alle Türen gut zugemacht, hört Sie? daß uns das Geschrei hier nicht stört. Wünsche meiner Frau gute Besserung. – Den 1. Januar 388 Rtlr. 4 Pf.« –
Die Magd schlich sich ganz verdutzt aus dem Turm, warf aber doch ein bischen malitiös laut die Tür hinter sich zu, so daß vieljähriger Bureaustaub aufgescheucht und umhergefegt wurde und Herrn Habichs, dem er auf die Brust fiel, ein leises Husten ankam. Wie er nun, um nicht ins Buch zu husten, die Finanznase ein wenig in die Höhe richtete – siehe da! zwei seiner Schreiber in der seltsamsten Stellung, wie er sie sonst nie gesehen hatte, Nase und Augen gen Himmel starrend und stierend, Mund weit offen, die Hand mit der Feder schlaff und tatenlos herunterbaumelnd, wie Zweige an der Trauerweide; ganz wie Verzückte oder Verrückte. Erschreckt schraubt sich Herr Habichs auf dem Esel ein wenig herum und sieh! der nächste Schreiber ganz in derselben Stellung. Er schraubt sich weiter und weiter, und in der Drehung vorbeispazieren seinem Auge alle zwölf Schreiber, einer nach dem andern, einer wie der andere, dem gemalten Erstaunen gleich, regungslos, guckend, horchend und maulaufsperrend, so daß gerade zwölf gebratene Tauben, wenn solche wirklich die löbliche Gewohnheit an sich hätten herumzufliegen und offene Mäuler zu suchen, Quartier gefunden hätten.
»Was da, was da?!« krächzte Herr Habichs in erstickter, leiser Wut. »Warum nicht gearbeitet?«
Die zwölf gemalten Erstaunen erschraken und fuhren leicht zusammen, wie alte, hängende Tapetenbilder vom Zugwind getroffen; aber sie staunten und faulenzten im nächsten Augenblicke unbeweglich fort.
»Gleich die Nase ins Buch, meine Herren! Narrheit das, unerhört!« kreischte Herr Habichs sie in der Runde an, indem er sich hastig, fast die Balance verlierend, rings herum schraubte. Da faßte der oberste Schreiber ein Herz und sprach:
»Werden gütigst entschuldigen, Herr Prinzipal, aber zweifelsohne vernehmen Dieselben auch jenen überaus lieblichen und ganz wunderbaren Gesang über dem Turme, der uns unwiderstehlich in sotane Verwunderung und Untätigkeit versetzet hat.« –
»Unsinn das! Über dem Turme Gesang, und lieblicher Gesang gar! Wer soll da singen? Ist Gesang lieblich? Exaltiertes Wesen! taugt nichts für einen tüchtigen Arbeiter. Gleich aufgehört sich Unsinn einzubilden! Kann das nicht leiden.« –
Die Schreiber rissen sich gewaltsam aus ihrer Träumerei. Zwölf Mäuler gingen langsam zu, aber ohne gebratene Tauben drin, zwölf Nasen zeigten wieder jede auf ihr korrespondierendes Buch und schnell war alles regungslos bis auf die zwölf Federn, die, in sittsamer Entfernung voneinander, ihr altes, steifes Menuett forttanzten.
Mit dem Gesange aber hatte es doch seine Richtigkeit gehabt, obgleich Herr Habichs nichts davon gewahr wurde; wie er denn überhaupt gar vieles nicht gewahr wurde.
In dem Augenblicke nämlich, als der Knabe geboren wurde, schwebte über Habichs Haus hin, langsam, leicht und feierlich, ein lichter, glänzender Schwan, die Schwingen vom rötlichen Kuß der sinkenden Sonne leise angeschimmert, und sang folgende Worte, die aber die Schreiber freilich nicht verstanden:
Du holdes Kindlein, sei gegrüßt! Dein Leben wird, wie keines je, Verbittert werden und versüßt Von höchster Wonne, tiefstem Weh. Du Röslein auf des Felsen Stirn, In schwarzer Nacht du zuckender Schein, Du Morgenglut auf eisiger Firn, Ein Fremdling wirst du immer sein. Der Maulwurf schilt den Adler blind, Weil er nichts sieht im Maulwurfsloch: Dich nennt man Tor einst, holdes Kind; Bist weiser als die andern doch. Dein Glück ist nur von dort ein Traum, Der hier ein Weilchen dich entzückt, Wie Regenbogenpracht den Saum Der dunklen Wolke flüchtig schmückt. Du bist erkoren und verdammt, Bis der von Ost verirrte Strahl Zurück in seine Heimat flammt, Und Wonnen aufblühn aus jeder Qual.
So sang der Schwan, stieg höher und höher, das Lied verwehte leis, der Sänger schwand im dunklen Blau. Als nachher der Herr Habichs einmal alle seine Bücher durchsah, fand er, daß jeder der zwölf Schreiber an jenem Tage einen Rechenfehler gemacht hatte, was ihm so unerhört war, daß er sie zornig anließ und sie beinahe alle weggejagt hätte, wenn er nur gleich zwölf bessere hätte bekommen können.
Kapitel III
Am Vorabende des Tages, da des Herrn Habichs erstes Söhnlein getauft werden sollte, gerade am Schluß der Bureaustunden, in demselben Augenblicke, als Herr Habichs eben aus dem Gange in die eine Tür der Stube trat, wo seine Frau am Teetisch auf ihn wartete, klopfte es an der andern Tür derselben Stube! Verdrießlich, weil er glaubte, jetzt noch mit Geschäften behelligt zu werden, rief Herr Habichs sein: Herein! Und herein trat, feierlich und mutwillig, stolz und lustig, gravitätisch und nachlässig, ernst und komisch zugleich, ein stattlicher Mann in hohen, plumpen Stiefeln, grobem Tuchrock, mit langem, dickem, gepudertem Haar, starkbuschigen schwarzen Augenbrauen, unter denen es wie lauteres Geistesleben hervorleuchtete und zwischen denen eine schöne Königsadlernase sich herabwölbte. »Guten Morgen, liebe Schwester, guten Morgen, lieber Schwager!« sprach er ganz ruhig und reichte der Frau Habichs und ihrem Gemahle die Hand, als ob gar nichts los wäre. Diese aber waren höchst befremdet und überrascht, so daß sie erst gar nicht wußten, was sie sagen sollten. Der Mann war nämlich der einzige Bruder der Frau Habichs, der in einer andern Stadt, wohl fünfzig Meilen weit, wohnte und höchstens alle fünf Jahre einmal seine Schwester zu besuchen pflegte. Auch erfuhren sie niemals durch Briefe etwas voneinander, denn Herr Habichs hatte keine Zeit und Holofernes, wie alle großen Geister, keine Lust zum Briefschreiben. Was aber die Frau Habichs betrifft, so hatte sie zwar früher einmal viele schlechte Romane gelesen, das Schreiben aber, bei verwahrloster Erziehung, nur sehr mangelhaft gelernt. Nichtsdestoweniger schrieb sie kurz vor ihrer Verheiratung einmal an ihren Bruder und erhielt auch von ihm folgende Antwort:
Geliebte Schwester!!!
Mit brüderlicher Freude, doch auch in zahrter Wehmut gepahrt, hat meine innere Simpathie Deinen so liebenswürdigen Zeilen gelauscht; und ich ergreife die Feder.
Ja wol hast Du recht, das der Wert des Edleren in den speculativen Berechnungen des Kalten Zeitalters erdrückt wird. In meiner Phantasy mahlt sich ganz die Empfindung eines Leidens, daß Mir die eigne Erfahrung nur Leider! – zu treu wiederspiegelnd. Alle edlen Sehlen werden – verkant und bleiben nur in dem süßen Troste gestärkt, daß sie sich gegenseitig auch in der Entfernung, über die gemeineren Naturen des Eigennutzes erhaben, verstehen. Bei alleden ist Herr Habichs nach den Angaben Deines Briefes eine gute Parthie, wenn Du ihm auch nicht mit der schwärmerischen Hingebung des weiblichen Gemütes lieben kannst. Und wenn er Dir die Romanlektüre, die Sehlen von unsrem Schlage zum höheren erhebt, ferbothen hat – so ergib Dich der stillen Empfindung in Dir selbst Beruhigung und Beschäftigung zu finden.
Das erbetene Recépt für Leberklöse folgt anbei. Lebe wol und vergib Deinem Ewig unvergeßlichen Bruder
Holofernes.
Diesen Brief hielt Frau Habichs durchaus für Ernst und für erhaben, rührend und »padehdisch« und zeigte ihn deshalb mit Stolz allen ihren Freundinnen, bis eine von ihnen so gescheit und aufrichtig (vielleicht auch boshaft) war, einzusehen und ihr geradezu zu sagen, Holofernes habe darin nur ihren eignen Stil und ihre Rechtschreibung lächerlich machen wollen, und sie möge deshalb den Brief ja nicht weiter herumzeigen; so riete sie ihr wohlwollend als Freundin. Der Erfolg davon war, daß Frau Habichs fortan einen geheimen Haß auf jene Freundin warf, ihren Bruder aber fortan mit unsinnigen Weiberbriefen gänzlich verschonte.
Übrigens konnten sich Herr Habichs und Holofernes gegenseitig nicht besonders leiden, und auch Frau Habichs, obgleich innerlich stolz auf das »Schenie« ihres Bruders, hatte vieles an ihm zu tadeln. Herr Holofernes war nämlich gelahrten und geheimen Forschungen und Künsten ganz ergeben, und weihte ihnen seine ganze Zeit, was Herrn Habichs sehr ärgerte, denn er sagte, es käme nichts dabei heraus und die erste Pflicht des Mannes sei eine regelmäßige und nützliche praktische Tätigkeit; die Frau Habichs aber ärgerte es auch, denn sie sagte: die erste Pflicht des Mannes sei, ein fixes Einkommen zu haben und dann, sich eine Frau zu nehmen. Wäre dann einer nebenbei noch ein Genie, so wäre dies ein recht angenehmes, schönes Talent an ihm; aber doch nicht die Hauptsache. Auch in diesem Augenblicke war es Herrn Habichs wieder höchst ärgerlich, daß sein Schwager beim Gruß »Guten Morgen!« sagte, da es doch augenscheinlich Abend war, denn er konnte nun einmal keinen Unsinn leiden. Indem das Ehepaar den Holofernes noch ganz verdutzt anstarrte, unterbrach er die verlegene Stille mit den Worten: »Ei, was wundert ihr euch so? – Es ist doch ganz natürlich, daß ich der Taufe meines kleinen Neffen, die ihr morgen zelebrieren wollt, beizuwohnen komme.« –
»Woher weißt du was vom kleinen Neffen und von der Taufe? Wir haben dir ja kein Wort davon geschrieben?« sprach Frau Habichs erstaunt.
»Je nun«, sagte Holofernes, »ich komme, wie einer der drei Weisen aus dem Morgenlande. Wozu hat uns denn der Herrgott Lichter am Himmel angezündet, als damit wir bei ihrem Schein mehr sehen sollen, als bei dem von Wachskerzen oder Astral- oder Studier- oder Gaslampen; der gemeinen verächtlich schmierigen Talglichter gar nicht zu gedenken? Aber laßt euch das nicht anfechten. Kurz, ich hab's nun einmal gewußt und bin hier.« Dabei nahm Holofernes eine geheimnisvoll verschlossene Zaubermeisterphysiognomie an; um seinen Mund aber spürte man ein leises Lächeln, so daß man sehen konnte, das Habichssche Ehepaar sah's freilich nicht, wie er im Innern sich über seine eigne Feierlichkeit lustig machte.
»Unsinn! Scharlatanerie!« brummte Herr Habichs leise für sich und schüttelte den Kopf.
Die Frau Habichs überlief ein leiser Schauer, wie Gespensterfurcht; dann regte sich die Weibereitelkeit, einen so gescheiten Bruder zu haben, dann die Hausfrage, wie er aufzunehmen und zu bewirten sei. »Mit welcher Gelegenheit bist du gekommen? Wo bist du eingekehrt? Willst du nicht bei uns übernachten und deine Sachen herbringen lassen?« So ging's jetzt, denn die Plapperklappermühle begann zu erwachen. »Gekommen bin ich zu Fuß; eingekehrt nirgends; Sachen hab' ich nicht, und übernachten werd' ich nicht. Ich komme heut bloß, um mich für morgen anzumelden und werde in dieser mondhellen Nacht, weil ich gerade in einer schönen Gegend bin, noch eine kleine Fußreise machen.« –
»Sonderbares Reisen das!« sagte Herr Habichs.
»Gar nicht sonderbar, sondern angenehm, praktisch und vernünftig. Die Leute machen sich immer tausend und abertausend unnütze Weitläufigkeiten. Schwierigkeiten, Unbequemlichkeiten und alle möglichen ›keiten›, wenn sie einmal den fürchterlichen Entschluß gefaßt haben, zu reisen; gerade als ob sie mit aller Gewalt darauf hinarbeiteten, womöglich nicht vom Fleck zu kommen. Ich mach's umgekehrt. Ich gehe eben fort und das weitere findet sich. Was aber meine Nachtmärsche betrifft, so muß ich erklären, daß niemand das Wachen der Natur verstehen kann, der nicht ihren Schlummer belauscht hat. In der Nacht, da träumt sie von Gott und lauscht seinen ewigen Worten, um sie bei Tage zu offenbaren in Sproß und Blüte. Aber jetzt zeigt mir einmal euren kleinen Jungen.« –
»Er schläft,« sprach Frau Habichs. »Vor der Hand setz' dich, trink mit uns eine Tasse Tee und iß ein Butterbrot.« –
»Sehr gern, wenn ihr Rum zum Tee habt,« sprach Holofernes und ließ sich ganz behaglich in einen Lehnstuhl nieder. Dem Ehepaar war der Besuch peinlich und unheimlich; Holofernes aber schien davon gar nichts zu merken und sprach, heiter und unbefangen, allerlei durcheinander, wovon die beiden kein Wort verstanden. Herr Habichs hielt deshalb alles für baren Unsinn, und Frau Habichs alles für tiefe Weisheit. Als Holofernes sich satt gegessen hatte, fragte er seine Schwester gutmütig spöttisch, ob sie ihm wohl erlaube, eine Pfeife Tabak zu rauchen. Das konnte nun Herr Habichs nicht leiden, weil es unnütz Geld kostet und von ernster Arbeit abhält; Frau Habichs auch nicht, weil es die Gardinen gelb macht und die Kleider durchzieht. Sie konntens aber doch nicht abschlagen und Holofernes zog ein langes Pfeifenrohr aus dem Ärmel, dann aus der Tasche einen türkischen Tonkopf und eine kulpige Bernsteinspitze: er stopfte dann mit echt türkischem Tabak, und, indem er die ersten Züge behaglich einsog und die Stube mit Wohlgeruch füllte, sprach er: »Den ganzen Apparat und diesen edlen Opferweihrauch hab' ich mir unterwegs in einem Kramladen in Konstantinopel selbst gekauft.« Dabei lächelte er, so daß man nicht wußte, ob er bloß spaße oder im Ernst weiß machen wollte, er käme zu Fuß über Konstantinopel.
Jetzt fing der kleine Junge an zu schreien. Frau Habichs wollte ihn still machen.
»Gib mir ihn, Frau Schwester! ich weiß mit dergleichen umzugehen,« sagte Holofernes.
»Ei, wo sollst du das gelernt haben?« sprach Frau Habichs und lächelte, denn sie merkte, daß sie unbewußt eine Neckerei gesagt hatte.
»Man kann wissen, ohne gelernt zu haben. Gib den Jungen nur her!« Sie tat es; Holofernes richtete einen hellen, liebevollen, aber durchdringenden Blick in die Augen des Kleinen und sofort wurde der Junge still und sah den Onkel tief nachdenklich an.
»Und hast du noch immer nicht an eine Frau gedacht?« fragte Frau Habichs den Bruder, und da er es lächelnd verneinte, fuhr sie fort:
»Willst du denn wirklich nie heiraten? und warum denn nicht?« Holofernes nahm eine komisch ernsthafte Miene an. »Aus vielen und wichtigen Gründen, liebe Schwester,« erwiderte er, »hauptsächlich aber, weil ich noch kein Weib gefunden habe, das folgende drei Dinge begriffen hätte, nämlich:
Daß ein nasser Fußboden im Zimmer unangenehm und ungesund sei.Daß in einer Arbeitsstube, in der Bücher und Schriften scheinbar wild durcheinander liegen, eine geheime, sehr wohl berechnete Ordnung herrschen könne, und daß eine ungeweihte Hand, die sich vorwitzig vermisst, alles darin recht hübsch zurecht zu legen, damit es, nach dem gemeinen Vorurteil, ordentlich aussehe, nichts anderes anrichten kann als die heilloseste Konfusion.Und hauptsächlich endlich, daß ein Mensch unmöglich zum zweiten Frühstück eine Sardellensemmel essen und ein Glas Rheinwein dazu trinken kann, ohne vom unüberwindlichsten Ekel erfaßt und geschüttelt zu werden, wenn er zufällig in einer Ecke der Stube auf einer Kommode einen Kamm oder gar eine alte abgenutzte Zahnbürste liegen sieht.«»O du böser Mensch!« rief Frau Habichs, die doch ungefähr begriffen hatte, daß ihres Bruders Antwort eine Satire sei; der aber hatte sich wieder in das Anschauen des Kindes versenkt.
»Wahrhaftig ein hübscher Junge!« sprach er und küßte ihn, dann fügte er leise für sich hinzu: »Wer sollte dirs ansehn, daß du von einem Geldsack und einer Kaffeekanne abstammst? Welche höhere Hand hat dich hierher geworfen, wie eine Perle unter den Kehricht, du junger Paradiesvogel im Nest des Wiedehopfs?«
Dies sprechend fing er an, die Tabakwolken etwas leidenschaftlicher zu blasen, so daß sie sich dunkel verdichteten, dann wieder lichtblau, bald wie langgezogene Schleier, bald wie wallende Morgennebel sich leise verteilten und verzogen. Sie wölkten, ballten, jagten, zogen und bogen, streckten und reckten, zerrten und kräuselten sich, wogten und schwebten, stiegen und gaukelten – ein ewig phantastisches Wechselspiel von halbkenntlichen, flüchtig angedeuteten, rasch zerfließenden Formen und Gestalten, eine stille, wilde Jagd von lieblichen seltsamen kleinen Spukgesichten. Das Kind sah nach dem Tabakwolkenspiel mit größern und größern, erstauntern und erstauntern Augen. Dann belebte sich sein Gesichtlein, es lächelte die zerfließenden Nebelbilder an, es begann zu lallen, als ob es sich mit ihnen unterhielte.
»Und ein kluger Junge!« rief Holofernes ganz warm, »ein goldner, gescheiter Junge! Seht doch: er versteht den schönen Hexentanz und würde ihn euch gleich dramatisch erklären, wenn er sprechen könnte. So bleibt's bloß Gelall; aber ein tiefsinniges Gelall, das sage ich euch, denn ich versteh's gar wohl. Aus dem Jungen wird was, denn es kommen ihm Gedanken beim Anblick des Tabakdampfes, wie allen geistreichen Menschen. Deshalb haben wir ja in Deutschland so viel Philosophie und Tiefsinn, weil wir viel Tabakrauch haben, und das französische Gouvernement ist nicht recht klug und rennt selbst in sein Verderben, da es den Tabak immer noch so schwer besteuert. Denn wo viel Tabakrauch, da sind viel Gedanken; wo viel Gedanken, da sind keine Taten, folglich auch keine Revolutionen. Das sollte das französische Gouvernement zu Herzen nehmen. Aber jetzt lebt wohl! Morgen bin ich wieder hier und ich hoffe, ihr werdet mir die Ehre nicht verweigern, bei eurem Kind Pate zu stehen. Adieu, Junge!« – Er küßte ihn und gab ihn der Mutter; dann rauchte er wieder eifrig und immer eifriger, das Wolkenspiel wurde düsterer, schwerer, massenhafter. Herr Habichs hustete, Frau Habichs keuchte und mühte sich vergebens die Worte: »Bist du verrückt, Bruder?« hervorzubringen. Es wirbelte, schwindelte, dunkelte ihnen vor den Augen, der Rauch füllte die Stube und deckte selbst das Licht mit Nacht, das Ehepaar war einer Ohnmacht nahe. Da tönte es aus dem Kern der Finsternis: »Guten Morgen, auf Wiedersehen!« Sogleich teilte sich der Dampf leise, das Licht tauchte wieder hervor, die Wölkchen sonderten sich, verschwebten und verzettelten sich hier und dort, es wurde völlig klar und rein in der Stube; aber wer nicht mehr im Lehnstuhl saß, das war der Herr Holofernes; Tür und Fenster waren fest zu gewesen und geblieben, aber wer fort und verschwunden war, das war der Herr Holofernes.
Kapitel IV
Der ehrliche Leser wird vielleicht sehr begierig sein, zu erfahren, was das Ehepaar Habichs bei dem höchst wunderbaren und plötzlichen Verschwinden ihres Bruders und respektiven Schwagers sich alles gedacht und wie sie sich darüber den Kopf zerbrochen haben. Aber sie pflegten überhaupt selten über etwas anderes zu denken, als er über Geldgeschäfte und sie über Kaffeeklatschereien, beim Romanlesen nämlich dachte sie gar nichts; und was Kopfbrechen anbetrifft, so war Herr Habichs zwar ein großer Kopfrechner, aber durchaus kein Kopfbrecher, nicht einmal ein Pfeifenkopfbrecher, da er nicht rauchte, und die Frau Habichs hatte einen angeborenen Abscheu gegen alles Zerbrechen, sei es nun das eines Tassen-, Hauben- oder ihres eigenen Kopfes. Sie gingen zwar ganz verwirrt an jenem Abend schlafen, wurden von wilden und wüsten Träumen die ganze Nacht heimgesucht; aber am andern Morgen warfen sie Traum und Wirklichkeit zusammen, glaubten, das Verschwinden des Holofernes habe ihnen auch nur geträumt, und sie hätten es nur vergessen, daß er eigentlich ganz ordentlich und vernünftig, wie es gesetzten und wohlgesinnten Leuten ziemt, zur Tür hinausgegangen wäre.
Am andern Tage warteten sie auf ihn, und beschlossen, dass er wirklich Pate des Kindes werden sollte; denn man konnte es mit ihm nicht ganz verderben. Obgleich er leider kein einträgliches und honettes Amt bekleidete, so stand er doch im Rufe, Vermögen zu haben, und das konnte sein Patchen dermaleinst erben. Auch war einmal aus dem Wohnort des Holofernes bis in Habichs Haus ein dunkles Gericht gedrungen, Holofernes treibe unter anderen auch die Goldmacherkunst. Frau Habichs, die, wie alle Frauenzimmer, abergläubisch und geldliebend war, zweifelte hieran gar nicht, und obgleich der Herr Habichs sonst ein viel zu vernünftiger Mann war, um abergläubisch zu sein, so war doch Gold seine Liebhaberei, und in Hinsicht auf Liebhabereien ist jeder Mensch leichtgläubig und töricht; kurz, die Sache war ihm auch ganz plausibel, namentlich da er nicht begreifen konnte, wovon ein Müßiggänger sonst existieren könne.
Holofernes trat auch wirklich ganz unvermutet zur Tür hinein, als es eben die höchste Zeit war, und erklärte auf Befragen, der Knabe solle von ihm den Namen Junius erhalten, was dem Herrn Habichs gar nicht recht war. Doch Holofernes bestand darauf und das Kind wurde in dem alten, gotischen Dome der Stadt also getauft.
Als der Zug die Kirche verließ, sagte Holofernes zu Habichs, an dessen Seite er ging:
»Diese Alfanzereien und Spielereien mit dem Heiligen, wozu ihr Leute die Wertlosigkeit eines unschuldigen, unbewussten Geschöpfes mißbraucht, gefallen mir im ganzen gar nicht; aber etwas ist mir bei der Taufe des kleinen Junius doch lieb, nämlich, daß er sie in einem erhabenen, riesenhaften, wahrhaft groß, fromm und künstlerisch gedachten Spitzbogenschiffe, umweht von kühlen Dämmerungsschauern empfangen hat, und vor allem, daß die Fenster dort alle aus vortrefflichen Glasmalereien bestehen, die das hereinbrechende Licht zugleich erhöhen und dämpfen und jenen eignen, wunderbaren Zusammenguß von brennendster Farbenglut und ehrwürdigster Nacht, von träumerischester Gestaltenbevölkerung und heiligster Einsamkeit erzeugen, der sich, einmal geschaut und empfunden, mit leiser, doch überwältigender Macht in jede Brust versenkt und dort, fort und fort, ein unerschöpflicher, geheimnisvoller Quell großer und hoher Gedanken, heiliger, süßer Empfindungen bleibt. Glaubt mir's, Schwager! der wichtigste Teil der Erziehung des Kleinen ist nun schon vollbracht, dadurch, daß schon so frühe die Gewalt jenes Eindrucks auf seine noch ungeübten und unbewehrten Sinne los und eingebrochen ist, wie ein kriegerisches Heer in eine unbewachte Festung!« – »Kann Euch nicht ganz verstehen und beistimmen, Schwager,« sprach Habichs. »Kann überhaupt das viele Schwatzen über unwichtige Dinge nicht leiden. Die Glasbilder sind recht zierlich und bunt; aber wenn man sie sieht, ist's gut; und kommt man aus der Kirche wieder heraus, so hat man sie gesehen, und es ist auch gut. Weiß nicht, was Ihr mit dem Versenken, und dem unerschöpflichen Quell, und den heiligen Gefühlen usw. wollt, das sind so schnurrige Redensarten in Eurem Geschmack.« –
»Nicht doch, Herr Schwager! wenn Ihr dergleichen auch noch nie an Euch erfahren habt, könnt Ihr's denn nicht nachfühlen, wie zum Beispiel ein einziger bedeutungsvoller Blick von einer Geliebten, mag sie auch nachher vergessen oder gestorben oder treulos geworden sein, in einem süßen geweihten Augenblick gespendet und empfangen, ein ganzes künftiges Leben leise und mild vergolden und verherrlichen kann: nicht anders, wie die untergegangene Sonne über einer ganzen Gegend einen befriedenden, beseligenden Erinnerungsschimmer zurückläßt, als ob alle Rebenhügel und Wälder ringsum über die Herrlichkeit der geschiedenen Gottheit still und innig nachsännen?« –
»Das mag bei Euch so sein; aber ich habe nie Zeit gehabt, Romane zu lesen, denn ernstere Geschäfte hinderten mich daran. Überhaupt bin ich einmal ganz anders konstituiert, und danke Gott dafür. Aber wenn das alles auch seinen Grund hätte, so könnte doch bei einem ganz unvernünftigen Kinde, das noch nicht sprechen, noch nichts verstehen kann, gewiß keine besondere Wirkung der Art stattfinden, und ich danke Gott dafür; denn mein Junius, wie Ihr ihn leider doch einmal genannt habt, soll ein tüchtiger Geschäftsmann werden und der hat den Henker was mit heiligen Gefühlen, hohen Gedanken und dergleichen belletristischem Plunder zu schaffen.«
Da lachte Holofernes schadenfroh, aber aus gutem Herzen und sprach: »Bester Schwager, Eure frommen Wünsche helfen Euch jetzt nichts mehr; das ist verspielt! Wißt Ihr nicht, daß dieser Eindruck, eben weil er der erste bedeutende, auch der entscheidende ist; die erste Schule noch ganz ungeübter und nun plötzlich aufgerüttelter Fähigkeiten? Zehn Jahre lang schlummert er vielleicht in Eurem kleinen Junius, dann aber tritt er mit Macht hervor, in Gedanken und Wort, in Reim oder Farbe, in Gesinnung und Schöpfung und bedingt die ganze Lebensrichtung. Alle herrlichsten Dichtungen sind nur ein Zurückbesinnen in die früheste Kindheit des Dichters hinein; sie ist der eigentliche Fond und gibt den Kern; alle Lebenserfahrung gibt nur das Bei- und Kulissenwerk. Ja eigentlich ist alle Poesie nichts weiter, als ein Zurückerinnern an den Moment des Erzeugtwerdens, wo durch die ewige Urkraft des erobernden Hingebens und hingebenden Eroberns das junge Organon als Keim gestaltet wurde und von nun an das lebendige Gesetz des Wachsens, Aufblühens und geistigen Fortwerdens unwiderruflich in ihm pulsierte. Und je energischer, reiner und edler dieser geheimnisvolle Augenblick gefeiert und genossen wurde, desto reicher und tiefer ist dereinst das Gemüt des Werdenden. Ich könnte füglich noch weiter gehen und das Göttliche im Menschen von Keim zu Keim zurück verfolgen bis zum Urkeim, und dann ist am Ende alle Poesie, im Innern des Poeten betrachtet, nichts, als ein dunkles aber mächtiges Zurückerinnern an jenen ersten, heiligsten und gewaltigsten Augenblick der sich entäußernden Liebe, wo das Donnerwort Gottes: Es werde! das unendliche, wüste Nichts durchzuckte, so daß es, süß und schaurig erbebend, sein Wesen verlor und fortan mit Millionen von Keimen eines freudigen, rüstigen, schwellenden Lebens unwiderruflich schwanger ging. Und in diesen Keimen waren und fühlten wir ja auch schon. Alle Dichtung ist hiernach nichts, als ein leise mahnender, schwacher, stümperhafter Nachhall jenes ersten Schöpfungswortes, aber bei aller Mangelhaftigkeit doch eine sichere Gewähr der Gottähnlichkeit des Menschen, mithin auch der individuellen Unsterblichkeit. Ich deute Euch dies hier nur flüchtig an, behalte mir aber vor, es in meiner herauszugebenden Ästhetik, wenn ich sie je schreiben sollte, gelahrt und gründlichst zu erörtern. Die werdet Ihr aber wahrscheinlich nicht lesen, bester Schwager, denn ich sehe jetzt schon, daß Euch meine Theorie nicht zusagt; ihr seht verdrießlich, ja, wie mir scheint, sogar bleich und entsetzt aus. Also, um auf unser Thema, d. h. auf Junius und die Macht der ersten Eindrücke zurück zu kommen: meint Ihr, daß man brauchbare Mülleresel unter Rosenbüschen erzieht? Hättet Ihr Euren Jungen in Eurem gespenstig nüchternen Turmbureau, das auch einen gewaltigen Eindruck macht, einen gewaltig langweiligen nämlich, taufen lassen, dann hättet Ihr vielleicht hoffen können, einen Kassabuchautomaten aus ihm zu ziehen. Nun aber ist's vorbei und Ihr habt einen Poeten, ein Genie zum Jungen.« –
Bei diesen beiden Worten, die dem Herrn Habichs die unleidlichsten in der ganzen Sprache waren, schauerte er zusammen und schwieg, teils aus Schreck, teils, weil er nach seiner Meinung heute überhaupt schon viel zu viel geschwatzt hatte, wobei nichts herauskam. »Also ein Vagabund!« seufzte er nur ganz still in sich hinein, denn dies Wort hielt er für gleichbedeutend mit Poet und Genie. Doch den Eindruck der Prophezeiung kräftig abschüttelnd, dachte er im nächsten Augenblick: »Ach was, dummes Zeug!« Holofernes aber lachte für sich und weidete sich herzinnig an dem Entsetzen seines Schwagers.
Kapitel V
Unter solcherlei Gesprächen, wobei es Herrn Habichs grün und blau vor den Augen geworden war, kamen sie endlich bei der Wöchnerin an, um die sie, eintretend, einen Kreis von Damen kaffeetrinkend und klatschend versammelt fanden.
Da war nun an Herrn Holofernes das Blaßwerden und Erschrecken, denn das Gespräch versammelter Weiber machte auf ihn ganz denselben schauerlichen Eindruck, wie auf manche das Kratzen und Greinen eines gewaltsam rückwärts geführten Griffels auf der Schiefertafel. Er faßte sich jedoch bald und grüßte alle mit leise spöttelnder, linkischer Höflichkeit. Hierauf ging's an's Ueberreichen der Patengeschenke. Da hatte sich nun Frau Habichs eingebildet, ihr Bruder werde mit einem Röllchen Goldstücke aus seiner Ersparnis oder gar seiner Goldmacherfabrik herausrücken. Sie wußte schon genau, in welcher Ecke des Schreibtisches sie selbige verstecken würde, und wie sie sie dem kleinen Junius alle Jahre zu seinem Geburtstage einmal zeigen wollte und ihm dann jedesmal erzählen, daß sie vom Onkel wären und daß er sie einmal haben sollte, was den Jungen freilich nicht satt gemacht hätte; und so wollte sie das Röllchen aufheben, bis Junius heiratete, ein vermögendes Mädchen natürlich, und dann wollte sie ihm für die Goldstücke Hemden, Tischtücher und Servietten kaufen. Alles das war schon genau berechnet, nur die Hauptsache fehlte noch. Nun denke man sich den Ärger und das Erstaunen der Frau Habichs und ihres Gemahls, denn auch der hatte auf etwas Solides und Honettes gerechnet, als Holofernes ein dünnes, buntes, mit grillenhaft grotesken Arabesken auf dem Deckel verziertes Büchlein hervorzog und dies mit den Worten überreichte:
»Da euch doch vor allem daran gelegen sein muß, daß euer Junge was lernt, da aber die gewöhnliche Methode verabscheuungswert ist und den Menschen sowohl schlecht, als dumm macht, so schenke ich dem Jungen hiermit dies ABC-Buch, auf das ich wohl stolz sein kann, denn ich habe solches selbst ersonnen, gesetzt, gedruckt, geheftet und eingebunden. Auch habe ich die Bilder darin selbst verfertigt. Diese Bilder werden Ihnen allen, meine Herrschaften, etwas sehr plump vorkommen, ich weiß es, aber Sie werden gewiß begreifen und zugeben, daß zierliche, geleckte Bilderchen die Phantasie des Kindes, deren Erweckung man doch durch Bilderbücher allein bezweckt, nur träge, feige und zahm machen können. Man zeige ihm erst das Ungestaltete, Verzerrte, Verzeichnete, aber in starken kecken Strichen, so daß sich's dem jungen, weichen Hirn einprägt. Dann wird der angestammte Schönheitssinn im Knaben sich dagegen empören, ankämpfen und ringen und so unwillkürlich, durch eigene Kraft, das Schöne zu ersinnen anfangen, bis die dunkle Kraft sich zur Einsicht reinigt und verklärt und das Wohlgefallen an Harmonie und Schönheit dann ein selbsterrungener, unverlierbarer Sieg ist. Dies wird und muß um so mehr geschehen, da in der Fratze schon der geheimnisvolle Schlüssel, die kräftigste Hindeutung der Schönheit, ja die Schönheit selbst enthalten ist, nur verschoben und auseinander gestreut wie ein wohlgebildetes Gesicht im Hohlspiegel, wie das Licht durchs Prisma gebrochen. Sie werden, meine Damen, diese Bemerkung gewiß selbst schon beim Studium der verschiedenen Malerschulen gemacht haben. Da sehen Sie immer aus der steifen, rohen und fratzenhaften Manier die großen Meister hervorgehen, aus den göttlichen Schöpfungen dieser aber, in raschem Abfall, die geleckten, lüsternen, gedankenlosen, affektierten Weichlinge: und ein Erheben erfolgt immer erst dann wieder, wenn das oberflächliche Treiben solcher Akademiker in handgreifliche Abgeschmacktheit und Barbarei ausgeartet ist. Was insbesondere die unverhältnismäßige Größe der Köpfe zum übrigen Körper bei meinen Figuren betrifft, so hat das noch einen anderen Grund. Wenn Sie die sonst so treffliche Technik, namentlich älterer deutscher Meister betrachten, so werden Sie ihnen gewiß nicht den totalen Mangel an Auge zutrauen, daß selbige nicht gewußt hätten, wie ihre Köpfe gar nicht auf die kleinen verkrüppelten Leiber passen, so daß alle Figuren wie Zwerge aussehen. Aber sie hielten das Bild eines Menschen nur für Mittel, einen Charakter, oder, was hier dasselbe ist, eine Idee zu versinnbildlichen. Nun ist Ihnen bekannt, daß das menschliche Antlitz die Effloreszenz, Quintessenz, der Auszug aus dem ganzen innern und äußern Wesen des Menschen ist; alle andern Glieder, obgleich in ihrem lebendig bewegten Einklang mitwirkend zum Siege über das Gemüt des Beschauers, sind doch nur Hilfstruppen. Dies drückten die alten Maler, auf ihre naive Weise, mechanisch durch die großen Köpfe und kleinen Leiber aus. Oder geben Sie nicht zu, meine Damen, daß es Unsinn wäre, ein Porträt zu besitzen, wo unter der Brust alles andere abgeschnitten ist, und doch sich einbilden, man besitze eine Erinnerung an den ganzen Menschen, wenn das Gesagte nicht seine Richtigkeit hätte? Man könnte sonst ebensogut sich von einem werten Freunde eine Hand oder einen Rücken, die in mancher Stellung auch charakteristisch und unverkennbar sein können, malen lassen und zum Andenken aufbewahren. Auf diese hohe Wichtigkeit des menschlichen Angesichts wollte ich auch meinen kleinen Neffen in den Bildern aufmerksam machen. Auch hängt die Erkenntnis davon genau mit dem Geiste des Christentums zusammen und Junius soll kein Heide werden.« –
Holofernes hatte seine Rede mit Willen so lang ausgedehnt, um sich an den versammelten Frauenzimmern, die ihm einen solchen Schreck beigebracht hatten, zu rächen. Und in der Tat war diese Rede für ihrer aller Geduld eine länger und länger auszerrende Folterbank, so daß diese Geduld beinahe zerrissen wäre. So lange verurteilt zu sein, anzuhören, ohne ein Wort mitzusprechen, und was noch schrecklicher ist, Gedanken anzuhören! Dabei mußten sie noch süße und aufmerksame Gesichter schneiden, um ihren Mangel an Verständnis nicht merken zu lassen. Sie ließen unterdes, zu einigem Troste, das ABC-Buch im Kreise herumgehen und besahen die Zeichnungen; aber zu ihrer Pein durften sie jetzt nicht einmal über die verzerrten Figuren lächeln oder gar spöttelnd zischeln, da sich Holofernes dieserhalb in unverständlichen, mithin verdammt gescheiten, Ausdrücken gerechtfertigt hatte.
»Wirklich höchst interessant!« flüsterte jetzt ein Fräulein, das einmal zwölf italienische Vokabeln auswendig gelernt hatte, mithin eine sehr gebildete Dame war. Dies wollten alle andern wie ein Feldgeschrei hastig aufraffen, und rüsteten sich schnell und einmütig, ihre Zungen wieder aufs rascheste als Mühlräder in Bewegung zu setzen, indem sie die Ströme mannigfacher Reden darüber hinschäumen, rauschen, sprudeln, plätschern und platschern ließen; aber Holofernes war ganz unbarmherzig. Mit höhnischem Lächeln stürzte er sie zurück in den gähnenden Höllenabgrund des Schweigens und Zuhörens, indem er sich so zu Herrn Habichs wandte: »Was den Inhalt des Büchleins betrifft, so müßt Ihr Euch nicht wundern, lieber Schwager, wenn derselbe gänzlich von dem gewöhnlichen abweicht, ja Ihr werdet schwerlich die darin als Leseübung enthaltenen Sätze verstehen; selbst Sie, meine geistreichen Damen, würden sich kaum ganz darein zu finden wissen. Ich könnte als Grund anführen, daß, indem ich aus einer kräftigen und klaren Gedankenreihe einzelne bedeutsame Glieder herausreiße und diese, mit Wegwerfung der Zwischenglieder, rätselhaft hinstelle, dadurch die Denkkraft des von Natur neu- und wißbegierigen Kindes angespornt würde, das Fehlende durch eigene Tat zu ergänzen. Möchte dies nun gelingen oder nicht, so wäre es auf jeden Fall eine Übung der Kraft; und Erweckung der Selbsttätigkeit ist am Ende doch das A und O aller Erziehung. Aber meine Gründe gehen noch tiefer. Man gebe nur ja den Kindern bei ihrem ersten Unterricht Gedanken zu lesen, die gänzlich über ihrem Bereich liegen! Dadurch allein kann das Ahnungsvermögen, und durch dies allein die Sehnsucht nach dem Göttlichen, die Verwandtschaft der Seele dem Drüben, aller Glauben und alle Begeisterung, kurz: die Einheit des Einzelngeistes mit dem Urgeiste erhalten werden. Gebt ihr aber den Kindern nur das, was sie handgreiflich und hausbacken, als erworbenen und fertigen Besitz in die Taschen des Wissens schieben können, so erzieht ihr nüchterne, egoistische, in oberflächlichem Selbstgenügen sich überhebende Materialisten und Atheisten, die auch nicht einmal in ihrer Niedrigkeit glücklich sein können, denn bald wird Überdruß und Ekel sie auch zu irdischem Genuß unfähig machen, denn auch dieser hat seine ewig auffrischende Würze nur in einem tief verborgenen geistigen Kerne, in einem Beischmack vom Höchsten, vom Göttlichen. – Auch habe ich mich wohl vor einer sichtbar werdenden Verbindung und Regelmäßigkeit gehütet, sondern im Gegenteil nach möglichster Konfusion gestrebt, denn wenn sich dem Kinde bei seiner ersten Belehrung gleich ein fertig gebautes, ausgemessenes und abgezirkeltes System auch nur dunkel einprägt, so bleibt es zeitlebens ein Knecht, eine Versteinerung. Es soll aber ein frischer Bach werden, der seine Bahn selbst wählend, Dämme durchbricht und auf eigenem Wege sich das Unendliche sucht.« – Jetzt aber hatte Holofernes seine schadenfrohe Laune gesättigt und es tat ihm nun leid, länger seine Perlen unter die – Hühner zu werfen. Er zog rasch noch eine Kapsel hervor und nahm aus derselben ein kurzes und plumpes hölzernes Rohr, das an dem einen Ende mit einem seltsam geschliffenen Glase geschlossen war. »Dieses Guckglas,« sagte er, »das ich auch selbst geschliffen habe und dessen besondere Eigenschaften sich von selbst offenbaren müssen, ohne daß ich mich darüber auslasse, bitte ich dem kleinen Junius zu geben, wenn er mein ABC-Buch ganz durchstudiert hat und überhaupt lesen und schreiben kann.«





























