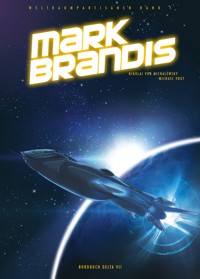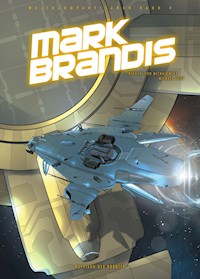3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Unermeßlichen Reichtum und ein sorgloses Leben verheißt ein Brief von Roberto, der vor der Küste Sardiniens auf eine Korallenbank gestoßen ist. Die Korallenjäger Riccardo, Marco und Bernard nehmen mit der »Fortunata« Kurs auf Santa Teresa, den vereinbarten Treffpunkt. Aber Roberto kommt nicht. Ein spannender, mit großer Sachkenntnis geschriebener Abenteuerroman aus der Welt der Taucher – und eine ideale Ferienlektüre. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 221
Ähnliche
Nikolai von Michalewsky
Korallenjäger
Abenteuerroman
FISCHER E-Books
Inhalt
Es kam alles, wie es kommen mußte, weil ein jeder von uns war, wie er war – mit seinem Mut und mit seiner Angst: Bernard, Marco und ich. Und Giovanna. Es war so unabänderlich wie der Lauf der Gestirne.
Ich nenne Namen, aber ich sehe dahinter die Freunde, die verlorenen und dennoch unverlierbaren. Jeder von ihnen nahm ein Stück von mir mit, und jeder von ihnen ließ etwas von sich in mir zurück – mehr als nur eine Erinnerung. Als Bernard starb, ist auch ein Teil von mir gestorben, und als Marco die Hand nicht mehr nahm, die ich ihm entgegenhielt, ging trotzdem etwas von ihm auf mich über, das Gefühl einer Größe, zu der nur der Mensch sich erheben kann, weil er allein dazu verurteilt ist, seinen Wunsch nach Unsterblichkeit in Einklang zu bringen mit dem Bewußtsein der Sterblichkeit, um daraus die Kraft zu schöpfen zur Tat. Wäre er gut und mutig von Natur und Geburt, dann wäre nichts Bemerkenswertes an seinem Leben und Sterben. Erst durch die Überwindung des Bösen, zu dem auch die Angst gehört, erhebt er sich aus seiner kreatürlichen Existenz zum höchsten Wesen nach Gott – was immer man unter diesem Namen verstehen will.
Es kam alles auf einmal: der Erfolg und der Rausch, die Liebe und der Zusammenbruch, und auch das war unabänderlich, weil es zu unserer Art zu leben gehörte. Es war ein Leben, das wir Tag für Tag in Frage stellten und das wir ebenfalls Tag um Tag aufs neue eroberten und auskosteten, weil es im Grunde nur eines gab, was für uns zählte, und das war der Sommer – dieses lange goldene Band aus sonnenheißen Tagen über einem Meer, das wie flüssiges Kristall war. Das Schiff, das wir besaßen, die »FORTUNATA«, war ein Teil dieses Sommers – und mehr noch: sie war das Instrument, mit dem man den Sommer festhalten konnte, indem man ihm nacheilte – dorthin, wohin er sich zurückzog, an die südlichen Küsten des Mittelmeeres und weiter nach Süden noch, wo der Herbst nicht hinreichte. Sommer, das bedeutete für uns das perlende Gefühl ewiger Jugend, einen zeitlosen Zustand höchster physischer Erregung. Glück? Nein, damit hatte es nichts zu tun, denn im Hintergrund aller gelebten Träume war immer das Bewußtsein gegenwärtig, daß trotz allem die unerbittliche Stunde kommen mußte, die alles auslöschen würde, was wir liebten. Es war nicht das Glück, das wir suchten und wofür wir bereit waren, den vollen Preis zu zahlen – es war das Leben an sich, dieses freie, stolze, unabhängige Leben mit allen seinen Verheißungen. Wir beeilten uns zu leben – das war’s. In einem Jahrhundert, das Automaten zu übermenschlichen Fähigkeiten heranzüchtet, während es gleichzeitig aus Menschen Automaten macht, fühlten wir uns als die letzte Bastion einer kompromißlosen Freiheit. Wir zahlten für dieses Vorrecht, falls es eines war, anfangs nur mit dem Risiko, zuletzt mit unserer Angst. Aber wir zahlten, und niemand zwang uns dazu – und das allein schon dünkte uns wert, gelebt zu haben. Was später kommen würde, berührte uns nicht. Das Alter hatte kein Recht auf uns – nicht solange wir imstande waren, es um seinen Anspruch zu betrügen. Und das taten wir – mit jedem Abstieg unter das Meer.
Das war letztlich auch der Grund, weshalb wir nach Santa Teresa kamen. Wir kamen, um uns alles das zu nehmen, was uns noch fehlte, um unser Leben mit dem Sommer verschmelzen zu können. Tauchen war unser Beruf, wenn man in diesem Zusammenhang überhaupt von einem Beruf sprechen kann. Vielleicht waren wir lediglich Spieler, denen keine andere Wahl mehr blieb als diese eine: weiterzuspielen bis zur letzten Karte. Auf jeden Fall waren wir keine Amateure. Das Tauchen ist ein Handwerk, und dieses Handwerk beherrschten wir.
Hinter uns lagen Enttäuschungen. Wir kamen nach Santa Teresa, wie man in das gelobte Land kommt – voller Hoffnungen und voller Erwartung und zugleich mit der Bereitschaft, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen: Bernard, Marco und ich. Wir waren Freunde, fühlten uns verbunden durch ein festes unzerreißbares Band – geflochten aus allem dem, was uns gemeinsam war: das Schiff, die Träume, die Gefahr und das Risiko. Es gab nichts anderes, auf dem wir hätten aufbauen können, und wir hätten es auch gar nicht gewollt. Wir waren die Dreieinigkeit, die sich selbst genug war. So war es, bis wir nach Santa Teresa kamen. Dort gesellte sich Giovanna zu uns, und wenigstens für mich hätte das ein neuer Anfang sein können – ein Aufbruch zu irgendwelchen anderen Ufern. Erst im Zusammenbruch erkannte ich, daß alles umsonst gewesen war, weil nichts, was enteilt, sich festhalten und binden läßt.
Doch es kann geschehen, daß man selbst gebunden bleibt – an einen Menschen, an einen Ort, an einen Tag, und es ist eine Bindung, die man nicht abstreifen kann, weil man, um das zu tun, sich selbst auslöschen müßte. Ich sage »Bernard« – und ich höre ihn zu mir sprechen, ein wenig hastig, wie er immer sprach, weil seine Gedanken dem, was er zu sagen hatte, bereits vorauseilten; ich sage »Marco« – und ich sehe ihn wieder vor mir stehen, im Regen, mit seinem kalten Blick, in dem der Tod, den er mir hatte abnehmen wollen, noch nicht ganz getilgt war. Aber dann rufe ich »Giovanna« – und kein Echo kommt zu mir zurück. Das ist der Preis, der endgültige.
1.
Als die Fortunata nach siebenundzwanzigstündiger Fahrt, die sie in Messina begonnen hatte, in den Hafen von Santa Teresa im Norden Sardiniens einlief, stand ich ganz vorn, beide Hände auf den stählernen Bugkorb gestützt, und hielt Ausschau nach Roberto Croci.
Der Hafen war kleiner, als ich angenommen hatte, und das Wasser darin war gefährlich flach. Wenn die Tiefenangaben auf unserer Karte zutrafen, so hatte die Fortunata gerade noch einen Viertelmeter Wasser unter dem Kiel, als sie langsam herumschwang, um sich dann mit dem Heck voraus in eine Lücke zwischen den Fischerbooten zu schieben, während gleichzeitig der Anker aus der Klüse rauschte. An der Kaimauer brandete das Wasser hoch, als Bernard Auber die beiden Schrauben noch einmal vorwärtslaufen ließ, um die Fahrt aus dem Schiff zu nehmen. Marco Maltese, mit seinen vierundzwanzig Jahren der Jüngste von uns dreien, war schon an Land und belegte die Heckleinen.
Marco war groß und breitschultrig, eine zu goldener Bronze verbrannte Jünglingsstatue aus römischer Zeit, doch wenn er sich bewegte, war alles an ihm sehnige Geschmeidigkeit. Er hatte dunkle Augen, die so unergründlich sein konnten wie das Meer, von dem wir lebten.
Er belegte die Leinen, richtete sich auf und hob die Hand, damit Bernard wußte, daß die Fortunata nun festlag.
Bernard verließ den erhöhten Kommandostand und stieg zu mir herab, und wie immer, wenn er mit etwas zufrieden war, schwebte ein kleines Lächeln um seine Lippen, und seine Augen, die je nach Stimmung und Temperament ihre Farbe wechselten, leuchteten. Jetzt, da er mit sich und der Welt im Einklang war, hatten sie die blaue Farbe der See angenommen.
»Ist er da?«
Wir sprachen italienisch untereinander, Bernard, Marco und ich, nicht weil die Fortunata ein Schiff war, das unter der grünweißroten Flagge fuhr, sondern weil Italienisch die Sprache war, die wir alle gemeinsam beherrschten – Bernard mit einem kleinen französischen, ich mit einem leichten deutschen Akzent. Für Marco war es die Muttersprache.
Bernard war einen halben Kopf kleiner als ich und einen vollen Kopf kleiner als Marco, aber in seinem hageren, sonnenverbrannten Körper steckte eine Zähigkeit und Energie, die uns oft genug in Erstaunen versetzt hatte – zuletzt an jenem verrückten Nachmittag, als er viermal hintereinander hinabgetaucht war zu einer harpunierten Cernia, die sich in einer Felsspalte verkeilt hatte. Jeder andere hätte in dieser Situation den Fisch sich selbst überlassen – nur nicht Bernard. Bernard haßte es, eine Sache nicht zu Ende zu führen. Er hatte um diese Cernia gekämpft wie um einen kostbaren Schatz – zuletzt, als das Atemgerät nicht mehr mitspielen wollte, unter Einsatz seines Lebens.
Ich ließ den Blick über die Kaimauer wandern, auf der schwarz und lang die Schatten der Fischer lagen, die gebückt und wortlos ihre Netze flickten. Es war heiß in Santa Teresa, und in der Luft hing auch hier der Geruch, der uns so vertraut war wie kaum ein anderer: der Geruch nach Fisch, Teer und faulendem Tang.
Das graue Felsmassiv von Capo Testa, das hinter Santa Teresa aufragte, ein wuchtiger Klotz aus windzernagtem Granit, hatte sich in das rote Rubinlicht der untergehenden Sonne gehüllt. Ein wenig von diesem Licht hatte sich auch über die Dächer und Wände des Ortes selbst gebreitet; die Fenster glichen weißglühenden Feuerschlünden.
Vielleicht lag es an diesem strengen, feierlichen Licht, daß ich mit der Antwort zurückhielt, denn plötzlich kam mir dieser Ort fremd und unnahbar vor, eine steinerne Festung über dem Meer, die mit ihren Mauern ein uraltes Geheimnis umschloß. Das Meer, vor ein paar Minuten noch heiter, leuchtend blau und von einer durchsichtig scheinenden Klarheit, war dunkel geworden – ein schwarzsamtener Teppich, über dem im Norden die purpurnen Berge Korsikas schwebten.
Aber jetzt mußte ich Bernards Frage beantworten und ihn meine Enttäuschung spüren lassen; denn bis zu diesem Augenblick war ich fest davon überzeugt gewesen, daß Roberto am Kai stehen würde. Ich selbst hatte ihm, bevor die Fortunata Messina verließ, ein Telegramm geschickt, das ihm unsere Ankunft für etwa diese Stunde ankündigen sollte.
»Hier ist er nicht.«
»Vielleicht«, meinte Bernard, »ist er noch draußen.«
»Vielleicht«, sagte ich.
Robertos Brief steckte in meiner Tasche, dieser Brief, in dem er von einer Korallenbank berichtete, die er nur wenige Seemeilen von Santa Teresa entfernt gefunden hatte – eine Korallenbank, die so reich und unerschöpflich sein sollte, daß er allein ein Leben lang damit zu tun haben würde, um alles abzuernten. Wenn Roberto Croci so etwas schrieb, konnte man sich darauf verlassen. Für uns konnte es die Rettung sein.
Wahrscheinlich hatte Bernard recht, und Roberto war mit dem Boot noch draußen. Auch ich hätte vielleicht das gute Wetter ausgenützt bis zur letzten Minute. Wind und Seegang würden sich früh genug wieder einstellen. Trotzdem gab es mir einen Stich ins Herz, weil er nicht erschienen war, mich zu begrüßen.
Im Geiste hatte ich ihn bereits am Kai stehen gesehen – groß, blond, mit einem kleinen Lachen in den grauen Augen. An seiner Seite hatte ich meine ersten zaghaften Schwimmstöße unter Wasser gemacht. Er hatte mich alles gelehrt, was ein Taucher wissen muß, und er hatte mir alle die Tricks und Kniffe gezeigt, die in keinem der Lehrbücher stehen und von deren Kenntnis doch oft genug alles abhängen kann, sogar das Leben.
Marco kam heran. Er hatte sich die Schiffspapiere unter den Arm geklemmt.
»Was ist los, Riccardo? Läßt uns dein großer Roberto im Stich?«
Marcos Art ärgerte mich. Roberto ließ keinen im Stich. Aber um das zu wissen, mußte man ihn so gut kennen, wie ich ihn kannte. Man mußte mit ihm in einem Boot gelebt haben, und man mußte mit ihm getaucht sein, an guten und an schlimmen Tagen.
»Mag sein, daß er noch draußen ist«, sagte ich. »Mag auch sein, daß er das Telegramm nicht erhalten hat.« »Mag ebenfalls sein, daß er sich’s anders überlegt hat«, sagte Marco. »Oder die Korallen gibt es nur in seiner Phantasie.«
Ich verstand Marcos Bedenken. Wir hatten gerade noch zwei Wochen Zeit, und wir hatten keine Hoffnung mehr bis auf diese.
Bernard kam mir zu Hilfe.
»Hör auf, Marco. Roberto ist in Ordnung.«
Ich warf einen Blick auf den Ort, über dem schon die Dämmerung schwebte.
»Ich seh nach, wo er steckt. Es wird nicht lange dauern. Ihr könnt den Papierkrieg im Hafenamt erledigen.«
Es hatte sich so ergeben, daß mir das Amt des Kapitäns auf der Fortunata zugefallen war, auch wenn Bernard, Marco und ich gleichberechtigte Partner und Eigner waren. Genausogut hätte die Wahl auch auf Bernard fallen können, der vor ein paar Tagen seinen sechsundzwanzigsten Geburtstag gefeiert hatte und damit der Älteste von uns war. Aber aus irgendeinem Grund war sie auf mich gefallen – vielleicht, weil meine Papiere die einzigen waren, die den kritischen Blicken der italienischen Bürokratie standhalten konnten. Bernards Schifferpatent war einwandfrei gefälscht, und Marco besaß zwar einen ganzen Sack seemännischer Erfahrung, hatte sich jedoch nie aufraffen können, die vorgeschriebene Prüfung abzulegen. Außerhalb der Dreimeilenzone pfiff er auf alle Vorschriften und führte, wenn die Reihe an ihm war, das Schiff so sicher wie jeder andere von uns.
Hier im Hafen mußten wir uns den Vorschriften beugen. Verärgerte Hafenkommandanten konnten, wenn sie es darauf anlegten, alle möglichen Unannehmlichkeiten bereiten, konnten einen sogar aus ihrem Hafen in aller Form hinausekeln. Für das, was wir vorhatten, war Santa Teresa jedoch der geeignete Stützpunkt. Die Korallenbank, von der Roberto Croci in seinem Brief berichtete, befand sich sozusagen in Griffweite, besser konnten wir es anderswo nicht treffen.
Bevor ich mich auf den Weg machte, warf ich noch einen Blick zurück auf unser Schiff, und mein Herz wurde warm bei seinem Anblick. Es war weiß Gott nicht das, was man sich unter einem schönen Schiff vorstellt, aber mit seinen achtzehn Metern Länge, dem hohen Kommandoturm mittschiffs und den beiden Chrysler-Dieseln im Leib, von denen ein jeder an die hundertundsechzig Pferdestärken hergab, war es jedem Wind und jeder See gewachsen. Die Werft, die den Umbau besorgt hatte, war weise genug gewesen, nur die inneren Einrichtungen zu verändern. Nach außen hin war die Fortunata noch immer der sturmerprobte US-Seenotkreuzer, als der sie fast ein halbes Menschenleben lang Dienst getan hatte. Sie war ein Schiff, auf das man stolz sein konnte, und das zählte mehr als alle sogenannte Schönheit.
Roberto Croci hatte uns den rettenden Fingerzeig gegeben, um sie zu behalten. Irgendwo unter der glatten Oberfläche des Meeres, eingebettet in ewige Nacht, warteten die Korallen auf uns – rote, bizarr verschlungene Gebilde, die in Jahrtausenden gewachsen waren. Wir brauchten nur noch hinabzusteigen, um den Schatz zu heben.
Ich begann, die gewundene Straße hinaufzusteigen, die vom Hafen in den Ort führt, vorüber an aufgeslippten Booten und knorrigen Olivenbäumen. Es dunkelte rasch, aber noch immer war es heiß. Die rissige Erde, die seit Monaten keinen Regen mehr gespürt hatte, strahlte die Glut der Sonne wieder aus, die sie den ganzen langen Tag über in sich aufgesogen hatte. Die Zikaden waren erwacht; ihre schrille Musik begleitete mich bis weit in den Ort hinein.
Santa Teresa ist nicht groß. Nachdem ich einmal gefragt hatte, war es mir ein leichtes, Robertos Hotel zu finden. Nach außen hin sah es eher aus wie eine ländliche Trattoria. Roberto hatte nie viel auf Äußerlichkeiten gegeben.
2.
Der Wirt war ein freundlicher alter Mann mit weißen Haaren, und er hatte eine Schürze umgebunden, als käme er geradewegs aus der Küche. Er fragte, was er für mich tun könnte, und ich sagte ihm, daß ich Richard Martens hieß und eine Verabredung hätte mit Roberto Croci. Noch während ich ihm dies auseinandersetzte, sah ich, wie sich sein Gesichtsausdruck plötzlich veränderte, und als ich das sah, ahnte ich bereits, daß etwas geschehen sein mußte.
»Er hat mir von Ihnen erzählt.« Der alte Mann wischte sich die Hände an der Schürze ab, obwohl es an ihnen nichts zum Abwischen gab. Wahrscheinlich versuchte er Zeit zu gewinnen, um sich die Worte zurechtzulegen. »Nur…«
»Was ist passiert?«
Seine Augen wurden stumpf.
»Hat es Ihnen noch keiner gesagt?«
»Was gesagt?« fragte ich mit trockenem Mund zurück. Er sah mich nicht an.
»Es hat auch in ein paar Zeitungen gestanden. Signor Roberto war, glaube ich, ein berühmter Mann.«
»War?«
Dieses eine Wort eröffnete mir alles. Nichts auf der Welt konnte endgültiger klingen als dieses ›war‹. Ich starrte den alten Mann an und hoffte darauf, daß er dieses fatale Wort zurücknehmen würde, aber statt dessen sagte er leise:
»Es tut mir leid. Es ist, als hätte ich einen eigenen Sohn verloren. Signor Roberto hat vor sechs Tagen einen Unfall gehabt.«
»Schlimm?«
»Sie haben ihn nach La Maddalena geschafft, ins Krankenhaus. Dort ist er dann gestorben.«
»Was für einen Unfall?«
»Ich weiß es nicht.« Das Gesicht des alten Mannes drückte Ratlosigkeit aus. »Es ist beim Tauchen passiert. Ich verstehe nichts davon. Die Leute sagen, es muß damit zu tun haben, daß er zu schnell wieder aufgetaucht ist.« Ich stand da, sprach mit dem alten Mann und wartete darauf, daß eine Tür aufgehen und Roberto vor mich hintreten würde. Einen Atemzug lang glaubte ich sogar seine Stimme zu hören, diese heitere, sorglose Stimme, in der so viel Festigkeit und Kraft mitschwangen. Mein Verstand weigerte sich einfach, die schlimme Botschaft zur Kenntnis zu nehmen. Es konnte nicht wahr sein, daß Roberto tot war.
Aber er war es.
Mein Herz war dem Verstand voraus. Es hatte von Anfang an geahnt, daß sich etwas Schlimmes zugetragen haben mußte.
»Eine Embolie?«
Der Alte dachte nach.
»Ich glaube, so nannten sie’s.«
Und plötzlich begriff es auch mein Verstand, und eine unsichtbare Hand drückte mir die Kehle zu. Vor meinen Augen verschwammen die Konturen. Ich war wie gelähmt.
Der alte Mann fragte: »Er war Ihr Freund?«
Ich konnte nur nicken.
Es drückt so wenig aus, dieses Wort. Die Leute haben es abgewertet. Und dennoch gibt es kein anderes. Bruder, Kamerad, Gefährte – alles das ist in diesem einen Wort enthalten. Es läßt sich nicht ersetzen. Nichts auf der Welt, wenn es wahr und echt ist, läßt sich ersetzen. »Ich wollte, Sie hätten’s schon gewußt.« Der alte Mann sagte es sehr schlicht. »Es ist immer schlimm, einen Menschen zu verlieren, den man gern hat. Ich weiß es. Ich habe zwei Söhne verloren – den älteren im Krieg, den anderen draußen auf dem Meer. Jetzt habe ich niemanden mehr.«
Er war ein alter Mann und ein weiser Mann. Er erzählte mir von seinem Leid, um mich von dem meinen abzulenken. Er mußte im stillen begriffen haben, daß es auf die Worte gar nicht so sehr ankam, sondern vielmehr darauf, daß jemand da war, der zu mir sprach – so lange wenigstens, bis ich mich von dem Schock erholt hatte. In diesem Augenblick verkörperte er das Leben, und seine Worte waren Geländer, auf die ich mich stützen konnte. Er war das Leben und stand zwischen mir und dem Tod. Er machte ihn nicht ungeschehen, aber er nahm ihm den Sieg.
Hinterher machte er mir einen Kaffee und drückte mir eine angezündete Zigarette in die Hand.
Auf den Schock folgte die Trauer, und damit war ich bereits wieder so weit in mein Leben zurückgekehrt, daß ich anfangen konnte, nach den Einzelheiten zu fragen. Mir war eine tiefe Wunde geschlagen worden, aber schon begann sie zu heilen, weil die Trauer zum Leben gehört wie die Freude, das Glück und die Liebe.
Im Grunde war Robertos Tod vorauszusehen gewesen. Ein jeder bekam seine Portion Glück zugeteilt, und irgendwann kam auch für jeden der Augenblick, an dem er mit leeren Händen dastand. Roberto hatte in seinem Leben viel Glück gehabt – und ich war mir nicht einmal sicher, ob nicht selbst in diesem Unfall ein letzter Rest von Glück enthalten war, denn nichts hatte Roberto mehr gehaßt als den Gedanken, einmal Abschied nehmen zu müssen vom Meer. Nun aber war das Meer ihm zum Schicksal geworden.
Aber warum? Was hatte sich zugetragen?
Der alte Mann wußte es nicht.
»Niemand weiß das, Signor Riccardo – nicht einmal die beiden, die im Boot gewesen sind, als es geschah.«
»Wer sind sie?«
»Nun, der Fischer, dem das Boot gehört, und dann Signor Robertos Schwester.«
»Seine Schwester?«
Dann und wann hatte Roberto von ihr gesprochen. Sie hieß Giovanna und war einige Jahre jünger als er. Ich hatte sie nie kennengelernt.
Der Daumen des alten Mannes zeigte auf die Treppe. »Sie ist oben. Wenn Sie sie sprechen wollen …«
»Etwas später.«
Meine Gedanken arbeiteten plötzlich ganz von selbst. Von einem Piloten, der mir vom ungeklärten Absturz seines Kameraden erzählt hatte, wußte ich, daß es auch ihm so ergangen war. Auf den Schock folgte die Trauer – und dann begannen die Gedanken zu arbeiten. Wenn man das Unabwendbare begriffen hatte, fing man an, nach dem Fehler zu suchen – nach jenem geringfügigen Fehler, der die Katastrophe ausgelöst hatte.
Vor mir sah ich die glatte Oberfläche der See, und ich sah auch, wie Roberto den klaren Spiegel durchbrach, als er aus der dunklen Tiefe zurückkehrte in das helle Licht des Tages. Aber was hatte ihn zu diesem tödlichen Risiko gezwungen? Es war mir wieder, als hätte ich seine Stimme im Ohr:
»Laß dir Zeit beim Auftauchen, Junge – egal, wie eilig du es hast. Und wenn die Welt untergeht, du mußt die Pausen einhalten.«
Es ist ein physikalisches Gesetz. Der Körper muß Gelegenheit haben, nach und nach den Stickstoff auszuatmen, der sich unter dem Druck von mehreren Atmosphären im Blut angesammelt hat. Es gibt Tabellen, auf denen man die Werte ablesen kann. Auch Roberto besaß eine solche Tabelle, er vergaß sie nie, wenn er zu einem Abstieg in die Tiefe rüstete. An einem Metallarmband trug er sie über dem rechten Handgelenk.
Vielmehr – ich berichtigte mich stumm – er hatte sie getragen. Dort, wo er jetzt sein mochte, benötigte er keine Tabelle mehr. In der Ewigkeit war die Zeit nicht mehr wichtig.
Vor sechs Tagen jedoch war sie sehr wichtig gewesen. Ich wußte, wie gründlich und umsichtig und vorausschauend Roberto bei allen seinen Expeditionen in die gläserne Welt des Schweigens gewesen war. Deshalb hatte er sie alle überlebt, die anderen, die Unerfahrenen, die Voreiligen, die Prahler.
Ich sah nichts als die Oberfläche, und ich sah Roberto, wie er vielleicht noch einmal die Hand hob, um mit letzter Kraft das Boot zu sich heranzuwinken, aber unter die Oberfläche reichte mein Blick nicht.
»Es muß doch einen Grund gegeben haben«, sagte ich. Der alte Mann schüttelte bekümmert den Kopf.
»Er hat ihn nicht mehr nennen können. Als sie ihn ins Boot zogen, war er schon bewußtlos. Er ist dann nicht mehr aufgewacht. Er muß wohl sehr tief unten gewesen sein.«
Alles sprach dafür. Roberto war auf eine Korallenbank gestoßen. Korallen wachsen nur selten in den lichten Zonen des Meeres. Wer zu ihnen hinabsteigt, weiß nie mit Sicherheit, ob er den langen Weg zurück auch wiederfinden wird. Unter Wasser kann vieles geschehen, das nicht zu ergründen ist.
Langsam stand ich auf. Ich mußte es herausfinden. Vielleicht konnte mir Giovanna dabei behilflich sein, Robertos Schwester.
Die Korallen waren die besten, die ich je gesehen hatte – blaßrot und von makelloser Beschaffenheit. Bereits das wenige, was Giovanna mir zeigte, war ein kleiner Schatz. Roberto hatte mit dem, was er mir schrieb, nicht übertrieben. Diese Korallen hatte er bei sich gehabt, als der Unfall geschah; und als ich sie berührte, war es mir, als reichte er mir noch ein letztes Mal die Hand.
Ein paar Minuten lang saß ich nur da und starrte auf diese bizarren roten Gebilde, aber auch sie gaben keine Antwort auf die Frage, warum Roberto hatte sterben müssen. Dort, wo sie gewachsen waren, mußte der Schlüssel zum Geheimnis zu finden sein – wenn es überhaupt einen gab und der Unfall nicht nur die Folge von einer Kette unglückseliger Zufälle gewesen war.
Es gibt solche verhexte Kombinationen aus lauter Geringfügigkeiten, von denen jede für sich kaum eine ernsthafte Gefahr darstellt. Aber wenn eine Geringfügigkeit zur anderen kommt, dann kann am Ende der Kette plötzlich der Tod stehen. Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, um unter Wasser zu leben. Sobald er sich unter die Oberfläche begibt, unterwirft er sich einer fremden Gesetzmäßigkeit. Er kann seine Maske verlieren, oder sein Gerät hat einen Defekt, oder er erschrickt über irgend etwas, vielleicht wird ihm auch ganz einfach schlecht. Nichts davon ist allein imstande, einen erfahrenen Taucher in tödliche Gefahr zu bringen. Was aber, wenn eine Kleinigkeit die andere jagt?
Ich legte die Korallen zurück in die Schublade, aus der ich sie genommen hatte.
»Erzählen Sie mir alles, was Sie wissen!« bat ich. »Lassen Sie nichts aus! Mitunter sind es die nebensächlichen Dinge, die einem die Antwort geben.«
Giovanna war jünger, als ich gedacht hatte. Roberto war dreißig gewesen, als ich ihn zum letzten Mal sah. Giovanna mochte gerade etwas über zwanzig sein. Wenn man sie nur flüchtig ansah, erkannte man die Ähnlichkeit nicht gleich – vielleicht, weil Roberto blond gewesen war, während sie dunkel war. Man mußte ihr Mienenspiel studieren, um herauszufinden, daß sie Robertos Schwester war, und man mußte einmal in ihre Augen geblickt haben. Die Augen verrieten sie. Aus ihnen leuchtete die gleiche Kraft und Freude am Leben, wie ich es in der Erinnerung hatte, wenn ich an Roberto Croci dachte.
Sie hatte mich erst eingelassen, nachdem ich ihr meinen Namen genannt hatte, und schon nach ein paar Minuten wußte ich, daß sie viel mehr über mich wußte als ich über sie. Roberto mußte oft von mir gesprochen haben. Sie sagte, sie hätte mich längst benachrichtigt, wenn sie meine Adresse gewußt hätte. Nur weil sie diese nicht kannte, war sie noch in Santa Teresa.
Sie schien auf meine Frage vorbereitet zu sein, denn sie zögerte keinen Augenblick, darauf zu antworten.
»Wir waren mit einem Fischerboot draußen«, begann sie. »Roberto hatte da feste Abmachungen getroffen. Der Fischer bekam einen gewissen Anteil von dem, was uns die Korallen einbrachten.« Sie berichtigte sich. »Vielmehr, er sollte es bekommen, denn der Unfall passierte ja schon beim zweiten Abstieg. Ich verstehe einfach nicht, wie es dazu kommen konnte. Es war ein ruhiger, sonniger Tag, und Roberto war in bester Verfassung. Noch als er sich fertigmachte, kamen wir aus dem Lachen nicht heraus. Dann ging er ’runter, und wir anderen blieben im Boot, Giuseppe und ich. Es war alles wie sonst. Das zweite Gerät erwartete ihn ein paar Meter unter dem Boot, ich selbst hatte es an der Leine befestigt und heruntergelassen.« Sie hielt kurz inne und fuhr sich über die Augen. Vielleicht wischte sie sich auch nur eine Haarsträhne aus der Stirn. »Er brauchte es nicht mehr. Er kam plötzlich hoch. Wir hätten’s gar nicht bemerkt, wenn er nicht so schrecklich um sich geschlagen hätte. Er war ziemlich weit vom Boot entfernt – und als wir endlich bei ihm waren und ihn an Bord zogen, war er schon bewußtlos. Die Korallen, die Sie vorhin gesehen haben, hatte er bei sich im Netz. Der kleine Tauchretter, den er immer am Gürtel trug, war aufgebläht. Er muß durch das Wasser geschossen sein wie eine Rakete.«
Ich nickte. So hatte ich es mir vorgestellt. Aber noch immer wußte ich nicht, was sich unten zugetragen hatte. »Giovanna«, sagte ich, »denken Sie gut nach! Ist Ihnen an Roberto irgend etwas aufgefallen?«
Sie schloß die Augen, während sie mit ihren Gedanken zu dieser verhängnisvollen Stunde zurückkehrte. Als sie mich wieder ansah, wußte ich, daß sie sich an etwas erinnerte, das uns vielleicht weiterbringen konnte.
»Der Hammer!«
»Was war mit dem Hammer?«
Er hatte ihn nicht mehr. Aber er hatte sein Messer in der Hand.«
»Sein Messer – warum?«