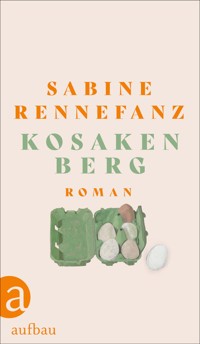
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was ist Heimat und wie lässt man die Provinz hinter sich, davon erzählt Sabine Rennefanz voller Ironie und Melancholie.
Kathleen hat es geschafft. Sie ist erfolgreich, redegewandt, attraktiv. Seit Jahren lebt sie als Grafikerin in London. Woher sie kommt, hat sie hinter sich gelassen. Zumindest glaubt sie das. Doch die Besuche bei ihrer Mutter im brandenburgischen Kosakenberg konfrontieren sie mit einer Welt, der sie in den neunziger Jahren zu entkommen versuchte und die nun eine ungeahnte Kraft entfaltet. Mit starken Bildern führt Sabine Rennefanz in ein Dorf im Osten des Landes, in dem fast nur Männer geblieben sind und die wenigen Frauen, die nicht das Weite gesucht haben, mit Eiern handeln, von der Liebe träumen und über die reden, die weggegangen sind.
»Sabine Rennefanz erzählt davon, wie es ist, wenn man auf der Reise zwischen alter und neuer Heimat sich selbst nicht nur findet, sondern sich auch verlorengeht. Ein sehr berührendes, kluges und nachdenklich machendes Buch.« Jenny Erpenbeck.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Kathleen hat es geschafft. Sie ist erfolgreich, redegewandt, attraktiv. Seit Jahren lebt sie als Grafikdesignerin in London. Woher sie kommt, hat sie hinter sich gelassen. Zumindest glaubt sie das. Doch die Besuche bei ihrer Mutter im brandenburgischen Kosakenberg konfrontieren sie mit einer Welt, der sie in den neunziger Jahren zu entkommen versuchte und die nun eine ungeahnte Kraft entfaltet. Mit starken Bildern führt Sabine Rennefanz in ein Dorf im Osten des Landes, in dem fast nur Männer geblieben sind und die wenigen Frauen, die nicht das Weite gesucht haben, mit Eiern handeln, von der Liebe träumen und über die reden, die weggegangen sind.
Über Sabine Rennefanz
Sabine Rennefanz, geboren 1974 in Beeskow, wurde mit ihrem Bestseller »Eisenkinder. Die stille Wut der Wendegeneration« als Autorin schlagartig bekannt. Sie ist eine der führenden Kolumnistinnen Deutschlands, war langjährige Redakteurin der Berliner Zeitung und arbeitet als Journalistin u. a. für Der Spiegel, Der Tagesspiegel und Radio 1. Für ihre Reportagen und Essays wurde sie mit dem Theodor-Wolff-Preis und dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Sabine Rennefanz
Kosakenberg
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Zitat
Weggehen
Die erste Heimfahrt
Die zweite Heimfahrt
Die dritte Heimfahrt
Die vierte Heimfahrt
Die fünfte Heimfahrt
Die sechste Heimfahrt
Die siebte Heimfahrt
Die achte Heimfahrt
Die neunte Heimfahrt
Die zehnte Heimfahrt
Wiederkommen
Dank
Impressum
Für Arthur und Agatha
»Deshalb bedeutet die Rückkehr in ein Herkunftsmilieu, aus dem man hervor- und von dem man fortgegangen ist, immer auch eine Umkehr, eine Rückbesinnung, ein Wiedersehen mit einem ebenso konservierten wie negierten Selbst.«
Didier Eribon
»Vielleicht ist das, was in uns geschieht, nur das Versäumte eures Lebens? Und wir beenden wie ein Lied das Beten, welches ihr vergebens begonnen habt oft in den Nächten?«
Christine Lavant
Weggehen
1997 habe ich, Kathleen, Kosakenberg verlassen. Fast alle aus meiner Klasse sind weggegangen. Wir machten noch zusammen Abitur und dann verteilten wir uns in alle Himmelsrichtungen. Nein, das stimmt nicht, denn das würde ja bedeuten, dass gleich viele von uns jeweils nach Norden, Süden, Osten und Westen gegangen sind. Die meisten aber gingen in eine einzige Richtung: nach Westen. Hunderte Leute pro Jahr aus dem ganzen Landkreis. Immer wieder hieß es: Sie ist weg. Der ist weg. Und die ist auch weg. Aus einem Rinnsal wurde ein Fluss wurde ein Strom.
Wir verließen nicht nur unsere Familien, unsere Häuser, unsere Dörfer, sondern auch unsere Vergangenheit. Wir wollten andere werden und in dem Wollen steckte schon die Trauer um den Verlust. Wir gingen weg, um zu suchen, was wir gleichzeitig verloren. Eine Heimat. Wir gingen, weil uns nichts im Vertrauten hielt. Es blieben zurück: der geschlossene Konsum, der verfallende Gasthof, der leere Kindergarten, die arbeitslosen Väter, die den Friedhof harkten. Die depressiven Mütter und Tanten, die tagsüber am Fenster standen, sich Valium einwarfen oder Weinbrand tranken. Die Holzkreuze an den Bäumen, die an die Söhne, Brüder und Freunde erinnerten, die in den schnellen neuen Autos gestorben waren.
Es hieß, wir gingen wegen der Arbeit, zum Studieren, es hieß, wir gingen aus Abenteuerlust, es hieß, wir gingen, weil der Westen die Zukunft war, aber wir gingen auch, weil wir nicht mehr konnten. Nicht mehr atmen konnten. Vom Dorf in die Stadt, von der Stadt in die Großstadt und dann weiter weg, immer weiter. Weg von den Schmerzen, der eigenen Haut. In der Hoffnung, der Gestalt zu entfliehen, die uns aufgezwungen wurde. In dem Bewusstsein, wenn wir nicht weggehen würden, würden auch wir, eines Tages, unabhängig von unserer Entschlossenheit, unseren Vorsätzen, von den Schmerzen überwältigt werden. Wir rannten weg. Wir kamen als Fremde an unseren Ursprung zurück.
Ich habe geweint, als ich später Buenos Aires verließ, ich habe geweint, als ich Kapstadt verließ, ich habe geweint, als ich Hamburg verließ. Ich habe nicht geweint, als ich Kosakenberg verließ.
Im Zuge von Umbrüchen können Menschen von einem Tag auf den nächsten zu anderen werden. Ihr eigenes Leben wird ihnen unbekannt. Vielleicht bin ich deshalb am liebsten in der Fremde, weil es dort leichter zu ertragen ist, fremd zu sein, als an einem Ort namens »Zuhause«.
Was wäre gewesen, wenn ich geblieben wäre? Wenn ich nicht gemeinsam mit Millionen anderen gegangen wäre? Wenn ich nicht die alte Haut abgestreift hätte? Wenn ich die Schmerzen ertragen hätte? Wenn ich nicht in das weiße Haus in London gezogen wäre? Wäre es das bessere, glücklichere Leben gewesen?
Das Dorf wäre mein Zimmer, melancholisch und übersichtlich. Das Dorf, das Kosakenberg heißt, obwohl es keinen Berg gibt und die Kosaken aus den Napoleonischen Kriegen auch schon lange wieder weg sind. Ich besäße vielleicht ein gelb angemaltes Häuschen mit einem schwarzen Metallzaun drumherum und einem Schild, auf dem man einen sehr groß geratenen Schäferhund erkennt. »Hier wache ich!« stände darauf. Ich würde um fünf Uhr aufwachen, Tee trinken und meine Tochter wecken. Ich würde im Stall nach einem Ei sehen. Ich hätte eine Tochter, da bin ich mir sicher. Vielleicht wäre ich Bibliothekarin in Waldstadt, der Kreisstadt. Ich würde um neun Uhr die Bibliothek öffnen. Und wenn die Leserinnen nach einer Empfehlung fragten, würde ich sagen: »Lesen Sie ›Heimsuchung‹, das ist noch richtige Literatur.« Abends, wenn ich nach Hause käme, würde ich zuerst nach den Hühnern sehen. Ich würde um achtzehn Uhr mit meiner Tochter Abendbrot essen. Danach würde ich zu meiner Mutter gehen, mit ihr ein Glas Wein trinken und über das reden, was ich erlebt habe. Vielleicht würden wir Musik hören, André Rieu zum Beispiel. Sie würde mir ein Kleid zeigen aus einem Katalog, das ihr gefiel. Ich würde ihr sagen, dass man keinen Katalog mehr braucht und Kleider online bestellen kann. Und sie würde sagen, dass sie das nicht möchte. Ich wäre geschieden, würde aber nie darüber reden. Über unsere eigenen gescheiterten Beziehungen redeten wir nicht, nur über die der anderen. Wir würden zusammen die Nachrichten schauen und den Kopf schütteln.
Der russisch-französische Schriftsteller Vladimir Nabokov hat einmal gesagt, dass jeder, der seine Heimat verlassen hat, zwei Leben besitzt. Das eine, das man lebt, und das andere, das an dem Ort weitergeht, von dem man weggegangen ist.
Die erste Heimfahrt
Ich stand auf dem Bahnhofsvorplatz von Waldstadt, der Wind blies durch meine dünne Jacke und in die leichten Turnschuhe drang von unten die Märzkälte. Das war hier schon immer so gewesen, selbst im Hochsommer pfiff ein kühler Wind.
Zwei Männer waren mit mir aus dem Zug gestiegen und in unterschiedliche Richtungen davongegangen. Auf der anderen Seite des Platzes saß eine ältere Frau mit Mütze auf einer Bank. Sie drückte eine Penny-Einkaufstasche an sich und schaute mich misstrauisch an.
Ich wartete auf meinen Vater. Ein Bus nach Kosakenberg fuhr nur morgens und abends. Zwischen meinen Beinen stand eine kleine, schwarze Reisetasche aus Nylon, da passte alles rein, was ich für die drei Tage in London gebraucht hatte. In wenigen Tagen würde ich dorthin umziehen. Es war der größte Schritt von all den kleinen Schritten, die ich vorher gegangen war, um mich von Kosakenberg zu entfernen.
Der erste Schritt war eigentlich kein echtes Weggehen. Vom Studium in Berlin kam ich jede Woche am Freitagabend oder am Sonnabend nach Hause. Später fuhr ich nur einmal im Monat heim, dann nur alle zwei Monate, schließlich nur noch in den Ferien. Trippelschritte. Dann folgte ein größerer. Als angehende Grafikdesignerin musste man Praktika absolvieren. Im Osten gab es noch keine Agenturen, die Verlage wiederum hatten fast alle zugemacht, also ging ich in den Westen, nach München und Hamburg, dann wieder Berlin. Zog von Wohngemeinschaft zu Wohngemeinschaft, fand meine erste feste Anstellung bei einem Magazin. Provisorien, anders war es nie gedacht.
Nun aber würde ich bald in einem anderen Land leben. Ich würde Kosakenberg endgültig hinter mir lassen.
Fast ein bisschen überrascht von mir selbst dachte ich daran, was ich in den vergangenen Tagen alles geschafft hatte. Ich hatte eine Wohnung in Berlin aufgelöst und in London eine gemietet. Sie lag in einem weiß getünchten, typisch englischen Haus, davor stand eine einzelne, schmale, junge Birke, die sich im Wind bog. Ihre Äste wehten wie zarte Kinderhaare hin und her. Im Viertel gab es viele Cafés, kleine Geschäfte, junge Leute. Das kannte ich von Prenzlauer Berg. Aber die Häuser hier sahen anders aus als in Berlin. Sie waren kleiner, viktorianisch, mit Erker und spitzem Dach, jedes hatte seine eigene Tür, und jede Tür war in einer anderen Farbe gestrichen, rot, blau, schwarz, grün. Manche der Häuschen wirkten von außen ein wenig heruntergekommen. Ich fand das charmant.
Prebend Street hieß meine neue Straße. Es gab ein italienisches Delikatessengeschäft, eine Apotheke und eine Kirche. Tony Blair hatte hier gewohnt, früher, bevor er Premierminister wurde. Zumindest hatte das der Makler gesagt, betont beiläufig, als er mir die Wohnung zeigte.
Blair war zwar nicht mehr so cool wie vor dem Einmarsch in den Irak, aber beeindruckt war ich trotzdem. Was für eine bedeutende Gegend ich mir zufällig ausgesucht hatte. Bei dem Gedanken daran, dass ich in London die Fast-Nachbarin von Tony Blair werden würde, musste ich auf dem Bahnhofsvorplatz in Waldstadt unwillkürlich lächeln. Auch wenn Blair inzwischen in der Downing Street wohnte, ich ihm also nicht beim Einkaufen begegnen würde.
Meine Augen tränten vom Wind. Ich schob meine kalten Hände in die Jackentaschen. Es war kurz nach vier. Wo blieb mein Vater bloß? Viel konnte man von ihm nicht erwarten, aber pünktlich war er. »Pünktlich wie ein Maurer«, sagte meine Mutter. Mein Vater war Schlosser. Ich schaute nach rechts auf das Gebäude an der Ecke, zur Not könnte ich mich in der Bahnhofskneipe aufwärmen. Von der Fassade blätterte die Farbe ab, »Zum Bahnhof« stand an der Wand, in altdeutschen Lettern, wie früher.
Ich kramte nach einem Taschentuch, dabei fiel mein in Lammleder gebundener Terminkalender auf den Boden, er hatte ein Heidengeld gekostet. Auf der Vorderseite war eine schmale geschwungene Prägung mit der Jahreszahl 2004. Es war ein besonders exquisites Exemplar, von der britischen Firma Smythson, darin steckte noch die Bordkarte vom Hinflug. Reihe 14, Platz A.
Ich war in London-Stansted gelandet. Im Zug ins Zentrum hielt ich den Stadtplan »London A–Z« auf den Knien. Die Menschen um mich herum waren mir auf Anhieb sympathisch, so zurückhaltend, höflich, alle vertieft in eine Zeitung oder ein Buch. Auf dem Bahnhof King’s Cross dagegen fühlte ich mich von den Menschenmassen fast erdrückt. Ich hörte Englisch, aber auch Französisch, Spanisch und andere, exotisch klingende Sprachen, die ich nicht zuordnen konnte. Alle hatten es eilig, hasteten mit einem Becher Kaffee in der Hand durch die Halle. Wer langsam lief, war im Weg. Ich hatte es auch eilig.
Lynda, meine neue Chefin, wollte, dass ich am ersten Mai als Art Direktorin bei »Design Review« anfangen sollte. Das war in sechs Wochen. Nur sechs Wochen, hatte ich gedacht.
Ich trat von einem Fuß auf den anderen, um meine steifen Beine etwas zu lockern und in der Hoffnung, dass mir wärmer werden würde. Aus der alten Bahnhofskneipe wehte der Geruch von Bockwurst herüber. Ich beschloss, doch lieber draußen zu warten, holte einen Marsriegel aus meiner Tasche und biss ab.
Es rächte sich mal wieder, dass ich kein eigenes Auto besaß. Das ganze Leben richtete sich in der Peripherie nach dem Auto und dem Verkehr aus.
Früher bestellte man bei der Geburt eines Kindes ein Auto, damit es, wenn man Glück hatte, nach achtzehn Jahren abholbereit war. Später fing man bei der Geburt an, auf den Führerschein und das erste eigene Auto zu sparen. Kein Auto zu besitzen, das war in Kosakenberg so, als ob man auch als Erwachsener ein Kind blieb. Keine meiner alten Freundinnen verstand, warum ich keinen Wagen hatte, obwohl ich doch wie alle anderen einen Führerschein besaß.
Nadine hatte natürlich ein Auto. Sie übernahm kurz nach der Wende den alten Lada ihres Vaters, weil der sich ein neues Auto gekauft hatte, einen Gebrauchtwagen aus dem Westen. Nadine, die mit ihrer Mutter und ihrer Schwester über dem Konsum wohnte, kannte ich schon im Kindergarten. Als sie vier oder fünf war und ich sieben, wurden wir Freundinnen. Sie hatte eine acht Jahre ältere Schwester, Birgit. Die konnte einen französischen Zopf flechten.
Später trafen Nadine und ich uns jeden Nachmittag nach der Schule und verbrachten die Wochenenden bei uns, im Sommer in unserem Garten, im Winter im Haus. Öfter kam auch Tamara dazu. Sie war so alt wie Nadine, klein und pummelig und wohnte nebenan. Wir schickten sie weg, weil wir allein, ohne sie, eine Bude bauen wollten, aber sie ließ sich nicht abwimmeln. Wenn wir sie verscheuchten, lachte sie nur. Und je schlimmer unsere Ausdrücke ihr gegenüber wurden, desto lauter lachte sie. Irgendwann blieb sie. Sie sammelte Blätter und Blumen und bot sich an, unsere Bude zu dekorieren. Manchmal machten wir gemeinsam Hausaufgaben und Tamara störte uns, indem sie ständig irgendetwas herumkrähte. Sie hatte etwas Witziges. Was ist hundert minus null? Zehn, sagte sie und strich einfach eine Null. Birgit, Nadines große Schwester, war nicht dabei, sie saß in ihrem Zimmer am Kassettenrecorder und nahm Lieder aus dem Radio auf.
An den Nachmittagen tischte meine Mutter uns Kuchen und Geschichten von früher auf. Wie findet man heraus, ob man heiratet? Man muss in der Silvesternacht an einen Hühnerstall klopfen. Meldete sich zuerst eine Henne, wird nichts draus. Antwortet ein Hahn, wird geheiratet. Oder: Wenn man heiraten will, soll man die Spinnweben hängen lassen. Denn wer die Spinnweben wegmachte, vertrieb die Heiratswilligen. Wir kicherten und lachten, bis uns der Bauch weh tat.
Ende der Achtziger tanzten wir in der Schuldisco zu »99 Luftballons« von Nena, wir bewegten uns mit den gleichen eckigen Bewegungen, Tipp zwei, zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück. Ich dachte am Bahnhof daran zurück und mir kam der Gedanke, dass wir wahrscheinlich die letzte Generation waren, die nicht darauf achtete, dass sie sexy beim Tanzen aussah.
Obwohl drei Jahre jünger als ich, war Nadine in allem schneller gewesen, ihre Brüste waren schneller gewachsen, sie hatte eher einen Jungen geküsst und hielt vor mir ihre Fahrerlaubnis in den Händen. Seit meinem Studium hatte ich sie nur noch sporadisch gesehen, wenn ich zu Weihnachten oder bei Familienfesten für ein paar Tage in Kosakenberg zu Gast war. Wir verabredeten uns nicht mehr. Ob wir uns trafen, hing davon ab, ob wir uns zufällig auf der Straße begegneten.
Für mich hatte sich da schon alles geändert, sie war immer noch die gleiche Nadine. In der achten Klasse war sie sitzengeblieben, Abitur hatte sie nicht geschafft. Das hatte mir leid getan. Aber es reichte nicht, um sie nicht aus den Augen zu verlieren. Sie hatte nichts Interessantes, nichts Neues zu sagen. So nahm ich sie damals wahr.
Ich drehte mich nach der Bahnhofsuhr um. Halb zehn. Sie war offenbar stehengeblieben.
Unzählige Male hatte mich mein Vater von diesem Bahnhof abgeholt. Der Bahnhof war eine Konstante in der Beziehung zwischen mir und meiner Familie, ich ging, sie blieben, meine Welt wurde größer, ihre blieb klein und eng.
Endlich tauchte der grüne VW‑Passat meines Vaters auf. Schwerfällig stieg er aus. Er trug keine Winterjacke mehr, sondern nur einen blauen Arbeitskittel, der sich bedenklich über seinen Bauch spannte. Die Figur hatte ich von ihm geerbt. Er gab mir zur Begrüßung die Hand, ich sah den Schmutz unter seinen Fingernägeln, griff zögerlich zu und hoffte, mein Vater würde mein Zögern nicht bemerken. »Der Verkehr«, sagte er. Es sollte eine Entschuldigung dafür sein, warum er zu spät gekommen war. Als käme nicht ich, sondern er aus der Großstadt. Er verstaute meine Tasche im Kofferraum, ich schaute mich nach links und rechts um. Ich war erleichtert, dass niemand sah, wie ich mit dem Mann im blauen Kittel ins Auto stieg. Ein Gebrauchtwagen, versteht sich.
»Du hast da was«, sagte er. Und deutete auf meinen Mund. Ich wischte mir hektisch an den Lippen herum, wahrscheinlich Schokoladenreste. Sobald ich neben meinem Vater im Auto Platz nahm, wurde ich wieder zum Kind. Es ging schon damit los, dass ich es nicht schaffte, den Gurt herauszuziehen. Er hatte sich verhakt, ich bekam ihn nicht aus der Halterung heraus. Wahrscheinlich war ich müde von der langen Reise. Das passierte mir immer. Wenn ich erschöpft war, wurde ich fahrig. Für meinen Vater war ich schon immer die Ungeschickte, die mit den zwei linken Händen. »Das ist doch alles krumm und schief«, rief er, wenn ich mit einer Bastelarbeit aus der Schule nach Hause kam. »Das wird doch nichts«, rief er. Ohne mich anzusehen, griff er nach meinem Gurt. Das war ein bisschen umständlich, weil er sich aus seinem Sitz hochschieben musste und der Bauch im Weg war. Er schnaufte etwas, zog aber ganz leicht ein langes Stück aus der Halterung, legte mir den Gurt um und steckte ihn fest. Dann schnallte er sich selbst an, fuhr los, den Blick auf die Straße gerichtet. Auch ich blickte geradeaus auf die Straße. Es roch im Auto immer noch nach Zigarettenrauch, obwohl mein Vater das Rauchen angeblich vor einiger Zeit aufgegeben hatte.
Um nach Kosakenberg zu gelangen, musste man Waldstadt einmal durchqueren, links an der Kirche und der Altstadt vorbei, über die Eisenbahnbrücke, dann durch Siedlungen mit Neubaublöcken, die für die Arbeiter des Reifenwerks angelegt worden waren. Die meisten Blocks standen seit Längerem leer und verfielen. Das Reifenwerk hatte dichtgemacht, die Leute waren entlassen worden und weggezogen. Auf einer Hauswand stand ein Graffito, über das ich mich jedes Mal amüsierte: »Ich bin kein Rassist, ich hasse alle Menschen.« Das passte gut zu meinem Vater. Vielleicht sprühte er heimlich. Nein, natürlich nicht. Aber auch das war eine amüsante Vorstellung.
Kurz vor dem Ortsausgangsschild gab mein Vater Gas, die Nadel des Tachos schnellte nach oben. Man könnte meinen, dass Menschen, die abseits der urbanen Zentren wohnten, Muße hätten und gemächlich fahren würden. Aber das war ein Denkfehler, wie ihn die Städter machten. Wenn sie die Gegend besuchten, dachten sie, sie seien in der Natur. Sie verstanden nicht, dass das, was sich vor ihnen auftat, die Kiefernwälder, die Felder, die Wiesen, keine Natur war, sondern das Produkt menschlicher Bewirtschaftung. Dass die Menschen hier nicht den ganzen Tag Freizeit hatten und die Landschaften genossen, sondern genauso arbeiteten wie überall.
Obwohl die Straße eine steile Kurve machte, beschleunigte mein Vater weiter, sodass ich in meinen Sitz und zur Seite gedrückt wurde. Das Auto hielt sich mit einem Drall nach rechts unten schräg auf der gewölbten Fahrbahn. Mein Vater fuhr am liebsten schnell. Darin bestand für ihn der Sinn des Autofahrens. Unabhängigkeit. Freiheit. Die beiden großen Versprechen der deutschen Einheit, im Autofahren sah er sie umgesetzt. Mein Vater hasste es, wenn jemand vor ihm zögerte, dauernd abbremste, weil die Zögerlichkeit auf ihn wirkte, als könne die Freiheit ihm wieder weggenommen werden. Als könne die Zeit zurückgedreht werden und er wieder in seiner langsamen Pappkiste von früher landen.
Deshalb fühlte sich mein Vater, wie die meisten Kosakenberger, von jedem langsamen Auto persönlich herausgefordert, angegriffen und provoziert. Die Straße war hier kein öffentlicher Ort, wo ein allgemein akzeptiertes Regelwerk galt, dem jeder seine Interessen unterordnete. Die Straße wurde als privater Raum betrachtet, wo jeder versuchte, seinen Vorteil durchzusetzen. Der mit dem größten Hubraum gewann.
Von der Autobahnabfahrt bog ein weißer Audi auf die Straße, obwohl er meinen Vater kommen sah. Mein Vater bremste scharf, und ich flog nach vorn Richtung Windschutzscheibe. Der blitzblanke Audi trug ein Berliner Kennzeichen und fuhr erlaubte achtzig. Mein Vater blieb dicht hinter ihm und scherte kurz vor der nächsten Kurve nach links aus, um zu überholen. Ich hob nervös die Hand und umklammerte dann den Griff über der Tür, einhundertdreißig Stundenkilometer zeigte der Tacho. Ich schloss vor Schreck die Augen, und als ich sie wieder öffnete, sah ich einen Laster auf uns zukommen. Ich zitterte. Der Fahrer im Laster hupte. Mein Vater riss das Lenkrad nach rechts und fuhr ungerührt weiter. Der weiße Audi war nur noch im Rückspiegel zu sehen.
»Das war knapp«, sagte ich.
»Nee, das war Ronny«, sagte er. Damit meinte er den Fahrer im Laster.
So wie mein Vater machten es alle Männer in Kosakenberg. Sie folgten darin einem einfachen Prinzip. Ihr habt die Hauptstadt, wir haben die Straße. Ihr habt die Neuwagen, wir haben den Mut. Sie liebten riskante Überholmanöver, und auf ihren gebrauchten Autos prangten Aufkleber wie »Die einen führen, die anderen folgen« oder »Böhse Onkelz«.
Nach dem Erfolg über den Berliner wurde mein Vater gesprächiger. Er berichtete, an welcher Kreuzung er vorhin länger hatte stehen müssen, wegen einer ausgefallenen Ampel. Dann waren bei der leerstehenden Kunststofffabrik die Bahnschranken unten gewesen. Deshalb hatte es so lange gedauert, deshalb hatte ich warten müssen. Mein Vater kommentierte das Wetter: »Ganz schön frisch für die Jahreszeit«, sagte er. Beim Wetter waren wir sicher, da konnten wir nichts falsch machen. Zu kalt, zu warm, zu viel Regen, zu wenig Regen. Irgendwas war immer.
Ich antwortete darauf mit einem interessierten: »Hm.« Oder: »Oh.« Oder: »Mmmh.«
Er schien damit zufrieden zu sein. Er erwartete keine Antwort, er füllte nur den Raum. Als Nächstes ging es darum, was in den letzten Tagen mit dem Auto passiert war. Eine Bremse war kaputt. Der Motor stotterte. Es gab keine Ersatzteile. Ich hörte nur halb zu.
Das Auto war sein größter Stolz. Er ließ niemand anders damit fahren. Ein einziges Mal durfte ich ans Steuer, da muss er sich das Bein gebrochen haben. Er saß neben mir und knirschte in jeder Kurve mit den Zähnen, als sei es so schmerzhaft, neben mir im Auto zu sitzen, weil ich so ungeschickt fuhr. Er rief Anweisungen: »Gang runter«, dann wieder »Gang rauf«. Es war Folter. Für uns beide.
Nach 1990 waren die Gebrauchtwagenhändler wie Pilze aus dem Boden geschossen. Niemand machte sich damals die Mühe, Autohäuser zu bauen, sondern es wurden einfach ein paar alte Wagen, die jemand aus Hannover oder Bochum herbeigeschafft hatte, auf die Wiese gestellt. Drumherum wurde ein blauweißes Band gespannt und an den Bäumen befestigt. Fertig. Ich sah das noch vor mir, wie die bunten Bänder im Wind flatterten. Mein Vater tauschte auf so einer Wiese seinen alten Wartburg gegen einen gebrauchten VW Golf, den er nach einigen Jahren gegen einen Passat umtauschte. Er träumte von einem Mercedes.
Mich langweilten die Geschichten über Autos. Nachdem ich mich von dem Überholmanöver erholt und den Griff über mir losgelassen hatte, kreisten meine Gedanken wieder um London. Ich erinnerte mich an den Moment, als ich meinem Vater und meiner Mutter von dem Umzug erzählt hatte. Da war bereits alles entschieden, der Arbeitsvertrag unterschrieben. Ich hatte erwartet, dass sie überrascht sein würden. Zumindest das. Ich zog in ein anderes Land, sogar in dessen Hauptstadt, eine Metropole. Es handelte sich um ein wichtiges Magazin, das mich anstellen würde, hatte ich gesagt, gut, da hatte ich etwas geschummelt. Aber so richtig konnten sie das nicht beurteilen. Meine Mutter hatte nicht aufgehört, die Arbeitsfläche der Küche zu putzen. Mein Vater hatte mich taxiert und die Augen zusammengekniffen, dann schaute er auf das blaue Muster seiner Kaffeetasse, als sehe er es zum ersten Mal. »Dann wirst du ja noch seltener hierherkommen«, stellte meine Mutter als Erstes fest. Ich schaute auf den Boden und rang um eine Antwort. Wahrscheinlich hatte sie recht.
Sie konnten nicht einmal den Namen des Magazins richtig aussprechen: »Di‑sein Riw‑ju«. Es war schwer, in ihren Gesichtern zu lesen, was sie dachten. Waren sie gleichgültig? Traurig? Abwehrend? Seit Langem hatten sie die Technik perfektioniert, in ihren Gesichtern nichts preiszugeben. Schon gar nicht, wenn es Neuigkeiten gab. Erst mal abwarten, hieß die Devise, egal, ob der Brigadeleiter oder die Tochter vor einem stand.
Von Octavio, meinem neuen Freund, erzählte ich nichts. Ich redete nie von Männern, und weder mein Vater noch meine Mutter stellten Fragen. Das Einzige, was sie interessierte, war, ob alles in Ordnung ist. Und obwohl sie sich darunter bestimmt etwas anderes vorstellten als ich, sagte ich bei jedem meiner Besuche: Klar, alles in Ordnung. Anfangs dachten meine Eltern, ich sei Fotografin, auch wenn ich ihnen erklärt hatte, dass ich Magazinseiten gestaltete, Bilder und Grafiken aussuchte und sie so zusammenstellte, dass sie zum Text passten. Aber was sollte das für ein Beruf sein? Für meinen Vater zählte nur Arbeit mit den Händen, und er machte sich oft lustig über die Sesselfurzer, die den ganzen Tag nur am Schreibtisch saßen und Kaffee tranken, während andere bei »richtiger Arbeit« schufteten. Mein Job gab ihm Rätsel auf. Zwölf Jahre war ich zur Schule gegangen, hatte vier Jahre studiert und trotzdem nichts Vernünftiges gelernt, womit man die Kollegen und die Nachbarn im Dorf beeindrucken konnte. Also so etwas wie Ärztin. Oder Lehrerin.
Nach meiner Ankündigung, dass ich nach London gehen würde, hatten die Worte »Umzug«, »weggehen«, »England« wie Fremdkörper in der Küche gehangen. »London. Sieh an«, hatte mein Vater schließlich gesagt, als hätte er über diese Bemerkung sehr lange nachgedacht. Nach ein paar Minuten war er mit Zeitung und Kaffee in seine Garage verschwunden.
Meine Mutter hatte schließlich beiläufig gefragt: »Ab wann?« Ohne ihre Wischbewegung zu unterbrechen. Als ich ihr antwortete, dass ich schon bald umziehen würde, meinte sie gedankenverloren: »In der Schule hatten wir English for you. Mit Tom und Peggy.« Sie zog das »You« künstlich lang und sagte »Änglisch«. Tom und Peggy, so hießen die beiden Lehrer, die im DDR-Schulfernsehen mit den Kindern Aussprache und Grammatik übten und ihnen beibrachten, dass es im Vereinigten Königreich große Probleme mit Diskriminierung aufgrund der Herkunft und der Hautfarbe gab.
In meiner Schulzeit waren Tom und Peggy schon verschwunden, und besonders viel lernten wir nicht im Englischunterricht. Man konnte sich kaum auf Englisch richtig vorstellen, über seinen Alltag sprechen oder ein spontanes Gespräch führen. Keine meiner Lehrerinnen war Muttersprachlerin oder hatte jemals einen Fuß in ein englischsprachiges Land gesetzt.
Meine mangelhaften Sprachkenntnisse hatte ich schlauerweise verschwiegen, als ich den Verlagsleiter des Magazins, bei dem ich in Berlin arbeitete, um einen Job in Amerika gebeten hatte. Das war größenwahnsinnig gewesen, andererseits war ein Nein das Schlimmste, was hätte passieren können. Der Verlagsleiter war ein kleiner schmaler Mann aus Dresden, der 1990 in ein Fortbildungsprogramm für DDR-Studenten gerutscht war. Um im Westen Karriere zu machen, hatte er sich sein Sächsisch abtrainiert, indem er Vorträge auf Kassetten gesprochen hatte. Nun beherrschte er perfektes Hochdeutsch. Nur wenige wussten, dass er aus Dresden kam. Aber mir hatte er es erzählt. Bei meinem Einstellungsgespräch hatte er verschwörerisch geflüstert: »Kosakenberg, kenn ich. In Waldstadt war ich mal im FDJ-Lager.« Er hatte seinen Finger auf den Mund gelegt, als sei das jetzt unser Geheimnis. Ich war verblüfft gewesen, niemand kannte Kosakenberg. Wahrscheinlich hatte ich bereits damals insgeheim beschlossen, ihn eines Tages um einen Gefallen zu bitten.
In Amerika gab es allerdings keinen Job für mich. »Aber wie wäre es mit London?«, hatte mein Chef gefragt, als ob der Unterschied gar nicht so groß war. Ich hatte sofort zugesagt. Erst als ich wieder zurück zu meinem Schreibtisch lief, fiel mir ein, dass ich weder je in London gewesen war noch etwas mehr als Schulenglisch sprach. Aber ich liebte doch englische Musik, sprach ich mir selbst Mut zu, Joy Division, New Order, Pet Shop Boys. Auch mit Octavio unterhielt ich mich auf Englisch, von ihm könnte ich lernen. Ich war fast sechsundzwanzig, nicht mehr ganz jung, aber auch noch nicht alt. Ich würde es schon schaffen.
Ich schaute aus dem Autofenster. In London hatten schon die Kastanien geblüht, hier streckten sie noch nicht einmal die Blätter heraus. Kiefernwälder und kahle Felder zogen vorbei. Mein Vater hatte aufgehört von Autos zu reden. Erst jetzt fiel mir die Stille auf. Ich hätte ihm von Lynda erzählen können, meiner neuen Chefin, und davon, dass sie einen schrägen Humor hatte. Aber mein Vater mochte keine Erzählungen von Leuten, die er nicht kannte und die er wahrscheinlich nie kennenlernen würde. Es ergab für ihn keinen Sinn, sich mit ihnen zu beschäftigen, genauso wenig wie mit Orten, an denen er nie sein würde. Und dazu gehörte London für ihn auf jeden Fall.
Er mochte keine Geschwätzigkeit. Und für ihn war jedes Reden geschwätzig, was nicht im Hier und Jetzt seinen Anlass hatte.
Lynda hatte mich in ein Café bestellt, laut »London A–Z« hieß die Gegend Smithfield und lag im Zentrum von London, St. Pauls Cathedral war um die Ecke. Das Café befand sich in einer umgebauten Fabrikhalle, in der riesige lange Tische aus Stahl standen, an die man sich mit fremden Menschen setzte, um zu plaudern oder Geschäfte zu machen. Ich kannte niemanden, mich kannte niemand. Was für eine Freiheit.
Lynda war Anfang fünfzig. Sie trug komplett Schwarz, einen knallroten Lippenstift, dazu leuchtend rote Haare. Sie erkannte mich zuerst und winkte mich heran. Ich hatte kaum Platz genommen, da fragte sie schon: »Weißt du, wo du hier bist?« Ich schüttelte den Kopf.
«Smithfield war früher einer der grausamsten Orte Londons, hier fanden öffentliche Hinrichtungen und Verbrennungen statt«, sagte sie. Die Menschen seien in kochendes Wasser geworfen worden. Ein gewisser Braveheart wurde wohl im vierzehnten Jahrhundert auf dem Platz erhängt. Braveheart? Ich traute mich nicht zu sagen, dass ich nicht wusste, wer das war. Gab es da nicht einen Film? Lynda schaute mich an und lachte laut auf. Das musste der berühmte englische Humor sein. Ich hatte noch viel zu lernen.
Sie hatte zwei Getränke für sich bestellt, einen Cappuccino und frisch gepressten Orangensaft. Ich war mir nicht sicher, wie viel der Kaffee kostete, und bestellte nur ein Wasser. Sie sprach indes weiter über Smithfield. Viele Jahrhunderte lang hatte ein Viehmarkt hier stattgefunden. Die Bauern brachten ihre Schafe und Pferde in die Stadt, um sie vor Ort zu verkaufen, um den Markt herum hatten sich Schlachtereien und Fleischer angesiedelt. Im Juni 1855 sei der Viehmarkt aufgrund von Beschwerden über die Unordnung, die durch das Treiben von Lebendvieh im Zentrum von London verursacht wurden, geschlossen worden. Lydia schien es zu genießen, für mich die Ortskundige zu spielen. Ich schaute mich im Café um. Ich versuchte mir vorzustellen, wie neben den Rinnsteinen früher lange Reihen von Kühen, Schweinen und Pferden herumgestanden hatten. Auf dem Boden muss es sehr schmutzig gewesen sein, wahrscheinlich blökten die Schafe und schrien die Händler durcheinander. Um uns herum saßen saubere, gut gekleidete Menschen, Männer in Anzügen, Frauen in Kostümen. Es roch nach Kaffee und frisch gebackenen Croissants. Ich nahm einen Schluck von meinem Wasser und schaute vorsichtig auf die Uhr.
Lynda verstand den Wink und lobte meine Arbeitsmappe, die ich ihr geschickt hatte. Sie nannte mir eine Summe als Gehalt, die so hoch war, dass ich fürchtete, sie nicht richtig verstanden zu haben. Ich nickte freudig, es lief gut, sehr gut. Zur Verabschiedung zog mich meine künftige Chefin an sich und küsste mich erst auf die rechte Wange und dann auf die linke. Ich zog meine Wange nicht weg, war aber verunsichert. In Kosakenberg wurde nicht geküsst. Jedenfalls nicht so.
Ich drehte im Auto meinen Kopf zur Seite, sacht, gerade so weit, dass ich meinen Vater sehen konnte. Er hielt das Lenkrad mit dem rechten Daumen, seine linke Hand lag auf dem Oberschenkel. Nur Frauen hielten das Lenkrad mit beiden Händen fest, hatte er mal gesagt. Vielleicht sollte ich ihm wenigstens von der Bankeröffnung in London erzählen? Wie man im Ausland an sein Geld kommt, würde auch ihn interessieren. Nein, ein Kosakenberger würde nie irgendwo hingehen, wenn das bedeutete, dass man nicht mehr zu Frau Schmidt von der Sparkasse gehen konnte, wenn es Probleme mit dem Konto gab. Und tatsächlich war es unerwartet kompliziert gewesen, in London ein Konto zu eröffnen.
»Du brauchst die Gas- oder Stromrechnungen deiner Wohnung«, hatte der Bankangestellte gesagt. Wir saßen im zweiten Stock einer Bank in Islington, meinem neuen Wohnviertel. Das Fenster war vergittert, die roten Sessel etwas abgewetzt. Er erläuterte mir, was utility bedeutet und inland revenue tax notification. Ich fragte, ob er die Gasrechnung meiner Wohnung in Berlin meinte. Er lachte, als hätte ich einen Witz gemacht, und zeigte eine Reihe perfekter weißer Zähne. Ich erklärte ihm, dass ich keine Wohnung in London hatte und deshalb auch keine Gasrechnungen. Ich bekam nur eine Wohnung, wenn ich ein Konto hatte, und ein Konto, nur wenn ich eine Wohnung nachweisen konnte. »Ein Waffenschein reicht auch aus«, sagte der Mann mit den weißen Zähnen, er sah dabei völlig ernst aus. Genügte nicht mein Arbeitsvertrag? »Sadly not.« Leider nicht.
Der Bankangestellte war in meinem Alter und musterte mich wie ein hungriger Vogel. Ich fühlte mich unwohl und rutschte auf dem roten Sessel hin und her. Ich schaute zur Tür und wieder zurück zu ihm. Er sagte, dass er mir die besten Clubs der Stadt zeigen würde. Dabei könnten wir über das Konto reden. Er sah gut aus, sportlich, kein Gramm Fett zu viel. Dass er bei Frauen Erfolg hatte, stand ihm ins Gesicht geschrieben. Asiatische Züge, perfekte glatte Haut. Wahrscheinlich mochte er Garage oder Dubstep. »Gibst du mir deine Nummer?«, fragte er. Vielleicht später, sagte ich.





























