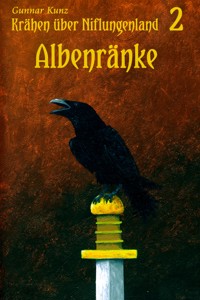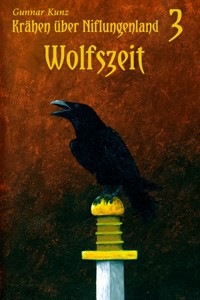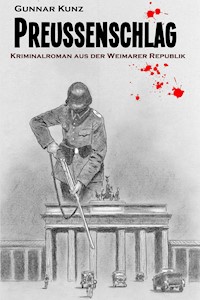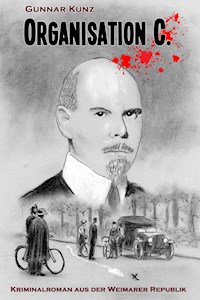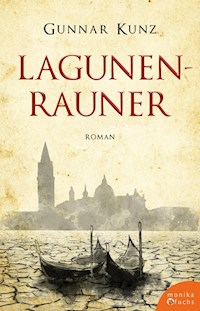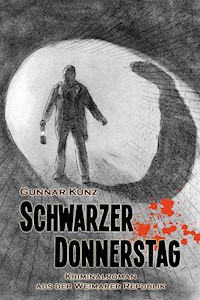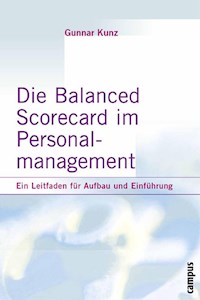Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Roter Drache
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Fünf Menschen: Grimhild, die aus Liebe eine Katastrophe heraufbeschwört. Sigfrid, der plötzlich versteht, als es zu spät ist. Hagen, dessen eiserne Selbstbeherrschung von einem Lächeln bis auf den Grund zerschlagen wird. Brünhild, die ihre Seele verschenkt und der Macht gebrochener Versprechen erliegt. Gunter, der zum ersten Mal etwas für sich will und sich nicht damit abfinden kann, dass es unerreichbar sein soll. Fünf Menschen, die in unauflösbaren Leidenschaften miteinander verstrickt sind. Fünf Menschen, die ihrem Schicksal nicht entfliehen können. Denn Wodan, der Gott der Ekstase, liebt es, Lust und Leid gleichermaßen bis zum Äußersten auszuloten. Der Autor nähert sich dem Nibelungenmythos auf ungewöhnliche Weise, indem er sich auf die Forschung zur Thidrekssaga von Heinz Ritter-Schaumburg bezieht, der den Stoff für einen authentischen Bericht der Völkerwanderungszeit hielt. Demzufolge werden in diesem Roman psychologisch überzeugende Menschen mit all ihren Hoffnungen und Ängsten geschildert, gefangen zwischen Loyalität und Verrat. Mit erzählerischer Kraft erweckt der Autor eine Welt im Umbruch zum Leben, die den Keim des Untergangs bereits in sich trägt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Das Leben erkennt man an seiner Ekstase.“
Vilhelm Grønbech
1. Auflage August 2017
Copyright © 2017 by Edition Roter Drache.
Edtion Roter Drache, Holger Kliemannel, Haufeld 1, 07407 Remda-Teichel [email protected]; www.roterdrache.org
Titelbild: Rannug
Buch- und Umschlaggestaltung: Holger Kliemannel
Gesamtherstellung: Wonka Druck
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2018
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form (auch auszugsweise) ohne die schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden.
ISBN 978-3-964260-08-6
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Prolog (Winter 471/472)
1 (Sommer 477)
Sigfrid kommt
Vergessen, verlieren
Brautwerbung
Kalte Ekstase
2 (Herbst 472, fünf Jahre zuvor)
Das Schwert der Schwerter
Albenränke
Liebesschwüre
3 (Frühjahr 481)
Der Streit der Königinnen
Gott der Lust, Gott der Toten
Andvaranaut
4 (Winter 482)
Neue Hoffnung?
5 (Altweibersommer 488)
Schicksalsrunen
Schwarzer Eiter
Neidingswerk
Wolfszeit
Die Leere zwischen den Sternen
Epilog (Winter 498 / 499)
Anhang
Dramatis Personae
Glossar
Nachwort
Der Autor
Grimhild trieb ihre Stute an, die sich mühsam durch zum Teil mannshohe Schneewehen kämpfte. Pferd und Reiterin hinterließen kurzlebige Atemwolken in der Luft. Die schwache Sonne reichte nicht aus, um die klirrende Kälte zu vertreiben, nicht einmal, um sie erträglicher zu machen. Grimhild fröstelte, obwohl sie einen dicken Wollmantel über ihrem leinenen Unterhemd trug, und zog den Umhang fester um ihre Schultern. Weder die Wickelbänder um ihre Beine noch die Schnürstiefel, in denen ihre Füße steckten, konnten verhindern, dass die Kälte ihren Körper heraufkroch. Ihr silberblondes Haar, zu einem Zopf zusammengebunden, fiel ihr schwer in den Nacken und fühlte sich unangenehm klamm an. Das Mädchen rieb die Handflächen aneinander, formte die Hände zu einer Schale und hauchte hinein. Es nutzte nicht viel.
Unter der verharschten Decke erwies sich der Schnee als trocken und feinkörnig, was das Vorankommen leidlich erleichterte, aber die Stute musste trotz allem kräftig arbeiten, weil sie immer wieder in Schneewehen versank. Sie schnaufte bereits vor Anstrengung und bewegte sich nur unwillig fort, dabei war Fála das gutmütigste Pferd im Stall der Niflungen.
Die Anstrengungen des Rittes schienen Grimhild nichts auszumachen. Aufrecht saß sie im Sattel, den Rücken gestreckt. Trotz ihrer Jugend lag in ihrer Haltung bereits etwas Selbstbewusstes, das Männer veranlasste, sich nach ihr umzudrehen. Schon jetzt konnte man in dem schmächtigen Mädchen die Frau ahnen, die sie einmal werden würde. Grimhild war nicht besonders groß, dennoch hatte man stets den Eindruck, ihr auf gleicher Höhe zu begegnen, was sie ihren herausfordernden grünen Augen verdankte. Es gab nicht viele, die ihrem Blick standhalten konnten. Gislher, ihr Lieblingsbruder, hatte ihr den Spitznamen »Schmiedeauge« gegeben, weil er der Ansicht war, ihre Blicke könnten Steine erweichen und Herzen zum Schmelzen bringen.
Auf einem Hügel hielt Grimhild an und gab Fála Gelegenheit zu verschnaufen. Sie tätschelte den Hals der Stute, während sie ihren Blick schweifen ließ. Der Anblick von Niflungenland erfüllte sie stets aufs Neue mit Freude, besonders in der friedlichen Stille der Wintertage. Bäume bogen sich unter der Last des Schnees, Wälder und Felsen warfen Schatten in zartem Blau. Das Land schien in tiefem Schlaf zu liegen. Die einzigen Anzeichen von Leben waren die Schnürspur eines Fuchses und das Werk der Zähne von Mäusen und Kaninchen, die in Ermangelung von Grünfutter die Rinden der Baumstämme benagt hatten. Die klare Luft machte es möglich, einen Blick auf den Rhein zu erhaschen, der sich in der Ferne als gewundenes Band dahinschlängelte, ein Anblick, der unweigerlich Grimhilds Herz zum Klopfen brachte. Der Fluss und die Täler ringsumher waren für sie der Inbegriff von Geborgenheit. Sie besaß keine Erinnerung an die Zeit, bevor ihr Vater das Land links des Rheins erobert hatte. Für sie war dies das Land ihrer Sippe.
Grimhild drehte sich um und konnte sich ein triumphierendes Lächeln nicht verkneifen. Tolbiacum, das einstige vicus der Römer, das sich die Niflungen zum Herrschersitz erkoren hatten, war längst hinter bewaldeten Bergrücken verschwunden. Niemand verfolgte sie, obwohl ihr heimlicher Ausflug nicht unbemerkt geblieben war. Volker, der Skop, hatte sie gesehen, als sie sich ihre Stute holte. Aber es war ihr gelungen, ihn davon zu überzeugen, dass sie nur einen Spazierritt unternahm, und nachdem sie eine Weile mit ihm gescherzt und ihm erlaubt hatte, ihr ein paar Komplimente zu machen, hatte er sie gehen lassen. Es war leicht, einen Mann dazu zu bringen, ihr gefällig zu sein. Männer waren jungen Mädchen gern behilflich, zumal einem hübschen.
Zweifellos setzte sie sich Gefahren aus, wenn sie allein durch das Land ritt. Die Wege waren unsicher, allerlei Gesindel trieb sich in der Gegend herum. Hin und wieder sandte König Aldrian, ihr Vater, eine Eskorte aus, um die Straßen zu sichern und Wegelagerer zu vertreiben, aber es nützte nicht viel, sie kamen immer wieder. Der Hunger trieb sie dazu, besonders in diesem strengen Winter. So manch einer wurde nach dem Verzehr von schlechtem Mehl vom Heiligen Feuer heimgesucht, litt unter Krämpfen und bekam Brandblasen oder gar brandige Glieder. Ihre Mutter hatte ihr den Pilz am Getreide gezeigt, der die Schuld daran trug. Und Menschen waren nicht die Einzigen, die Hunger litten. Auch Wölfe näherten sich neuerdings den Siedlungen und umschlichen die Wehrzäune in der Hoffnung, etwas Essbares zu erwischen. Aber Grimhild hatte sich noch nie von einer Gefahr oder einem Verbot zurückhalten lassen zu tun, was sie für richtig hielt.
Sie warf einen letzten Blick umher und nickte befriedigt. Niemand würde sie suchen. Dass sie sich vom Webstuhl fortgestohlen hatte, war nichts Ungewöhnliches. Und wem sollte es auch auffallen? Ihr Vater weilte bei Didrik von Bern, um Beistand zu erbitten, falls der schwelende Grenzkonflikt mit Jarl Elsung zum Ausbruch kommen sollte. Ihre Mutter hatte alle Hände voll zu tun, die Herstellung neuer Holzfässer zu überwachen, nachdem sie heute früh entdecken mussten, dass einige der gelagerten Weinfässer leck waren, weil irgendjemand am Pech gespart hatte. Und ihre Brüder kümmerten sich nicht um sie. Vor dem Abendessen würde ihre Abwesenheit kaum bemerkt werden.
Sollte allerdings doch jemand dahinter kommen, dass sie ohne Erlaubnis fortgeritten war … aber selbst dann hatte sie nicht viel zu befürchten. Da ihr Vater nicht daheim war, würde Gunter versuchen, sie für ihren Ungehorsam zu bestrafen. Grimhild grinste. Als künftiger König glaubte er gelegentlich, ihr Befehle erteilen zu können. In der Regel beachtete sie ihn einfach nicht, was ihn maßlos ärgerte. Ob er mehr Durchsetzungskraft haben würde, wenn er erst König war? Aldrian besaß Autorität, seinen Befehlen gehorchte jeder widerspruchslos. Gunter … nun, er war einfach zu still. Die Leute mochten ihn, und meist gehorchten sie ihm auch, doch mehr, weil sie ihn gern hatten, als aus Respekt. Grimhild rieb ihre kalten Hände aneinander. Sie mochte ihren ältesten Bruder, aber sie stand ihm nicht nahe. Sie fühlte sich mehr zu Männern der Tat hingezogen.
Und das brachte sie wieder zu dem Grund ihres Ausrittes. Grimhild fluchte über ihre Trödelei und trieb das Pferd an. Sie durfte nicht zu lange verweilen, wenn sie vor Anbruch der Dunkelheit zurück sein wollte. Die Tage waren kurz, und sie hatte noch ein gutes Stück Weges vor sich. Sie würde sich nicht lange bei Thiota aufhalten können, aber für ihre Zwecke musste es genügen. Die Blätter der Schafgarbe, die sie jede Nacht auf ihre Augenlider legte, hatten ihr einen Traum beschert, den sie nicht zu deuten wusste. Die Seherin musste ihr helfen, Klarheit zu gewinnen. Sicher würde sie sich wieder zieren und sie ermahnen, sich vor Fragen zu hüten, deren Antwort sie gar nicht wissen wolle, und dass es Unglück bringe, die Zukunft zu kennen, und dergleichen mehr. Grimhild verzog das Gesicht. Alle glaubten ständig, ihr Ratschläge geben zu müssen und behandelten sie wie ein kleines Kind. Dabei war sie schon elf!
Und ihr Traum war wichtig. Immerhin ging es darum, eine Vision von ihrem zukünftigen Mann zu erhalten! Doppelt wichtig sogar, wenn man bedachte, wie langweilig die meisten Männer in Tolbiacum waren. Na schön, da gab es Hagen, den Waffenmeister, der zu den Wenigen gehörte, die gegen den Zauber ihrer Augen immun zu sein schienen. Trotz seiner Hässlichkeit, trotz seiner Verschlossenheit – oder gerade deswegen – faszinierte er sie. Jedenfalls war er der einzig interessante Mann in der Niflungenburg, wenn man von Volker, dem Sänger absah, aber der umwarb jede Frau und war daher keine Herausforderung. Flüchtig dachte sie an ihren Vetter Irung, einen reizbaren, schnell beleidigten Krieger, der sich neuerdings darum bemühte, ihre Aufmerksamkeit zu erringen. Wenn er nur nicht ständig versuchen würde, sein struppiges Haar mit Butter zu glätten! Grimhild mochte ihn mit zerzausten Haaren lieber, er sah dann immer richtig verwegen aus. Aber er schien zu glauben, dass er den Frauen imponieren könne, wenn er mit ranzigem Fett eingeschmiert herumlief. Männer!
Fála scheute plötzlich und schnaubte. Hatte die Stute etwas gewittert? Grimhild tätschelte ihr beruhigend den Hals und sah sich aufmerksam um. Nicht weit voraus entdeckte sie die Spuren zweier Pferde. Sie schienen aus verschiedenen Richtungen gekommen und an dieser Stelle zusammengetroffen zu sein. Eine kurze Strecke liefen sie friedlich nebeneinander her, aber zwei Steinwürfe entfernt war der Schnee wie von einem Kampf zerwühlt. Eine Blutspur führte in ein nahe gelegenes Gehölz.
Grimhild biss sich auf die Lippen. Sie wusste, sie sollte nicht hier sein. Unschlüssig drehte sie sich hin und her. Sollte sie weiterreiten, als ob nichts geschehen wäre? Undenkbar! Also blieben ihr nur zwei Möglichkeiten. Sie konnte umkehren, ihrer Sippe Bericht erstatten und sich wie ein kleines Mädchen für ihren Ungehorsam ausschelten lassen. Oder sie konnte herausfinden, was geschehen war. Gescholten werden würde sie auf jeden Fall. Aber wenn sie der Sache auf den Grund ging, würde sie sich zumindest den Respekt ihrer Sippe erwerben. Außerdem, und das gab am Ende den Ausschlag, mochte es ja sein, dass der Anlass für die blutige Fährte harmlos war, und in diesem Fall brauchte sie gar nichts zu sagen. Aber daran glaubte sie selbst nicht.
Mit einem Schnalzen brachte sie Fála dazu, der roten Fährte zu folgen. Vor einer Gruppe von Büschen wurde das Pferd langsamer und scharrte nervös mit den Hufen. Grimhild schluckte. Was immer der Grund für die Blutspur war, gleich würde sie ihn zu Gesicht bekommen. Ihr hugi, der Teil ihrer Seele, der Neigung und Instinkt in sich trug, warnte sie, aber sie ignorierte seine Stimme und unterdrückte das Zittern ihrer Glieder. Vorsichtshalber zog sie ihr Messer. Dann atmete sie tief durch und trieb Fála durch einen Schenkeldruck weiter.
Sie war nicht vorbereitet auf das, was sich ihren Augen darbot, und im ersten Moment fühlte sie sich, als würde sämtliche Luft aus ihren Lungen gepresst. Sie erkannte den Toten sofort, trotz seiner grauenvollen Lage und obwohl alles, aber auch alles von Blut nur so triefte: die verkrümmt daliegende Gestalt, der Felsen, auf dem man sie ausgebreitet hatte, sogar das umliegende Gesträuch und der Schnee ringsumher. Der Anblick erinnerte sie an das Schlachten von Schweinen.
Der steifgefrorene Krieger war eindeutig einer Blutrache zum Opfer gefallen. Jemand hatte ihm den Blutaar geritzt: Sein Rücken war vom Kreuzbein bis zum Nacken aufgeschlitzt, die Rippen sorgfältig vom Rückgrat abgetrennt und wie Adlerschwingen auseinandergefaltet worden. Anschließend hatte man die Lungenflügel herausgezogen. Dass der Hingerichtete während dieser grausamen Prozedur noch am Leben gewesen war, bewiesen die abgerissenen Fingernägel; offenbar hatte er versucht, sich zu wehren, während er Qualen erlitt, die sich das erschütterte Mädchen nicht annähernd vorzustellen vermochte.
Es dauerte eine Ewigkeit, bevor Grimhild ihr Zittern unter Kontrolle bekam und den Mut aufbrachte, vom Pferd zu steigen. Der Blutgeruch verursachte ihr Übelkeit, doch sie kämpfte erfolgreich gegen den Wunsch an, sich zu übergeben. Vor dem Leichnam sank sie auf die Knie.
»Vater!«, flüsterte sie erstickt.
Sigfrid kommt
1.
Das Scheppern von Metall auf Metall hallte über das freie Gelände vor den umwehrten Höfen der Niflungen, Kampfgeschrei begleitete jeden Schlag. Hagen, der Waffenmeister, hielt seine täglichen Übungen mit dem zwölfjährigen Gislher, dem jüngsten von Aldrians Söhnen, ab. Die beiden trugen ihre Brünnen, eng anliegende Hemden aus zusammengeketteten Eisenringen, und waren schweißgebadet.
Hagen war ein Krieger, der überall Aufsehen erregt hätte. Niemand würde ihn einen schönen Mann nennen, aber er besaß eine Ausstrahlung, der man sich nicht entziehen konnte. Er überragte die meisten Männer um Haupteslänge, was ihn an und für sich schon zu einer Furcht einflößenden Erscheinung machte, der schwarze Bart, die Narben und die tief hängenden Brauen taten ein Übriges, seine düstere Natur zu unterstreichen. Zudem war er einäugig. Wo sich das linke Auge befunden hatte, gähnte ein Loch. Er sprach nie davon, bei welcher Gelegenheit er das Auge verloren hatte, und wenn man an seinem Leben hing, tat man gut daran, ihn nicht danach zu fragen. Meist verbarg er die unheimliche Höhle unter einer Augenklappe, nur in der Schlacht nahm er die Bedeckung ab, weil er genau wusste, welche Wirkung er damit unter seinen Feinden erzielte. Und Hagen war zu klug, um sich einen Vorteil wie diesen nicht zunutze zu machen.
Das Training dauerte bereits den halben Tag. Trotz seiner Behinderung war Hagen ein guter Lehrer. Es gab keinen besseren Kämpfer weit und breit. Endlos probte er mit Gislher das Parieren eines bestimmten Hiebes und den darauf folgenden Gegenangriff, bis die Muskeln des Jungen die Kombination derart verinnerlicht hatten, dass sie von selbst reagierten. Die Übungen wurden mit der Spatha abgehalten, einem zweischneidigen Langschwert, das links getragen wurde. Es waren stumpfe Waffen, natürlich, doch auch so schmerzte ein Treffer noch genug, zumal Hagen seinen Schüler nicht schonte und die Schläge mit aller Kraft führte.
Wie gewöhnlich beendete der Waffenmeister seinen Unterricht mit einem Scheinkampf. »Wir nehmen das Sax und den Schild«, entschied er. Das Breitsax mit der kurzen Griffangel war eine Mehrzweckwaffe, sowohl für den Hieb als auch zum Zustoßen geeignet.
Ohne besondere Aufforderung zog Gislher seine Brünne aus und legte Helm und Beinschienen beiseite. »Beweglichkeit ist alles in einem Kampf«, pflegte Hagen zu sagen. »Wenn du dich mit einer Brünne schützt, bedeutet das, dass du dir nicht vertraust. Das ist so gut, als würdest du dich von vornherein für verloren geben.«
Die nackten Oberkörper der Kontrahenten glänzten in der Sonne, als sie sich gegenseitig belauerten. Wie Hagen es ihm beigebracht hatte, beobachtete der Junge seinen Lehrmeister auf der Suche nach einer Blöße. Er war fest entschlossen, ihn diesmal zu besiegen. Seit den Tagen, da er als Kind mit Stockfechten auf den Schwertkampf vorbereitet wurde, träumte er davon. Er bewunderte den Waffenmeister; ihm im Kampf überlegen zu sein, schien Gislher das erstrebenswerteste Ziel auf der Welt.
Hagen stand breitbeinig, die Füße leicht auswärts gestellt. Seine Arme hingen entspannt an ihm herab, die rechte Hand umfasste locker den Griff des Schwertes, dessen Spitze auf den Boden zeigte. Sein gesundes Auge war eher beiläufig auf seinen Gegner gerichtet. Alles in allem bot er ein Bild der Selbstversunkenheit, doch Gislher ließ sich nicht täuschen. Er bemühte sich, es seinem Lehrer nachzutun und eine selbstbewusste Haltung einzunehmen, war dabei allerdings nicht sehr erfolgreich. Mehrmals zuckten seine Muskeln, weil das unerwartete Brüllen eines Ochsen ihn erschreckte oder ein Windstoß durch Hagens Haare fuhr und ihm Bewegung vorgaukelte, wo keine war.
»Du hast alles vergessen, was ich dich gelehrt habe«, sagte Hagen verdrossen.
Gislher spürte, wie er rot wurde. »Was meinst du?«, fragte er, obwohl er die Antwort kannte.
»Du zappelst herum wie ein neugeborener Säugling. Dies ist kein Spiel. Konzentriere dich!«
»Ich bin konzentriert.«
Hagen beachtete seinen Einwand nicht. »Du hast den Kontakt zu deinem megin verloren.«
Beschämt senkte Gislher den Kopf. Natürlich hatte sein Lehrmeister recht. Und wenn er im nächsten Jahr auf dem Thing als freier Mann und Krieger in den Kreis der Sippe aufgenommen werden wollte, tat er besser daran, auf ihn zu hören. Der Junge atmete tief durch und bemühte sich, die Anspannung loszulassen. Nach und nach lockerten sich seine Muskeln, der Druck in seinem Bauch ließ nach. Schließlich konnte er es wieder spüren, sein megin, die Kraft, die aus der Essenz seiner Seele gespeist wurde. Jetzt war er bereit.
Unvermutet stürmte er vor und zielte auf Hagens Kopf. Der Waffenmeister blockte den Hieb mit einer sparsamen Bewegung ab, ohne seinerseits anzugreifen. Gislher trat nach dem ungeschützten Unterleib seines Lehrers, doch der stand längst an einer anderen Stelle, reglos, als habe er sich nicht gerührt. Er unternahm keinen Versuch, mit dem Schwert nach Gislhers Bein zu schlagen, aber der Niflunge wusste auch so, dass der Waffenmeister es gekonnt hätte. Hagens scheinbare Schutzlosigkeit hatte ihn verleitet, die Deckung aufzugeben. Es ärgerte Gislher, dass seine Reaktionen so vorhersehbar waren. Verbissen drang er auf seinen Lehrer ein und traf doch immer nur dessen Schild. Das war das Frustrierendste an einem Kampf mit Hagen: dass dieser seine wütenden Attacken mit spielerischer Leichtigkeit parierte. Es schien ihn nicht einmal außer Atem zu bringen. Wo Gislher mit dem Eifer eines Knaben auf ihn eindrosch, konterte Hagen mit der Kunst eines Schwertmeisters.
Keuchend hielt der Niflunge inne und rang nach Atem. Das war der Moment, auf den Hagen gewartet hatte. Wie ein Gewitter kam er über den Jungen und hieb von links und rechts auf ihn ein. Gislher taumelte rückwärts und konnte die Schläge gerade noch mit seinem Schild abfangen, zu einem Gegenangriff sah er sich außerstande. Die Hiebe fielen so schnell, so hart und so präzise, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als immer weiter zurückzuweichen. Der Waffenmeister trieb ihn vor sich her wie ein Kaninchen. Gislhers linkes Handgelenk, das den hölzernen Rundschild hielt und die Wucht des Angriffs auffangen musste, schmerzte; jeden Stoß spürte er bis in die Schulter.
Unvermittelt blieb Hagen stehen und gab Gislher, der noch zwei, drei Schritte weiter taumelte, Gelegenheit, sich wieder zu fangen. Das Gesicht des Jungen lief dunkelrot an. Er fühlte sich gedemütigt. Zornig sprang er nach rechts und hieb nach seinem Lehrer. Es war der plumpe Versuch, Vorteil aus Hagens Einäugigkeit zu ziehen und ihn aus der Deckung seines blinden Flecks heraus zu besiegen. Gislher versuchte es nicht zum ersten Mal, und wie gewöhnlich funktionierte es nicht. Hagen war ein viel zu guter Kämpfer, um sich nicht über seine eigenen Schwächen im Klaren zu sein. Er hatte lange trainiert, um sein fehlendes räumliches Wahrnehmungsvermögen durch Instinkt zu ersetzen und einen Angriff von links blind abzuwehren.
Stahl traf auf Stahl. Blitzschnell packte der Waffenmeister Gislhers Schwerthand. »Tu niemals in einem Kampf das Offensichtliche«, sagte er. »Dein Gegner rechnet damit.« Er ließ den Jungen los, und als dieser das Schwert hob, um noch einmal zuzuschlagen, rammte er ihm den Schild in den Magen.
Gislher ging in die Knie und würgte. Als es ihm gelang, sich wieder zu erheben, war er wütend. »Ein Schild ist zum Verteidigen da«, grollte er, »nicht zum Angriff.«
»Willst du überleben? Dann solltest du dich nicht von eingefahrenen Verhaltensweisen beherrschen lassen. Wenn du auf einen unterlegenen Mann triffst, genügt Erfahrung, im Kampf gegen einen Schwertmeister liegt deine einzige Hoffnung in der Überraschung.«
Das Tor des Wehrzauns, der die Häuser der Niflungen umschloss, öffnete sich. Gunter kam heraus. Er hatte die Schwertschläge vernommen und wollte in Erfahrung bringen, welche Fortschritte Gislher machte. Aus den Augenwinkeln musterte er Gernholt, seinen anderen Bruder, der gegen die Pfahlwand lehnte und Hagens Technik studierte. Gernholt hatte offenbar einen guten Tag erwischt, sein Gesicht zeigte Farbe, und er nahm seine Umwelt mit wachem Interesse wahr. »Wie macht er sich?«, fragte Gunter, während er sich neben ihm niederließ.
»Das Übliche. Er kämpft kraftvoll und mutig, aber er ist zu ungeduldig und vernachlässigt die Verteidigung.«
Gislher hatte einen schweren Stand gegen seinen Lehrmeister; das frustrierte ihn und machte ihn wütend, wodurch er seine Schläge immer unpräziser ausführte.
»Konzentriere dich!«, befahl Hagen und hieb nach der Hüfte des Jungen. Gislher schützte sich mit dem Schild und schlug seinerseits zu. Mühelos blockte der Waffenmeister den Schlag ab und zielte erneut auf die Hüfte. Unmerklich zwang er seinem Gegner einen Rhythmus auf: Schlagen – Senken des Schildes – Schlagen. »Denk an meine Worte«, sagte er, »eingefahrene Verhaltensweisen sind dein Tod.«
Erst als sein Lehrer das Schwert nach oben riss, als wolle er ihm den Schädel spalten, während er selbst seinen Schild wieder gesenkt hatte, begriff Gislher, worauf der Waffenmeister hinauswollte. Verzweifelt riss er den Schild nach oben, um den Hieb abzufangen. Seine Bewegung war von Panik diktiert, deshalb nahm er sich für den Bruchteil eines Herzschlages die Sicht. Als er seinen Fehler erkannte, als ihm klar wurde, dass Hagen, der listenreiche Taktiker, eine Finte in einer Finte versteckt hatte, war es zu spät. Hagens Schwert beschrieb eine Kurve und bremste knapp vor dem ungeschützten Bauch des Jungen. »Lass dir niemals von einem Feind eine Kampfweise aufzwingen!«
Gislher gab sich geschlagen. »So gut wie du werde ich nie im Leben«, sagte er. »Vielleicht sollte ich lieber Felder bestellen.«
»Ein solcher Gedanke ist deiner unwürdig.«
»Ach, Hagen, sei nicht immer so ernst! Es war doch bloß ein Scherz.«
Sie steckten die Schwerter ein und gingen zu den Zuschauern hinüber.
»Gut gemacht, alter Kämpe!« Gunter gab dem Waffenmeister einen freundschaftlichen Hieb auf die Schulter. »Und du wirst auch immer besser, Gislher.«
Wie Aldrians Söhne so beieinander standen, wurde ihre Verschiedenartigkeit deutlich. Die drei Brüder hätten ungleicher nicht sein können. Gislher war von heiterer, ungestümer Natur, und seine Hände und Füße standen keinen Augenblick still. Gunter war das genaue Gegenteil, nachdenklich, zögernd. Trotz der kräftigen Statur verlieh ihm sein grüblerisches Wesen eine Unscheinbarkeit, die so gar nicht der Vorstellung entsprach, die man sich von einem König machte. Gernholt passte überhaupt nicht zwischen die beiden, nicht nur, weil sein kurz geschnittenes Haar, die Bartlosigkeit und die Form seiner Nase ihm ein römisches Aussehen verliehen, was er noch dadurch unterstrich, dass er sich bevorzugt in tunikaartige Hemdröcke kleidete, sondern mehr noch durch sein abweisendes Verhalten.
Gernholt war vierzehn gewesen, als er verkrüppelt wurde. Bei einem der Kämpfe um den Besitz von Niflungenland hatte er seinen Schwertarm verloren und zu allem Unglück auch noch eine Verletzung am linken Bein davongetragen. Seitdem hinkte er. Mit eisernem Willen hatte er gelernt, das Schwert mit der linken Hand zu führen, aber das war doppelt schwer, wenn einen das Bein, das dabei das meiste Gewicht tragen musste, im Stich ließ. Die Verkrüppelung hatte ihn launisch gemacht. Man konnte nie vorhersagen, in welcher Stimmung er sich gerade befand. Die meisten Menschen gingen ihm deshalb aus dem Weg, was ihm durchaus recht war. Es gab Zeiten, da konnte er keine Gesellschaft ertragen. Am allerwenigsten die eigene.
Die Auswertung der Waffenübung wurde durch die Ankunft zweier Reiter unterbrochen, die langsam über die Viehweide geritten kamen. Anführer schien ein kaum achtzehnjähriger Jüngling zu sein, der einen auffälligen Fuchsschecken ritt. Auf den ersten Blick konnte man sehen, dass er großes Heil besaß. Alles an ihm drückte Selbstbewusstsein aus, das Selbstbewusstsein eines Mannes, dem nichts fehlschlug. Sein untersetzter Begleiter machte den Eindruck, dass er den Annehmlichkeiten des Lebens nicht abgeneigt war, doch die niemals stillstehenden Augen legten ein beredtes Zeugnis seiner Wachsamkeit ab.
Vor den Niflungen zügelten die Reiter ihre Pferde und sprangen ab. Sie waren staubig von der Reise, aber gut gekleidet. Der Blonde hob den Arm zu einem Gruß. »År ok friðr!«, sagte er mit nordischem Akzent. »Jungherr Sigfrid von Tarlungenland und sein Gefolgsmann Eckewart bitten um Eure Gastfreundschaft.«
Die Brüder sahen sich an, nur Hagen hatte sich so weit unter Kontrolle, dass bis auf ein Zucken seiner Wangenmuskeln nichts die Gefühle verriet, die der Name in ihm hervorrief. Natürlich kannten sie den Sachsen. Die Geschichte von seinem Kampf mit dem Drachen war Gesprächsstoff von Wilzenland bis Hesbanien, von der Heimat der Nordmänner bis zu den Überresten des Römischen Reiches. Neugierig musterten sie den Mann, dessen Taten sie so oft in den Liedern der Skopen gehört hatten.
Sigfrids Haut war dunkel und verhornt, aber sein Gemüt so sonnig wie das blond gelockte Haar, das ihm in den Nacken fiel. Er trug ein weißes Leinenhemd und Hosen, die an den Waden mit Lederriemen umwickelt waren. An seinem Gürtel hing ein zweischneidiges Langschwert, vermutlich das viel besungene Mimung. Obwohl sein Körper durchtrainiert und in zahllosen Schlachten gestählt war, fehlte ihm die ständige Alarmbereitschaft, die kampferprobten Kriegern eigen war. Das hervorstechendste Merkmal war jedoch sein gewinnendes Lachen. Es fiel schwer, ihn nicht auf Anhieb zu mögen.
Die Sachsen ihrerseits nahmen unterdessen die Niflungen in Augenschein. Eckewarts Aufmerksamkeit galt vor allem dem Einäugigen. Ob es zutraf, was man sich erzählte? Dass der Waffenmeister zur Hälfte ein Schwarzalbe war? Er hätte ihn gern danach gefragt, aber ein Blick in das grimmige Gesicht belehrte ihn, dass es vermutlich gesünder war, dies zu unterlassen.
Hagen konnte die Gedanken des Dicken lesen wie das Runen-Futhark und spürte, wie sich der altbekannte Zorn in seinem Magen sammelte. Stellt die Frage, schrie es in ihm, und ich werde sie Euch mit meinem Schwert beantworten! Aber der Sachse schien zu spüren, was gut für ihn war, und wandte den Blick ab.
Gunter hieß die Gäste willkommen und führte sie in das Innere des Wehrzauns.
Das ehemalige Kastell Tolbiacum war den Bedürfnissen der Rheinfranken angepasst worden. Beackerte Felder und Viehweiden breiteten sich innerhalb der Festungsmauern aus, das impluvium eines Hauses, das einst einem reichen Bürger Roms gehört hatte, diente nun als Viehtränke. Von der Pracht römischer Baukunst war nicht viel geblieben, obwohl König Aldrian sich Mühe gegeben hatte, einige Ruinen instand zu setzen.
Sigfrid war beeindruckt, dass die Niflungen in steinernen Häusern wohnten, aber es kam ihm auch unnatürlich vor. Im Stein zu leben war etwas für Wölfe und Schwarzalben. Der Ort selbst allerdings war gut gewählt. Mit dem Blick des Kriegers hatte Sigfrid schon während sie sich Tolbiacum näherten die strategisch günstige Lage des vicus im Kreuzungspunkt der alten römischen Fernstraßen erkannt. Und nicht nur der taktische Aspekt kennzeichnete die kluge Wahl, auch die Fruchtbarkeit des Bodens war nicht zu übersehen. Die Macht der Erde war stark im Land der Niflungen.
Ivo, der Stallbursche, kam herbeigeeilt und nahm die Pferde in seine Obhut. Er war ein schmutziger Junge mit vorstehenden Zähnen, aber es gab niemanden weit und breit, der größeres Heil im Umgang mit Tieren besaß. Die Pferde schienen es zu spüren und ließen sich willig von ihm in den Stall führen.
Gislher, der Sigfrid bislang nur in stummer Verehrung angestarrt hatte, konnte sich nicht länger bezähmen. »Ist das das berühmte Schwert?«, fragte er, auf Mimung deutend.
»Ja. Mimes Meisterschwert. Wollt Ihr es sehen?« Ohne eine Antwort abzuwarten legte Sigfrid die Hand um den goldverzierten Griff. »Geben kann ich es Euch nicht, denn es hat ein eigensinniges Wesen, das durch keinen Zauber gebannt wurde. Aber sehen sollt Ihr es.« Mit einem Ruck zog er das Schwert aus der Scheide.
Wie immer spürte er die gewaltige Macht, die es durchströmte, zusammen mit der Auflehnung gegen seinen Besitzer. Mimung hatte einen unersättlichen Hunger nach Blut und konnte nicht unterworfen werden. Es war leichtsinnig von ihm, das Schwert grundlos herauszufordern, aber es bereitete ihm jedes Mal Vergnügen, sich mit der Klinge zu messen. Ihr Singen und Funkeln war von atemberaubender Schönheit und suchte ihren Herrn in seinen Bann zu ziehen, um ihn zum Töten zu verleiten. Es war ein Kampf Wille gegen Wille, und es brauchte Sigfrids ganze Kraft, um Mimung im Zaum zu halten. Gewaltsam zwang er das protestierende Schwert in die Scheide zurück.
»Was für eine Waffe!«, hauchte Gislher.
Hagen war den anderen gefolgt, nachdem er die Übungsschwerter eingesammelt und sein Wolfsfell umgelegt hatte, das ihn als Auserwählten kennzeichnete, als Krieger des Kampfbundes im Zeichen des Wolfes. Er trug es nicht aus Eitelkeit, sondern als Mahnung an sich selbst. Es gehörte zu seinem Leben vor König Aldrian, zu einem Leben, an das er nur mit Schaudern zurückdachte. Der Pelz erinnerte ihn beständig daran, wie nahe er daran gewesen war, ein Neiding zu werden, und dass seine Dankesschuld an die Niflungen nicht hoch genug anzusetzen war.
Scheu deutete Sigfrid auf das Fell. »Ihr habt Wodans Kampfekstase über Euch kommen lassen?«
Hagen nickte gleichgültig.
»Wenige haben den Mut dazu. Ich würde fürchten, mich in der Großen Dunkelheit zu verirren und den Weg zurück nicht mehr zu finden. Habt Ihr Euer Auge in einem Berserkerkampf verloren? Oder hat das etwas mit Eurer albischen Vergangenheit zu tun?«
Die Niflungen erstarrten zu Salzsäulen. Sie konnten nicht fassen, dass jemand die Kühnheit besaß, Hagen direkt nach einer so intimen Sache zu fragen. Selbst Eckewart, der die unbekümmerte Art seines Herrn gewohnt war, zuckte zusammen.
Hagens erster Impuls war, zum Schwert zu greifen, aber er bezähmte sein heißes Blut und zwang sich zur Ruhe. Sigfrid war Gunters Gast. Außerdem hatte keine Verachtung in den Worten des Sachsen gelegen. Er war einfach ein dummer Junge, der den Mund aufmachte, ohne nachzudenken. »Das geht Euch nichts an«, erwiderte der Waffenmeister schroff.
»Habe ich Euch beleidigt? Tut mir leid. Vermutlich seid Ihr der Meinung, man sollte meinen vorlauten Mund stopfen.« Sigfrid lachte. »Mein Vater würde Euch zustimmen. Ich glaube, dies war auch sein größter Wunsch.«
Selbst auf einen Mann wirkte sein Lachen entwaffnend. Verblüfft entdeckten die Niflungen, wie Hagen, der grimmige, unzugängliche Hagen, mit einem zögernden Lächeln antwortete, das sich auf seinem Gesicht ausbreitete wie Wellen in einem Teich.
2.
Aufgeregt stand Grimhild inmitten eines Haufens verschiedenfarbiger Gewänder und konnte sich für keines davon entscheiden. Beim heutigen Festmahl zu Ehren der Gäste durfte sie, der Tradition der Walküren in Wodans Halle folgend, Wein und Bier reichen und die Krieger bedienen. So etwas kam allzu selten vor, sie begrüßte die Unterbrechung der alltäglichen Langeweile. Selbst die Unfreien freuten sich trotz der zusätzlichen Arbeit, denn Gäste brachten Abwechslung und für gewöhnlich auch interessante Neuigkeiten. Besonders gespannt war Grimhild auf den Mann, dessen Taten so oft von den Skopen besungen wurden. Ob Jungherr Sigfrid der Vorstellung entsprach, die sie sich von ihm machte?
Irmgard, eine Hermionin, in deren Adern noch cheruskisches Blut floss, half ihr wie gewöhnlich beim Ankleiden. Sie war ein blässliches, farbloses Mädchen, aber Grimhild schätzte sie wegen ihrer Zuverlässigkeit und weil sie sich niemals von ihrer Aufgeregtheit anstecken ließ. In der Regel schaffte es Irmgard, sie während der Ankleideprozedur so weit zu beruhigen, dass sie anschließend den Eindruck von Gelassenheit vermitteln konnte.
Endlich hatte Grimhild ihre Wahl getroffen und schlüpfte in ein blaues, durch einen kostbaren Gürtel zusammengehaltenes Leinengewand, dessen Ärmel mit Goldstickereien verziert waren. Zwei silberne Ohrringe, an denen Goldkapseln mit roten und weißen Glaseinlagen hingen, und zwei mit Ornamenten versehene Armringe vervollständigten ihren Schmuck. Sie verzichtete darauf, ihr Haar zu einer kunstvollen Frisur aufzustecken, es zeigte größere Wirkung, wenn sie es auf natürliche Weise herabfallen ließ. Allerdings hieß sie Irmgard, einige farbige Bänder hineinzuwinden.
Prüfend drehte sie sich einmal um sich selbst. In den Augen ihrer Dienerin fand sie die Bestätigung, die sie suchte, und setzte sich befriedigt auf eine Bank, um sich zu färben. Irmgard, die die Vorlieben ihrer Herrin kannte, hatte bereits verschiedene Pulver vorbereitet. Wie gewöhnlich zog Grimhild ihre blonden Brauen mit Stibium nach und betonte auch die Wimpern mit dem schwarzen Pulver. Dann legte sie geriebenen Rötel auf die Wangen. Die Lippen färbte sie meist mit Heidelbeersaft, heute jedoch entschied sie sich für den roten Farbstoff aus der gemahlenen Wurzel des Krapps. Er schmeckte abscheulich. Grimhild verzog das Gesicht und ging zu einer Ablage. Unter Salbentöpfen aus Alabaster und Terrakottafläschchen mit Duftstoffen fand sie, was sie suchte. Dezent betupfte sie Hals und Ohren mit Rosenöl.
Zum Abschluss öffnete sie eine kleine Flasche, die den Saft der Tollkirsche enthielt. In geringen Dosen bewirkte er eine Erweiterung der Pupillen und erweckte so den Eindruck weiblicher Unschuld. Irmgard runzelte die Stirn, sagte aber nichts. Vorsichtig träufelte sich Grimhild ein paar Tropfen der Tinktur in die Augen. Nach einer Weile stellte sich die bekannte Verminderung der Sehschärfe ein. Grimhild blinzelte ein paarmal, bis sie sich an die Wirkung gewöhnt hatte, dann war sie bereit.
Lärm und Gelächter erfüllten die Große Halle. In aller Eile hatten Unfreie den Saal mit Blumen geschmückt und den Fußboden gesäubert, um das herrliche Mosaik besser zur Geltung kommen zu lassen. Die Feiernden saßen auf den Langbänken, abgestuften Erhöhungen entlang der Wände. In der Mitte der nördlichen Langbank befand sich der Hochsitz für den Herrn der Burg, groß genug für zwei Personen. Sollte Gunter sich einmal verheiraten, würde seine Frau mit ihm dort sitzen. Die beiden Gäste durften rechts des Niflungenkönigs Platz nehmen.
Sigfrid, der die kargen Holzhäuser seiner Heimat gewohnt war, bewunderte die kostbaren Wandteppiche und Vorhänge. Auch das Licht in der Halle wurde nicht etwa von gewöhnlichen Kienspänen gespendet, sondern von teuren Talgkerzen und Tonlampen mit in Olivenöl schwimmenden Flachs- und Hanfdochten. Der Sachse hielt es für eine Verschwendung, Lebensmittel für Beleuchtungszwecke zu verwenden, aber er musste zugeben, dass die Lampen eine angenehme Atmosphäre verbreiteten. Das Unglaublichste jedoch war sein stechal. Es war nicht etwa ein gewöhnliches Rinderhorn, sondern bestand aus silberbeschlagenem Glas. Sigfrid hatte Scheu, aus einem solchen Kunstwerk zu trinken.
Das Essen wurde hereingebracht. In aller Eile hatte man an Leckereien zusammengetragen, was sich auftreiben ließ: Wildschweinlenden und Saueuter, gefüllte Gänseeier und Honigkuchen. Dazwischen wurden Schalen mit Quitten, Äpfeln und Pistazien gereicht. Geräuschvoll machten sich die Anwesenden über die Köstlichkeiten her.
Grimhild betrat die Halle mit einer Amphore Wein, und sogleich wandten sich ihr zahllose Augenpaare zu. Die schöne Fränkin bot aber auch einen erfreulichen Anblick und weckte in einem Mann den Wunsch, ihr gefällig zu sein, für keine andere Belohnung als ein Lächeln von ihren Lippen. Nun ja, der eine oder andere mochte eine größere Gunst im Sinn haben. Sie bemerkte es kaum, die Bewunderung der Krieger war für sie ein alltäglicher Vorgang.
»Ah, meine Schwester Grimhild!«, stellte Gunter sie vor.
Die Gäste begrüßten sie ehrerbietig.
»Ich wusste nicht, dass die Franken einen Schatz haben, gegen den der Hort des Stillen Volkes verblasst«, erwiderte Sigfrid höflich.
Grimhild verfluchte die Wirkung der Tollkirsche. Sie erkannte kaum mehr als einen konturlosen, von einem blonden Haarkranz umgebenen Fleck, dabei hätte sie gar zu gern gewusst, wie der Sachse aussah! Jede Regel des Anstands vergessend, beugte sie sich vor, um ihn besser betrachten zu können. Aus dem verschwommenen Fleck tauchte ein herzliches Lachen auf.
»Ihr seht mich an wie eine Walküre, die sich ihr Opfer erwählt.«
Über dem Lachen entdeckte Grimhild jetzt zwei verträumte blaue Augen, in die sie sich unwillkürlich hineingesogen fühlte.
Plötzlich wurde ihr bewusst, wie unhöflich sie war. Mit einem raschen Blick schätzte sie die Entfernung zu den Trinkhörnern, die die Sachsen ihr hinhielten, lenkte die Männer mit ihrem süßesten Lächeln von ihren Händen ab und hoffte, dass sie beim Einschenken nichts verschüttete.
Pflichtschuldig goss Eckewart etwas Wein auf den Boden als Trankopfer für den Hausgeist, ehe er sich selbst einen Schluck gestattete. Das Schicksal meinte es gut mit ihm! Der Tisch bog sich unter der Last der Gerichte, es herrschte eine ausgelassene Stimmung, wie er sie in den Diensten seines neuen Herrn allzu lange entbehren musste, und darüber hinaus zeigten sich hübsche Mädchen bestrebt, die Trinkhörner nicht leer werden zu lassen. Die Franken besaßen eben Lebensart. Ganz anders als die sauertöpfischen Sachsen, die nur Kampf und Tod kannten. Man brauchte bloß an den Jarl von Bertangenland zu denken, seinen früheren Herrn. Er war großzügig gewesen, gewiss, aber auch besessen davon, sich mit anderen im Kampf zu messen. Kämpfen, immer nur kämpfen!
Und Sigfrid war auch nicht besser. Zu Anfang hatte es Eckewart überhaupt nicht behagt, dass sein Gefolgsherr ihn bei jedem Auftrag dem Sachsen als Begleiter mitgab. Mittlerweile hatte er Sigfrid schätzen gelernt, so sehr, dass er den Jarl von Bertangenland dazu gebracht hatte, ihn von seinem Eid zu entbinden, um in Sigfrids Dienste treten zu können, aber zu Anfang … Sigfrid war für seinen Geschmack viel zu unstet und ruhmesdurstig. Aber wenigstens verstand er zu feiern. Deshalb hatte Eckewart schließlich seinen Frieden mit dem Schicksal gemacht und die Zeit zwischen den Festgelagen als Intermezzo betrachtet, das man eben ertragen musste als Preis für die anschließenden Freuden. Zumal er herausfand, dass man in jeder Küche einen zusätzlichen Bissen bekam, wenn man den Unfreien die Geschichte vom Kampf mit dem Drachen erzählte. Dass er nicht dabei gewesen war und die Größe des Lindwurms mit der Anzahl der in Aussicht gestellten Bierbecher wuchs, bereitete ihm keine Magenschmerzen. Half es doch, den Ruhm seines neuen Herrn zu mehren.
Mit dem genossenen Alkohol nahm der Lärm in der Halle zu. Da die Trinkhörner keine Standflächen besaßen, waren die Krieger gezwungen, sie ununterbrochen kreisen zu lassen oder in einem Zug zu leeren, ein Zwang, der manchem gelegen kam. Ansgar, ein großmäuliger, aber allseits geschätzter Gefolgsmann Gunters, war schon jetzt sturzbetrunken. Er lallte ein Lied und grölte nach Volker, dem Skopen, der ebenso unbekümmert vom anderen Ende der Halle zurückbrüllte, dass er zu singen bereit sei, sobald Ansgar sein Gekrächze aufgebe. Die Umsitzenden amüsierten sich über den Schlagabtausch.
Während Grimhild Wein einschenkte und sich hie und da auf ein paar Scherzworte oder eine Unterhaltung einließ, kehrte allmählich ihre Sehschärfe zurück. Immer wieder suchten ihre Augen den blonden Sachsen. Seine Unbeschwertheit hob ihn unter allen Anwesenden hervor. Die meisten Krieger konnten ihre Wachsamkeit auch bei einem Gelage nie vergessen, nicht so Sigfrid. Er genoss den Frohsinn des Augenblicks wie kein zweiter und strahlte eine Entspanntheit aus, die dafür sorgte, dass sich jedermann in seiner Nähe wohlfühlte. Und dann waren da noch seine Augen …
Grimhild hörte ihn über irgendeinen Scherz lachen, laut und unmelodisch, und doch traf sie dieses Lachen mitten ins Zentrum wie ein Albstich. Sie wünschte, er würde hersehen, aber er unterhielt sich angeregt mit Gunter. Warum ließ er nicht von Zeit zu Zeit seine Blicke zu ihr gleiten wie andere Männer? Ob sein Desinteresse nur vorgetäuscht war? Grimhild beschloss, es herauszufinden. »Darf ich Euch Wein nachschenken, frō Sigfrid?«
»Gern. Habt Dank für Eure Güte, frūa!«
Sein sächsischer Akzent gefiel ihr. »Es bereitet mir Freude, Euch zu dienen«, kokettierte sie und atmete tief ein, als sie sich vorbeugte. Sie wusste, welch reizvolles Bild sie damit bot. »Ist der Wein zu Eurer Zufriedenheit?«
»Er ist das Beste, was ich seit langem zu kosten bekam.« Sigfrid dankte ihr artig und wandte sich wieder dem Gespräch mit ihren Brüdern zu.
Sein Betragen war tadellos, es gab nichts daran auszusetzen. Aber es war offenkundig, dass ihm ihre Reize nichts bedeuteten. Warum wirkte ihr Zauber nicht bei ihm?
Volker hatte derweil seine Hände in einer Wasserschale gesäubert, die fünfsaitige lyra mit den geschwungenen Jocharmen ergriffen und zupfte nun ein paar Töne. Eckewart, der auf dem linken Ohr mehr oder weniger taub war, legte den Kopf schräg, um besser zuhören zu können. Die Gespräche verstummten.
»Einst war die Zeit,
da Ymir lebte.
Nicht war Stein noch Wellen
noch Baum und Strauch.
Nicht Grund unten
noch Sterne oben.
Leblose Leere,
und überall Stille.«
So sang der Skop, und seine Stimme erfüllte die Halle. Volker war ein Meister seiner Zunft. Er besaß Wodans Gabe, die Gabe der Dichtkunst. Seine Stimme war weich und voll wie Honig und rührte die Herzen der Zuhörer. Vor ihren Augen und Ohren erstanden Walhall und Hel, Helden und Dämonen. Volker sang von fernen Zeiten, als die Welt aus dem Körper des Riesen Ymir erschaffen wurde, und dann sang er vom Tod des Gottes Balder und von seinem Vater Wodan, der dem Leichnam seines Sohnes eine Rune ins Ohr flüsterte, das Geheimnis aller Geheimnisse.
Lange war es still, als er schließlich endete. »Es liegt Macht in deinen Worten«, brach Gunter das Schweigen. »Du kannst Bilder der Seele heraufbeschwören und tapfere Männer weinen machen.« Er zog einen kostbaren Ring vom Finger und warf ihn dem Skopen zu, der ihn geschickt auffing. »Nimm dies als Lohn für deine Kunst.«
Volker verneigte sich dankbar und schlug einen neuen Ton an. Den Gästen zu Ehren sang er von der Landung der Nordmänner in Haduloha, vom Kampf um den Hafen und der folgenden Zeit des Handels mit den Einheimischen. Seine Stimme veränderte sich mit der Stimmung, die er beschrieb, sie wurde bitter, wenn er von Enttäuschung sang, und schwermütig angesichts eines harten Schicksals, doch immer behielt sie ihre Klarheit. Dann schlich sich ein listiger Tonfall ein, als er erzählte, wie ein Nordmann Goldschmuck an die Einheimischen verteilte im Austausch für etwas Erde, die er in seinem Rockschoß forttrug. Die Zuhörer wurden Zeuge, wie die Nordmänner die getauschte Erde dünn über die Äcker streuten, um dann Anspruch auf das damit bedeckte Land zu erheben, und nickten einander zu. Tiefe Wahrheit lag in Volkers Worten, denn die Einheimischen hatten das Heil und die Seele der Erde fortgegeben. Ja, das war erdmegin, von solcher Macht war die Kraft der Erde!
Sigfrid war den Tränen nahe. Der Gesang des Skopen wühlte ihn auf. Plötzlich meinte er, das Meer zu riechen. Obwohl die Sachsen seit langem sesshaft waren, floss noch immer das Blut von Nordmännern in seinen Adern. So ergriffen war er von Volkers Worten, dass es eine Weile dauerte, bis er entdeckte, dass der Sänger geendet hatte. Bewegt zog er ein edelsteinbesetztes Amulett aus einem Beutel und warf es ihm zu. »Ich will hinter König Gunters Freigebigkeit nicht zurückstehen«, sagte er. »Euer Gesang ist wahrlich eines Königs würdig.«
Volker bedankte sich und beendete seine Darbietung.
Ansgar boxte ihm in die Seite. »Nicht übel für einen Schönling«, grinste er.
Die Unterhaltungen, die während des Vortrags unterbrochen worden waren, setzten wieder ein. Grimhild näherte sich Sigfrid von neuem, um ihm einzuschenken.
»Wollt Ihr mich betrunken machen, frūa?«, lachte er.
Seine Hand streifte ihren Arm, als er ihr das stechal entzog, und ein weiterer Stich traf sie, diesmal in der Lendengegend. Verzweifelt suchte sie nach einer Möglichkeit, eine Unterhaltung mit ihm zu beginnen, doch er hatte sich bereits wieder umgedreht, um sein Gespräch mit Gunter fortzusetzen. Grimhild kochte vor Zorn. Sie war es nicht gewohnt, derart beiläufig behandelt zu werden. Wütend drehte sie sich um und stürmte aus der Halle.
Sigfrid bekam ihren Abgang gar nicht mit. Seine Gedanken waren weder bei ihr noch bei dem, was ihr Bruder ihm gerade erzählte, sondern daheim. Nachdem er den letzten Auftrag seines ehemaligen Gefolgsherrn ausgeführt hatte, war er nun frei, nach Tarlungenland zurückzukehren. Er hatte gelernt, was ein Krieger lernen musste, und sich eigenen Ruhm erworben. Seine Sippe würde ihn mit offenen Armen empfangen. Er konnte es kaum erwarten, mit den Seinen am Feuer beisammenzusitzen, sich am Frieden zu erwärmen und von der Kraft des Sippengefühls zu trinken. Und um Brünhild zu freien, dachte er bei sich, und ein süßer Schmerz schnürte ihm die Brust zu. Die Svawenkönigin war die streitbarste Frau, die er je getroffen hatte, aber ihr nachtdunkles Haar war wie Seide, und in ihren Augen loderte ein Feuer, das jeden Winter fernhielt. Mit ihr zu streiten barg größere Leidenschaft als anderer Leute Liebesgeflüster. Sie war die eine, mit deren Seele er unauflöslich verbunden war.
Über seine Gedanken waren ihm Gunters letzte Worte entgangen. »Was habt Ihr gesagt?«, erkundigte er sich.
»Ich sagte: Warum erholt Ihr Euch nicht eine Weile, ehe Ihr Euch auf die weite Heimreise macht? Ihr seid herzlich eingeladen, Mittsommer mit uns zu feiern.«
Sigfrid wollte Gunter nicht vor den Kopf stoßen, und ihre Pferde konnten Ruhe gebrauchen, deshalb sagte er: »Bis zum Fest können wir nicht bleiben, aber für ein paar Nächte nehmen wir Eure Gastfreundschaft gern an.«
Er konnte nicht ahnen, wie folgenschwer diese Entscheidung sein sollte.
3.
Es war ein herrlicher Morgen. Die Sonne schien in die hintersten Ecken der Räume, als wollte sie alles, was atmete, ins Freie locken. Irmgard blickte sehnsüchtig aus dem Fenster, während sie die Haare ihrer Herrin in einer louga aus Ziegenfett und Buchenasche bleichte. Sie tat diese Arbeit gern, es machte ihr Freude, die Finger durch Grimhilds vollen Haarschopf laufen zu lassen. Ein Lied vor sich hinsummend seifte und spülte sie und massierte dabei die Kopfhaut der Niflunge.
»Hör endlich mit dem Geplärre auf!«, fuhr Grimhild sie an.
Erschrocken verstummte Irmgard. Sie kannte ihre Herrin; wenn sie sich in einer solchen Stimmung befand, benahm man sich tunlichst unauffällig, bis der Sturm vorüber war.
Grimhilds Kopf ruckte hoch. »Lass mich allein! Ich kämme mich lieber selbst, ehe du mit deinen ungeschickten Händen noch alles durcheinanderbringst.« Kaum war die Dienerin fort, bereute Grimhild auch schon ihre Worte. Es war nicht recht, ihre schlechte Laune an Irmgard auszulassen. Das Schuldbewusstsein machte sie noch wütender, sie trat nach einer Truhe. Au! Alles hatte sich heute gegen sie verschworen! Ihr Zeh schmerzte, der Saum ihres Gewandes blieb ständig irgendwo hängen, und der Kamm war nirgends aufzutreiben. Grimhild stieß einen Schrei der Frustration aus. Der Anblick ihrer Mutter, die ungehört hereingekommen war und sie mit einem wissenden Lächeln bedachte, steigerte ihren Zorn ins Unermessliche. »Was willst du?«, fauchte sie.
Oda nahm einen neutralen Gesichtsausdruck an und bemühte sich, nicht zu zeigen, wie sehr die leicht durchschaubaren Gefühle ihrer Tochter sie amüsierten. »Dir helfen, dich herzurichten«, erwiderte sie und ergriff den Kamm, der sich arglistig hinter einer Schale versteckt hatte.
Grimhild biss sich auf die Lippen und schwieg, weil ihr kein Grund einfiel, sich zu widersetzen. Mit zusammengebissenen Zähnen ließ sie zu, dass ihre Mutter sich hinter sie stellte und die nassen Haare entwirrte.
»Ich sah Irmgard aus deinem Zimmer kommen«, sagte Oda. »Sie schien es eilig zu haben.«
»Ich nehme an, sie hat zu arbeiten«, schnappte Grimhild. Die Vögel vor dem Fenster gingen ihr auf die Nerven. Sie sollten endlich still sein und ihre gute Laune für sich behalten!
Oda kannte ihre Tochter gut genug, um zu wissen, dass eine direkte Frage nach der Ursache ihrer schlechten Laune der falsche Weg war, ihr zu helfen. Sie würde sich nur verschließen wie ein trotziges Kind. An der Art, wie Grimhild den Rücken gerade hielt, erkannte die Königin, dass ihre Tochter die Hände zu Fäusten ballte, doch sie hütete sich wohlweislich, das Mitleid, das sie empfand, zu zeigen. »Das war ein schönes Fest gestern, findest du nicht?«, fragte sie stattdessen.
»Sie haben gesoffen wie die Schweine.«
»Ich hatte meinen Spaß. Mir gefällt es, wenn so viele kühne Recken in unserer Halle sitzen.«
»Er hat mich nicht einmal beachtet!«, platzte Grimhild heraus.
»Wer?« Wenn ihre Tochter sich verstellen konnte – Oda war Meisterin in diesem Spiel. Nicht umsonst hatte sie damals Aldrian, der eigentlich um ihre Schwester freien sollte, für sich gewonnen. Die Erinnerung daran schmerzte, aber es war ein süßer Schmerz, dem sie gern nachgab. Als er in jenem Jahr zur Burg ihres Vaters kam, besaß er noch keinen großen Namen, kein Skop sang Lieder von seinen Heldentaten. Doch sie hatte gewusst, was in ihm steckte. Sie wollte ihn. Und sie handelte, ehe er Gelegenheit bekam, die verhängnisvolle Werbung auszusprechen. Ein absichtlich zerbrochener Krug, dessen Scherben aufzusammeln er half, gab ihr die Möglichkeit, ihm nahe zu kommen. Mehr brauchte sie nicht. Wie er sie ansah, als er schließlich um sie freite, als fürchte er, sie könne ablehnen! Ihre Augen wurden feucht bei dem Gedanken. Sie hatte ihre Wahl nie bereut. Aldrian hatte Königsheil besessen und den Kampf außerhalb der Grenzen seines Reiches gehalten. Vor allem aber war er ein wundervoller Gemahl gewesen.
»Sigfrid.«
Oda brauchte einen Moment, um sich zu erinnern, worüber sie gerade sprachen. »Tatsächlich? Das ist mir gar nicht aufgefallen.«
Das war nun eine Spur zu dick aufgetragen. Grimhild sah sie argwöhnisch an und seufzte: »O Mutter! Du weißt genau, wovon ich spreche.«
»Mag sein. Ich sah ein albernes Mädchen, das vor einem fremden Recken herumkokettierte.«
Grimhild brach in Gelächter aus, und ihr mühsam aufrecht erhaltener Schutzwall stürzte zusammen.
Oda fiel nicht in das Lachen ein. »Und einen Krieger, der sich nicht für dieses Mädchen interessierte«, sagte sie ernst.
»Warum hat er mich nicht angesehen? Bin ich nicht schön? Jeder Mann dreht sich nach mir um. Warum er nicht?«
»Dafür kann es viele Gründe geben. Wahrscheinlich ist sein Herz schon vergeben. Schlag ihn dir aus dem Kopf, Kind! Es gibt genug Männer, die deiner würdig sind.«
»Ich will Sigfrid und keinen anderen!«, sagte Grimhild, und erst, als sie es ausgesprochen hatte, wusste sie, dass es die Wahrheit war.
Oda antwortete nicht, sondern fuhr fort, ihr die Haare zu kämmen. Argumente waren hier verschwendet, das wusste sie. Wenn Grimhild sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, konnte nur ragnarök sie daran hindern. Und war es denn so verwunderlich, dass ihre Tochter ihr nachschlug und dem Schicksal auf die Sprünge helfen wollte?
Grimhild ließ sich jetzt willig kämmen. Eine andere Frau. Ja, das war nur allzu wahrscheinlich. Sigfrid sah gut aus, war der Sohn eines reichen Königs und besaß ein gewinnendes Wesen. Sie würde aufpassen müssen, wenn sie erst seine Gemahlin war! Gedankenverloren spielte sie mit einer Strähne ihres Haares. Eine andere Frau. Sie erinnerte sich jetzt an seinen verschleierten Blick und die heimwehkranke Stimme während des Festes. Sie hatte angenommen, er vermisse seine Sippe, aber natürlich … Eine andere Frau. Es machte Sinn.
Thiota fiel ihr ein. Die Seherin konnte mehr als nur die Zukunft aus dem Vogelflug lesen und Runenstäbe werfen. Sicher hatte sie eine Lösung für ihren Kummer. Bestimmt wusste sie, was zu tun war! Grimhild lächelte, schloss die Augen und dachte an Sigfrid. Ja, sie wollte ihn! Und sie würde ihn bekommen!
Vergessen, verlieren
1.
Mit einem Fluch machte Grimhild sich Luft und trieb Fála an. Es war ihr nicht gelungen, vor dem Mittag unbemerkt zu entwischen. Sigfrid wollte am nächsten Morgen abreisen, ihr blieb also nicht mehr viel Zeit, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Wenn sie den Mut dazu aufbrachte.
Ihr war nicht wohl bei dem Gedanken an das, was sie zu tun beabsichtigte, aber noch weniger konnte sie es ertragen, Sigfrid fortreiten zu sehen. Bis zu diesem Sommer hatte sie zwar gelegentlich mit dem Gedanken an einen künftigen Gemahl kokettiert, aber das war ein Spiel gewesen, mehr nicht. Mit ihren sechzehn Jahren konnte sie es sich leisten, noch ein, zwei Sommer zu warten, ehe sie sich ernsthaft mit dieser Frage auseinandersetzte. Und dann war Sigfrid gekommen, und jetzt war alles anders. Zornig dachte sie an den Rat ihrer Mutter, sich mit einem anderen zu begnügen, und hieß den Zorn willkommen, denn er lenkte sie von ihrem schlechten Gewissen ab. Niemals würde sie jemandem erlauben, über ihr Leben zu verfügen, weder dem Schicksal noch ihrer Sippe! Es gab Wege für alles.
Mit einem Ruck zügelte Grimhild ihre Stute.
Wie hatte sie nur so in Gedanken sein können! Vor ihr befand sich jenes Gebüsch, dem sie die schlimmste Erfahrung ihres Lebens verdankte. Lähmung erfasste sie, wie jedes Mal, wenn sie sich der Stelle näherte, an der sie vor gut fünf Jahren ihren Vater gefunden hatte. Ein böser Zauber ging davon aus, die dunkle Aura einer Neidingstat. Grimhild unterdrückte die Übelkeit, die in ihr aufsteigen wollte, wandte den Kopf ab und trieb Fála mit einem Schenkeldruck weiter. Die Stute schnaubte, gehorchte aber. Grimhild ließ Fála kräftig ausholen, um so viel Distanz wie möglich zwischen sich und das Gebüsch zu bringen, und wurde erst ruhiger, als der Ort der Bluttat hinter einem Hügel verschwand.
Vor der Hütte der Seherin sprang sie von ihrem Pferd und zögerte, plötzlich unsicher. Tat sie wirklich das Richtige? Bisher hatte sie Thiota nur um harmlose Dinge gebeten, Fragen nach der Zukunft gestellt, nach ihrem künftigen Mann, nach Kindern, Mädchenfragen eben. Dies war etwas anderes. Zum ersten Mal wollte sie sich der Hilfe der Seherin bedienen, um in den Ablauf des Schicksals einzugreifen. Sie wünschte, Frija würde ihr ein Zeichen schicken, ob das Vorhaben ihre Gunst fand. Aber wann hatten die Götter sich je eindeutig geäußert? Nein, sie würde die schwierige Entscheidung allein treffen müssen. Ein Echo von Sigfrids Lachen hallte durch ihren Kopf, und es war ihr Körper, der die Entscheidung traf, nicht ihr Verstand. Grimhild holte Luft und trat ein.
Die Hütte war schmutzig, doch stärker noch als die fauligen Gerüche und der Anblick von Nachlässigkeit war der Eindruck von Macht. Etwas Ungreifbares beseelte den Raum, eine Spannung, das Echo gewaltiger Kräfte.
Als sich ihre Augen an das Halbdunkel gewöhnt hatten, entdeckte sie Thiotas runzlige Gestalt. Sie trug die typische Kleidung einer Seherin, einen zerschlissenen Leibrock aus Schaffell, darüber einen speckigen, ehemals blauen Mantel. Offenbar war sie im Wald gewesen, um Kräuter zu sammeln, denn in ihrem Mantel hatten sich die Widerhaken von Häkelfrüchten verfangen. Grimhild erkannte Kletten und Nelkenwurz und wunderte sich, weshalb ihr Verstand sich mit solchen Nebensächlichkeiten beschäftigte, bis ihr aufging, dass sie sich davor fürchtete, Thiota in die Augen zu sehen.
»Grimhild.«
Ihr Name aus dem zahnlosen Mund der Seherin war Feststellung, Begrüßung und Frage zugleich. Vielleicht auch eine Drohung. Auf dem Weg hierher war Grimhild die selbstbewusste Königstochter einer starken Sippe gewesen, mit Betreten der Hütte hatte sie sich wieder in ein kleines Mädchen verwandelt. »Wodan sei mit dir, Thiota!«, gab sie eingeschüchtert zurück.
Die alte Frau bedeutete ihr, Platz zu nehmen. Da es, abgesehen von dem hölzernen Hochstuhl für die Zukunftsschau, keine Möbel gab, setzte Grimhild sich auf eines der Schaffelle. Thiota ließ sich ebenfalls nieder. Sie sprach kein Wort, wartete einfach ab und sah sie dabei unentwegt an, als wolle sie auf den Grund ihrer Seele blicken, bis Grimhild, um dieser Tortur ein Ende zu bereiten, herausplatzte: »Ich brauche einen Zauber.«
Die Schweigsamkeit der Seherin ärgerte sie. Die ganze Zeit über hatte sie das Gefühl, sich verteidigen zu müssen. Bei ihrem Aufbruch hatte sie sich vorgenommen, Thiotas Fragen ausweichend zu beantworten und nichts preiszugeben, was ihr zum Nachteil gereichen konnte, da die alte Frau aber keine Fragen stellte, sondern sie nur ansah, sprangen die Worte von selbst aus ihrem Mund: »Wir haben einen Krieger zu Gast, und … und … ich will ihn.«
Thiota sagte immer noch nichts. Unbarmherzig hielt sie ihren stechenden Blick auf sie gerichtet, bis Grimhild die Augen niederschlug. Das Schweigen der Seherin enthielt die Gewissheit, dass die Niflunge über kurz oder lang die albernen Versuche aufgeben würde, etwas vor ihr zu verbergen.
»Er liebt eine andere Frau«, sagte Grimhild leise. »Glaube ich.«
»Einen Trank, der ihn in dich verliebt und die andere vergessen macht – ist es das, was du von mir willst?«
Grimhild nickte beklommen, über ihren eigenen Mut erschrocken. Bis eben war alles nur ein Hirngespinst gewesen, eine Möglichkeit. Indem sie ihren Wunsch aussprach, verwandelte sie diese Möglichkeit in Wirklichkeit. Die Macht der Worte war groß, niemand konnte sie zurücknehmen. Für einen flüchtigen Augenblick fragte sie sich, ob sie nicht dabei war, einen Fehler zu begehen, aber sie wischte diesen Gedanken beiseite.
»Du weißt, was du tust.«
Wie konnte ein Satz, der als Feststellung ausgesprochen wurde, ihr derart das Gefühl vermitteln, dass ihre Urteilsfähigkeit in Zweifel gezogen wurde? Grimhild bemühte sich um Festigkeit in ihrer Stimme. »Ja.« Und um der Alten zu beweisen, dass sie imstande war, die Konsequenzen zu übersehen, zählte sie auf: »Ich nehme Einfluss auf einen Menschen. Ich zerreiße ein vorhandenes Muster. Ich verändere das Schicksal.«
»Du spielst ein Spiel mit hohem Einsatz. Aber das Gewebe der Nornen veränderst du nicht. Du wirst tun, was gewebt ist.« Thiotas Augen waren abwesend, als bereite sie in Gedanken bereits den Trank zu, doch dann heftete sich ihr Blick wieder auf ihre Besucherin. »Bedenke deinen Wunsch! Es liegt kein Heil darin, die Zukunft beherrschen zu wollen.«
Gereizt zog Grimhild die Nase kraus. Dies waren die üblichen Ermahnungen, die jeder meinte, ihr gegenüber vorbringen zu müssen. Wann begriffen die Menschen endlich, dass sie erwachsen war und für sich selbst entscheiden konnte?
Thiota beugte sich vor und zwang sie, ihrem Blick standzuhalten. »Gebrochene Versprechen«, sagte sie und bohrte ihren Zeigefinger unterhalb des Schlüsselbeins in die Haut der jungen Frau. »Gebrochene Versprechen leugnen, was war, leugnen, was sein wird. Gebrochene Versprechen besitzen einen starken Zauber. Gebrochene Versprechen sind voller Leid.«
»Es ist mir egal, was war!«, stieß Grimhild trotzig hervor. »Ich will ihn! Ich will, dass er mich liebt!«
Die Seherin beugte sich der Macht ihrer Leidenschaft. »Du hast entschieden«, sagte sie.
Verspätet begriff Grimhild, dass die Abmachung zwischen ihnen damit besiegelt war. Aufgeregt öffnete sie den Lederbeutel, den sie bei sich trug, und entnahm ihm etwas Bruchsilber. Sie wusste, dass Thiota diese Art der Bezahlung römischen Münzen vorzog. Alles, was von den Römern kam, hielt sie für eine gefährliche Abkehr von den alten Pfaden.
Die Alte strich den Lohn ein und machte sich an die Arbeit. »Amnesia«, murmelte sie geistesabwesend, öffnete Tongefäße und schnupperte an Kräutern. Gemeinsam mit Wurzeln, Samen und Pflanzenfasern wanderten diese in eine Tonschale. Nachdem die Seherin die Zutaten zerstoßen hatte, rührte sie das entstandene Pulver in einen Kessel mit Wasser ein und hängte ihn über das Feuer. Anschließend verschwand sie nach draußen. Als sie zurückkehrte, hielt sie einen blühenden Buchenzweig in der Hand. Geschickt entfernte sie die Blüten und schnitt den Ast in gleich lange Holzstäbchen, die sie in den Himmel hielt, um Wodan, den Herrn der Runen, um Beistand anzurufen.
»Neun Nächte hingst du,
o Runenmeister,
am windigen Baume
in Yggdrasils Ästen,
dir selbst geweiht,
geritzt mit dem Speer,
blutend, wartend.
Groß war dein Opfer.
Du neigtest dich nieder
und hobst unter Qualen
die heilhaften Stäbe,
die mächtigen Runen.
Sie raunten dir zu
verborg’nes Geheimnis.
Raune mit mir,
o Raterfürst!«
Thiota nahm das Messer, mit dem sie den Zweig unterteilt hatte, und ritzte fehu, die Rune für Reichtum und Glück, in das weiche Holz, gebō, die Rune für Freundschaft und Gunst, und jēra, die Rune der guten Ernte. Nach kurzer Überlegung fügte sie noch berkō, die Fruchtbarkeit verheißende Birkenrune hinzu.
»Runen sind magisch,
Runen sind Macht.
Heilhafte Hölzer,
zeitlos geritzt
auf die Pfote des Wolfs,
auf die Schwinge des Raben,
auf die Zunge der Schlange,
auf die Spitze des Speeres,
in die Schwelle des Hauses,
in Feuer und Fels, in Wasser und Wind«,
murmelte sie halblaut dabei. Das Wort laukaR würde ihr Werk gedeihen lassen, das Wort alu ihm Schutz verleihen. Aber wie leicht konnte jemand, der etwas von Runenmagie verstand, den Zauber erkennen und verändern! Deshalb war es unumgänglich, die Worte zu verrätseln. Thiota verkürzte laukaR zu einem l und verdrehte alu zu lua. Die Runen hatte sie bereits als Binderunen verschlüsselt, indem sie gebō und jēra übereinander ritzte und fehu und berkō einen gemeinsamen Stab gab.
So plötzlich, dass Grimhild zusammenzuckte, waren die Augen der Seherin auf sie gerichtet. »Hast du, was für einen Liebeszauber nötig ist?«
Die Niflunge wurde rot und nickte. So viel wusste jeder von Liebestränken, dass es gewisse Zutaten gab, die unentbehrlich waren. Sie öffnete ihren Lederbeutel und entnahm ihm ein Tuch mit getrocknetem Monatsblut.
Thiota löste die Substanz mit warmem Wasser an. »Wenn dein Blut mit seinem gemischt ist, seid ihr für immer aneinander gebunden.« Ein paar Tropfen der roten Flüssigkeit ließ sie in den Sud fallen, mit dem Rest tränkte sie die Runen, Frija um Beistand anrufend. Während das Blut trocknete, wandte sie sich wieder dem Kessel zu. Der Sud war kurz vor dem Sieden. Auf dem Hochstuhl lag ein Eibenstab, den die Seherin nun holte, um damit den Kessel zu berühren, gleichzeitig stimmte sie einen leisen Gesang an. Gesang verstärkte die Zauberkraft des Wortes, das wusste jeder. Bestimmte Regeln waren dabei einzuhalten, damit die Worte ein Muster ergaben und sich nicht gegenseitig aufhoben. In Trance nahm die alte Frau eine Handvoll geweihter Erde, die sie von draußen mitgebracht hatte.
Eine Gänsehaut bildete sich auf Grimhilds Arm. Thiota wollte dem Trank erdmegin beimischen! Plötzlich fürchtete sich die Niflunge. Waren die Mächte, die sie zu ihrer Unterstützung herbeirief, nicht zu groß, um kontrolliert zu werden?
Thiota fühlte den Strom schwerer Energie von der dunklen, nach Moos und Farn riechenden Erde durch ihre Finger fließen. Ihre Hände kribbelten. Vorsichtig ließ sie ein paar Krümel in den Trank fallen und hauchte:
»Erde, Erde,
Kristallgebärende,
Fruchtbare, Nährende,
Reifende, Sprießende,
Flur oder Grünende
– bei jedem Namen
rufe ich dich!«
Thiotas Gesicht war angespannt. Ihr durfte kein Fehler unterlaufen. Ein Wort verfügte über die Kraft, das Gesagte zu erschaffen, ein Versprecher konnte unvorstellbare Folgen haben. Sie hob die mit Runen versehenen Holzstäbchen auf und ergriff das Messer. Dies war der entscheidende Augenblick. Schrift fixierte den Zauber und machte ihn dadurch mächtiger. Schriftmagie war stärker als Wortmagie, weil sie den Zauber dauerhaft band. Immer noch singend schabte Thiota die Runen ab und ließ die Späne in den Trank fallen.
»Vergessen, verlieren,
die Frau, die du liebst,
der Treue du schworst.
Ihr Antlitz verblasst,
trinkst du die Runen.
Verändern, verwandeln
soll sich dein Sinn.
Nicht schlafen sollst du
vor Sehnsucht nach dieser,
der herrlichen Jungfrau.
Verlangen, verfallen,
gefesselt dein Herz.
Trinkst du die Runen,
wirst nimmer begehren
du Freiheit von ihr.«
Thiota fühlte sich schwindlig, wie immer, wenn sie starke Magie benutzte. Vor ihren Augen tanzten farbige Kreise, und sie hörte Geräusche, die nicht wirklich da waren: Rauschen, Klingeln, dumpfes Pochen. Ein scharfer Geruch erfüllte ihre Nase. Außerdem plagten sie Kopfschmerzen. Es wurde höchste Zeit, die Trance zu beenden. Kontrolliert ließ sie die Spannung entweichen. Einen Augenblick lang musste sie die Augen schließen, bis die Welt aufgehört hatte, sich zu drehen.
»Ist es fertig?«, fragte Grimhild unsicher.