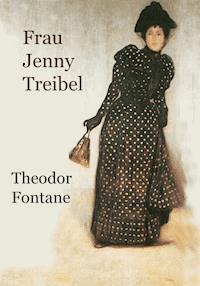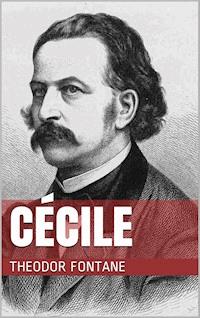4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Fontanes persönlichstes Buch, die Schilderung seiner Gefangenschaft im Deutsch-Französischen Krieg. Verhaftet als vermeintlicher preußischer Spion. Im September 1870 reist Theodor Fontane nach Frankreich, um für sein Buch über den Deutsch-Französischen Krieg zu recherchieren. Am 5. Oktober wird er »zu Füßen der Jungfrau«, das heißt am Jeanne-d'Arc-Denkmal in Domrémy, verhaftet. Die Situation ist gefährlich: Dem Schriftsteller droht standrechtliche Erschießung. Schließlich wird er zwei Monate inhaftiert, zuletzt auf der Atlantikinsel Oléron. Hier entsteht, unter dem Eindruck des unmittelbar Erlebten, eines seiner schönsten und persönlichsten Prosawerke. Seine Überzeugung, dass hinterm Berge auch Leute wohnen, kann er selbst in dieser extremen Lage demonstrieren. »Theodor Fontane ist der wichtigste deutsche Romancier zwischen Goethe und Thomas Mann.« MARCEL REICH-RANICKI Mit einem Nachwort von Christine Hehle
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über Theodor Fontane
Theodor Fontane wurde am 30. Dezember 1819 im märkischen Neuruppin geboren. Nach vierjähriger Lehre arbeitete er in verschiedenen Städten als Apothekergehilfe und erwarb 1847 die Zulassung als »Apotheker erster Klasse«. 1849 gab er den Beruf auf, etablierte sich als Journalist und freier Schriftsteller und heiratete 1850 Emilie Rouanet-Kummer. 1855 bis Anfang 1858 hielt er sich in London auf, u. a. als »Presseagent« des preußischen Gesandten. Zwischen 1862 und 1882 kamen die »Wanderungen durch die Mark Brandenburg« heraus. Neben seiner umfangreichen Tätigkeit als Kriegsberichterstatter und Reiseschriftsteller war Fontane zwei Jahrzehnte Theaterkritiker der »Vossischen Zeitung«. In seinem 60. Lebensjahr trat er als Romancier an die Öffentlichkeit. Dem ersten Roman »Vor dem Sturm« (1878) folgten in kurzen Abständen seine berühmt gewordenen Romane und Erzählungen sowie die beiden Erinnerungsbücher »Meine Kinderjahre« und »Von Zwanzig bis Dreißig«. Fontane starb am 20. September 1898 in Berlin.
Informationen zum Buch
Fontanes persönlichstes Buch, die Schilderung seiner Gefangenschaft im Deutsch-Französischen Krieg.
Verhaftet als vermeintlicher preußischer Spion.
Im September 1870 reist Theodor Fontane nach Frankreich, um für sein Buch über den Deutsch-Französischen Krieg zu recherchieren. Am 5. Oktober wird er »zu Füßen der Jungfrau«, das heißt am Jeanne-d'Arc-Denkmal in Domrémy, verhaftet. Die Situation ist gefährlich: Dem Schriftsteller droht standrechtliche Erschießung. Schließlich wird er zwei Monate inhaftiert, zuletzt auf der Atlantikinsel Oléron. Hier entsteht, unter dem Eindruck des unmittelbar Erlebten, eines seiner schönsten und persönlichsten Prosawerke. Seine Überzeugung, dass hinterm Berge auch Leute wohnen, kann er selbst in dieser extremen Lage demonstrieren.
»Theodor Fontane ist der wichtigste deutsche Romancier zwischen Goethe und Thomas Mann.« Marcel Reich-Ranicki
Mit einem Nachwort von Christine Hehle
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Theodor Fontane
Kriegsgefangen
Erlebtes 1870
Mit einem Nachwort von Christine Hehle
Inhaltsübersicht
Über Theodor Fontane
Informationen zum Buch
Newsletter
»Ins alte, romantische Land«
1. Domrémy
2. Neufchâteau
3. Langres
4. Von Langres bis Besançon
5. Die Zitadelle von Besançon
6. Rückblicke
»Comme officier supérieur«
1. Von Besançon bis Lyon
2. Lyon
3. Moulins
4. Guéret
5. Poitiers-Rochefort
6. Marennes
Ile d’Oléron
1. Die Insel Oléron
2. Ankunft
3. Die Zitadelle
4. Rasumofsky
5. Blanche
6. Le Rempart
7. Mittag
8. Teestunde
9. Regentage
10. Der Überfall von Ablis
11. Drei von den 3. Garde-Ulanen
12. Fünf vom 14. Jäger-Bataillon
13. Begräbnis
14. Sturm im Glase Wasser
15. »Sentinelle, prenez garde à vous«
Frei
1. Unverhofft kommt oft
2. Der letzte Sonntag
3. Der letzte Abend
4. Abschied
5. Rückreise
Anhang
Übersetzung französischer Wörter und Wendungen
Vom Kriegsgefangenen zum freien Autor
Anmerkungen
Fußnoten
Impressum
Meinen Freunden dankbar gewidmet
»Ins alte, romantische Land«
1. Domrémy
Wie heißt der Ritter?
Baudricourt. Er steht
Kaum einen Tagesmarsch von Vaucouleurs.
Ich bin nur eines Hirten niedre Tochter
Aus meines Königs Flecken Domremy,
Der in dem Kirchensprengel liegt von Toul.
Jungfrau von Orleans
Am 2. Oktober war ich in Toul. Ich kam von Nancy. Nancy ist eine Residenz, Toul ist ein Nest. Es machte den Eindruck auf mich wie Spandau vor dreißig Jahren. Die Kathedrale ist bewunderungswürdig, das Innere einer zweiten Kirche (St. Jean, wenn ich nicht irre) von fast noch größerer Schönheit, aber von dem Augenblick an, wo man mit diesen mittelalterlichen Bauten fertig ist, ist man es mit Toul überhaupt.
In zwei Stunden hatt’ ich diese Sehenswürdigkeiten hinter mir, und dennoch war ich gezwungen, zwei Tage an dieser Stelle auszuhalten. Dies hatte darin seinen Grund, daß unmittelbar südlich von Toul das Jeanne d’Arc-Land gelegen ist und daß es, dank dem Kriege und den Requisitionen, unmöglich war, in der ganzen Stadt einen Wagen aufzutreiben. Die Partie selber aufzugeben schien mir untunlich, ich hätte jede Mühe und jeden Preis daran gesetzt. Endlich, am Nachmittage des zweiten Tages, hieß es: Madame Grosjean hat noch einen Wagen. Ich atmete auf. In einem schattigen Hinterhause, dicht neben der Kathedrale, fand ich die genannte Dame, die bei zurückgeschlagenen Gardinen in einem großen Himmelbette saß. Sie war krank, abgezehrt, hatte aber die klaren, klugen Augen, die man so oft bei hektischen Personen findet und die nie eines Eindrucks verfehlen. Wir unterhandelten in Gegenwart zweier Gevatterinnen, die mindestens ebenso gesund waren wie Madame Grosjean krank. Das Geschäftliche arrangierte sich leicht; nur ein Übelstand blieb, an dem auch jetzt noch die Partie zu scheitern drohte: das einzig vorhandene Gefährt, ein char à banc*1, war nämlich zerbrochen und Mr. Jacques, Schmied und Stellmacher, hatte erklärt, überbürdet mit Arbeit, die Reparatur nicht machen, keinesfalls aber den Wagen abholen lassen zu können. In diesen letzten Worten schimmerte doch noch eine Hoffnung. Ich eilte also auf die Straße, engagierte zwei Artilleristen vom Regiment »Feldzeugmeister«, spannte mich selbst mit vor, und im Trabe jagten wir nun mit der leichten Kalesche über das holprige Pflaster hin, in den Arbeitshof des Mr. Jacques hinein. Dieser war ein Hüne, also gutmütig wie alle starken Leute. Meine Beredsamkeit in Etappenfranzösisch amüsierte ihn ersichtlich, und wir schieden als gute Freunde, nachdem er versprochen hatte, bis Sonnenuntergang die Reparatur machen zu wollen. Er hielt auch Wort.
In der Dämmerstunde klopfte es an meine Tür. Ein Blaukittel trat ein, teilte mir mit, daß er der »Knecht« der Madame Grosjean sei und daß wir am andern Morgen 7 Uhr fahren würden. Soweit war alles gut. Aber der Blaukittel selbst flößte mir wenig Vertrauen ein, am wenigsten, als er schließlich versicherte: die Partie sei in einem Tage nicht zu machen, wir würden nach Vaucouleurs fahren, von dort nach Domrémy und von Domrémy wieder zurück nach Vaucouleurs, aber mehr sei nicht zu leisten; in Vaucouleurs müßten wir übernachten. Er berief sich dabei auf einen russischen Grafen, mit dem er vor Jahresfrist dieselbe Partie gemacht habe, und begleitete seine Rede, die mir aus nichts als aus den vollklingenden Worten »Kilometer« und »quatre-vingt-douze« zu bestehen schien, mit den allerlebhaftesten Gesten. Ein starker Verdacht schoß mir durch den Kopf; wer indessen viel gereist ist, weiß aus Erfahrung, daß auf solche Anwandlungen nicht allzuviel zu geben ist, und ich entließ ihn ohne Weiteres mit einem kurzen: Eh bien, demain matin 7 heures. Ich freute mich sehr auf diesen Ausflug. Das Mißtrauen, das so plötzlich in mir aufgestiegen war, galt mehr dem Blaukittel in Person als der Gesamtsituation, und dieser Person glaubte ich schlimmstenfalls Herr werden zu können. Ich lud meinen Lefaucheux-Revolver und wickelte ihn derart in meine Reisedecke, daß ich, durch einen Griff von rechts her in die nun muffartige Rolle hinein, den Kolben packen und eine »Gefechtsstellung« einnehmen konnte. Ich muß dies erwähnen, weil es zu einer späteren Stunde von Wichtigkeit für mich wurde. Daß ich den Revolver nicht mit mir führte, um etwa auf eigene Hand Frankreich mit Krieg zu überziehen, brauch ich wohl nicht erst zu versichern; man hat aber die Pflicht, sich gegen mauvais sujets und die Effronterien des ersten besten Strolches zu schützen.
7 Uhr früh rasselte der Wagen über das Pflaster und hielt vor meinem Hotel. Ich war fertig; eine Viertelstunde später lag Toul hinter uns.
Bis Vaucouleurs sind drei Meilen. Von rechts her traten mächtige Weingelände, in der Mitte des Abhangs mit hellleuchtenden Dörfern geschmückt, bis an die Straße heran; nach links hin dehnten sich Fruchtfelder, dahinter Bergzüge, oft in blauer Ferne verschwimmend. Es war eine entzückende Fahrt; die Chaussee bergan steigend und wieder sich senkend, dann und wann ein Flußstreifen, eine Wassermühle, dazu rund umher das Herbstlaub in hundert Farben schillernd. Ehe wir noch die erste große Biegung des Weges erreicht hatten, erfüllte sich, was sich immer zu erfüllen pflegt: ein Fußgänger stand am Wege und bat, aufsteigen zu dürfen. Der Kutscher stellte ihn mir als einen seiner »Freunde« vor. Ich kann nicht sagen, daß er mir dadurch besonders empfohlen worden wäre, und ich rückte meine Reisedecke unwillkürlich etwas zurecht. Ich hatte aber unrecht. Der neue Fahrgast erwies sich als ein freundlicher, angenehmer Mann; plaudernd über Krieg und Frieden, fuhren wir um 10 Uhr in Vaucouleurs hinein.
Ein reizender kleiner Ort. Der Kutscher hatte zwei Stunden dafür festgesetzt, Zeit genug, die alte Kapelle und das leidlich wohlerhaltene Schloß des »Ritters Baudricourt«, das die Stadt beherrscht, zu besuchen. Über diese Erinnerungsstätte zu berichten ist hier nicht der Ort. Um 12 Uhr weiter nach Domrémy.
Domrémy – das von den Bewohnern dortiger Gegend immer nur Dórmy ausgesprochen wird – liegt noch drittehalb Meilen südlich von Vaucouleurs. Das Terrain verändert sich hier etwas und nimmt mehr und mehr den Charakter eines Defilees an. Die Höhenzüge zur Rechten bleiben dieselben, aber von gegenüber treten die Berge näher heran, während unmittelbar zur Linken ein breites Wiesental sich zieht, drin die Meuse fließt; das Ganze nicht ohne Reiz, aber ein wenig kahl und verbrannt, voll frappanter Ähnlichkeit mit dem Nuthetal, das sich von Potsdam aus, an Saarmund vorbei, bis hinauf an die alte sächsische Grenze zieht. Halben Wegs erreicht man Burey en Vaux, das Dörfchen, wohin Jeanne d’Arc zu ihrem Oheim Durand Laxart ging, als sie im elterlichen Hause nicht länger wohlgelitten war; dann (zur Linken) ein mittelalterliches, halb schloßartiges Gehöft, bis endlich, bei einer Biegung des Weges, Domrémy selbst mit einzelnen seiner blitzenden Dächer sichtbar wird. Nicht mit seiner Kirche. Es hat nur eine Kapelle, die, etwas tief gelegen, sich hinter Pappeln und anderem Baumwerk versteckt.
Die letzten zehn Minuten vor Einfahrt in das Dorf waren die schönsten. Es war, als ob die Reisegötter hier noch einmal den Zweck verfolgten, ein übriges für mich tun und die ganze Szene künstlerisch abrunden zu wollen. Ein Geistlicher in weißem Haar und breitkrempigem Hut kam des Weges; wir grüßten einander. Ein Hirt folgte; strickend schritt er seiner Herde vorauf. Durch die herbstlich klare Luft zogen Tausende von Sommerfäden, und auf meine neugierige Frage, welchen Namen diese weißen Fäden in Frankreich führten, antwortete mein Kutscher: les cheveux de la Ste Vierge. War es denkbar, unter glücklicherer Vorbedeutung in das Dorf der Jeanne d’Arc einzuziehen? Und doch täuschten alle diese Zeichen.
Um 3 Uhr etwa fuhren wir in die Hauptstraße von Domrémy hinein. Es ist ein Dorf von mittlerer Größe, eher klein. Der Eindruck, trotz hellen Sonnenscheins und des weißen Anstrichs der Häuser, war ein düsterer; alles schien auf Verfall und Armut hinzudeuten. In der Mitte des Dorfes hielten wir vor einem rußigen, anscheinend herabgekommenen Gasthause, das in verwaschenen Buchstaben die Inschrift trug: Café de Jeanne d’Arc. Es war unheimlich. Ich hatte dieselbe, mich direkt ins Herz treffende Empfindung wie am Abend vorher, wo der Blaukittel mich besucht und seine Botschaft ausgerichtet hatte.
Ich eilte, mich diesem Eindruck zu entziehen; die geweihte Stätte, wo »la Pucelle« geboren wurde, schien mir der geeignetste Platz dazu. Ich brach also unverzüglich auf. Es waren nur 150 Schritt; in einem Stück Gartenland lag das ehrwürdige Gemäuer. Ich zog die Glocke an einem sauberen drahtgeflochtenen Gittertor, das den Garten von der Straße schied. Eine »Religieuse« öffnete und machte die Führerin. Und siehe da, als ich erst in der Nische über der niederen Eingangstür das in Stein gemeißelte Bild der gewappneten Jungfrau, innerhalb des Hauses selbst aber den alten eichenen Wandschrank sah, der ihr jahrelang als Truhe gedient hatte, fiel alles Mißtrauen wieder von mir ab, und ich fühlte mich ganz dem Zauber dieser Stunde hingegeben. Ich machte meine Notizen, trat dann zurück in den Garten und versenkte mich noch einmal in den Anblick dieses in Geschichte und Dichtung gleich gefeierten Ortes. Convolvulus rankte sich um die Stämme einiger Zypressen; Resedabeete füllten die Luft mit ihrem Duft, die Religieuse sprach leise freundliche Worte; – alles war Poesie.
In unmittelbarer Nähe des Hauses »de la Pucelle« liegt die Kapelle. Sie ist gotisch. Einige Glasfenster, namentlich eines, dessen bunte Scheiben das Wappen der Jeanne d’Arc aufweisen, deuten auf das 15.Jahrhundert zurück; das meiste aber ist modern. Ich verweilte wohl eine Viertelstunde an dieser Stelle, mir jedes Kleinste einprägend, und trat dann wieder vor das Portal der Kapelle, zu deren Linken sich eine Statue der Pucelle erhebt. Diese kniet im Gebet, preßt die linke Hand aufs Herz, während sie die rechte gen Himmel hebt; – eine wohlgemeinte, aber schwache Arbeit.
Ich klopfte eben mit meinem spanischen Rohr an der Statue umher, um mich zu vergewissern, ob es Bronze oder gebrannter Ton sei, als ich vom Café de Jeanne d’Arc her eine Gruppe von acht bis zwölf Männern auf mich zukommen sah, ziemlich eng geschlossen und untereinander flüsternd. Ich stutzte, ließ mich aber zunächst in meiner Untersuchung nicht stören und fragte, als sie heran waren, mit Unbefangenheit: aus welchem Material die Statue gemacht sei? Man antwortete ziemlich höflich: »Aus Bronze«, schnitt aber weitere kunsthistorische Fragen, zu denen ich Lust bezeugte, durch die Gegenfrage nach meinen Papieren ab. Ich überreichte ein rotes Portefeuille, in dem sich meine Legitimationspapiere befanden, selbstverständlich nur preußische. Man suchte sich darin zurechtzufinden, kam aber nicht weit und forderte mich nunmehr auf, zu besserer Feststellung sowohl meiner Person wie meiner Reiseberechtigung ihnen in das Wirtshaus zu folgen.
Die ganze Szene, so peinlich sie war, hatte, der Gesamthaltung der Dorfbewohner nach, nicht gerade viel Bedrohliches gehabt und schien nach unserem Eintreten in das Wirtshaus, wo bald Wein und Reimser Biscuit herumgegeben wurden, ein immer helleres Licht gewinnen zu wollen. Ich machte alle Umstehenden, deren Zahl von Minute zu Minute wuchs, mit dem Inhalt meiner Legitimationspapiere bekannt und setzte ihnen offen den Zweck meiner Reise und dieser speziellen Exkursion nach Domrémy auseinander, was alles wohl aufgenommen wurde. Aber der kleine Lichtstrahl, der eben durchbrechen wollte, sollte bald wieder schwinden. Ich war eben noch im besten Perorieren, als ein junger Bauer, der sich mit meinem Stock zu tun gemacht hatte, die Krücke aus der Stockscheide zog und mit einem »ah, un poignard« die mir zuhörende Gesellschaft überraschte. Es durchfröstelte mich etwas, weil ich klar einsah, was jetzt notwendig kommen mußte. Ich faßte mich aber schnell, und zur Initiative greifend, die allein einem Schlimmeren vorbeugen konnte, sagte ich mit Ruhe: »Naturellement, Messieurs, je suis armé.« Ich sprach es so, daß man heraushören mußte: mit diesem Poignard allein ist es nicht getan. Man verstand mich auch sofort, und von mehreren Seiten hieß es jetzt: »Ah, ah! sans doute un revolver«, während andere dazwischenriefen: »où est-il? où sont ses effets? cherchez! apportez!« Man brachte alsbald meine Reisedecke und bestand seltsamerweise darauf, daß ich sie selber öffnen solle. Es war, als hätt’ ich sie mit Torpedos geladen. Ich konnte mich selbst in diesem Augenblicke eines Lächelns nicht erwehren, löste die Riemen, wickelte die Decke auseinander und überreichte meinen Revolver. Er ging von Hand zu Hand; ich konnte wahrnehmen, daß er mit sehr verschiedenen Gefühlen betrachtet wurde.
Die Situation war bereits heikel genug, aber schlimme Momente kommen nie allein; so auch hier. In eben diesem Augenblick, wo die Stimmung gegen mich ziemlich hochging, drängte sich durch den dichtesten Haufen ein wüst aussehender Geselle, der, gedunsen und kurzhalsig, seiner apoplektischen Anlage durch sechs Liter Wein täglich zu Hülfe zu kommen schien, stellte sich sperrbeinig vor mich hin, schlug mit der Faust auf seine Brust und erklärte mit lallender Zunge: »Je suis le Maire.« Dies kam mir sehr ungelegen. Ich griff zu einem verzweifelten Mittel und sagte ihm unter Verbeugung, »daß ich erfreut sei, ihn zu sehen«, was bei einzelnen (ich hatte also richtig gerechnet) sofort eine gewisse Heiterkeit zu meinen Gunsten erweckte und die Gebildeteren veranlaßte, die Dorfobrigkeit, die noch allerhand faselte, beiseite zu schieben. Dies war sehr wichtig für mich. Solch trunkener Imbécile, an dem alles, was Vernunft und Wahrheit ist, notwendig scheitern mußte, war das Schlimmste, was mir in solchem Momente begegnen konnte.
Einer aus dem Kreise der Minorität trat jetzt an mich heran und fragte ruhig: ob ich damit einverstanden sei, daß man mich nach Neufchâteau auf die Souspräfektur führe? Ich mußte lächeln; ebensogut hätte er mich fragen können, ob ich damit einverstanden sei, gehängt zu werden? Ich mußte eben tragen, was über mich beschlossen wurde.
Meine Einwilligung war kaum ausgesprochen, als man meinen Kutscher, der mich übrigens nicht verraten hatte, antrieb, seinen Braunen wieder einzuspannen. Ich bezahlte meine Zehrung, die Wirtin nahm das Geld und sah mich teilnahmsvoll an. Sie schien sagen zu wollen: die Welt ist toll geworden. Im Moment, wo ich auf den Flur hinaustrat, legte ein hübsch aussehender, rotblonder Mann seine Hand auf meine Schulter und flüsterte mir zu: »Monsieur, encore un moment!« Er wies auf ein großes Hinterzimmer, in das er voranschritt; ich folgte. Als wir allein waren, zeigte er mir ein Papier, das an seiner Spitze ein umstrahltes Dreieck und in dem Dreieck, soviel ich erkennen konnte, einige hebräische Zeichen trug. »Connaissez-vous cela?« Es schien mir ein Freimaurer-Papier. Ich antwortete: »Nein«, hinzusetzend, daß ich die Bedeutung allerdings zu kennen glaubte. »Ah! c’est bon!« Er steckte sein Papier wieder ein, und ich war entlassen. Ob er wirklich meine Freilassung durchsetzen wollte oder ob das Ganze umgekehrt nur eine Falle war, darüber kann ich bloß Vermutungen hegen. Das eine ist so gut möglich wie das andere.
Wir stiegen auf. Rechts der Kutscher, links ein Franktireur, ich eingeklemmt zwischen beiden; hinter uns, auf einem Strohbündel, lagen zwei Blusenmänner. Die Sonne war im Niedergehen, der Abend klar und schön; so ging es auf Neufchâteau zu.
2. Neufchâteau
What may this mean,
That thou
Revisit’st thus the glimpses of the moon?
How now! a rat?
Hamlet
Die Blusenmänner schliefen; mein Nachbar, der Franktireur, aber plauderte und rauchte seine Zigarette. Er war frisch, patriotisch, bescheiden; meine Situation flößte ihm eine gewisse Teilnahme ein. Ich fragte nach dem Souspräfekten. Der Franktireur nannte mir den Namen: Mr. Cialandri, ein Korse. Ich kann nicht sagen, daß mir bei diesem Zusatz besonders wohl geworden wäre. Ein Korse! Die Engländer haben ein Schul- und Kinderbuch, das den Titel führt: »Peter Parleys Reise um die Welt, oder was zu wissen not tut«. Gleich im ersten Kapitel werden die europäischen Nationen im Lapidarstil charakterisiert. Der Holländer wäscht sich viel und kaut Tabak; der Russe wäscht sich wenig und trinkt Branntwein; der Türke raucht und ruft Allah. Wie oft habe ich über Peter Parley gelacht. Im Grunde genommen stehen wir aber allen fremden Nationen gegenüber mehr oder weniger auf dem Peter-Parley-Standpunkt; es sind immer nur ein, zwei Dinge, die uns, wenn wir den Namen eines fremden Volkes hören, sofort entgegentreten: ein langer Zopf oder Schlitzaugen oder ein Nasenring. Unter einem Korsen hatte ich mir nie etwas anderes gedacht als einen kleinen braunen Kerl, der seinen Feind meuchlings niederschießt und drei Tage später von dem Bruder seines Feindes niedergeschossen wird. Man kann daraus abnehmen, welcher Trost mir aus der Mitteilung erwuchs, daß Mr. Cialandri ein Korse sei.
Es dunkelte schon, als wir in Neufchâteau einfuhren. Die Straßen waren wenig belebt; nach einigem Hin- und Herfragen hielten wir vor der Souspräfektur. Der Anblick war der freundlichste von der Welt. Ein Gitter, ein kiesbestreuter Vorhof, dahinter eine Villa, im italienischen Kastellstil aufgeführt. Das Baumaterial war roter Ziegel; Wein und Pfirsich rankten am Spalier. Nach erfolgter Anmeldung wurde ich treppauf geführt. In einem mit türkischem Teppich ausgelegten Salon saßen die Damen des Hauses; ein Diener brachte eben die Lampen; ich verneigte mich. Mr. Cialandri empfing mich an der Schwelle des dahinter gelegenen Zimmers, das dieselbe Eleganz zeigte: Marmorkamin, breite Spiegel, Fauteuils. Auf einem derselben wurde ich gebeten Platz zu nehmen. Mr. Cialandri setzte sich mir gegenüber. Das Kaminfeuer beleuchtete seine Züge.
Es war ein schmächtiger Mann, von vollkommen weltmännischer Tournure, dabei augenscheinlich krank. Er entschuldigte sich, daß er im Flüstertone sprechen müsse. Sein Auge war dunkel, sein Teint erdfahl; wenn sich irgendeine Blutrache an ihm vollzogen hatte, so konnte sie nur den Charakter anhaltender Aderlässe gehabt haben. Er drückte sein Bedauern aus, bei den Zeitläuften, die leider herrschten, mich nicht ohne weiteres in Freiheit setzen zu können; der Capitaine der Gendarmerie, nach dem er bereits geschickt habe, werde das Weitere veranlassen.
Die Situation, alles in allem genommen, schien mir nicht hoffnungslos; aber sie sollte sich bald verändern. Der Capitaine trat ein, verbeugte sich leicht und nahm dann den mit leiser Stimme gegebenen Bericht des Souspräfekten entgegen. Dann und wann warf er ein kurzes Wort ein und blickte, scharf musternd, mit seinen dunklen Augen zu mir herüber. Ich hasse im allgemeinen nichts mehr als diese törichten Augenkämpfe, die, aus einer falschen Vorstellung von Mut und Mannhaftigkeit hervorgehend, schon so viel Unheil angerichtet haben; diese Blicke aber hielt ich aus. Woher mir, bei sonstiger Scheuheit, die Kraft dazu kam, weiß ich nicht. Gleichviel, ich hielt aus. Gefühl der Unschuld, Abwehr gegen offenbare Provokation, endlich die ruhige Überzeugung, daß man durch Sich-Kleinmachen noch nie das Herz eines Feindes erobert hat – all’ das mochte zusammenwirken.
Der Capitaine wandte sich jetzt an mich:
Vous êtes officier prussien?
Non!
Vous avez fait une »excursion« à Domrémy?
Oui!
Vous suivez votre armée?
Oui et non! En tout cas je n’en dépends pas.
Ah, ah! – Vous avez été à Toul?
Oui!
A Nancy?
Oui!
Vous êtes médecin?
Non.
Mais vous portez la croix rouge!
Oui; comme légitimation.
Ah, ah!
Nun folgte wieder ein Geflüster und eine Seitenmusterung, worauf ich gebeten wurde, ihm zu folgen. Ich verbeugte mich gegen den Souspräfekten, die Damen im Salon erwiderten höflich meinen Gruß, und ich stieg rasch in den Flur des Hauses nieder. Im Hinaustreten auf den Vorhof besann sich der Capitaine (wofür ich ihm danke) plötzlich eines Besseren, ließ eine Hinterpforte öffnen und führte mich auf abgekürztem Wege und durch Straßen, wo niemand unserer achtete, in das Gefängnis der Stadt.
Es war ein weitschichtiges Gebäude, Korridore, ein Gewirr von Treppen; endlich öffneten wir ein Zimmer, darin der Greffier von Neufchâteau seine Wohnung hatte. Im Kamin knackten die großen Scheite; die Flamme schlug hoch auf und gab dem niedrigen, aber geräumigen Gemach mehr Licht als die kleine Lampe, die auf dem Tische stand. Im Moment unseres Eintretens erhob sich der Greffier, nahm die Lampe, schlug den Schirm zurück und schritt uns entgegen. Ich war wie vom Donner getroffen; das leibhaftige Ebenbild meines Vaters stand vor mir. Wir schrieben den 5. Oktober; vor drei Jahren, fast um dieselbe Stunde, war er gestorben; – hier sah ich ihn wieder, frisch, lebensvoll, hoch aufgewachsen, mit breiten Schultern und großen Augen, im Auge selbst jene Mischung von Strenge und Gutmütigkeit, wie sie ihm eigentümlich gewesen war.
Der Capitaine übergab mich dem Greffier, der den vollklingenden Namen Mr. Palazot führte, verbeugte sich gegen mich mit einem Anflug von Ironie und ließ mich mit meinem Hüter allein. Ich war jetzt Gefangener.
Mr. Palazot rückte seinen Stuhl vom Kamin an den Tisch, stellte die üblichen Fragen und machte einige Notizen, nachdem ich Uhr und Geld und ein kleines Perlmuttermesser, das gerade ausgereicht haben würde, einen Maikäfer zu ermorden, bei ihm deponiert hatte. Nachdem so alles Dienstliche abgemacht worden war, glättete sich die Stirn des Alten! er warf ein neues Scheit in die Flamme und forderte mich auf, an seiner Mahlzeit teilzunehmen. Es waren Karotten in einer Petersiliensauce. Ich lehnte dankend ab, bat aber um ein Glas Wasser und einen Löffel Cognac. Mein alter Gascogner nickte, gab in die Küche hinaus die Ordre, und alsbald erschien Madame Palazot, um mir das Gewünschte zu bringen. Wir saßen nun zu dritt um den runden Tisch und sprachen von Krieg und Frieden. Die üblichen Trivialitäten wurden ausgetauscht und aufs neue festgestellt, daß Krieg eine sehr böse und Friede eine sehr schöne Sache sei. Nachdem wir uns innerhalb dieses Glaubensbekenntnisses gefunden, wurden die Herzen immer offener. »Madame«, eine herzensgute Frau, holte das Bild ihres Sohnes, eines hübschen Husarenoffiziers, dessen Regiment die großen Kavalleriechargen bei Mars la Tour mitgemacht hatte und von dem seit der Einschließung von Metz keine Nachrichten mehr eingetroffen waren. »Il est mort« – dabei liefen der Alten die Tränen über das Gesicht; der Alte sah starr vor sich hin, spießte eine Karotte auf, legte aber die Gabel wieder nieder, ohne gegessen zu haben. Ein braunfleckiger, weißer Hühnerhund, der dem Sohn gehörte, stimmte winselnd in die Familientrauer mit ein. Eine halbe Stunde später kam Besuch, ein junger Advokat, natürlich Republikaner. Mr. Palazot war Orleanist. Die Debatte wurde immer lebhafter, der Advokat sprach sich mehr und mehr in Feuer und Flamme hinein: »L’Alsace et la Lorraine à l’Allemagne?! jamais, jamais! Vous voulez une guerre d’extermination, une guerre à outrance, – eh bien vous l’aurez.« Mir schwindelte der Kopf. Die furchtbaren Aufregungen dieses Tages, die sich immer wieder aufdrängende Frage: »was wird?«, die Diskussionen in einer fremden Sprache – eine völlige Erschöpfung kam über mich, und ich bat, mich in mein Zimmer zu führen. Ich glaubte, ich sagte wirklich Zimmer.
Es mochte 9 Uhr sein. Mad. Palazot, auf meine Bitte, gab mir vier wollene Decken mit; der Alte selbst nahm ein Licht und führte mich in mein »Zimmer« hinüber. Es trug die Inschrift »cachot«. Wir sagten einander gute Nacht, der Bolzen wurde vorgeschoben.
Ich kann nicht sagen, daß mich ein Schrecken angewandelt hätte; im Gegenteil, ich hatte das Gefühl einer innerlichen Befreiung; ich war allein. In diesem Wort liegen Himmel und Hölle. Ich empfand zunächst nur jenen. Der übliche Gefängnisapparat, der Schemel, der Wasserkrug, das eiserne Bett machten mich lächeln. Ich sprach vor mich hin: alles echt. Das Ganze hatte zudem nichts Abschreckendes. Die Wände waren weiß, die Laken sauber, durch das breite Gitterfenster fiel das Mondlicht bis in die halbe Tiefe des Zimmers, drunten, in weißem Schimmer, lag die Stadt. Ich schritt eine Viertelstunde lang auf und ab; dann entkleidete ich mich und wickelte mich in die Decken. Ich war todmüde und hoffte »einen guten Schlaf zu tun«.
Es war anders beschlossen. Ich mochte fünf Minuten geschlafen haben, als mich ein lautes Nagen und Knabbern weckte. Ich fuhr auf und horchte. Kein Zweifel, Ratten. Wie mir dabei zumute wurde, kann ich nicht beschreiben. Ich wußte sofort: einen Schlaf gibt es in dieser Nacht nicht mehr für dich. Hätt’ ich auch anders darüber gedacht, die Bewohner hinter Wand und Diele hätten mich bald eines andern belehrt. Nie hab’ ich diese Tiere mit solcher Frechheit sich gebärden sehen; sie waren überall; zupften und zerrten an den Decken, ließen sich durch mein Husten und Zurufen nicht im geringsten stören und machten, wenn sie unter dem Fußboden geschwaderartig und mit stampfendem Gepolter hinjagten, den Eindruck einer infernalen Kavallerie auf mich. Jeden Augenblick mußt’ ich fürchten, daß sie mein Bett mit Sturm nehmen würden.
Der erste Seufzer kam aus meiner Brust. Bis dahin hatt’ ich mich gehalten. Ich stand auf, kleidete mich an, wickelte mich in meine Reisedecke und setzte mich auf das Fensterbrett, das gerade breit genug war, meinem Körper Platz zu geben. In solcher Stellung, nur mal rechts, mal links meine Rückenlehne suchend, durchwachte ich die Nacht, zählte ich die Viertelstunden. Das höllische Getier, das mich einfach als einen Eindringling betrachtete, ließ übrigens auch jetzt nicht von mir ab; sie drängten sich an den Schemel, den ich als eine Art Treppenstufe an das Fenster geschoben hatte, und suchten diesen zu erklettern; als sie aber ihre Anstrengungen scheitern und mich beständig auf Wache sahen, gaben sie endlich ihre Chargen auf. Um 4 Uhr wurde es still; um 5 Uhr dämmerte es.
Um 7 Uhr erschien Mr. Palazot. Ich sagte ihm, daß ich nicht geschlafen hätte und weshalb nicht. Er lächelte. »Ja, ja.« Am Kaminfeuer sollten jetzt die Gespräche vom Abend vorher wieder aufgenommen werden; aber, trotz angeborner Höflichkeit, – ich konnte nicht. Eine Viertelstunde lang, während ich wieder ein wenig Wasser und Cognac trank, hielt ich es aus; dann fragte ich ihn, ob er mir wohl erlauben wolle, in seinem Sorgenstuhl den versäumten Schlaf der Nacht nachzuholen? Er nickte, gab mir sein bestes Kissen, und ich rückte mich zurecht. An Schlaf war natürlich nicht zu denken; auch lag mir nur an Ruhe, an der Möglichkeit, mir selber anzugehören.
So saß ich eine Stunde; das Feuer knisterte, der Hühnerhund gappste nach den Fliegen, der Alte las, Mad. Palazot ging leise, wie auf Socken, auf und ab. Mit dem Schlage neun wurde es draußen laut; schwere Schritte klangen auf der Treppe; drei Gendarmen, große schöne Leute, traten ein. Unter ihrer Eskorte, so erfuhr ich jetzt, sollte ich nach der Festung Langres, zum Brigadegeneral gebracht werden. Abschied war bald genommen: meiner freundlichen Wirtin sprach ich die Hoffnung aus, daß sie ihren Sohn wiedersehen möge. Sie weinte: jamais, jamais!
Der Bahnhof lag an der entgegengesetzten Seite der Stadt. Ich mußte also die Hauptstraße der ganzen Länge nach passieren. Es war eine Art Volksfest; die Nachricht von meiner Verhaftung hatte sich schon am Abend vorher in allen Schichten der Bevölkerung verbreitet. Als ich so, Haus bei Haus, an den Gruppen Neugieriger vorübermußte, ging mir die Strophe eines alten Liedes durch den Sinn:
Mary Hamilton schritt die Straß entlang.
Alle Mädchen schauten herfür,
Die Männer und die Frauen
Standen fragend in der Tür.
So das Lied. Mary Hamilton schritt auf einen Hügel zu, um dort zu sterben. Wohin schritt ich?
3. Langres
Was schüttelt dich nun? was erschüttert den
Sinn? Ein innrer Schauer durchfährt mich.
Egmont
Von Neufchâteau bis Langres werden zwölf Meilen sein. Wir machten die Fahrt in vier Stunden, im allgemeinen durch Neugier oder Schlimmeres wenig belästigt. Die einzige Klasse von Personen, die sich hier, wie auch späterhin, durch eine gewisse feindselige Zudringlichkeit auszeichnete, waren Beamte niedern Grades, die in noch junger Beziehung zum »roten Bändchen« standen, kleine Carrièremacher, die auf diese Weise ihrer nationalen, aber mehr noch ihrer persönlichen Eitelkeit frönen wollten. Sie traten an das Coupéfenster, unterwarfen mich einem Kreuzverhör, musterten mich und verschwanden wieder. Sie waren nicht geradezu unhöflich, nur das ganze Verfahren überhaupt bildete eine Unart.
Es war gegen 2 Uhr, als wir Langres erreichten. In halbstündiger Entfernung vom Bahnhof, auf einem Bergrücken, lagen Stadt und Festung; dort mußten wir hinauf. Trotz Oktober war eine glühende Hitze; die Sonne stach. Halben Wegs bat ich, einen Augenblick rasten zu dürfen; man war sogleich bereit und stellte mir anheim, diese Berg-Ersteigung in so viel Etappen zu machen, wie mir bequem sei. Endlich waren wir oben, das Festungstor nahm uns auf.
Gefängnisse und Verhörslokale, zu meinem nicht geringen Leidwesen, lagen hier, wie an allen anderen Orten, die ich zu passieren hatte, immer am entgegengesetzten Ende der Stadt, so daß ich das Spießrutenlaufen durch eine feindlich gesinnte Bevölkerung gründlich kennenlernte. Ich erweiterte auf die Weise zwar meine Städtekenntnis, aber ich hätte auf diesen Wissenszuwachs gern Verzicht geleistet. Die Straßenjugend, auch hier in Langres, war ziemlich arg hinter mir her, namentlich in den engeren Gassen, und wenn mir von den Zurufen auch vieles entging, so hatte ich doch gerade Ohr genug, um das immer wiederkehrende »pendre« und »fusiller« sehr deutlich herauszuhören.
Endlich standen wir vor dem Verhörslokal; die Militärgerichtsbarkeit der Brigade hatte hier ihren Sitz. Man führte mich in ein niedriges Bureauzimmer, an dessen großem Doppelschreibtisch zwei Capitaine beschäftigt waren. Der Gendarmeriewachtmeister entlud seine Ledertasche und legte allerhand Papiere, darunter auch die Legitimationskarten, Briefe und Notizbücher, die man mir in Domrémy abgenommen hatte, auf den Tisch. Der scharfe Gang bergan (der eingebüßten Nachtruhe ganz zu geschweigen) hatte mich so angestrengt, daß ich einer Ohnmacht nahe war. Da ich aber zugleich empfand, daß es auf die Antworten, die ich hier zu geben haben würde, sehr erheblich ankommen müsse, so bat ich zuvor um ein Glas Wasser. Man brachte mir Wein. Ich stürzte es herunter und war nun wie neubelebt. Die Fragen, die an mich gerichtet wurden, waren dieselben wie in Neufchâteau, aber ruhiger, weniger feindselig. Man wollte auch hier einen Offizier aus mir herauspressen, um so mehr als das vom Gendarmeriecapitaine ausgestellte Begleitpapier mich ohne weiteres als einen solchen angemeldet hatte, meine Erscheinung und Sprachweise aber, vor allem die Notizen meines Taschenbuchs, die ein Interprete rasch durchfliegen mußte, schienen im ganzen die Situation zu meinen Gunsten zu ändern. Es kam nur darauf an, ob dieser Eindruck dauern oder durch irgend etwas anderes paralysiert werden würde.
Das ganze Verhör hatte kaum zehn Minuten gedauert; ich wurde entlassen und durch meine Begleiter einige Straßen weiter in ein graues schloßartiges Gebäude geführt. Ich betrat es mit einer gewissen Zuversicht, die sich darauf gründen mochte, daß ich, am Schluß meines Zwiegesprächs mit den beiden Capitainen, das Wort »Kaserne« gehört zu haben glaubte, ein Wort, das mir in der Lage, in der ich mich befand, schon halb wie Freiheit klingen mußte. Ich sollte indes nicht lange in diesem Irrtum bleiben. Ein kleiner, schwarzäugiger Franzose (Monsieur Bourgaut, wie ich später erfuhr) nahm mich in Empfang, stellte die üblichen Fragen und führte mich dann treppauf, über lange Korridore hin, in ein geräumiges, in allem übrigen aber meinen Erwartungen wenig entsprechendes Zimmer. Mr. Bourgaut selbst war ungemein beweglich und geschäftig, plapperte mit halblauter Stimme lange Sätze vor sich hin, die ich nicht verstand, und verschwand dann rasch, nachdem er sich wie ein Kreisel verschiedene Male umgedreht hatte. Das Ganze gefiel mir nicht allzusehr. Mit einer Art Sehnsucht dachte ich an meinen alten Palazot zurück.