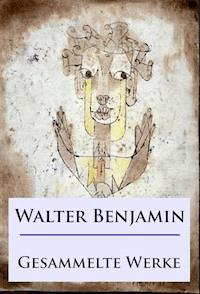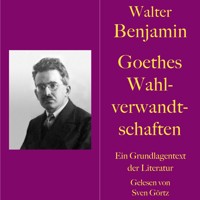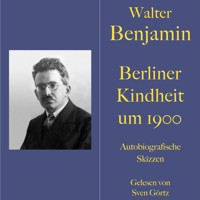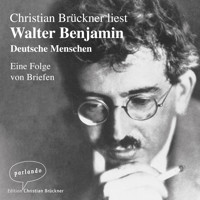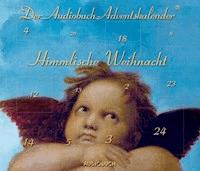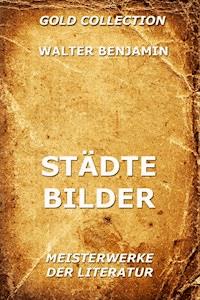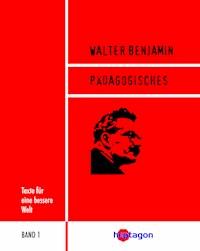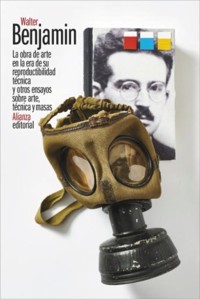0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sachbücher bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Walter Benjamin war der bedeutendste Kritiker seiner Zeit. Viele seiner Rezensionen sind immer noch erste Anlaufstelle für Literaturinteressierte. Benjamin bespricht in diesem E-Book Reiseberichte, Romane, Übersetzungen, gar Schulbücher u. v. m. Diese chronologisch geordnete Sammlung von hunderten von Beiträgen ist mit einem verlinkten Index versehen. Es finden sich Beiträge u. a. zu Lily Braun, Hugo von Hofmannsthal, Hans Bethge, Edgar Allan Poe, Lenin, Alfred Polgar, Georg Mendelssohn, Chaplin, Hans Heckel, Hebel, Gottfried Keller, Kierkegaard, Brecht, Max Brod und Franz Kafka. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 951
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Walter Benjamin
Kritiken und Rezensionen
1912 - 1940
Walter Benjamin
Kritiken und Rezensionen
1912 - 1940
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-954189-96-0
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
1912
Lily Brauns Manifest an die Schuljugend
1924
Karl Hobrecker, Alte vergessene Kinderbücher.
1926
Friedensware
Alfred Kuhn, Das alte Spanien. Landschaft, Geschichte, Kunst.
Hugo von Hofmannsthal, Der Turm.
Hans Bethge, Ägyptische Reise. Ein Tagebuch.
»Bella«
Ein Drama von Poe entdeckt
»Deutsche Volkheit.«
Ventura Garcia Calderon: La vengeance du Condor.
Übersetzungen
Margaret Kennedy, Die treue Nymphe.
Carl Albrecht Bernoulli, Johann Jacob Bachofen und das Natursymbol.
Franz Hessel
Der Kaufmann im Dichter
Ssofja Fedortschenko, Der Russe redet. Aufzeichnungen nach dem Stenogramm.
Oskar Walzel, Das Wortkunstwerk. Mittel seiner Erforschung.
Wladimir Iljitsch Lenin, Briefe an Maxim Gorki 1908 – 1913.
1927
Einige ältere und neuere Neudrucke
Paul Hankamer, Die Sprache, ihr Begriff und ihre Deutung im 16. und 17. Jahrhundert.
Fjodor Gladkow, Zement.
Iwan Schmeljow, Der Kellner.
Europäische Lyrik der Gegenwart. 1900-1925.
Gaston Baty, Le masque et l’encensoir.
Paul Léautaud, Le théâtre de Maurice Boissard.
Ramon Gomez de la Serna, Le cirque.
Philippe Soupault, Le cœur d’or.
Henry Poulaille, L’enfantement de la paix.
Henry Poulaille, Ames neuves.
Pierre Girard, Connaissez mieux le cœur des femmes.
Martin Maurice, Nuit et jour.
Anthologie de la nouvelle prose française.
Drei Franzosen
Franz Hessel, Heimliches Berlin.
Aus Gottfried Kellers glücklicher Zeit. Der Dichter im Briefwechsel mit Marie und Adolf Exner.
1928
Porträt eines Barockpoeten
Landschaft und Reisen
Graf Paul Yorck von Wartenburg, Italienisches Tagebuch.
Georg Lichey, Italien und wir. Eine Italienreise.
Der Deutsche in der Landschaft.
Drei kleine Kritiken von Reisebüchern
Eva Fiesel, Die Sprachphilosophie der deutschen Romantik.
Hugo von Hofmannsthals »Turm«
Eine neue gnostische Liebesdichtung
Michael Sostschenko, So lacht Rußland! Humoresken.
Aus unbekannten Schriften. Festgabe für Martin Buber zum 50. Geburtstag.
Drei Bücher: Viktor Schklowski – Alfred Polgar – Julien Benda
Kulturgeschichte des Spielzeugs
Giacomo Leopardi, Gedanken.
Ein grundsätzlicher Briefwechsel über die Kritik übersetzter Werke
George Moore, Albert und Hubert. Erzählung.
Alexander Moritz Frey, Außenseiter. Zwölf seltsame Geschichten.
Zwei Kommentare
Spielzeug und Spielen
Jakob Job, Neapel. Reisebilder und Skizzen.
Anja und Georg Mendelssohn, Der Mensch in der Handschrift.
Paris als Göttin
Alexys A. Sidorow, Moskau.
Isaac Benrubi, Philosophische Strömungen der Gegenwart in Frankreich.
Feuergeiz-Saga
Johann Wolfgang von Goethe, Farbenlehre.
Neues von Blumen
»Adrienne Mesurat«
1929
Rückblick auf Chaplin
Russische Romane
Zwei Bücher über Lyrik
Alexander Mette, Über Beziehungen zwischen Spracheigentümlichkeiten Schizophrener und dichterischer Produktion.
Arthur Holitscher, Es geschah in Moskau.
Robert Faesi, Die Ernte schweizerischer Lyrik.
Nicolas von Arseniew, Die russische Literatur der Neuzeit und Gegenwart in ihren geistigen Zusammenhängen in Einzeldarstellungen.
Bücher, die lebendig geblieben sind
Die dritte Freiheit
Bücher, die übersetzt werden sollten
Marcel Brian, Bartholomée de Las Casas. »Père des Indiens«.
Léon Deubel, Œuvres. Préface de Georges Duhamel.
Gebrauchslyrik? Aber nicht so!
Willa Cather, Frau im Zwielicht.
Curt Elwenspoek, Rinaldo Rinaldini, der romantische Räuberfürst.
Der arkadische Schmock
Echt Ingolstädter Originalnovellen
Hans Heckel, Geschichte der deutschen Literatur in Schlesien.
Die Wiederkehr des Flaneurs
Alfred Polgar, Hinterland.
Joseph Gregor, Die Schwestern von Prag und andere Novellen.
Magnus Hirschfeld, Berndt Götz, Das erotische Weltbild.
Familienbriefe Jeremias Gotthelfs.
Hebel gegen einen neuen Bewunderer verteidigt
Eine kommunistische Pädagogik
Was schenke ich einem Snob?
G.F. Hartlaub, Der Genius im Kinde.
1930
Lob der Puppe
François Porché, Der Leidensweg des Dichters Baudelaire.
Ein Außenseiter macht sich bemerkbar. Zu S. Kracauer, »Die Angestellten«
Ein Buch für die, die Romane satt haben
Krisis des Romans. Zu Döblins »Berlin Alexanderplatz«
Gabriele Eckehard, das deutsche Buch im Zeitalter des Barock.
Theorien des deutschen Faschismus
Zur Wiederkehr von Hofmannsthals Todestag
Wider ein Meisterwerk
Ein Jakobiner von heute
Symeon, der neue Theologe, Licht vom Licht.
Chichleuchlauchra. Zu einer Fibel
Kolonialpädagogik
1931
Theologische Kritik Zu Willy Haas, »Gestalten der Zeit«
Linke Melancholie. Zu Erich Kästners neuem Gedichtbuch
Literaturgeschichte und Literaturwissenschaft
Das Problem des Klassischen und die Antike.
Wie erklären sich grosse Bücherfolge? »Chrut und Uchrut« – ein schweizerisches Kräuterbuch
Wissenschaft nach der Mode
Baudelaire unterm Stahlhelm
Ein Schwarmgeist auf dem Katheder: Franz von Baader
Oskar Maria Graf als Erzähler
Grünende Anfangsgründe
1932
Privilegiertes Denken
Gottfried Keller, Sämtliche Werke.
Hans Hoffmann, Bürgerbauten der alten Schweiz.
Nietzsche und das Archiv seiner Schwester
Hundert Jahre Schrifttum um Goethe
Pestalozzi in Yverdon
Der Irrtum des Aktivismus
Goethebücher, aber willkommene
Cherry Kearton, Die Insel der fünf Millionen Pinguine.
Erleuchtung durch Dunkelmänner.
Jemand meint
Strenge Kunstwissenschaft (1)
Strenge Kunstwissenschaft (2)
1933
Hermann Gumbel, Deutsche Sonderrenaissance in deutscher Prosa.
Memoiren aus unserer Zeit
Kierkegaard
Briefe von Max Dauthendey
Marc Aldanov, Eine unsentimentale Reise.
Am Kamin. Zum 25jährigen Jubiläum eines Romans
Rückblick auf Stefan George
Gelehrte Registratur
Kleiner Mann aus London
Deutsch in Norwegen »Die Meister« – deutsches Lesebuch für norwegische Gymnasien
1934
Rückblick auf 150 Jahre deutscher Bildung
Der eingetunkte Zauberstab
Neues zur Literaturgeschichte
Iwan Bunin
A. Pinloche, Fourier et le socialisme.
Arnold Hirsch, Bürgertum und Barock im deutschen Roman.
Lawrence Ecker, Arabischer, provenzalischer und deutscher Minnesang.
Die deutsche Ballade
Das Gartentheater
Georges Laronze, Le Baron Haussmann.
Julien Benda, Discours à la nation européenne.
1935
Brechts Dreigroschenroman
Wilhelm Platz, Charles Renouvier als Kritiker der französischen Kultur.
Volkstümlichkeit als Problem
Probleme der Sprachsoziologie
Jacques Maritain, Du régime temporel et de la liberté.
1936
Pariser Brief (1)
Pariser Brief (2)
1937
Recherches philosophiques.
Felix Armand et René Maublanc, Fourier.
(Helmut Anton – Hansjörg Garte – Oskar Walzel – Alain: Stendhal – Hugo von Hofmannsthal – Hermann Blackert – Hermann Broch)
1938
Ein deutsches Institut freier Forschung. (Frankfurter »Institut für Sozialforschung«)
Max Brod, Franz Kafka. Eine Biographie.
Eine Chronik der deutschen Arbeitslosen
Krisenjahre der Frühromantik. Briefe aus dem Schlegel-Kreis.
Gisèle Freund, La photographie en France au dix-neuvième siècle.
Grete de Francesco, Die Macht des Charlatans.
Roman deutscher Juden
Louise Weiss, Souvenirs d’une enfance républicaine.
Roger Caillois – Julien Benda – Georges Bernanos – G. Fessard
Rolland de Renéville, L’expérience poétique.
Léon Robin, La morale antique.
1939/1940
Albert Béguin, L’âme romantique et le rêve.
Ferdinand Brunot, Histoire de la langue française des origines à 1900.
Richard Hönigswald, Philosophie und Sprache. Problemkritik und System.
Louis Dimier, De l’esprit à la parole. Leur brouille et leur accord.
Dolf Sternberger, Panorama oder Ansichten vom 19. Jahrhundert.
Encyclopédie Française. Bd. 16 u. 17: Arts et littératures dans la société contemporaine, I, II. (Dirigé par Pierre Abraham.)
Jean Rostand, Hérédité et racisme.
Henri-Irénée Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique.
Georges Salles, Le regard. La collection, Le musée, La fouille, Une journée, L’école.
Une Lettre de Walter Benjamin au sujet de »Le Regard« de Georges Salles
Index
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Sachbücher bei Null Papier
Aufstand in der Wüste
Das Leben Jesu
Vom Kriege
Geschmacksverirrungen im Kunstgewerbe
Ansichten der Natur
Über den Umgang mit Menschen
Die Kunst Recht zu behalten
Walden
Römische Geschichte
Der Untergang des Abendlandes
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
1912
Lily Brauns Manifest an die Schuljugend1
Eines fällt an dem neuen Buche Lily Brauns vor allem auf. Es mag ein Fehler sehr vieler pädagogischer und schulreformatorischer Schriften sein, daß sie ihr Schulideal an so manchen Ideen und Institutionen orientieren – an Staat oder Religion, allgemeiner Bildung oder dem Prinzip der Arbeit – nur nicht am Ursprünglichsten: an der Jugend. Und bei vielen Schulplänen wird ein solcher Fehler nicht einmal auffallen. Denn – paradox konnte man formulieren: die Menge der geplanten Reformen hat den Blick auf die eine wirkliche, werdende Jugend verbaut. Die Verfasserin aber schreibt »eine Rede an die Schuljugend«. Sie hat diese eine wirkliche und werdende Jugend erblickt, die sich ihrer selbst langsam bewußt wird, ihrer Rechte, ihrer Stärke und ihrer Möglichkeiten, die zu Pflichten werden. Und doch indem Lily Braun zu dieser Jugend von der Schule redet, verliert sie ihre Hörer aus den Augen, schweift über sie hinweg zu irgendeinem leeren, negativen Ideal der Freiheit. Ziellosigkeit bei allem Fanatismus ist ein Hauptmerkmal der Schrift.
Der Jugend weiß Lily Braun nichts weiter zuzurufen, als: Ihr seid rechtlos! In der Schule dürft ihr keine eigene Meinung entwickeln, im Hause müßt ihr schweigen, die grundlegende, selbstverständliche politische Bildung verbietet der Staat den Vierzehnjährigen, die sich selber ihr Brot verdienen. Darum: Habt in der Schule den Mut eurer eigenen Meinung, und wenn man euch auch auf die letzte Bank setzte; darum: Versagt euren Eltern den Gehorsam. »Gehorsam ist keine Tugend, wenn er nicht ein freudiges Jasagen zum Befehle ist.«
Es kann sich nicht um die Tatsachen handeln, von denen die Verfasserin ausgeht. Man mag 10 Ausnahmen und 100 Ausnahmen nennen, trotzdem bleibt das Prinzip, wie es sich in jeder Alltäglichkeit in der Schule äußert, dasselbe – und nicht anders in der Familie. Von ganz bedeutender Wichtigkeit aber sind Lily Brauns Folgerungen, ihre Vorschläge, mit denen sie allerdings Wege angibt, ohne ein Ziel zu nennen. Denn die Freiheit ist zwar für den Augenblick und für den heutigen Schüler ein Ziel, an sich aber nur ein Ausgangspunkt. Wohin der Weg der freien Jugend gehen sollte, darüber schweigt Lily Braun. Sie schweigt da, wo gerade der, der sich an die Jugend wendet, das Bedeutendste zu sagen hätte.
Beachtenswert sind die Vorschläge der Verfasserin dennoch deswegen, weil sie keineswegs vereinzelt dastehen – höchstens so kategorisch in der Öffentlichkeit noch nicht geäußert worden sind. Denn es sind Aufforderungen und Begeisterungen, wie sie in den Gesprächen kühner, unruhiger Schüler Tag für Tag geäußert werden; allerdings um bald in ihrer Undurchführbarkeit erkannt zu werden oder dem allzu Mutigen ein oder mehrere Jahre seines Lebens zu verderben. Diese Vorschläge – ganz abgesehen davon, zu welchen positiven Zielen sie führen mögen erweisen sich auf den ersten Blick jedem, der auch nur oberflächlich mit den Verhältnissen vertraut ist, als völlig undurchführbar, weil unter der Schülerschaft die Organisation und Solidarität fehlt, die eine unerläßliche Vorbedingung auch des geringsten Erfolges wäre. Als undurchführbar auch, weil es sich mit der Emanzipation der Kinder durchaus nicht so verhält, wie mit jenen gewaltigen Bewegungen, die die Verfasserin so freigebig zum Vergleich heranzieht, wie mit dem Befreiungskampfe, den »die Sklaven des Altertums, die Bauern des Mittelalters, die Bürger des Zeitalters der Revolution, die Arbeiter und Frauen der Gegenwart« führen. Hinter der Schülerschaft steht nicht die materielle, rohe Macht, die den Kampf, der einmal so fürchterlich eröffnet wäre, durchhalten könnte. Und die Schulreform ist ein Kampf der Ideen, in dem die sozialen Momente, die jene erwähnten Kämpfe so furchtbar gestalteten, zurücktreten.
Doch nicht der Mangel an klaren Zielen, nicht die gänzlich verfehlten Vorschläge allein entwerten die Schrift. Unwürdig und empörend erscheint es, daß die Verfasserin als der ersten eine, die zur Jugend spricht, nicht mehr als eine – sozusagen politische Rede, nichts über einen aufreizenden Aufruf hinaus zu sagen hat. Daß die Schrift, die agitatorisch mit widerlich schwüler Selbstmord-Romantik aufgeputzt ist (man lese die ersten Seiten!), nichts weiter zu sein scheint, als eine Aufforderung zu brutaler Befreiung von brutaler Knechtschaft. Daß dieses Eine ganz verkannt oder ganz verschwiegen ist: eine Reform der Jugend müßte hervorbrechen, auch wenn unsere Schule die vollkommenste wäre. Von der neuen Jugend, die aus dem Bewußtsein ihrer selbst als jugendlicher Menschen wieder einen höchsten Sinn und Zweck in ihr Dasein legt, sollte vor allem sprechen, wer sich an die Jugend wendet.
Im Lichte einer solchen Anschauung erscheint die heutige Schule von selbst als Ruine.
Diejenigen, die den neuen Geist in der Jugend zum Bewußtsein seiner selbst bringen, werden die größten Reformatoren auch der Schule werden.
Trotzdem im einzelnen die Schrift hie und da wahre Gedanken enthält, kann man ihr nur wünschen, daß der Schulreformer sie zu den Akten lege, daß kein »kindlicher« Geist sich an ihrem gefährlichen Feuer entzünden möge.
Lily Braun, Die Emanzipation der Kinder. Eine Rede an die Schuljugend. München: Albert Langen (1911). 28 S. <<<
1924
Karl Hobrecker, Alte vergessene Kinderbücher.
Berlin: Mauritius-Verlag 1924. 160 S.
Ein Buch, dem niemand auf den ersten Blick sein bibliographisches Fundament, seine Herkunft aus vieljährigem Sammlerstudium ansieht: »Alte vergessene Kinderbücher« von Karl Hobrecker. So vorzüglich – sorgfältig und temperamentvoll zugleich – hat der Mauritius-Verlag in Gemeinschaft mit dem Verfasser es auszustatten gewußt, daß man glaubt, eines jener erfreulichen Werke selber in Händen zu haben, von denen es handelt. Die bunte Umschlagzeichnung, schwarze und farbige Textbilder in Fülle geben Proben aus dem Schatze der Sammlung Hobrecker, von dessen Bedeutung die Bescheidenheit des Autors freilich nicht mehr verrät, als es der Gegenstand durchaus erfordert. Ein hervorragendes Anschauungsmaterial wird selbst den Flüchtigen mit dem Charme berühren, dem jeder Sammler dieser Dinge einmal unterlegen sein muß.
Vom Sammler von Kinderbüchern als einem Typus kann man vielleicht erst seit dem Aufschwung der Bibliophilie reden, der zwischen 1919 und 1923 aus teils mehr, teils minder erfreulichen Ursachen sich vollzog. Damals hatte Hobrecker längst seinen Posten bezogen und mit dem Glück, das dem beharrlichen Liebhaber hier sich nie verweigert, die Fülle dessen vereinigt, was heute als unauffindbar rangieren muß. Aus dieser Sammlung, die ihr Bereich aus reiner, interesseloser Neigung zur Sache erst entdeckt und geschaffen hat, ist diese erste Geschichte des Kinderbuches, die vom zünftigen, pädagogischen Standpunkt sich emanzipiert hat, erwachsen. Dem entspricht die hier und da vernehmlich streitbare Tonart, mit der die schulmeisterlichen Moralitäten, wie sie seit der Aufklärung mit wirklich erstaunlicher Zähigkeit im Schrifttum für Kinder sich gehalten haben, verabschiedet werden. Kurz und markant wird die Entstehung des eigentlichen Kinderbuches aus Fibel, Märchen, Volksbuch, Lied und Klassik entwickelt. Bis in die dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts währt die Vormundschaft des erbaulichen, des belehrenden, des moralischen Zwecks. Der Textteil erweist sich starrer und konservativer als die anschauliche Gestaltung des Buches, in dem schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Abbildung (auch außerhalb der Anschauungsbilderbücher – Comenius, Basedow –) an Raum und Bedeutung gewinnt. Mit dem Biedermeier ist der farbige Kupfer für das Kinderbuch obligat geworden. Diese Periode, deren Reizen der Autor nicht fühllos gegenüber steht, wie seine schöne Hymne auf ihre Koloristik zeigt, tritt ihm, dem bekannten Hosemann-Forscher, doch zurück gegen die vierziger bis sechziger Jahre, den »Höhepunkt« – wie er sie überschreibt –, den die Herrschaft des großen Berliner Jugendschriften-Verlages Winckelmann und Söhne bezeichnet. Hier aber – und das ist vielleicht für Hobrecker den Sammler und Historiker das Charakteristische – erlahmt sein Interesse nicht, sondern geht ungebrochen ins Jahrhundert-Ende hinüber von Hosemann zu Oskar Pletsch, von Theodor Dielitz zu Julius Lohmeyer. Auf diesem letzten Wegstück dürfte seine Gefolgschaft sich vielleicht etwas lichten. Denn beim Aufschwung des Interesses für Kinderbücher spielt ganz unverkennbar künstlerische und technische Anteilnahme an primitiven, rein handwerklich gestimmten Dokumenten, wie sie mit dem Expressionismus aufkam, die größte Rolle. Primitive, anonyme und handwerkliche Produktion wird nach 1850 selten, die Fabrikation wird industrialisiert. Der Ruf des Künstlers fällt mehr und mehr ins Gewicht. Und damit ist eine wachsende Abhängigkeit von dem problematischen Schönheits- und Bildungsideal des Publikums gegeben. Schönheit, Kindlichkeit und Lieblichkeit der Typen findet sich weit robuster in den früheren Arbeiten des Jahrhunderts bedeutet als in den epigonal gestimmten Sachen des Jahrhundert-Endes. So sind denn solche Stücke in den Reproduktionen des Werkes mit Recht um so weniger berücksichtigt, als es den alten vergessenen Kinderbüchern gewidmet ist.
Im unübersehbaren Meer dieser Literatur bezeichnet ein katalogartiger Anhang mit mehr als 175 Titeln einige bibliographische Inseln. Auf einem Gebiet, wo jedes 40. oder 50. Exemplar ein Unikat ist, kann selbstverständlich an eine förmliche Bibliographie nicht gedacht werden, am wenigsten heute, da noch alle Vorarbeiten fehlen. Und für manchen Sammler dürfte Hobreckers kleines Verzeichnis mit einer Desideratenliste schon zusammenfallen. Deswegen wird er es ihm danken.
»Warum sammeln Sie Bücher?« – Hat man jemals die Bibliophilen mit einer solchen Umfrage zur Selbstbesinnung aufgefordert? Wie interessant wären die Antworten, zumindest die aufrichtigen. Denn nur der Uneingeweihte kann glauben, es gäbe nicht auch hier zu verhehlen und zu beschönigen. Hochmut, Einsamkeit, Verbitterung – das ist die Nachtseite so mancher hochgebildeten und glückhaften Sammlernatur. Hin und wieder zeigt jede Passion ihre dämonischen Züge; davon weiß die Geschichte der Bibliophilie zu sagen wie nur eine. – Nichts davon in dem Sammlercredo Karl Hobreckers, dessen große Sammlung von Kinderbüchern durch sein Werk1 nun dem Publikum bekannt wird. Wem die freundliche, feine Person, wem das Buch auf jeder Seite es nicht sagen würde, dem wäre die bloße Überlegung genug: dieses Sammelgebiet – das Kinderbuch – entdecken konnte nur, wer der kindlichen Freude daran die Treue gehalten hat. Sie ist der Ursprung seiner Bücherei, und einen gleichen wird jede ähnliche brauchen, um zu gedeihen. Ein Buch, ja eine Buchseite, ein bloßes Bild im altmodischen, vielleicht von Mutter und Großmutter her überkommenen Exemplar kann der Halt sein, um den die erste zarte Wurzel dieses Triebes sich rankt. Tut nichts, daß der Umschlag locker ist, Seiten fehlen und hin und wieder ungeschickte Hände die Holzschnitte betuscht haben. Die Suche nach dem schönen Exemplar hat ihr Recht, aber gerade hier wird sie dem Pedanten den Hals brechen. Und es ist gut, daß die Patina, wie ungewaschene Kinderhände sie über die Blätter legen, den Büchersnob fernhält.
Als vor 25 Jahren Hobrecker seine Sammlung begründete, waren alte Kinderbücher Makulatur. Er zuerst hat ihnen ein Asyl eröffnet, wo sie auf absehbare Zeit vor der Papiermühle gesichert sind. Unter den mehreren tausend, die seine Schränke füllen, mögen hunderte allein bei ihm, in einem letzten Exemplar, sich finden. Durchaus nicht mit seiner Würde und Amtsmiene tritt dieser erste Archivar des Kinderbuches mit seinem Werk vors Publikum. Er wirbt nicht um Anerkennung seiner Arbeit, sondern um Anteil an dem Schönen, das sie ihm erschlossen hat. Alles Gelehrte, insbesondere ein bibliographischer Anhang von etwa zweihundert der wichtigsten Titel ist Beiwerk, das dem Sammler willkommen ist, ohne den Fernerstehenden zu behelligen. Das deutsche Kinderbuch – so führt der Autor in dessen Geschichte ein – entstand mit der Aufklärung. Die Philanthropen machten mit ihrer Erziehung die Probe auf das Exempel des großen humanitären Bildungsprogramms. War der Mensch fromm, gut und gesellig von Natur, so mußte es gelingen, aus dem Kinde, dem Naturwesen schlechtweg, den frömmsten, besten und geselligsten heranzuziehen. Und da in aller theoretisch gestimmten Erziehung die Technik des sachlichen Einflusses erst spät entdeckt wird und die problematischen Vermahnungen den Anfang machen, so ist auch das Kinderbuch in den ersten Jahrzehnten erbaulich, moralistisch und variiert den Katechismus samt Auslegung im Sinn des Deismus. Mit diesen Texten geht Hobrecker streng ins Gericht. Ihre Trockenheit, selbst Bedeutungslosigkeit für das Kind wird sich oft nicht abstreiten lassen. Doch sind diese überwundenen Fehler geringfügig gegen die Verirrungen, welche dank der vermeintlichen Einfühlung in das kindliche Wesen heute im Schwange sind: die trostlose verzerrte Lustigkeit der gereimten Erzählungen und die grinsenden Babyfratzen, die von gottverlassenen Kinderfreunden dazu gemalt werden. Das Kind verlangt vom Erwachsenen deutliche und verständliche, doch nicht kindliche Darstellung. Am wenigsten aber das was der dafür zu halten pflegt. Und weil selbst für den entlegenen und schweren Ernst, wenn er nur aufrichtig und unreflektiert von Herzen kommt, das Kind genauen Sinn hat, mag auch für jene altfränkischen Texte sich manches sagen lassen. Neben Fibel und Katechismus steht am Anfang des Kinderbuches das Anschauungslexikon, das illustrierte Vokabelbuch oder wie man den »Orbis pictus« des Amos Comenius sonst nennen will. Auch dieser Form hat die Aufklärung sich auf ihre Weise bemächtigt und das monumentale Basedowsche »Elementarwerk« geschaffen. Dies Buch ist vielfach auch textlich erfreulich. Denn neben einem weitschweifigen Universalunterricht, der zeitgemäß den »Nutzen« aller Dinge ins rechte Licht rückt – den der Mathematik wie den des Seiltanzens – kommen moralische Geschichten von einer Drastik vor, die nicht unfreiwillig das Komische streift. Bei diesen beiden Werken hätte das spätere »Bilderbuch für Kinder« eine Erwähnung verdient. Es umfaßt zwölf Bände mit je hundert kolorierten Kupfertafeln und erschien unter F. J. Bertuchs Leitung in Weimar von 1792 bis 1847. Diese Bilderenzyklopädie beweist in ihrer sorgfältigen Ausführung, mit welcher Hingabe damals für Kinder gearbeitet wurde. Heute würden die meisten Eltern sich vor der Zumutung entsetzen, eine solche Kostbarkeit in Kinderhände zu legen. Bertuch fordert in seiner Vorrede ganz unbefangen zum Ausschneiden der Bilder auf. Endlich sind Märchen und Lied, in gewissem Abstand auch Volksbuch und Fabel ebenso viele Quellen für den Textgehalt der Kinderbücher. Selbstverständlich die reinsten. Ist es doch ein durch und durch modernes Vorurteil, aus dem die neuere romanartige Jugendschrift, ein wurzelloses Gebilde voll von trüben Säften, hervorgegangen ist. Dieses nämlich, daß Kinder so abseitige, inkommensurable Existenzen seien, daß man ganz besonders erfinderisch zur Produktion ihrer Unterhaltung sein müsse. Es ist müßig, auf die Herstellung von Gegenständen – Anschauungsmitteln, Spielzeug oder Büchern – die den Kindern gemäß wären, krampfhaft bedacht zu sein. Seit der Aufklärung ist das eine der muffigsten Grübeleien des Pädagogen. In seiner Befangenheit übersieht er, daß die Erde voll von reinen unverfälschten Stoffen kindlicher Aufmerksamkeit ist. Und von den bestimmtesten. Kinder nämlich sind auf besondere Art geneigt, jedwede Arbeitsstätte aufzusuchen, wo sichtbare Betätigung an den Dingen vor sich geht. Unwiderstehlich fühlen sie sich vom Abfall angezogen, der sei es beim Bauen, bei Garten- oder Tischlerarbeit, beim Schneidern oder wo sonst immer entsteht. In diesen Abfallprodukten erkennen sie das Gesicht, das die Dingwelt gerade ihnen, ihnen allein zukehrt. Mit diesen bilden sie die Werke von Erwachsenen nicht sowohl nach als daß sie diese Rest- und Abfallstoffe in eine sprunghafte neue Beziehung zueinander setzen. Kinder bilden sich damit ihre Dingwelt, eine kleine in der großen, selbst. Ein solches Abfallprodukt ist das Märchen, das gewaltigste vielleicht, das im geistigen Leben der Menschheit sich findet: Abfall im Entstehungs- und Verfallsprozeß der Sage. Mit Märchenstoffen vermag das Kind so souverän und unbefangen zu schalten wie mit Stoffetzen und Bausteinen. In Märchenmotiven baut es seine Welt auf, verbindet es wenigstens ihre Elemente. Vom Lied gilt ähnliches. Und die Fabel – »die Fabel in ihrer guten Form kann ein Geistesprodukt von wunderbarer Tiefe darstellen, dessen Wert die Kinder wohl in den wenigsten Fällen erkennen. Wir dürfen auch bezweifeln, daß die jugendlichen Leser sie der angehängten Moral wegen schätzten oder sie zur Schulung des Verstandes benutzten, wie es bisweilen kinderstubenfremde Weisheit vermutete und vor allem wünschte. Die Kleinen freuen sich am menschlich redenden und vernünftig handelnden Tier sicherlich mehr als am gedankenreichsten Text.« »Die spezifische Jugendliteratur« – so heißt es an anderer Stelle – »begann mit einem großen Fiasko, soviel ist sicher.« Und dabei, dürfen wir hinzufügen, ist es in sehr vielen Fällen geblieben.
Eines rettet selbst den altmodischsten, befangensten Werken dieser Epoche das Interesse: die Illustration. Diese entzog sich der Kontrolle der philanthropischen Theorien, und schnell haben über die Köpfe der Pädagogen hinweg Künstler und Kinder sich verständigt. Nicht als ob diese ausschließlich mit Rücksicht auf jene gearbeitet hätten. Die Fabelbücher zeigen, daß verwandte Schemata an den verschiedensten Stellen mehr oder weniger variiert auftauchen. Ebenso weisen die Anschauungsbücher z. B. in der Darstellung der sieben Weltwunder auf Kupfer des 17. Jahrhunderts, vielleicht auch noch weiter, zurück. Vermutungsweise sei gesagt, daß die Illustration dieser Werke in historischem Zusammenhang mit der Emblematik des Barock stehe. Die Gebiete sind sich nicht so fremd wie man wohl denken möchte. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts tauchen Bilderbücher auf, die eine bunte Menge von Sachen auf einem Blatte – und ohne irgend welche figurale Vermittlung – zusammenstellen. Es sind Gegenstände, die mit dem gleichen Buchstaben beginnen: Apfel, Anker, Acker, Atlas u. dgl. Ein oder mehrere fremdsprachige Übersetzungen dieser Vokabeln sind beigegeben. Die künstlerische Aufgabe, so gestellt, ist derjenigen verwandt, welche die bilderschriftartige Kombination allegorischer Gegenstände den Zeichnern des Barock stellte, und in beiden Epochen entstanden ingeniöse hochbedeutende Lösungen. Nichts auffallender, als daß im 19. Jahrhundert, das für seinen Zuwachs an universalem Wissen so reichlich Kulturgüter des vorhergehenden dahingehen mußte, das Kinderbuch weder textlich noch illustrativ Einbuße erlitt. Zwar kommen so fein kultivierte Werke wie die Wiener »Fabeln des Äsopus« (Zweite Auflage bey Heinr. Friedr. Müller, Wien o.J.), die Hobreckers Verzeichnis beifügen zu können ich mich glücklich schätze, nach 1810 nicht mehr vor. Es ist überhaupt nicht das Raffinement in Stich und Kolorit, in dem das Kinderbuch des 19. Jahrhunderts mit den Vorgängern wetteifern könnte. Sein Reiz liegt zum guten Teil im Primitiven, in den Dokumenten einer Zeit, da die alte Manufaktur mit den Anfängen neuer Techniken sich auseinandersetzt. Seit 1840 hatte die Lithographie die Herrschaft, während vorher im Kupferstich noch häufig Motive des 18. Jahrhunderts begegnen. Das Biedermeier, die zwanziger und dreißiger Jahre, sind nur im Kolorit charakteristisch und neu. »Mir scheint in jener biedermeierlichen Zeit eine Vorliebe für Karmin, Orange und Ultramarin zu bestehen, auch ein leuchtendes Grün wird vielfach verwendet. Wo bleiben neben diesen funkelnden Gewändern, neben dem Azur des Himmels, den wildwabernden Flammen der Vulkane und Feuersbrünste, die einfach schwarz-weißen Kupfer und Steindrucke, wie sie für die langweiligen großen Leute im allgemeinen gut genug waren? Wo blühen wieder solche Rosen, wo leuchten solch rotbackige Äpfel und Gesichter, wo blinken noch solche Husaren in grünem Dolman und gelbverschnürtem, krapprotem Waffenkleide? Selbst der schlichte, mausgraue Zylinder des edlen Vaters, die lohgelbe Kopfbedeckung der schönen Mutter rufen unsere Bewunderung wach.« Diese selbstgenügsam prangende Farbenwelt ist durchaus dem Kinderbuch vorbehalten. Die Malerei streift, wo in ihr die Farbigkeit, das Durchsichtige oder glühend Bunte der Töne ihre Beziehung zur Fläche beeinträchtigt, den leeren Effekt. Bei den Bildern der Kinderbücher bewirkt es jedoch meist der Gegenstand und die Selbständigkeit der graphischen Unterlage, daß an eine Synthese von Farbe und Fläche nicht gedacht werden kann. In diesen Farbenspielen ergeht sich aller Verantwortung entbunden die bloße Phantasie. Die Kinderbücher dienen ja nicht dazu, ihre Betrachter in die Welt der Gegenstände, Tiere und Menschen, in das sogenannte Leben unmittelbar einzuführen. Ganz allmählich findet deren Sinn im Außen sich wieder und nur in dem Maße wie es als ihnen gemäßes Inneres ihnen vertraut wird. Die Innerlichkeit dieser Anschauung steht in der Farbe und in deren Medium spielt das träumerische Leben sich ab, das die Dinge im Geiste der Kinder führen. Sie lernen am Bunten. Denn nirgends ist so wie in der Farbe die sehnsuchtslose sinnliche Kontemplation zuhause.
Die merkwürdigsten Erscheinungen aber treten gegen Ende des Biedermeier, mit den vierziger Jahren, gleichzeitig mit dem Aufschwung der technischen Zivilisation und jener Nivellierung der Kultur auf, die nicht ohne Zusammenhang damit war. Der Abbau der mittelalterlichen sphärisch gestuften Lebensordnungen war damals vollendet. In ihm waren gerade die feinsten edelsten Substanzen oft zu unterst geraten, und so kommt es, daß der Tieferblickende gerade in den Niederungen des Schrift- und Bildwerks, wie in den Kinderbüchern, diese Elemente findet, die er in den anerkannten Kulturdokumenten vergeblich sucht. Das Ineinandersinken aller geistigen Schichten und Aktionsweisen wird so recht deutlich an einer Bohèmeexistenz jener Tage, die in Hobreckers Darstellung leider keinen Platz gefunden hat, obwohl einige der vollendetsten, freilich auch seltensten Kinderbücher ihr zu verdanken sind. Es ist Johann Peter Lyser, der Journalist, Dichter, Maler und Musiker. Das »Fabelbuch« von A. L. Grimm mit Lysers Bildern (Grimma 1827), das »Buch der Mährchen für Töchter und Söhne gebildeter Stände« (Leipzig 1834), Text und Bilder von Lyser, und »Linas Mährchenbuch«, Text von A. L. Grimm, Bilder von Lyser (Grimma o. J.) – das sind drei seiner schönsten Kinderschriften. Das Kolorit ihrer Lithographien sticht von dem brennenden des Biedermeier ab und paßt um so besser zu dem verhärmten, abgezehrten Ausdruck mancher Gestalten, der schattenhaften Landschaft, der Märchenstimmung, die nicht frei ist von einem ironisch-satanischen Einschlag. Das Niveau der Kolportage, auf dem diese originale Kunst sich entwickelte, dokumentiert sich am schlagendsten in den vielbändigen, mit selbstentworfenen Lithographien gezierten »Abendländischen tausendundeinen Nacht«. Ein grundsatzloses, aus trüben Quellen geschöpftes Sammelsurium von Märchen, Sage, örtlicher Legende und Schauermär, welches in den dreißiger Jahren bei F. W. Goedsche in Meißen erschienen ist. Die banalsten Städte Mitteldeutschlands – Meißen, Langensalza, Potschappel, Grimma, Neuhaldensleben – treten für den Sammler in einen magischen topographischen Zusammenhang. Oft mögen da Schullehrer als Schriftsteller und Illustratoren in einer Person gewirkt haben, und man male sich aus, wie es in einem Büchlein aussieht, das auf 32 Seiten und 8 Lithographien der Jugend von Langensalza die Götter der Edda vorstellt.
Für Hobrecker aber liegt der Brennpunkt des Interesses weniger hier als in den vierziger bis sechziger Jahren. Und zwar in Berlin, wo der Zeichner Theodor Hosemann seine liebenswürdige Begabung vor allem an die Illustration von Jugendschriften wandte. Auch den weniger durchgearbeiteten Blättern gibt eine anmutige Kälte der Farbe, eine sympathische Nüchternheit im Ausdruck der Figuren einen Stempel, an dem jeder geborne Berliner seine Freude haben kann. Freilich werden die früheren, weniger schematischen und weniger häufigen Arbeiten des Meisters, wie die reizenden Illustrationen zur »Puppe Wunderhold«, ein Prachtstück der Sammlung Hobrecker, für den Kenner vor jenen geläufigeren rangieren, die kenntlich am uniformen Format und Verlagsvermerk »Berlin Winckelmann & Söhne« in allen Antiquariaten begegnen. Neben Hosemann wirkten Ramberg, Richter, Speckter, Pocci, von den Geringeren zu schweigen. Für die kindliche Anschauung eröffnet in ihren schwarz-weißen Holzschnitten sich eine eigene Welt. Ihr ursprünglicher Wert ist dem der kolorierten gleich: seine polare Ergänzung. Das farbige Bild versenkt die kindliche Phantasie träumerisch in sich selbst. Der schwarz-weiße Holzschnitt, die nüchterne prosaische Abbildung führt es aus sich heraus. Mit der zwingenden Aufforderung zur Beschreibung, die in dergleichen Bildern liegt, rufen sie im Kinde das Wort wach. Wie es aber diese Bilder mit Worten beschreibt, so beschreibt es sie in der Tat. Es wohnt in ihnen. Ihre Fläche ist nicht wie die farbige ein Noli me tangere – weder ist sie’s an sich noch für das Kind. Vielmehr ist sie gleichsam nur andeutend bestellt und einer gewissen Verdichtung fähig. Das Kind dichtet in sie hinein. Und so kommt es, daß es auch in der anderen, der sinnlichen Bedeutung diese Bilder »beschreibt«. Es bekritzelt sie. Es lernt an ihnen zugleich mit der Sprache die Schrift: Hieroglyphik. Die echte Bedeutung dieser schlichten graphischen Kinderbücher liegt also weit ab von der stumpfen Drastik, um deretwillen die rationalistische Pädagogik sie empfahl. Aber auch hier bestätigt sich: »Der Philister hat oft in der Sache Recht, aber nie in den Gründen.« Denn keine anderen Bilder führen wie diese das Kind in Sprache und Schrift ein eine Wahrheit, in deren Gefühl man den ersten Worten der alten Fibeln die Zeichnung dessen mitgab, was sie bedeuten. Farbige Fibelbilder wie sie jetzt aufkommen sind eine Verirrung. Im Reich der farblosen Bilder erwacht das Kind, wie es in dem der bunten seine Träume austräumt.
In aller Historiographie gehört die Auseinandersetzung über das Jüngstvergangene zum Strittigen. Das ist auch in der harmlosen Geschichte des Kinderbuches nicht anders. Über die Einschätzung der Jugendbücher vom letzten Viertel des 19. Jahrhunderts an werden am leichtesten die Meinungen auseinandergehen. Vielleicht hat Hobrecker, wenn er den aufdringlichen Schulmeisterton an den Pranger stellt, verstecktere Mißstände des neueren Jugendschrifttums weniger beachtet. Auch lag es seiner Aufgabe ferner. Der Stolz auf ein psychologisches Wissen vom kindlichen Innenleben, das an Tiefe und Lebenswert nirgends mit einer alten Pädagogik wie der Jean-Paulschen »Levana« zu messen ist, hat eine Literatur großgezogen, die im selbstgefälligen Buhlen um die Aufmerksamkeit des Publikums den sittlichen Gehalt verloren hat, der den sprödesten Versuchen der klassizistischen Pädagogik ihre Würde gibt. An seine Stelle ist die Abhängigkeit von den Schlagworten der Tagespresse getreten. Die heimliche Verständigung zwischen dem anonymen Handwerker und dem kindlichen Betrachter fällt fort; Schreiber wie Illustrator wenden sich mehr und mehr durch das unlautere Medium der akuten Sorgen und Moden zum Kinde. Die süßliche Geste, die nicht dem Kinde, sondern den verdorbenen Vorstellungen von ihm entspricht, wird in den Bildern heimisch. Das Format verliert die edle Unscheinbarkeit und wird aufdringlich. In all diesem Kitsch liegen freilich die wertvollsten kulturhistorischen Dokumente, aber sie sind noch zu neu, als daß die Freude an ihnen rein sein könnte.
Wie dem nun sei: in dem Hobreckerschen Werke selbst waltet, seiner innern wie äußern Gestalt nach, der Charme der liebenswürdigsten romantischen Kinderbücher. Holzschnitte, farbige Vollbilder, Schattenrisse und feinkolorierte Darstellungen im Text machen es zu einem überaus erfreulichen Hausbuche, mit dem nicht allein der Erwachsene sein Vergnügen hat, sondern an dem sehr wohl sich Kinder versuchen können, um in den alten Fibeltexten zu buchstabieren oder unter den Bildern sich Malvorlagen zu suchen. Dem Sammler aber wird einzig die Befürchtung, die Preise steigen zu sehen, einen Schatten auf seine Freude werfen. Dafür bleibt ihm die Hoffnung, ein oder das andere Bändchen, das achtlos der Zerstörung preisgegeben war, möge diesem Werke seine Erhaltung zu danken haben.
Karl Hobrecker, Alte vergessene Kinderbücher. Berlin: Mauritius-Verlag 1924. 160 S. <<<
1926
Friedensware
»Paris ist unser Ziel!«
In Rom, in Zürich, in Paris – kurz, hatte man den deutschen Boden einmal verlassen, wo man wollte – waren von 1920 bis 1923 deutsche Erzeugnisse für die Hälfte des Preises zu finden, den man im Ausland, ja in Deutschland selbst, sonst für die gleichen Waren anzulegen hatte. Damals begannen die Grenzen sich wieder zu öffnen und der Reisende trat seine Tour an. Vom Ausverkauf mußte man leben und je höher der Dollar stieg, desto größer wurde der Kreis der Ausfuhrgüter. Er schloß im Höhepunkt der Katastrophe auch geistiges Kulturgut in sich ein. Die kantische Idee des ewigen Friedens – schon längst im geistig mittellosen Inland unanbringlich – stand unter jenen spirituellen Ausfuhrartikeln an erster Stelle. Unkontrollierbar in ihrer Verarbeitung, nun seit zehn Jahren schon ein Ladenhüter, war sie lieferbar zu konkurrenzlosen Preisen und kam, die Wege des seriöseren Exports zu ebnen, wie gerufen. An wahre Friedensqualität war nicht zu denken. Das rauhe hausgemachte Gedankengespinst Immanuel Kants hatte zwar als höchst strapazierbar sich erwiesen, doch sagte es dem breiteren Publikum nicht zu. Hier galt es, dem modernen Geschmack der bürgerlichen Demokratien Rechnung zu tragen, ein bunteres Fähnchen auf den Markt zu bringen und noch dazu den Reisenden zu finden, der über jeden nötigen Elan der Geste aus dem dreimal gelockerten Handgelenk des Journalisten und des Stifts zugleich verfügte. Daß der Reserveleutnant ehemals als Reisender besonders gern gesehen war, ist bekannt. Er war in besseren Kreisen gut eingeführt. Das gilt denn auch durchaus von Herrn von Unruh, der 1922 als Stadtreisender für den ewigen Frieden den Pariser Platz bearbeitet hat. Freilich – und dies war danach angetan, für Augenblicke Herrn von Unruh selber stutzig zu machen ist seine Einführung in französische Kreise vor Jahren bei Verdun nicht ohne Aufsehen, nicht ohne Lärm, nicht ohne Blutvergießen abgegangen. Wie dem auch sei – der Bericht, den er vorlegt – »Flügel der Nike – Buch einer Reise«1 – besagt, daß seine Fühlung mit dem Kundenkreise sich behauptet hat, auch als er nicht mehr schwere Munition, sondern Friedensware bemustert vorlegte. Nicht gleich bestimmt mag sich versichern lassen, daß die Veröffentlichung seines Reisejournals – die Liste seiner Kunden und getätigten Abschlüsse – dem ferneren Geschäftsgang von Nutzen ist. Denn sie war nicht sobald erfolgt, als man die Ware aus Paris zu retournieren begann.
In jedem Falle ist es äußerst lehrreich, den Pazifismus Herrn von Unruhs näher zu prüfen. Seitdem sich die vermeinte Konvergenz der sittlichen Idee und der des Rechts, auf deren Voraussetzung die europäische Evidenz der kantischen Friedenslehre beruhte, im Geist des 19. Jahrhunderts zu lösen begann, wies immer deutlicher der deutsche »Friede« auf die Metaphysik als den Ort seiner Grundlegung. Das deutsche Friedensbild entspringt der Mystik. Demgegenüber hat man längst bemerkt, daß der Friedensgedanke der westeuropäischen Demokratien durchaus ein weltlicher, politischer und letzten Endes juristisch vertretbarer ist. Die pax ist ihnen Ideal des Völkerrechts. Dem entspricht das Instrument der Schiedsgerichte und Verträge praktisch. Von diesem großen sittlichen Konflikt des schrankenlosen und bewehrten Friedensrechts mit einer friedlichen Gerechtigkeit, von alledem was je im Laufe der Geschichte dies Thema mannigfach instrumentierte, ist ebenso wie von den weltgeschichtlichen Gegebenheiten dieser Stunde in Herrn von Unruhs Pazifismus nicht die Rede. Vielmehr sind die großen Diners die einzigen internationalen Fakten, denen sein neuer Pazifismus Rechnung trägt. Im Frieden der gemeinsamen Verdauung ist seine Internationale ausgebrütet und das Galamenü ist die magna charta des künftigen Völkerfriedens. Und wie ein übermütiger Kumpan beim Liebesmahl ein kostbares Gefäß zerschmeißt, so wird die spröde Terminologie des königsberger Philosophen mit dem Tritt eines Kanonenstiefels zum Teufel befördert und was übrigbleibt ist die Innerlichkeit des himmelnden Auges in seiner schönen alkoholischen Glasigkeit. Das Bild des begnadeten Schwätzers mit tränenden Blicken, wie nur Shakespeare es festhalten konnte! – Die große Prosa aller Friedenskünder sprach vom Kriege. Die eigne Friedensliebe zu betonen, liegt denen nahe, die den Krieg gestiftet haben. Wer aber den Frieden will, der rede vom Krieg. Er rede vom vergangenen (heißt er nicht Fritz von Unruh, welcher gerade davon einzig und allein zu schweigen hätte), er rede von dem kommenden vor allem. Er rede von seinen drohenden Anstiftern, seinen gewaltigem Ursachen, seinen entsetzlichsten Mitteln. Doch wäre das vielleicht der einzige Diskurs, gegen den die Salons, die Herrn von Unruh sich geöffnet haben, vollkommen lautdicht abgeschlossen sind? Der vielberufene Friede, der schon da ist, erweist bei Licht besehen sich als der eine – und einzig »ewige«, der uns bekannt ist – dessen jene genießen, die im Krieg kommandiert haben und beim Friedensfest tonangebend sein wollen. Das ist denn Herr von Unruh auch geworden. »Wehe« ruft sein kassandrisches Kauderwelsch über alle, die nicht zur rechten Zeit – das wäre etwa zwischen Fisch und Braten – es inne wurden, daß die »innere Umkehr« die einzig passable Revolte ist und daß die »Revolution des Brotes« und die Machenschaften der Kommunisten zugunsten einer vom Souper geläutert sich erhebenden Gemeinschaft der »Kommunionisten« zurückzustehen haben, deren Innungsschild – kein Zweifel das Sektglas sein wird. Und akkurater konnte vor Versailles der Festpoet der Republik sich gar nicht äußern: »Wenn ich zwischen den gekrönten goldenen Gittern stehe – zerreißen möchte ich sie, diese ganze Buchsbaumanlage der Tyrannei!«
Wenn eins in alledem versöhnend stimmt, so ist es die Pietät, mit welcher der herangewachsene Dichter der kleinsten Phrase seines »Neugebauer« oder »Ploetz« die Treue hält. In welche Räume ruft er nicht zurück, wo der Schweizer ein »Landsmann Tells«, die Mappe des Briefträgers ein »Schicksalssack mit Leid und Freud« und Apfelsinen ›purpurne Sonnenfrüchte‹ gewesen sind! Wie der Pennäler in der letzten Stunde sich »große Männer« in die Schulbank schnitzt, so finden wir den Dichter, der verschlief, noch immer über den Lektionen seiner Flegeljahre sitzen. In Gegenden, durch die noch Schützengräben laufen, sieht er sich selber einziehen »wie Coriolan, als er in das Lager des Aufidius kam«, und träumt sich dann im Strom der Weltgeschichte weiter, bis er sich als den einzigen erkennt, der den »Mut hat… sich als Winkelried vor die Gegenwart hinzuwagen«. Wie er so winkelfriedlich spinnt, erwächst in ihm »das Schicksal wie eine Blume von unaussprechlicher Ahnung«, daneben aber auch das duftlos blühende Kräutchen des schlichten Blödsinns. »Das Wasser der Meere werden wir zünden, daß noch die Fische Begeisterung lernen« – so setzt er’s sich und seinen Kameraden vor. Dann wieder schrillt ein Pfiff in seine Träumerei und löst die Bilder pueriler Selbstbefriedigung aus. »Immer noch heult die Heulboje wie der Schrei aller Frauen, die wir unter uns stießen, ehe sie eine Stimme gehabt.« Das Deutsch des Herrn von Unruh macht an das Gehaben der Morphinisten denken, welche Mahlzeit wie Lektüre und Gespräch auf Augenblicke unterbrechen müssen, um durch die Droge Lebenskraft sich einzuspritzen. So brechen seine Sätze jäh ab und keine Periode findet zum Vorstoß die Kraft, ehe sie nicht an den Aromen einer fauligen Dingwelt noch einmal genippt. »›Nietzsche!‹ Der Diener präsentiert den hohen Aufbau eines Erdbeereises.« »›Wollen Sie damit sagen‹, kippt Melchior einen Grand-Marnier hinter die Zähne.« Doch weil in diesem Buch wie nirgends sonst Gourmets versorgt und Wort und Speise aufgefahren sind, von denen Tisch und Leser zum Brechen voll werden, so will auch ein erlesener Laut bisweilen nur unter dem Hautgout des faulen Stils geschmeckt sein. Dem Kenner würzt ein hölderlinsches »O« (»daß du liebst … und Dein Auge so glänzt, das ist mir ein Wink, o ein Zeichen«) im Stadium der Verwesung den Sprachbrei nur um so besser.
Soviel vom Werdegang des desperaten Stils. Von dem Buche aber ein Mehreres. Da liegt nun der Abhub aller vierschrötigen Intimitäten, denen der Autor auf seinem Wege habhaft geworden ist. Ein wahrer Schindanger von Freundschaft, Dichterruhm und Frauenehre tut sich auf und wie frische Verstümmlungen stechen überall die leidigen Vornamen heraus. Da ist der hart gestrafte, der beklagenswerte »Jaques«. Was immer seine Schuld als Gönner eines solchen Gastes mag gewesen sein – da steht er nun als Partner des unendlichen Gefasels und hat gebüßt. Da sind »Agé«, sind Valéry, Drieu La Rochelle: sie alle in den öden Attitüden, die auf der Schmiere den »Causeur« bezeichnen. Da, gleich auf dem dritten Blatt, erscheint – herangewinkt wie man einem Chauffeur winkt – der deutsche »Stefan«. Und »die Noailles«, von deren »Schenkel« Unruh, sich »langsam aus den seidenen Polstern hebend«, abzurücken versucht. – Wohin, als in die Kneipe, wo man nach erledigtem Geschäft den guten Abschluß mit dem Kunden feiert, gehört diese ungewaschene Vertraulichkeit? An die Geschäftstour schließt der Bummel sich zwanglos an. Der Gast schleift seine Wirte durch die Stadt und vor dem Kneipendunst der Tafelrunde sperrt nun der Bürger Mund und Ohren auf, da er sich endlich Zeuge werden sieht, wie’s unterm Künstlervölkchen so frei dahergeht. Der Verfasser rülpst sich in Herzenslauten, und in der Ehrlichkeit seines seraphischen Pazifismus erkennt der Spießer freudig und erstaunt die sonore Bierehrlichkeit seiner früheren Kommilitonen wieder. Vom Abendstern gleitet immer wieder ein tränenfeuchter Blick zum Ordensstern herunter: denn das eiserne Kreuz erster Klasse im Kriege war dieser Brust, was der Schlag des erstklassigen Herzens darunter im Frieden. Allmählich kommt dann unter Schwüren und Geständnissen die Stunde der Zote herauf. Durchdringender sind Schweinereien in kein Ohr geflüstert und zimperlicher niemals stilisiert worden. Doch keine, der er ihre erbauliche Seite nicht abgewönne. Und endlich heben alle europäischen Renkontres dem Schmock sich gegen einen Hintergrund »nächtlicher Dirnen« ab, deren grobgemalter Prospekt das Reisepanorama schließt. Bewandert in Palästen und in Puffs, vor Pfeilerspiegeln und vor Pfützen gleich sehr zu Hause (wo immer einer sich bespiegeln kann: wie denn sein Bild in den eigenen Lackschuhen eine Abflucht von Tiefsinn im Autor wachruft), kann er das Fazit seiner Reise nicht prägnanter fassen, als in dem Traum, von dem er uns erzählt, daß ein französischer und ein deutscher Genius – Rodin und Lehmbruck – ihn, den Friedensboten, unwiderstehlich nach sich ziehen – zu zwei Huren. Die Geschäftsreise endet als Bierreise und die Völkerverständigung geht im Dreck aus. Denn weiter als die Dummheit dieses Buchs reicht die spiegelgeile Eitelkeit des Verfassers, höher als die Eitelkeit des Autors türmt der Unrat einer Produktion sich auf, an der ganz neu die theologische Erkenntnis sich bewährt, daß die Werke der Eitelkeit Schmutz sind. Er ist hier über beide Länderbreiten ausgegossen, daß kein großer und ehrlicher Name mehr bleibt, der von seinem Gestank nicht durchtränkt wäre.
Der PEN-Klub hat für Fritz von Unruh ein Diner gegeben. Ein wenig Blut an den Flügeln des Friedensengels – das macht ja in Europa keinen mehr irre. Doch galt das Essen nur dem Friedensboten? Vor allem galt es wohl dem Autor Fritz von Unruh. An der Festtafel saß ja der Dichter des »Reiterliedes«.
Reiterlied
Ulanen, stolz von Lützow her Mit Reitermut durchflogen, Beleidigt ist die deutsche Ehr’, Auf! in die Schlacht gezogen. Die Gäule raus, das Schwert zur Hand, Die Welt braucht uns Ulanen, Wir stürmen frisch in Feindes Land und hol’n uns welsche Fahnen. O Dasein, herrlich süßes Gut, Jetzt lernen wir dich lieben: Fürs Vaterland und deutsches Blut Bist du dem Tod verschrieben. Standarten hoch und vorwärts nun, Zu reden gibts nicht viel – Die heilge Pflicht, wir werden sie tun, Paris ist unser Ziel. Doch dieser Schwur sei ernst getan: Wie Gott auch bläst die Flammen – Wir Lützower stehn auf dem Plan Und hau’n die Welt zusammen.
Hier regt der neue, der verinnerlichte Pazifismus zum ersten Male seine tiefschwarzen Flügel. So fuhr der erste Schrei der Friedenskrähe über die Schlachtfelder. Sie kam – in ihrem Schnabel hielt sie die Palme des Kleistpreises. Von langer Hand – B. Z. am Mittag, 16. August 1914 – ist Paris das Ziel gewesen. Es ist erreicht.
Fritz von Unruh, Flügel der Nike. Buch einer Reise. Frankfurt a. M.: Societäts-Druckerei, Abt. Buchverlag 1925. 404 S. <<<
Alfred Kuhn, Das alte Spanien. Landschaft, Geschichte, Kunst.
Berlin: Verlag Neufeld u. Henius (1925). 184 S.
Das Buch löst seine Aufgabe, zur spanischen Reise zu stimmen, in durchaus sympathischer Weise. Es weckt die Neigung »eine Erde zu überqueren, deren Anblick von allem verschieden ist, was jenseits der Pyrenäen existiert«, und mit Recht erkennt die Vorrede in dem neuerwachten Interesse am elementar Ethnischen in seiner engen Verbindung mit religiösen Lebensverfassungen einen Impuls von vielen, die sich heute nach Spanien aufmachen. In das Land, wo afrikanische Kultur sich mit romanischer mehr noch verschlingt als auseinandersetzt, der Islam und das Christentum sich die Entscheidungsschlacht um Europa geliefert haben, führt der anspruchslose Text weiteste Kreise ein. Erfreulich berührt, daß die Kunst in textlicher und bildlicher Darstellung geziemend berücksichtigt ist, ohne, wie das oft geschieht, so stupid in den Vordergrund zu drängen, daß die notwendigen topographischen, historischen und kulturellen Daten darüber zu kurz kommen. Vielmehr sind »Landschaft, Mensch und Kunst« die drei Zentren, um welche die Darstellung sich gruppiert.
Hugo von Hofmannsthal, Der Turm.
Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. (München: Verlag der Bremer Presse 1925.) 158 S.
Mit seinem neuen Trauerspiel »Der Turm« greift Hofmannsthal auf die Gestaltenfülle des Barock zurück. Als der geheimnisreichsten einer aus der Menge tritt Calderons Prinz Sigismund in ein neues Leben. Dem Drama liegt ein Stoff im eminenten Sinne, der des spanischen »La vida es sueño« zugrunde: Das Leben ein Traum. Der Künstler aber wirkt nur in den Stoff hinein, indem er ihm gehorcht. Heißt »dichten« einen Stoff zur Auseinandersetzung mit sich selber bringen, so führt es oft durch eine Reihe von Stationen. Die großen Themen staffeln sich in Formen, von denen eine in die andere greift. Und nirgends gilt dies strenger als im Drama. Denn seine Form ist ein sehr wichtiger Index vom schöpferischen Willen eines Kollektivs. Dessen Gesetz aber besagt, daß in der Spannung zwischen Urform und Variante die echte, die produktive Intensität sich ausschwingt. Sie ist zu aller bloßen »Originalität« der Gegensatz. Die Zahl der fruchtbaren dramatischen Stoffe ist begrenzt; unendlich sind nur die Motive, die sie Form gewinnen lassen. Erfindung schlechtweg ist gerade im Dramatischen die Passion des Dilettanten. Der glaubt in ihr die »Originalität« verbürgt. Sie aber liegt, ihrem Begriffe nach, außerhalb des Kraftfeldes der historischen Spannungen, die das eigenste Leben des großen Dramas bestimmen.
Die geschichtliche Spannung, wie dieses neue Werk sowohl in sich wie im Verhältnis zu dem Calderonschen Urbild sie entfaltet, macht ihr höchstes Interesse aus. Man weiß, im Mittelpunkte jenes Dramas steht der Traum. Ein Königreich Polen »mehr der Sage als der Geschichte« ist dort, wie auch bei Hofmannsthal, der Schauplatz. Darinnen herrscht Basilius als König. Von seiner verstorbenen Gemahlin hat er einen Sohn Sigismund. Die Astrologen sehen dessen Horoskop voll Unheil. Der Mutter brachte er im Wochenbett den Tod, der Vater fürchtet weitere Erfüllung jenes Spruchs, der angibt, daß der Sohn die väterliche Krone rauben werde. Daher verbirgt man ihn an einem abgelegenen Ort. In einem Turme wächst der junge Sigismund heran. Mit niemandem als seinem Wärter darf er reden, nicht frei umhergehen, Ketten schmieden ihn an sein Gefängnis. Der väterliche Argwohn des Tyrannen steht bei Calderon, dem hohen Funktionär an Philipps Hofe, nicht außer allem Verhältnis zu Natur- und Staatsrecht. In seiner Weisheit gibt vielmehr der Fürst dem Prinzen die Gelegenheit zu einer Probe. Den Schlafenden entführt man auf das väterliche Schloß, und hier erwacht er, wird als Prinz begrüßt und zeigt in Spiel und Gegenspiel sein wahres Wesen. Zorn, Wollust, Mißgunst, Hochmut brechen aus dem Innern des fürstlichen Caliban. Es bleibt nichts übrig als ihn zu entfernen und dem von neuem in die Kerkernacht versenkten »Dies alles ist ein Traum gewesen« einzuschärfen. Was kommt, entscheidet sich in dieser zwiefach irrealen Schicht vermeinten Träumens. Der Prinz im Grübeln, dekretiert am Ende: »Doch sey’s Traum, seys Wahrheit eben: / Recht thun muss ich; war’ es Wahrheit, / Desshalb, weil sie’s ist; und war’ es / Traum, um Freunde zu gewinnen, / Wenn die Zeit uns wird erwecken.« Da ruft der Vater aus freien Stücken ihn auf den Thron, der Spruch der Weisen erfüllt sich zu aller Glück, die Drohung der dämonischen Natur aber hat christliche Vorsicht vereitelt.
Dies ist der Stoff, der um neues Leben den Dichter anging. Der Traum als Angelpunkt historischen Geschehens – das ist seine faszinierende, befremdliche Formel. Was konnte Hofmannsthal bestimmen, ihrem Aufruf zu entsprechen? Durch das, was nur »Variante« eines Stoffes ist, glückt ihm, aufs tiefste eine Form zu wandeln, zu bewegen. Calderon schrieb ein »Schauspiel«, in dem die spielerischen, die romanisch-romantischen Momente zu erstaunlichster Entfaltung kommen. Der Spanier umreißt die ganze, höchst barocke Spannung seines Stoffes innerlich. Als Reflexion, in der Volute rollt er ihn zusammen. Im »Turm« ist, was sich dort verschlungen, aufgerollt. Die Unnatur jener väterlichen Gewalt, das Martyrium dieses prinzlichen Daseins sind beim Namen genannt. Vielmehr in einer – auch im Theatralischen – unvergleichlichen Hauptszene nennen sie sich selber beim Namen. In den Schranken dieser neuen »Traumszene« rast nicht die blinde Kreatur sich aus, die leidende hält über ihren Peiniger Gericht. Und da der Vater aus Gründen der Staatsräson – um eine Rebellion zu stillen – seinen Sohn zu sich erheben will, schlägt Sigismund ihm ins Gesicht. »Wer bist du Satan, der mir Vater und Mutter unterschlägt? Beglaubige dich?« Damit hat die Funktion jenes Traums sich im tiefsten gewandelt. Wo er bei Calderon, wie ein Hohlspiegel, in einem unermeßlichen Grunde die Innerlichkeit als transzendenten siebenten Himmel aufreißt, da ist bei Hofmannsthal er eine wahrere Welt, in welche ganz und gar die Wachwelt hineinwandert. »Wir wissen von keinem Ding wie es ist, und nichts ist, von dem wir sagen könnten, daß es anderer Natur sei als unsere Träume.« »Sie haben zu mir gesagt: du hast geträumt und immer wieder: du hast geträumt! Dadurch, wie wenn einer einen eisernen Finger unter den Türangel steckt, haben sie vor mir eine Tür ausgehoben und ich bin hinter eine Wand getreten, von wo ich alles höre, was ihr redet, aber ihr könnt nicht zu mir und ich bin sicher vor euren Händen!« Durchaus hat alles sich im Wirklichen zusammengezogen wie unter der Einwirkung einer ätzenden Einsicht. Das breite Liebesspiel der spanischen Bühnentradition ist ebenso dahingefallen wie die transzendente Moralität des Traumlebens. Hofmannsthals Szenar kennt keine bedeutsamere Frauenrolle. Ein männliches Nebenspiel tritt an den Platz der parallelen Liebeshandlung. Julian, der für den Prinzen haftet, ihn bewacht, liebt Sigismund und sucht dennoch zugleich für den Ehrgeiz seines eigenen Strebens ihn auszunutzen. Der Mann, dem nichts als ein winziges Aussetzen des Willens, ein einziger Moment der Hingabe fehlt, um des Höchsten teilhaft zu werden, ist nie so leibhaft über die Bretter gegangen. Sein Gegenspieler, der Arzt, Herr seiner Kunst und Kundiger von ihren tiefsten Gründen, eine paracelsische Erscheinung, der seinesgleichen, seinen Oberen in der blöden Kreatur erkennt, als welche Sigismund am Anfang der Geschehnisse, fast ohne Sprachvermögen, aus dem Turme ihm entgegenkommt.
Dieses Drama ist ein weiteres, entschiedenstes Vordringen in einem Bezirk, der gleich sehr dem dramatischen Gestalten seines Dichters wie der neueren Szene schlechtweg vorbestimmt scheint. Das »Vortragische« mag man ihn nennen. Aus dem Ritual ist das Drama erwachsen, Urtypus der dramatischen Spannung die Spannung zwischen Wort und Aktion. Nicht was man in läßlicher Rede so nennt: nicht eine Spannung im Bereich der Worte selber (nicht die der Debatte) noch auch die des sprachlosen Ringens (des Kampfes schlechthin) ist dramatisch. Das ist allein die Spannung des Rituals, die zwischen Tun und Rede selber, im Polaren, überspringt. Dem so verstandenen innerlichsten Zirkel des Dramatischen ist selbst das Tragische schon äußerlich. Es trägt die Spannung zwischen Leib und Sprache – von Aktion und Wort – rein sprachlich aus und die Debatte als ein Späteres, ein Vereinzeltes und als Variante des Dramatischen schlechtweg kommt auf. Dieses Dramatische selbst aber ist ein Vortragisches. Als »Ödipus«, »Elektra« und »Alkestis« des Dichters vor mehr als zwanzig Jahren erschienen, da drängte eine Auseinandersetzung mit der griechischen Tragödie ans Licht, wie sie der barocken Dramatik in Opitz’ »Troerinnen« vorangegangen war. In ganz Europa wuchs damals die neue Form, die sich in Deutschland als das »Trauerspiel« wenn nicht am reinsten so am radikalsten prägte. Ein »Trauerspiel« heißt nicht umsonst der »Turm«. Und so entsagt er der Chimäre einer neuen »Tragik«. Was er im Prinzen Sigismund beschwört, das ist vor allem der geschundene Leib des Märtyrers, dem gerade Sprache – nicht umsonst – sich weigert. Damit nimmt dieses letzte Drama des Dichters die kostbare Tradition der deutschen Bühne so kühn wie sicher an dem Punkte auf, wo sie der Klassizismus unterbrach. Und wenn die Dramaturgen (die doch wahrlich nicht Überfluß an edlen Materialien haben) den Stoffen minder als den Kräften neuer Texte das wahrhaft Rechtzeitige abzumerken trachten würden, so wäre vielleicht gerade dieses Werk heute schon über die deutschen Bühnen gegangen. Es sind Szenen darinnen, welche die gewaltigen Anforderungen an Darsteller und Spielleiter mit der tiefsten Erschütterung des Publikums lohnen würden. Der blutige König, wie er sich, gleich Shakespeares Claudius ins Gebet, in die Schönheit eines Herbstabends verliert; der Prinz, wie er vorm Alkoven seiner Mutter zurückschauert und doch nicht weiß, wovor er sich befindet; Julian, sein Wächter, wie der Arzt ihm die Entscheidungsfrage stellt.
Das alte Trauerspiel schlug seinen Bogen zwischen Kreatur und Christ. In dessen Scheitelhöhe steht der vollkommene Prinz. Wo Calderons christlicher Optimismus den sah, da zeigt sich der Wahrhaftigkeit des neueren Autors Untergang. Sigismund geht zugrunde. Die dämonischen Gewalten des Turms werden seiner Herr. Die Träume steigen aus der Erde auf und der christliche Himmel ist längst aus ihnen gewichen. Im Aufruhr tritt ein sagenhafter »Kinderkönig« die wahre Erbschaft dieses Prinzen an, wie Fortinbras die Hamlets in der Thronbesteigung. Im Geist des Trauerspiels hat der Dichter den Stoff des Romantischen entkleidet und uns blicken die strengen Züge des deutschen Dramas daraus entgegen.
Hans Bethge, Ägyptische Reise. Ein Tagebuch.
Berlin: Euphorion Verlag (1926). 156 S., 48 Abb.
Durch die formvollendete Gestaltung, die allen Erzeugnissen dieses Verlages eignet, lädt das Buch zum Blättern geradezu ein. Die schönen Photographien (von Ernst Rathenau) sind ansprechend und exakt wiedergegeben. Leider ist der Text trostlos. Es beleidigt das Auge, ein Betteldeutsch, das auf Rotationspapier gehört, auf solch edlem Material festgehalten zu sehen. Bereits in »Genua«, einem »Ereignis von starkem und besonderem Reiz«, macht man auf allerhand im weiteren Verlauf der Reise sich gefaßt. Im Lande selber gibt es – beispielsweise eine Museumsführung, gegen die das Kauderwelsch des lausigsten Fremdenführers Musik ist. »Die ägyptische Mythologie war immer verworren, die Religion von den Priestern niemals in ein festes System gebracht, es gleitet alles etwas ungewiß durcheinander … Wenn ich Bildhauer wäre und sollte den Gott des Weines oder den Gott der Schönheit darstellen, ich glaube nicht, daß ich ihn wesentlich anders bilden könnte als die Griechen den Bacchus oder den Apollo gebildet haben. Aphrodite als Göttin der Liebe: ja. Hathor, die ägyptische Aphrodite mit dem ernsten Kuhgesicht: nein. Für die tierköpfig drohende Götterwelt der Ägypter ist kein Raum in unserer Phantasie.« Aber schließlich ist Bethge kein Bildhauer. Und ganz zu Hause ist er erst auf kritischem Gebiet. »Wer sich an einem Toten rächen und ihn aus den Wonnen des Paradieses vertreiben wollte, brauchte nur seinen Namen wegzumeißeln, und der Arme war der Ewigkeit verlustig. Das sind sehr kindlich-primitive Vorstellungen, die man mit der Idee der Unsterblichkeit verknüpfte.« Nein, Herr Verfasser! Das sind sehr kindlich primitive Vorkenntnisse für eine Reise nach Ägypten. So daß man sich gar nicht wundern kann, von dem Pharao Mykerinos zu hören: »Er muß ein sympathischer Mensch gewesen sein.« Womit man denn wohlbehalten auf dem »Anhalter Bahnhof« sich wiederfindet. Doch in uns klingt, was wir da unten in dem fernen Wunderland gesehen und gehört noch nach: Bethge als Schmock: ja. Bethge als Schriftsteller mit dem ernsten Kuhgesicht: nein.
»Bella«1
En Méditerranée – par les Messageries Maritimes. So lädt der Rücken dieses Buches ein, wenn Bellas Leben vor dem Leser abgelaufen ist. Man kann nicht besser ihr Gedächtnis feiern. Beim Lesen geht man gegen steifen Seewind an, und über den Dingen, auf die man trifft, liegt eine Salzkruste.
Der Pressechef im Pariser Ministerium des Auswärtigen, Jean Giraudoux, nimmt keinen nom de guerre an, wenn er Romane schreibt (von Fabre-Luce erscheint soeben die politische Romanze »Mars« unter dem schönen Dichternamen Jacques Sindral). Giraudoux bleibt als Autor hochgestellter Funktionär und beansprucht den technischen Apparat eines Büros für seine Phantasie mindestens ebensosehr wie in der Wahrnehmung seiner Berufsgeschäfte. Man möchte seine Sachen sich im Amt geschrieben denken. Oder in einer Dichterschule als »theme en classe«. Er selber muß aufs glücklichste erfahren haben, was er von den gelehrten Brüdern Dubardeau bemerkt:
»Sie konnten ohne das alltägliche Bad in einer Flut Vertrauter, Halb-Bekannter, Flut von Stimmen und von Lächeln nicht auskommen. Es war auch nicht nur Sache der Gewohnheit, weswegen sie im Lärm, in Zimmern, welche auf den Korridor hinausgehen, studieren mußten, wo immer Leute vorbeikamen, Leute, die Durand oder Dupont, Bloch oder Bechamort, La Rochefoucauld oder Uzès hießen. Die Menschheit war das Ferment, das ihre Versuche gelingen ließ. Bei all ihren Experimenten über Gasmischungen, hybride Pflanzen, die Lebensfähigkeit des neuen Österreich, hätten sie der Aufzählung der Mischungsbestandteile beifügen können, ›ich nehme hinzu: einen Menschen.‹ Die Anwesenheit eines belanglosen Individuums Labaville hatte beim Gelingen der Synthese den Ausschlag gegeben. Wenn Labaville mit seinen Knöpfen und seiner Kaschmirkrawatte nicht da war, arbeitete Onkel Karl nicht gut. Sie alle brauchten ein Gesicht als Feder-Wischer oder Blick-Wischer, wenn sie die Augen von den chemischen Synthesen oder den Giften, die da wirkten, erhoben. Ja selbst der Astronom brauchte am Abend, wenn er dem Firmamente gegenüberstand, den blassen Kopf von einem Sekretär in seiner Nähe.«
Der Autor selber ist von diesem Stamm und schlägt in seinem Buche sich zu ihm. Als Neffe nimmt er an den Kämpfen teil, die Rebendart, Ministerpräsident, den großen, freigesinnten Brüdern liefert. Das Urbild dieses Rebendart heißt Poincaré, und die Gestalt, die sich im Prisma der sechs Brüder bricht, ist Bertholots. Denn gern setzt Giraudoux ein Kollektiv an Stelle eines Individuums. Die Rebendart erscheinen ebenfalls als Gruppe. Der Haß, der sie mit primitiver Verve zeichnet, hat ihren Größten, Henri Poincaré, den Mathematiker, zugunsten jener Brüdergruppe annektiert. Was übrigbleibt, ist eine gottverlassene Sippe, die auf dem Lande ihre Existenz vertrauern muß, um nicht die wenigen aus ihrer Mitte, die in der Hauptstadt eine Rolle spielen, bloßzustellen. Die Zeichnung dieses Ministerpräsidenten erschöpft ihr Modell, wie eine chinesische Marter den Sträfling. »Alle Sonntage stand er zu Füßen eines jener gußeisernen Soldaten, die leichter als er selbst zurechtzuhämmern wären, hielt seine Rede und gab vor zu glauben, die Toten hätten sich nur etwas abgesondert, um über die Summen, die Deutschland schuldet, sich schlüssig zu werden.«
Im politischen Feldlager spielt ein Liebeskomplott. Der Romeo – Philipp, der Berichterstatter – auf Seiten seiner aufgeklärten Onkel, die Julia – Bella, eine junge Witwe – die Schwiegertochter Rebendarts. Von dieser Liebeshandlung wird das süßeste Geflecht im Buche nicht gewoben, sondern aufgetrennt. Denn beide haben, eh noch die Erzählung einsetzt, sich gehört und kannten nicht den wahren Namen voneinander. Nun bringt der Streit der Capulet und Montagu nur Trübsal, Gram, Entfremdung zwischen beide. Nicht allzuoft erscheint in der Geschichte Bella selbst; es ist darin von der Rücksicht des Liebhabers etwas, der seine Freundin unter Leuten nicht ermüden will. Seitdem sie umeinander wissen, sind sie stumm. Die Szene – der begnadete Verrat der Bella – die ihnen voreinander und den andern die Sprache wiedergibt und Rebendart im Augenblicke, da sein Anschlag fällig ist, entwaffnet, wird der Tod der Frau. Ihr platzt ein Blutgefäß in der Erregung.
Der Erzähler aber verliert nicht den Atem. Er saugt nur tiefer das geliebte Leben in sich und wendet die Geschichte Bellas Vater zu, verfolgt die Liebe in der Deszendenz, steigt zu den Quellen, endet im Motiv der sonderbarsten väterlichen Trauer, in der die Tochter ihren Vater neu belebt.