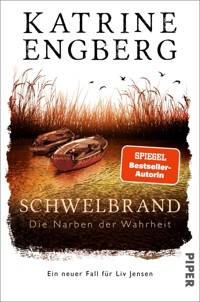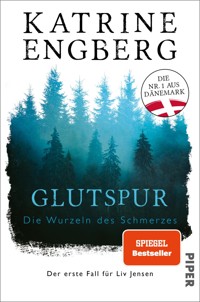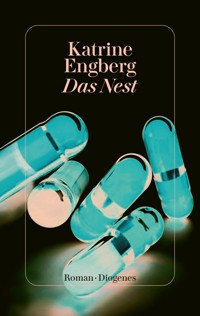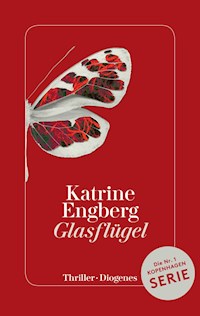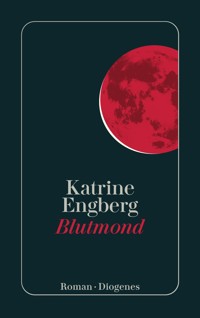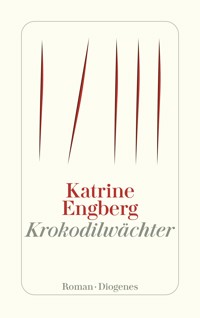
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kørner & Werner
- Sprache: Deutsch
Gerade erst war Julie nach Kopenhagen gezogen, um Literatur zu studieren. Warum musste sie so jung sterben? Erstochen und von Schnitten gezeichnet? Es ist ein schockierender Fall, in dem Jeppe Kørner und Anette Werner ermitteln. Als bei Julies Vermieterin ein Manuskript auftaucht, in dem ein ähnlicher Mord geschildert wird, glauben die beiden, der Aufklärung nahe zu sein. Aber der Täter spielt weiter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Katrine Engberg
Krokodilwächter
Ein Kopenhagen-Krimi
Aus dem Dänischen von Ulrich Sonnenberg
Diogenes
Für Timm. Von nun an.
Mittwoch, 8. August
1
Der Staub der schweren Gardinen wirbelte im morgendlichen Licht. Gregers Hermansen setzte sich in den Sessel und betrachtete den Tanz der Partikel durch das Wohnzimmer. Es dauerte inzwischen verdammt lange, bis er richtig aufwachte, aufzustehen lohnte sich schon fast nicht. Er legte die Hände auf das abgewetzte Polster, lehnte den Kopf zurück und schloss die Augen vor dem Lichtflimmern, bis das Gurgeln der Kaffeemaschine zu hören war.
Gregers zählte bis drei, schob sich aus dem Sessel, schlüpfte in seine Pantoffeln und schlurfte mit kurzen Schritten in die Küche. Immer der gleiche Weg, von der Mahagoni-Anrichte und dem grünen Sessel bis zu dem verfluchten Handgriff an der Wand, den die Altenpflegerin letztes Jahr angebracht hatte. »Ich komme auch ohne das Ding gut zurecht, vielen Dank«, hatte er erklärt – vergeblich.
Er warf den gebrauchten Kaffeefilter in die Mülltüte unter der Spüle. Schon wieder voll. Gregers zog den Müllbeutel vom Ständer und stützte sich auf dem Weg zur Küchentür am Tisch ab. Zumindest seinen Abfall konnte er noch selbst hinunterbringen. Er warf einen Blick auf die Flaschenbatterie seiner Nachbarin auf dem Treppenabsatz über seiner Wohnung. Elende Säuferin. Gott sei Dank war es schon eine Weile her, seit sie das letzte Mal eines ihrer ausschweifenden Abendessen gegeben hatte, die sich bis in den nächsten Vormittag zogen. Was waren das bloß für Menschen, die die ganze Nacht über saufen konnten? An einem Werktag!
Die Stufen der Küchentreppe schienen unter ihm nachzugeben, er hielt sich gut am Geländer fest. Natürlich wäre es vernünftiger, in eine moderne Wohnanlage für betagte Menschen zu ziehen, aber Gregers hatte sein ganzes Leben in der Kopenhagener Innenstadt gewohnt und wollte es lieber mit ein paar schiefen Treppenstufen aufnehmen, als in irgendeinem Pflegeheim an der Peripherie zu vergammeln. Im ersten Stock stellte er die Mülltüte ab und stützte sich an den Türrahmen. Die beiden jungen Studentinnen, die sich die Wohnung in der ersten Etage teilten, waren ein ständiger Quell der Irritation, insgeheim aber auch der Sehnsucht. Ihre beschwingten Schritte auf der Treppe, ihr duftendes Haar und ihr unbekümmertes Lächeln weckten Erinnerungen an Sommernächte am Kanal und verliebte Küsse. An all das, was einmal gewesen war, und an all das, was nicht passiert war, weil man zu lange gewartet und zu spät entdeckt hatte, dass das Leben allmählich zu Ende ging.
Nachdem er sich ein wenig erholt hatte und aufblickte, bemerkte er, dass die Wohnungstür der jungen Frauen nur angelehnt war. Grelles Licht drang aus dem Türspalt. Die Mädchen waren jung und gedankenlos, aber doch wohl nicht so dumm, mit offener Hintertür zu schlafen? Es war halb sieben, möglicherweise waren sie noch gar nicht zu Hause, aber dennoch. Warum brannte das Licht?
»Hallo …? Ist da jemand?«
Vorsichtig stieß er mit der Spitze seines Pantoffels gegen die Tür, die mühelos aufging. Gregers trat unwillkürlich einen Schritt zurück. Man wollte sich schließlich nicht vorwerfen lassen, ein altes Ferkel zu sein, das an fremden Türen lauschte. Vielleicht sollte er die Tür besser wieder zuziehen und seinen Abfall hinuntertragen, bevor der Kaffee oben auf der Warmhalteplatte einbrannte.
Gregers hielt sich am Türrahmen fest und beugte sich vor, um nach der Klinke zu fassen, allerdings hatte er die Entfernung unterschätzt. Entsetzt merkte er, dass er aus dem Gleichgewicht geriet. Er versuchte sich aufzufangen, rutschte aber auf dem glatten Parkett aus und landete mit einem dumpfen Schlag, dem jämmerlichen Geräusch eines unbeholfenen Altmännerkörpers, in seinem Frotteebademantel auf dem Fußboden der Wohnung der jungen Frauen.
Er versuchte zu Atem zu kommen. War die Hüfte gebrochen? Was würden die Leute sagen? Zum ersten Mal seit vielen Jahren hätte er gern geweint. Er kniff die Augen zu und wartete darauf, gefunden zu werden.
Er horchte auf Rufe oder herbeieilende Schritte, aber nichts geschah. Alles war still. Nach ein paar Minuten öffnete er die Augen, um sich zu orientieren. Eine nackte Sechzig-Watt-Birne hing von der weißen Decke und blendete ihn, über ihm ragten Kochtöpfe und Küchenkräuter aus einem Regal, und neben ihm standen ein Haufen Schuhe und Stiefel; auf einigen lag er vermutlich. Vorsichtig drehte er den Kopf von einer Seite zur anderen, um zu prüfen, ob irgendetwas gebrochen war. Nein, mit dem Kopf war alles in Ordnung. So weit, so gut.
Er ballte die Fäuste. Sie reagierten ebenfalls. Diese Scheißschuhe! Er versuchte sie unter sich wegzuschieben, aber es gelang ihm nicht. Das nervöse Gefühl im Bauch wurde langsam zu einem enormen, erstickenden Klumpen, der sich in seinem gesamten Körper ausbreitete. In dem Schuh, der halb unter seiner alten, schmerzenden Hüfte lag, steckte ein Bein, das in einem verrenkten Körper endete. Es sah aus wie das Bein einer Schaufensterpuppe, aber Gregers spürte weiche Haut an seiner Hand. Er zuckte zusammen und zog die Hand hervor. Da war Blut. Nicht nur auf der Hand, sondern auch auf dem Boden, an den Wänden. Überall Blut.
Gregers’ Herz flatterte wie ein Wellensittich. Panik raste durch seinen Körper, gleichzeitig war er wie gelähmt. Ich sterbe, dachte er. Er wollte schreien, doch die Stimme, mit der er hätte um Hilfe rufen können, hatte ihn schon vor vielen Jahren verlassen. Dann kamen die Tränen.
Esther schlug auf den Wecker und versuchte dem Inferno in ihrem Kopf Einhalt zu gebieten. Der Übergang vom Traum zur Wirklichkeit war schwer und zäh, sie erkannte den Ton der Türklingel erst, als sie zum dritten Mal gedrückt wurde. Anhaltend. Ihre beiden Möpse, Epistéme und Dóxa, bellten hysterisch, um ihr Territorium zu verteidigen. Esther de Laurenti war auf dem Bettüberwurf eingeschlafen; ihr Kissen hatte tiefe Spuren im Gesicht hinterlassen, die sie mit den Fingern spüren konnte. Mist. Seit sie vor knapp einem Jahr in Pension gegangen war, hatte ihr innerer Schweinehund das Kommando übernommen – selten stand sie vor zehn Uhr morgens auf. Die alte Messinguhr mit dem Schäferpärchen, die ihrer Mutter gehört hatte, zeigte 8.35 Uhr. Sie kannte niemanden, der auf die Idee kommen könnte, um diese Uhrzeit bei ihr zu klingeln. Wenn es der verfluchte Postbote war, würde sie ihm was an den Kopf schmeißen. Das Schäferpärchen zum Beispiel.
Sie wickelte sich in den lilafarbenen Bettüberwurf aus Seide und wankte mit pochender Stirn zur Wohnungstür. Hatte sie den Rotweinkarton gestern Abend ausgetrunken? Zumindest waren es mehr als die beiden Gläser gewesen, die sie sich prinzipiell erlaubte, wenn sie schrieb.
Ihr Körper schmerzte und verlangte nach seiner morgendlichen Routine: Dehnübungen, Atemübungen, Haferbrei mit Rosinen. Ein Aspirin wäre auch nicht schlecht. Esther riss sich zusammen und schaute durch den Türspion.
Auf dem Treppenabsatz standen ein Mann und eine Frau, die Esther nicht kannte. Allerdings hatte sie ihre Brille nicht auf, und im Übrigen fiel es ihr schwer, sich an die vielen hundert Studenten zu erinnern, die sie im Laufe der Jahre in ihren Unterrichtsräumen in der Njalsgade unterrichtet hatte. Trotzdem war sie sich ziemlich sicher, dass diese beiden Personen keine ehemaligen Studenten der Literaturwissenschaft waren. Akademiker sahen selten so entschlossen aus wie die beiden. Die Frau war großgewachsen und breitschultrig, trug einen etwas zu kleinen Nylonblazer und hatte die schmalen Lippen pink nachgezogen. Das Haar war zu einem Pferdeschwanz gebunden, und die Haut sah solariumversehrt aus. Der Mann war schlank und hatte blondiertes Haar. Wäre er nicht so blass und fahl gewesen, hätte sie ihn möglicherweise als attraktiv bezeichnet. Mormonen? Zeugen Jehovas?
Sie öffnete die Tür. Epistéme und Dóxa bellten kampfbereit.
»Ich hoffe, Sie haben den allerbesten Grund der Welt, mich zu wecken!«
Falls sie über ihre Aufmachung überrascht waren, zeigten sie es nicht. Der Mann sah sie aus seinen traurigen Augen ernst an.
»Esther de Laurenti? Wir sind von der Kopenhagener Polizei. Mein Name ist Jeppe Kørner, dies ist meine Kollegin Anette Werner. Ich fürchte, wir haben schlechte Nachrichten.«
Schlechte Nachrichten. Esthers Magen rebellierte. Sie ließ die Beamten eintreten und führte sie ins Wohnzimmer. Die Hunde spürten den Stimmungswechsel sofort und liefen ihr mit einem enttäuschten Winseln hinterher.
»Nehmen Sie doch Platz«, forderte sie die Polizisten mit belegter Stimme auf und setzte sich aufs Sofa.
»Danke«, sagte der Mann. Er beschrieb einen misstrauischen Bogen um die kleinen Möpse und setzte sich auf eine Sesselkante. Die Frau blieb im Flur stehen und blickte sich neugierig um.
»Vor einer Stunde fand der Inhaber des Cafés im Parterre Ihren Nachbarn Gregers Hermansen. Er hatte einen Herzanfall. Hermansen wurde ins Krankenhaus gebracht und wird dort behandelt. Er hatte Glück, dass man ihn schnell gefunden hat; soweit wir wissen, ist sein Zustand stabil. Er ist in der Wohnung im ersten Stock gestürzt.«
Esther griff nach der Stempelkanne mit dem Kaffee vom Vortag und stellte sie wieder ab, ohne sich etwas einzugießen.
»Das musste ja so kommen. Gregers geht es seit einiger Zeit nicht besonders gut. Was hatte er im ersten Stock verloren?«
»Sehen Sie, wir haben gehofft, dass Sie uns bei der Beantwortung dieser Frage helfen können.« Der Polizist faltete die Hände im Schoß und sah sie an.
Esther warf den umständlichen Bettüberwurf zu den Papierstapeln, benutzten Taschentüchern und Strickjäckchen, die auf dem Chesterfield-Sofa herumlagen. Die jungen Menschen würden den Anblick einer alten Frau im Nachthemd überleben.
»Sagen Sie mal, was ist hier eigentlich los? Seit wann erscheint die Polizei, wenn ein älterer Herr einen Herzanfall erleidet?«
Die Beamten wechselten einen Blick, der für Esther schwer zu deuten war. Die Frau nickte von ihrem Platz im Flur und trat noch einen Schritt zurück. Der Mann schob vorsichtig einen Stapel Bücher nach hinten und rutschte auf dem Stuhl ein Stück zurück.
»Haben Sie gestern Abend oder im Laufe der Nacht etwas Ungewöhnliches gehört, Frau Laurenti?«
Erstens verabscheute sie es, »Frau Laurenti« genannt zu werden, und zweitens hatte sie nichts anderes gehört als die Meditations-CD mit den Walgesängen, das wirksamste Schlafmittel, wenn der Rotwein nicht reichte.
»Wann sind Sie gestern Abend zu Bett gegangen?«
Er ließ nicht locker.
»Hat es in den letzten paar Tagen ungewöhnliche Aktivitäten im Haus gegeben? Oder fällt Ihnen sonst etwas ein?« Der Polizist sah ihr in die Augen.
Sie schlug die Arme übereinander.
»Ich sitze hier im Nachthemd und habe noch nicht mal einen Kaffee gehabt. Warum jagen Sie mich in solcher Herrgottsfrühe aus dem Bett? Ich will jetzt wissen, worum es eigentlich geht, bevor ich auch nur einen Ton sage!« Esther presste die Lippen zusammen.
»Gregers Hermansen fand heute früh die Leiche einer jungen Frau in der Küche der Wohnung in der ersten Etage.« Der Polizist sprach langsam und wandte den Blick nicht von ihr ab. »Wir sind noch dabei, das Opfer zu identifizieren und die Todesursache festzustellen, aber wir sind sicher, dass es sich um ein Verbrechen handelt. Gregers Hermansen hat einen ziemlichen Schock erlitten und kann noch nicht mit uns sprechen. Ich bitte Sie, uns alles zu erzählen, was Sie über die Hausbewohner wissen und was in den letzten paar Tagen passiert ist.«
Esther spürte, wie der Schock sich von den Füßen bis in die Brust ausbreitete, sie konnte kaum mehr atmen. Ihre Kopfhaut zog sich zusammen, das kurze, hennafarbene Haar sträubte sich im Nacken, ihr lief es kalt den Rücken hinunter. Sie umklammerte die Lehne des Sofas.
»Wer ist es? Eines der beiden Mädchen? Das kann nicht wahr sein. In meinem Haus stirbt doch niemand.«
Sie hörte selbst, wie kindisch und unkontrolliert sie klang.
Der Polizist griff nach ihrem Arm.
»Vielleicht schenken Sie sich erst mal eine Tasse von Ihrem Kaffee ein, Frau Laurenti.«
Die Biene summt endlich weg von den Marmeladenklecksen auf dem kleinen Teller und setzt sich auf einen Stapel Bücher. Ein handfester Schlag mit dem Klebstreifenabroller, und der zerquetschte Insektenkörper wird auf einen letzten Flug durch das offene Fenster geschickt. Sie atmet den Tag ein, und ein Prickeln breitet sich aus. Es ist ein gutes Gefühl, melancholisch und glücklich zugleich, und sie versucht es so lange wie möglich festzuhalten. Das Haar ist noch feucht vom Duschen. Das Zimmer ist von Sonnenlicht und den morgendlichen Geräuschen der Stadt erfüllt. Autohupen, Fahrradboten, die sich mit Touristen streiten, der Geruch von frisch abgespritztem Asphalt.
Zum Essen hat sie Toastbrot und starken Earl Grey zubereitet, der Tee dampft noch immer neben dem iPhone auf dem kleinen runden Tisch in der Küche. Kein Anruf, keine Nachrichten. Sie überprüft es noch einmal. Es ist noch nicht lange her, seit sie von zu Hause ausgezogen ist, sie muss sich noch an die alltäglichen Dinge wie Einkaufen und Wäschewaschen gewöhnen. Sie hat noch keinen wirklichen Rhythmus gefunden, genießt einfach dieses erwachsene Gefühl, selbst zu bestimmen, was wann und wie passiert.
Ihr Kühlschrank ist schon wieder leer. Es will ihr einfach nicht gelingen, ihn mit guten Dingen zu füllen, mit Bresaola oder Biogemüse zum Beispiel. Jedes Mal, wenn sie in den Supermarkt geht, kommt sie mit Scheuerschwämmen und Haferbrei nach Hause. Als hätte sie ihren Platz in der Welt noch nicht richtig gefunden. Im Waschsalon, wo sie mit anderen jungen Leuten ihre Wäsche wäscht, lächelt sie manchmal jemanden an oder tritt rücksichtsvoll zur Seite, wenn einer am Tisch die Wäsche zusammenlegen will – dann ist sie nicht einsam. Doch sobald sie die IKEA-Tasche mit der noch warmen Wäsche die Küchentreppe hochgeschleppt hat und die Wohnungstür hinter sich zuschließt, verfliegt dieses Gefühl rasch wieder.
2
Jeppe Kørner blickte auf den zarten Henkel, der zwischen seinen Fingerspitzen verschwand. Esther de Laurenti hatte einen Bademantel angezogen und frischen Kaffee gekocht, er saß wieder auf dem Stuhl und wartete darauf, dass sie in der Lage war, seine Fragen zu beantworten. Das Wohnzimmer war unaufgeräumt, Jeppe fühlte sich unwohl in diesem femininen Chaos. Vom Fußboden bis zur Decke zogen sich Regale voller Bücher über die Wände. Verblichene Lederrücken, Taschenbücher und bunte Koch- und Gartenbücher. Kleine Holzfiguren und verstaubter Nippes aus der ganzen Welt füllten jeden freien Platz auf den Regalbrettern, auf jeder waagerechten Fläche lagen Stapel von dichtbeschriebenem Papier mit roten Strichen und Anmerkungen.
Jeppe sah aus dem Fenster: Auf der Straße hatte sich das erste Kamerateam vor der ockerfarbenen Fassade aufgebaut. Den Polizeifunk konnte die Presse nicht mehr abhören, stattdessen achtete sie auf anhaltende Polizeisirenen und behielt die aktuellen Mitteilungen in den sozialen Medien im Auge. Es dauerte nie sehr lange, bis jemand ein Polizeiaufgebot meldete, spätestens ein paar Minuten nach den Einsatzfahrzeugen tauchten die ersten Journalisten auf. Die Kameras schwenkten bereits zwischen den Gesichtern der Reporter und dem Gewimmel der Kriminaltechniker in ihren weißen Overalls hin und her.
»Das Haus gehört mir, die erste und die zweite Etage sind vermietet, und der Laden im Erdgeschoss wechselt alle paar Jahre – zurzeit ist dort eine Kaffeebar. Ein paar junge Burschen betreiben sie …«
Esther de Laurenti sprach unaufgeregt und ruhig, ihr flackernder Blick verriet jedoch ihren Schockzustand. Jeppe hatte Rückenschmerzen und stemmte die Füße gegen den Fußboden, damit der Druck nachließ und er sich darauf konzentrieren konnte zuzuhören.
»Caroline wohnt seit anderthalb Jahren im ersten Stock. Ich kenne ihre Eltern aus früheren Zeiten an der Universität, bevor sie nach Jütland zogen. Wir waren gemeinsam in einem Kunstverein. Erst hat ihr Freund bei ihr gewohnt, aber irgendwann letzten Winter ist er ausgezogen. Stattdessen zog im Frühjahr Julie ein.«
Esther de Laurentis deutliche Diktion wirkte wie die einer Schauspielerin und stand in seltsamem Kontrast zu den Flüchen, die sie zwischen ihren wohlformulierten Sätzen ausstieß.
»Die beiden sind alte Freundinnen, sie kennen sich seit der Schule. Nette Mädchen, die ich gern im Haus habe«, fuhr sie fort und konzentrierte ihren Blick auf eine Vase der Königlichen Porzellanmanufaktur. »Wer von den beiden ist es? Hat man sie ermordet?«
»Die Identifikation ist noch nicht abgeschlossen.« Jeppe versuchte, sie zu beruhigen. »Ich verstehe gut, dass es schwer ist, aber es ist auch noch zu früh, um etwas über die Todesursache zu sagen.«
Es wurde still in dem stickigen Wohnzimmer. Esther de Laurentis helle Haut war ungeschminkt, die zahlreichen feinen Runzeln am Hals und rund um die Augen verstärkten den etwas vernachlässigten Eindruck. Anette hatte sich im Flur in die Hocke gesetzt und kraulte das helle Bauchfell eines der Möpse. Der Hund grunzte zufrieden.
»Ist in der letzten Zeit irgendetwas Ungewöhnliches im Haus vorgefallen? Was auch immer. Neue Leute, die die jungen Frauen in ihrer Wohnung besucht haben, Ärger auf der Straße, Streitereien?«, erkundigte sich Jeppe.
»Dass ich diesen Satz mal in Wirklichkeit höre!« Esther de Laurenti starrte noch immer auf die Vase. »Das klingt alles nach einem schlechten Film.«
Der Mops hatte genug von Anettes Streicheleinheiten und trippelte zu seinem Artgenossen, der im Hundekorb lag.
»Wir sitzen uns ja nicht gegenseitig auf der Pelle«, erklärte Esther schließlich. »Julie und Caroline sind junge Frauen, die beschäftigt sind, die Freunde haben, was weiß ich. Aus ihrer Wohnung kommt häufig laute Musik und nachts auch mal Lärm, aber das ist bei mir auch oft genug der Fall. Der arme Gregers hat einiges auszuhalten. Nur gut, dass er schwerhörig ist.«
Sie verlor sich in ihren Gedanken. Jeppe ließ ihr Zeit und verfluchte im Stillen Anette, die mit den Fingern ungeduldig auf dem Türrahmen trommelte.
»Caroline hat einen neuen Freund, Daniel. Ein netter junger Mann, er kommt auch aus der Gegend um Herning. Aber es ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Julie ist wohl … Single.« Sie ließ das Wort auf der Zunge zergehen, als hätte es eine rauhe Oberfläche und schmeckte sonderbar.
Jeppe notierte etwas in seinem kleinen Notizbuch, während sich im Wohnzimmer erneut Stille ausbreitete. Der Hundekorb knarrte ein wenig, und Esther zog den Bademantel um die Knie zusammen. Von der Straße war die Alarmanlage eines Autos zu hören.
So viel Bedächtigkeit hielt Anette nicht aus, was sie mit einem deutlichen Stöhnen zum Ausdruck brachte. Anette war für ihr nicht sonderlich diplomatisches Wesen bekannt, und wenn sie gemeinsam ermittelten, übernahm in der Regel Jeppe die Vernehmungen.
Die achtjährige berufliche Partnerschaft hatte bei ihnen verblüffend wenig Kanten abgeschliffen. Trotzdem arbeiteten sie häufig zusammen, wenn die Einsatzleitung Ermittlungsteams bestimmte. Der heutige Tag war keine Ausnahme. Als die Polizeikommissarin am frühen Morgen am Tatort eintraf, hatte sie zusammen mit dem zentralen Ermittlungsleiter sofort auch den Gerichtspathologen, das Kriminaltechnische Center sowie die Polizeiassistenten Kørner und Werner angefordert. Offenbar waren sie gemeinsam ein starkes Team, obwohl sie das beide gar nicht so wahrnahmen. Allein die Konstellation ihrer nahezu gleichklingenden Nachnamen irritierte Jeppe grenzenlos, wenn sie sich Zeugen und Angehörigen vorstellen mussten.
Er hielt sie für einen Bulldozer, und sie bezeichnete ihn als verzärtelt und old fashioned. An guten Tagen hackten sie aufeinander herum wie ein altes Ehepaar, an schlechten Tagen hätte er sie am liebsten in den Øresund geschmissen.
Und heute war ein schlechter Tag.
»Caroline ist seit letzter Woche auf einer Kanutour in Schweden«, fuhr Esther fort. »Ich glaube nicht, dass sie schon wieder in Kopenhagen ist. Julie habe ich gestern noch gesehen. Sie wollte sich eine Sicherung borgen. Sie war wie immer fröhlich, ihr Lächeln wirkte echt. Wie kann es da möglich sein, dass wir solch ein Gespräch führen!«
Jeppe nickte. Unter Schock ergriff die Betroffenen immer ein Gefühl der Unwirklichkeit.
»Ich glaube es einfach nicht! Könnte es sich nicht um eine Freundin handeln?« Sie klang verzweifelt.
»Wir wissen es leider noch nicht. Haben Sie die Telefonnummer der Mädchen?«
»Stehen alle auf einem Zettel am Kühlschrank. Sie können ihn mitnehmen.«
»Danke, Frau Laurenti, Sie waren uns eine große Hilfe.« Jeppe erhob sich und signalisierte damit, dass der Besuch überstanden war. Anette stand bereits am Kühlschrank und zog den Zettel unter einem Kühlschrankmagneten in der Form eines Mopses hervor. Jeppe hörte etwas zu Boden fallen, dann Anettes verärgertes Gemurmel.
»Wir müssen sicher später noch einmal mit Ihnen reden. Sind Sie heute Nachmittag zu Hause?« Jeppe bemühte sich, an dem überfüllten Glastisch vorbeizukommen, ohne Papiere und Tassen auf den Boden zu werfen.
»Ich werde Gregers im Krankenhaus besuchen, aber sonst habe ich keine weiteren Pläne.« Esther de Laurenti legte eine Hand auf das Goldmedaillon, das sie um den Hals trug, als könnte es sie beschützen.
»Am späteren Nachmittag kommt ein Fingerabdruckexperte, der eventuelle Spuren im Treppenhaus und an Ihrer Wohnungstür sichern wird. Er wird auch Ihre Fingerabdrücke nehmen. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen? Nur, damit wir Sie ausschließen können.«
Sie nickte.
Offensichtlich wollte sie ihn nicht hinausbegleiten. Im Flur wartete Anette bereits mit der Hand auf der Türklinke. Jeppe verspürte ein Gefühl der Unzulänglichkeit, als er sich von der kleinen Frau auf dem Sofa verabschiedete. Sie sah aus, als müsste sie dringend in den Arm genommen werden.
Auf dem Treppenabsatz atmete Anette vernehmlich auf.
»Mein Gott, befrei mich von alleinstehenden Weibsbildern und ihrem Nippes!«, jammerte sie gut hörbar, noch bevor Jeppe die Tür zuzog.
»Hätte dir alleinstehend und ohne Nippes besser gefallen?«
»Absolut!« Sie grinste. »Wenn man sich schon entschieden hat, allein zu wohnen und sonderbar zu werden, könnte man zumindest mal aufräumen.«
Er zog ein Päckchen mit antiseptischen Feuchttüchern aus der Tasche und reichte es Anette. Sie blickte ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an und schüttelte nur widerwillig den Kopf. Doch Jeppe ließ nicht locker.
»Hey, weißt du eigentlich, wie viele Schmarotzer im Pelz des besten Freunds des Menschen sitzen? Gar nicht zu reden von den Bakterien, den Staubmilben und der Tatsache, dass Hunde sich mehrmals in der Stunde hinten ablecken.«
»Deine Bakterienphobie ist krankhaft.«
»Wir begehen gleich einen Tatort. Nimm schon!«
Jeppe zog ein Tuch aus der Packung und reichte es seiner Kollegin. Anette nahm es und ging die Treppe hinunter.
»Du bist nicht ganz richtig im Kopf, Jeppe Kørner, das weißt du, oder? Und im Übrigen heißt es Arschloch, auch bei Hunden.«
Jeppe wischte sich seine Hände ebenfalls gründlich ab und steckte das zusammengeknüllte Tuch in die Tasche. Mit seinen bakterienfreien Fingern nahm er den Zettel vom Kühlschrank entgegen, den ihm Anette reichte. Auf dem Papier standen vier Namen und Telefonnummern in einer großen, nahezu unleserlichen Schrägschrift. Oben Gregers Hermansens Festnetznummer, darunter die Mobilnummern der beiden jungen Frauen Caroline Boutrup und Julie Stender. Ganz unten stand ein großes C, gefolgt von Krickelkrakel und einer weiteren Telefonnummer.
Anette hob das Absperrband und öffnete die Tür zur Wohnung in der ersten Etage mit einem »Na, Mädels, wie weit sind wir?«.
»Ah, Werner, hast du Frühstück mitgebracht?«, klang es munter aus der Wohnung. Anette zog die blauen Plastiküberzieher über ihre Schuhe und trat, ohne zu zögern, ein. Tatorte waren ihre Domäne.
Die Hundestaffel hatte ihre Arbeit im Treppenhaus bereits beendet, und Jeppe nickte dem Hundeführer zu, der mit seinem Schäferhund die Treppe herunterkam. Jetzt würden sie im Hof und auf der Straße nach irgendeiner menschlichen Spur suchen, die sie vielleicht auf die Fährte des Täters führte.
Jeppe bückte sich nach den Plastiküberziehern. Zuletzt hatte er so etwas getragen, als er letzten Herbst mit Therese den Flur grau gestrichen hatte. Spiritual Insights hieß die Farbe, darüber hatten sie sich ziemlich amüsiert. Er ließ sich Zeit. Zehn Jahre bei der Mordkommission hatten ihn gelehrt, mit verstümmelten Körpern umzugehen, ohne dass er sich übergeben musste, dennoch war er an Tatorten nie entspannt, und auch jetzt fühlte er sich schwummrig. Vielleicht nahm ja die Sensibilität mit dem Alter auch zu, das Bewusstsein der Allgegenwart des Todes wurde schließlich immer stärker. Vielleicht war es aber auch nur der Tablettencocktail, den er auf dem Weg hierher im Auto geschluckt hatte, um die Rückenschmerzen zu lindern.
Jeppe zog ein Paar Latexhandschuhe an und atmete einmal tief durch, dann folgte er Anette. Direkt hinter der Wohnungstür begann es bereits. Die Blutspritzer an den Wänden und auf dem Fußboden waren mit weißen Pfeilen auf kleinen schwarzen Klebestreifen markiert, die die Richtung der Spritzer anzeigten. Ein Polizeifotograf machte gerade eine Nahaufnahme von einem Haufen blutiger Kleidung. Jeppe atmete den feuchtwarmen Geruch einer Halal-Schlachterei ein und versuchte, durch den Mund zu atmen. Über seinem rechten Auge pochte eine Vene. So war es in den ersten Minuten immer, danach gewöhnte man sich daran.
Der Flur führte in ein Zimmer, das mehrere Funktionen zu haben schien. Jeppe registrierte einen schweren hölzernen Esstisch mit Klappstühlen, ein Sofa, einen altertümlichen Reisekoffer, der als Couchtisch diente, und eine Schreibtischecke mit einem aufgeklappten Laptop. Trotz des warmen Sommermorgens waren die drei Fenster zur Klosterstræde geschlossen. Die Luft war stickig, Jeppe fühlte sich unwohl.
Der Daktyloskopie-Techniker, wie man einen Fingerabdruckexperten neuerdings nannte, hockte in seiner weißen Papiermontur auf den Knien und bepinselte die blanken Fußleisten. Die Hitze war erstickend. Jeppe stützte sich an eine Wand, schaute auf den Boden und versuchte, wie jemand auszusehen, der nachdachte. Nur einen Augenblick stehen bleiben und durchatmen, bis dieses Gefühl des Unwohlseins vorbei war und der Puls sich beruhigt hatte. Keine Angst vor der Angst haben.
Er bekam sich in den Griff und wies mit dem Kopf auf die Fußleisten.
»Hast du was?«
Der Daktyloskopie-Techniker rutschte auf den Knien ein Stück zurück, ohne zu antworten. Es war einer der nicht beamteten Fingerabdruckexperten des Kriminaltechnischen Centers. Jeppe kannte ihn nicht besonders gut. Normalerweise wurden solche Angestellte bei Tötungsdelikten nicht eingesetzt, aber in der Zeit der Sommerurlaube galten andere Spielregeln als den Rest des Jahres.
Jeppe räusperte sich. »Gibt’s brauchbare Abdrücke?«
Der Daktyloskopie-Techniker blickte auf, irritiert, dass er unterbrochen wurde.
»Jede Menge. Auf Flaschen und Gläsern, auf dem Papier und der Tastatur des Laptops. Mehrere gute rund um die Leiche. Aber hier wurde seit langem nicht mehr saubergemacht, es könnten also alte Abdrücke sein.«
Er beugte sich wieder über die Fußleiste und drückte vorsichtig etwas aufs Holz, das wie ein heller Aufkleber aussah, dann zog er es ab, um es auf eine kleine durchsichtige Platte zu legen. Jeppe zog sich vorsichtig zurück, um nicht weiter zu stören, atmete tief durch und ging ins Wohnzimmer.
An einem zerschlissenen Flickenteppich hockte der Kollege Clausen und besprühte den Stoff mit einer klaren Flüssigkeit. Eine Handvoll Blutflecke hoben sich deutlich, fast lilafarben von der Flüssigkeit ab, und Clausen fing an, mit einem Wattestäbchen Proben von den Flecken zu nehmen. Jedes Wattestäbchen steckte er sorgfältig in ein separates braunes Papiertütchen.
Clausen war einer der erfahrensten Kriminaltechniker der Polizei. Er hatte Leichen in Massengräbern im Kosovo identifiziert und war nach dem Tsunami in Thailand gewesen und hatte sich an der Aufklärungsarbeit im Fall der Blekingegade-Bande beteiligt. Normalerweise sah man ihn lächelnd, ein jovialer Mann, der die Scheußlichkeiten seines Berufs durch einen skurrilen schwarzen Humor kompensierte. Heute lächelte er nicht.
»Hej, Kørner, gut, dich zu sehen. Aber pass auf, dass du nichts anfasst. Die Wohnung ist voller Blut, und wir sind noch längst nicht fertig mit der Spurensicherung.« Clausen schnitt ein Stück Teppich mit einem Teppichmesser aus und steckte die blutigen Fasern in eine weitere braune Tüte. »Das wird eine Heidenarbeit, den ganzen Kram zu katalogisieren, es wird Tage dauern. Allein von den Blutspritzern haben wir bereits mehr als sechzig Proben.«
Im Moment unseres Todes machen wir irgendjemandem Arbeit. Wer war die junge Frau, die hier gerade vom Boden gekratzt und in Tüten gesteckt wurde? Warum war ausgerechnet sie daran gehindert worden, Karriere zu machen, zu heiraten, Kinder zu bekommen? Jeppe dachte mit Unbehagen an die Familie, die er in Kenntnis setzen musste, sobald man die Tote identifiziert hatte. Die Angst, die jeweils in den Augen aufleuchtete, wenn er seinen Namen und seine Funktion nannte, die Hoffnung, die direkt danach aufblitzte – ein Onkel, ach, einen Onkel könnten wir durchaus entbehren –, wenn sich jedoch zeigte, dass es sich doch um jemanden handelte, der dem Betreffenden sehr nahestand: das Weinen, das Heulen oder, noch schlimmer, das stille Entsetzen. Dieser Teil des Jobs fiel ihm äußerst schwer.
»Haben wir eine Mordwaffe?« Anettes Stimme zerschnitt die stickige Luft in der Wohnung.
»Vielleicht«, antwortete Clausen. »Wir wissen noch immer nicht mit Sicherheit, woran sie gestorben ist. Aber es wurde in jedem Fall ein Messer benutzt, und das können wir ziemlich gut beschreiben. Sie wurde mit einer scharfen schmalen Klinge verstümmelt, die so aussehen dürfte wie diese hier.« Clausen hob vorsichtig ein blankes offenes Klappmesser in einer Tüte in die Luft.
»Wurde es abgewischt? Es sieht so sauber aus?«
»Ja. Er hat es gründlich abgewischt, vielleicht sogar abgewaschen. Aber es war trotzdem noch Blut dran. Ich zeige es euch.« Clausen zog einen kleinen Pappstreifen mit einem gelben Wattebausch aus einer sterilen Packung seines gutsortierten Werkzeugkastens und rieb damit über die Klinge. Der Wattebausch färbte sich augenblicklich grün. »Eine Reaktion auf die roten Blutkörperchen«, erklärte er.
»Und wieso ist das dann nicht unsere Mordwaffe?«, fragte Anette unwirsch.
»Ich habe nicht gesagt, dass sie es nicht ist. Aber der Gerichtsmediziner hat uns gebeten, nach einem schweren, stumpfen Gegenstand zu suchen. Bisher haben wir allerdings nichts Derartiges in der Wohnung gefunden, worauf Spuren hinterlassen wurden.«
»Apropos Spuren, ich habe die Nachbarin aus dem obersten Stockwerk darauf vorbereitet, dass ihr später jemanden nach oben schickt, um ihre Fingerabdrücke zu nehmen«, erinnerte sich Jeppe.
»Okay, das kann Bovin übernehmen.«
»Er ist kein Beamter, oder?«
»Nein, aber sehr tüchtig. Ich schicke ihn hoch, wenn er hier fertig ist.«
Jeppe klopfte Clausen leicht auf die Schulter und verließ den Raum. Ein Tatort erinnerte in vieler Hinsicht an ein Theaterstück. Eine Vielzahl von Aussagen, die zusammen eine Art Ganzes ergeben. Stichworte und Einsätze. Jeppe gab es ungern zu, aber er mochte diese Dynamik, diesen Rhythmus, der an Tatorten zu spüren war.
In der Küche beschäftigte sich der Gerichtspathologe Nyboe mit der Leiche, die wie irgendein Fundgegenstand verloren auf einem bunten Flickenteppich lag. Die Frau lag bäuchlings auf dem Boden, trug abgeschnittene Jeans, einen weißen Spitzen-BH und Turnschuhe, die Arme waren nackt. Ihr langes blondes Haar hatte klebrige Tentakel gebildet und lag um den Kopf wie die Sonne auf einer Kinderzeichnung.
Nyboe war ein älterer distinguierter Herr, der mit der Selbstverständlichkeit des Ärztestandes in rasendem Tempo Fachbegriffe von sich gab, als wollte er sein Gegenüber in wenigen Sätzen zum Aufgeben zwingen. Als leitender Pathologe des Rechtsmedizinischen Instituts war er durchaus respektiert, doch Jeppe mochte ihn nicht sonderlich. Und er war sich sicher, dass dies auf Gegenseitigkeit beruhte.
»Tag, Nyboe. Und?« Jeppe hockte sich neben den Rechtsmediziner und betrachtete die Leiche.
Nyboe schüttelte den Kopf. »Das ist schlimm.« Er klang ausnahmsweise einmal nicht von oben herab. »Das Opfer ist eine junge Frau, Anfang zwanzig. Sie wurde brutal angegriffen und hat mehrere tiefe Schnittwunden und Läsionen am Kopf, Letztere sind die Folge eines Schlags mit einem schweren Gegenstand. Als ich vor knapp einer Stunde gekommen bin, betrug die Temperatur im Ohr etwa achtundzwanzig Grad, und der Rigor mortis hatte bereits eingesetzt. Der Tod dürfte also vermutlich irgendwann zwischen zweiundzwanzig und vier Uhr eingetreten sein, aber wie du weißt, kann ich noch nichts mit Sicherheit sagen. Keine unmittelbaren Hinweise auf sexuellen Missbrauch. Schnittwunden an den Händen und Armen, die darauf deuten, dass sie sich gewehrt hat, aber auch einige … Schnitte, die ihr zugefügt wurden, als sie noch lebte.«
»Du meinst, sie wurde verstümmelt, bevor sie starb?«
Nyboe nickte ernst. Keiner der beiden Männer sagte ein Wort. Beide wussten, was das bedeutete: ein Aufschrei in der Presse, Panikstimmung. Ganz abgesehen von der Reaktion der Angehörigen.
»Das Gesicht ist ziemlich lädiert, glücklicherweise hat sie aber ein paar Tätowierungen, die die Identifikation erleichtern. Tja, nur diese Schnitte …«
»Schnitte?« Jeppe sah Nyboe direkt ins Gesicht.
»Der Täter hat dem Opfer das Gesicht zerschnitten, zum Teil vor, zum Teil nach dessen Ableben. Ich bin zwar kein Kunstexperte, aber für mich sieht das aus wie eine Art Scherenschnitt«, seufzte Nyboe müde.
»Scherenschnitt? Was soll das heißen?« Jeppe zog verwirrt die Brauen zusammen.
Nyboe griff nach dem Kinn der Leiche. Mit einer vorsichtigen Bewegung drehte er das blutige Gesicht in das grelle Licht des Flurs. »Es sieht aus, als hätte der Täter für uns eine kleine rätselhafte Nachricht ins Gesicht geritzt.«
Es blieb ihnen offensichtlich nichts erspart.
Esther de Laurenti knöpfte ihren klassischen Halston-Blazer vor dem Spiegel zu und strich ihn mit den Händen vorsichtig glatt. Dünne Wollhose, Seidenbluse und Blazer, sie fühlte sich eigentlich zu fein angezogen, zu formell, aber gleichzeitig hatte sie das Gefühl, sich anständig anziehen zu müssen, um diesen Tag zu überstehen.
Gedanken schwirrten ihr durch den Kopf. Julie oder Caroline? Julie konnte es nicht sein. Durfte es nicht sein. Aber Caroline auch nicht. Die kleine Caroline, die sie seit ihrer Geburt kannte. Wie groß war die Chance, dass es sich um eine völlig fremde Frau handelte? Eine Freundin, die in der Wohnung untergekommen war und einen suspekten Typen mitgenommen hatte? Der Kopfschmerz lag schwer hinter ihren Augen, die beiden Aspirin-Tabletten, die sie geschluckt hatte, halfen nicht.
Sie hörte Kristoffer in der Küche rumoren und war froh, dass er da war. Seit bald vier Jahren war er ihr Gesangslehrer, aber mit der Zeit war ihr Verhältnis intensiver geworden. Er war inzwischen ein enger Freund, obwohl sie dreimal so alt war wie er. Jemand anderen hätte sie momentan nicht ertragen.
»Kristoffer, Schatz, kochst du Kaffee?« Sie kam ins Wohnzimmer, wo er bereits Kaffee aus der Stempelkanne einschenkte. Sie blickte in sein lächelndes, hübsches Gesicht, das von einer Familiengeschichte mit asiatischem Einschlag zeugte. Die schmalen braunen, leicht schrägen Augen, die schwarzen Haare, der schlaksige Körper. Wie immer trug er viel zu große Sachen: einen Kapuzenpullover, unter dem ein Hemd hervorlugte, Jeans mit dem Schritt fast auf Kniehöhe, Strickmütze und Lederjacke. Die Sachen ließen ihn jünger aussehen. Wie einen obdachlosen Teenager.
Kristoffer hatte eine vielversprechende Karriere als Sänger aufgegeben, um kleinere Jobs anzunehmen und zu unterrichten. Sie wusste eigentlich nicht, warum. Aber er schien mit seiner derzeitigen Hauptbeschäftigung als Garderobier im Königlichen Theater glücklich zu sein, die es ihm gestattete, nachts an seiner sonderbaren elektronischen Musik zu arbeiten und außerdem seine wenigen ausgewählten Gesangsschüler zu unterrichten.
Nachdem sie im vergangenen Herbst ihre Unterrichtstätigkeit an der Universität aufgegeben hatte und in Pension gegangen war, hatte sie sich selbst versprochen, den Rest ihres Lebens nur noch Dinge zu tun, die ihr wirklich gefielen. Singen, schreiben, kochen. Hin und wieder eine Reise und vielleicht sogar Sex, wenn sie je wieder jemanden kennenlernte, mit dem sie gern schlafen wollte. Nie wieder Prüfungen und Fakultätssitzungen.
Esther ließ sich in den pfirsichfarbenen Ohrensessel fallen und legte die Beine auf den dazugehörigen Hocker. Kristoffer setzte sich auf ein marokkanisches Sitzkissen. Epistéme und Dóxa krabbelten ihm sofort auf den Schoß und ließen sich streicheln.
»Was ist dort unten los? Wieso ist die Polizei hier?« Er fragte mit einer Unschuld, die es ihr schwermachte zu antworten. Seine weiche Stimme gehörte zu einem anderen Universum, nicht zu diesem mit seinen schrecklichen Nachrichten.
»Im ersten Stock wurde eine Tote gefunden.« Sie räusperte sich. »Ein junges Mädchen. Sie wissen noch nicht, wer es ist. Aber es klingt schlimm. Nach einem Verbrechen.« Ihre Stimme wurde rauh. »Und Gregers liegt mit einem Herzanfall im Krankenhaus. Ich habe das Gefühl, als würde gerade die ganze Welt einstürzen.«
Kristoffer kraulte Dóxas weißes Bauchfell, ohne aufzublicken. Andere hätten erschrocken aufgeschrien, Fragen gestellt und dem Schock freien Lauf gelassen. Kristoffer nicht. »Was kann ich tun?«
Dankbarkeit durchströmte sie, alles wurde ein wenig leichter. Sie war nicht allein.
»Die Hunde müssen ausgeführt werden. Und würdest du uns etwas zu essen kaufen?«
»Okay. Ich gehe mit den Hunden Gassi und koche uns was zum Essen. Vielleicht ein bisschen Fisch. Ich schaue mal, was sie in der Frederiksborggade haben.« Esther hatte ihn in der Küche angelernt, und inzwischen war Kristoffer ein recht passabler Amateurkoch.
»Danke, du Lieber, nimm dir Geld aus dem Portemonnaie im Flur. Du weißt ja, wo es liegt.« Esther lehnte den Kopf zurück und versuchte, ihren Körper mit ein paar Atemübungen zu entspannen. Eigentlich war es ja schon ziemlich seltsam, dass er überhaupt keine Fragen stellte. »Nun hör aber auf!«, flüsterte sie. »Du siehst Gespenster, alte Närrin.«
Kristoffer schaute vom Flur aus herein. »Hast du etwas gesagt?«
Sie hob den Kopf und sah sein blasses Gesicht unter dem grauen Stoff des Kapuzenpullovers.
»Tut mir wirklich leid. Ich hoffe nur, es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört«, sagte er mit seiner weichen Stimme. Dann schob er die Möpse behutsam mit den Schuhen in Richtung Wohnungstür und schloss auf. Esther hörte eine fremde Stimme.
»Äh, wohnt hier die Hauseigentümerin?«
Esther setzte sich auf und blickte in den Flur. Vor Kristoffer stand ein weißgekleideter Mann, die Möpse kläfften wie verrückt.
»Ja, das bin ich.«
Sie erhob sich mit Mühe aus dem tiefen Sessel und trat auf den Mann zu. Es war einer der Spurensicherer aus der Wohnung der Mädchen. Er hatte den Reißverschluss seines weißen Overalls aufgezogen, und ein roter Strich auf seiner Stirn verriet, dass er eben noch eine Haube getragen hatte.
»Ich soll Ihre Fingerabdrücke nehmen.«
»Ja, natürlich. Man hat mir gesagt, dass jemand kommen würde. Esther de Laurenti, guten Tag.«
Sie streckte die Hand aus. Der Mann stellte seinen Aktenkoffer auf den Boden und erwiderte freundlich ihren Händedruck. Bei dem Gedanken, was sich in der ersten Etage ihres Hauses abspielte, zog sich Esther der Magen zusammen. »Wie geht das? Was brauchen Sie?«
»Einen Tisch und Ihre Hände, das ist alles. Es dauert nur einen Moment.«
Esther schob die Ärmel hoch und zeigte auf ihren Schreibtisch. Zu ihrer Überraschung sah sie, dass Kristoffer noch immer an der Tür stand und ihnen mit seinen dunklen Augen zusah. Sie blieb stehen und warf ihm ein herzliches Lächeln zu. Offensichtlich war er ebenso erschüttert wie sie.
Sie schwingt sich aufs Rad und fährt durch die Innenstadt. Es ist ein älteres Raleigh-Damenfahrrad, auf einer Polizeiauktion gekauft – in Kopenhagen benutzen alle nur gebrauchte Räder. Sie fährt in den kleinen Gassen gegen die Einbahnstraße und genießt den Fahrtwind, der ihre Augen tränen und die Nase laufen lässt. Sie kauft ein Croissant in ihrem kleinen Café, in dem immer superinteressante Typen mit Takeaway-Bechern in den Händen stehen. Der Barista ignoriert sie, obwohl er lediglich die Spülmaschine zu füllen hat. Verärgert beschließt sie zu gehen, bleibt aber trotzdem und wartet.
Da, wo sie herkommt, gibt es keine Cafés, abgesehen vom Imbiss beim Busbahnhof und den zwei Tischen in dem Möbelladen an der Hauptstraße. Mit Beklemmung erinnert sie sich an die endlosen Nachmittage und Abende ihrer Kindheit in Dunkelheit und Einsamkeit. An die schweren Holztüren, die immer geschlossen sein mussten, damit es nicht zog, und an die angestrengten Gespräche ihrer Eltern beim abendlichen Brokkoligratin. Mutter war ständig krank, sie war noch so klein, als sie starb. Anfälligkeit war immer ein Teil ihres Zuhauses gewesen, ebenso präsent wie das große Ecksofa, in dem nie Gäste saßen. Anfälligkeit und Krankheit.
Später dann die kalten Sommerabende in dünner Jeansjacke und rastloses Pendeln zwischen Tankstelle und Fußballplatz. Als könnten die Schritte irgendwohin führen. Als könnte der polnische Wodka, den sie in die Cola-Dosen füllten und mit einem Strohhalm tranken, sie betrunken machen. Sie trieben sich in den Straßen herum, nicht nur sie, niemand wollte zu Hause bleiben. Sie hingen an der Haltestelle herum und sahen die Busse vorbeifahren. Das kleine Kaff war es nicht mal wert, im Eisenbahnnetz vorzukommen. Die Jugendlichen des Ortes waren gezwungen, ihre Sehnsüchte auf heruntergekommene Überlandbusse mit Zielort Holstebro zu konzentrieren.
Sie bekommt ihren Kaffee, macht die Papiertüte am Lenker fest und tritt wieder in die Pedale.
3
Zurück im Büro setzten Jeppe und Anette sich an ihre Schreibtische, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Jeppe holte zwei Becher Kaffee aus der Teeküche, seinen mit Kaffeesahne, Anettes schwarz mit Zucker. Sie hatten den gleichen Dienstrang, aber wenn sie zusammenarbeiteten, holte immer er den Kaffee, und sie fuhr den Wagen. Das waren ungefähr die einzigen beiden Dinge, über die sie nie diskutierten – innerhalb ihrer turbulenten Partnerschaft eine wohltuende Konstante.
Das Kopenhagener Polizeihauptquartier war eigentlich ein imposantes Bauwerk, doch hatten die Modernisierungen der letzten Jahre diesen Eindruck zerstört. Dies galt indes nicht für die Mordkommission, die mit ihren gewölbten Decken und dunkelroten Wänden die ursprüngliche düstere Anmutung beibehalten hatte. Hier war von den Innenarchitekten nur das Mobiliar ausgewechselt worden – an der Katakombenatmosphäre und den abblätternden Farben durften sie nicht rühren. Das Ergebnis war eine bizarre Kombination aus Versäumnis und Fortschritt.
»Ist die Identifikation abgeschlossen?«, begann Anette. Irritiert bemerkte Jeppe, wie gutgelaunt sie im Gegensatz zu ihm zu sein schien. Sie hatte frischen blauen Lidschatten aufgelegt und sah aus wie jemand, der innerhalb der vergangenen vierundzwanzig Stunden Sex, eine gute Mahlzeit und acht Stunden ungestörten Schlaf gehabt hatte. Am liebsten wäre er um den Schreibtisch herumgegangen und hätte sie aus ihrem Stuhl gekippt.
Jeppe wusste, dass es eine rhetorische Frage war. Beide hatten sie das Gesicht der Leiche und vor allem die Tätowierungen – zwei Sterne und ein paar Wörter auf dem rechten Handgelenk sowie eine Feder auf dem Schulterblatt – mit den vielen Fotos verglichen, die sie auf dem Laptop gefunden hatten. Bei dem Opfer handelte es sich eindeutig um Julie Stender, eine von Esther de Laurentis jungen Mieterinnen. Allerdings wären sie vermutlich nicht so sicher gewesen, hätten sie die Leiche nur anhand des malträtierten Gesichts identifizieren müssen.
»Ja, sicher. Wer nimmt Kontakt zu Julie Stenders Familie auf?« Jeppe blätterte in seinem Notizbuch. »Die Eltern wohnen in einem kleinen Ort namens Sørvad, irgendwo in der Nähe von Herning. Schaust du mal nach?«
Anette tippte etwas in ihren Computer ein und rief dann die Polizei von Mittel- und Westjütland an, um die Maschinerie in Gang zu setzen.
Derweil schlug Jeppe eine neue Seite in seinem Notizbuch auf und legte eine To-do-Liste an. Als junger Mann hatte er alles Mögliche in seine Notizbücher geschrieben, Ideen, Gedanken, Pläne für die Zukunft, sogar ein Reisetagebuch hatte er darin geführt. Jetzt hielt er sich an die Arbeit.
MÄNNLICHE BEKANNTSCHAFTEN, schrieb er in sorgfältigen Versalien.
MUSTER DER MESSERVERLETZUNGEN?
CAROLINE, ergänzte er mit einem Ausrufezeichen.
MORDWAFFE (NYBOE/CLAUSEN)
JULIES COMPUTER UND TELEFON, fuhr er fort und fügte noch
HAUSBEWOHNER hinzu.
Er hörte, dass Anette eine Anordnung in den Hörer bellte.
»Stender, sag ich doch! S-T-E-N-D-E-R, begreifen Sie endlich! Christian und Ulla Stender. Sie wohnen in Sørvad. Auf einem Hof auf dem Land. Waldweg. Nur unterrichten, nicht vernehmen, verstehen Sie. Wir kommen selbst. Rufen Sie bitte zurück, wenn Sie dort gewesen sind.«
Den Abschiedsgruß ließ sie weg und legte auf.
»Das kannst du von der Liste streichen, Jeppesen!«, meinte sie zufrieden und stand auf, wobei sie die Hose hochzog. »Wollen wir mit dem Briefing beginnen? Wir haben ziemlich viel Arbeit zu verteilen.«
Sie marschierte davon, ohne eine Antwort abzuwarten. Jeppesen! Er hasste es, wenn sie ihn so nannte. Er blieb noch einen Augenblick sitzen, um seine Liste noch einmal durchzugehen.
Der Gedanke an die nächsten Tage beunruhigte ihn. Sobald die Sache publik würde, würde der Fall zum Selbstläufer. Er sah die Titelseiten bereits vor sich. »Junges Mädchen misshandelt, ermordet und verstümmelt. Täter auf freiem Fuß.«
Er musste mit der Polizeikommissarin sprechen, damit die Verstümmelungen der Leiche so lange wie möglich unveröffentlicht blieben und keine Panik aufkam. Sämtliche Details, die auf einen Wahnsinnigen als Täter hinwiesen, mussten bis auf weiteres intern bleiben. Wie viel Zeit hatten sie? Einen Tag, höchstens zwei, aber das war besser als nichts.
In der Kantine, wo das Briefing stattfand, war es ungewöhnlich still, als Jeppe eintrat. Normalerweise hallte der Raum von Geschichten und lautem Gelächter wider, Witze über abgesägte Köpfe, mit denen man Fußball spielte, waren hier an der Tagesordnung. Aber wirklich ernste Fälle dämpften immer die Stimmung. So zum Beispiel alles, was mit Kindern zu tun hatte. Oder Fälle, bei denen ein überführter Täter mangels Beweisen oder wegen Formfehlern auf freien Fuß gesetzt werden musste. Und Fälle wie dieser – für den alle Kräfte mobilisiert und Freizeit gestrichen wurden.
Einer der Polizeiassistenten knackte mit den Fingern. Jeppe versuchte, das Geräusch zu ignorieren, es irritierte ihn trotzdem. Normalerweise verstümmeln Gewaltverbrecher und Mörder ihre Opfer nicht bei lebendigem Leib. Es war zu früh, um zu spekulieren, ob es sich um einen sadistischen Exliebhaber oder etwas noch Schlimmeres handelte. Abgesehen von dem Fingerknacken war es still im Raum. Jeppe schaute seine Kollegen an, atmete tief durch und setzte dann zu seiner Rede an.
»Soll ich für Sie drücken? In welche Etage müssen Sie denn?«, fragte die kahle Frau mit dem Infusionsständer und hielt ihre Hand vor die vielen Knöpfe des Fahrstuhls. Esther nickte.
»Vierzehnte, vielen Dank.«
Die Tür schloss sich, und beide verstummten. Esther hätte sich gern unterhalten – übers Wetter, über alles Mögliche –, aber sie wusste ja nicht, wann die Frau das letzte Mal das Krankenhaus hatte verlassen können, also hielt sie den Mund. Die Frau stieg im zweiten Stock aus, schob ihr Gestell geschickt aus dem Fahrstuhl und grüßte sie mit einem – wie ihr schien – wehmütigen Lächeln. Als die Tür wieder zu war, spuckte Esther diskret auf ihre Fingerspitzen und versuchte, den letzten Rest Stempelfarbe an einem zusammengeknüllten Papiertaschentuch abzuwischen.
Der Beamte, der wegen ihrer Fingerabdrücke gekommen war, hatte ihr erzählt, dass Dänemark das einzige Land der Welt war, in dem noch Stempelfarbe benutzt wurde. Einhundert Millionen Kronen würde es kosten, ein modernes Scanner-System einzuführen, wie es der Rest der Welt längst nutzte. Sogar Zentralafrika sei Dänemark in diesem Punkt voraus, hatte er erklärt, während er ihre Finger in das Stempelkissen und den Zehnfingerbogen drückte. Merkwürdiger Typ. Direkt danach hatte sie sich die Finger mit der Nagelbürste geschrubbt, doch die Farbe war hartnäckig.
Die kardiologische Intensivstation des Rigshospitals sah nicht aus wie ein Ort, an dem man sich gern aufhielt. Irgendjemand hatte versucht, das allgegenwärtige Leiden mit Bildern und Plakaten in den fröhlichsten Farben zu übertünchen. Neben dem Fahrstuhl hing das Konzertprogramm eines Amateursängers, das acht Stücke aus dem populären Volkshochschulgesangbuch zu Klavierbegleitung ankündigte. Wie deprimierend. Bekommen Patienten etwa bessere Laune durch mitfühlende Unterhaltung, die kein gesunder Mensch länger als fünf Minuten erträgt?, fragte sich Esther, als sie den Schalter der Glastür zum Abschnitt 3-14-2 drückte.
Gregers Hermansen lag allein in einem Zweibettzimmer, das Gesicht einem Fenster mit Blick über Kopenhagen zugewandt; es sah aus, als versuchte er sich mit dem Blick von hier wegzubeamen. Esther klopfte vorsichtig an die offene Tür. Ohne sich umzudrehen, begann Gregers zu weinen. Wie ein Kind, das sich die Tränen so lange verbeißt, bis die Mutter kommt, um ihm aufs Knie zu pusten. Esther blieb an der Tür stehen und überlegte einen Augenblick, ob sie sich fortstehlen konnte, bevor er sich umdrehte. Doch schließlich besann sie sich.
»Hey, Gregers, ich bin’s.« Sie ging auf das Krankenhausbett zu.
Gregers ließ seinen Tränen jetzt freien Lauf, er schluchzte hemmungslos und geräuschvoll. Sie nahm seine Hand und blieb lange schweigend neben ihm stehen.
Alter Freund, du armer Kerl, dass du aber auch so etwas erleben musst, dachte sie und wurde von Mitleid überwältigt. Seit über zwanzig Jahren kannte sie ihn nun schon, und doch wusste sie nicht wirklich, wer er war. Obwohl sie eine Ewigkeit unter einem Dach gelebt hatten, waren sie nie Freunde geworden. Das tat ihr jetzt leid.
Eine Krankenschwester kam herein und schraubte an dem Tropf, der über dem Bett hing.
»Er weint viel. Aber es ist ganz normal, dass ein Herzanfall heftige emotionale Reaktionen auslöst. Der Schock hat ihn ziemlich mitgenommen. Das ist bei älteren Patienten oft der Fall. Es ist sozusagen der letzte Hilferuf, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
Als würde er nicht dort liegen und alles mitbekommen! Esther nickte verlegen und drückte Gregers’ Hand.
»Wissen Sie, ob er tatsächlich eine Leiche gefunden hat? Das habe ich in der Cafeteria gehört.«
Esther befand, dass es unter ihrer und Gregers’ Würde war, die Frage zu beantworten.
»Er hat Morphium bekommen, Sie werden sehen, dass er ein wenig benommen ist. Aber sein Zustand ist vollkommen stabil. Sie können gern eine Weile bleiben und sich mit ihm unterhalten, das wäre gut für ihn. Nicht wahr, Gregers?«
Die Krankenschwester tätschelte seine Hand und verließ das Zimmer, ohne eine Antwort abzuwarten. Esther zog einen Stuhl ans Bett, knöpfte die Jacke auf und griff wieder nach Gregers’ Hand. Sie wollte etwas Tröstendes sagen, aber es klang alles irgendwie verkehrt, also saß sie stattdessen nur da und hörte seinem Weinen zu; sie fühlte sich inkompetent und unwohl. Sie brauchte Urlaub, sie brauchte ein Glas Rotwein. Und Ruhe im Kopf. Um die tausend Gedanken zu verarbeiten, die ineinander übergingen und alle im Leeren endeten. Um sich an die Zeit zu erinnern, als sie selbst in einem Krankenhausbett lag und weinte. Es war unendlich lange her. Damals war niemand da gewesen, der ihr die Hand gehalten hätte.
Sie bemerkte, dass sie die knochige Hand zu fest drückte, lockerte ihren Griff und tätschelte sie linkisch. Das Weinen ließ allmählich nach.
»Ähm …« Die Stimme war brüchig, eingerostet wie die eines Eremiten. Esther beugte sich vor und spitzte die Ohren.
»Ähm. Ist. Sie?« Er war so heiser, dass sie seine Frage nicht verstand. Gregers räusperte sich irritiert und zeigte auf eine Plastikkanne mit rotem Saft. Sie schenkte ein Glas ein und ließ ihn trinken, füllte es erneut und wartete, bis er so weit war.
»Ich bin über einen … Körper gestolpert. Da war Blut an den Wänden. Die Polizei wollte mir nichts erzählen. Die haben mich nur immer wieder dasselbe gefragt.« Erneut kamen ihm die Tränen. Er sah so hinfällig aus, so gebrechlich, und mit einem Mal ging ihr durch den Kopf, dass sie ihn als Alten betrachtete – ganz im Gegensatz zu sich selbst.
»Ich weiß nicht, wer es ist, Gregers. Die Polizei wollte noch nichts sagen.«
»War sie tot? Als ich … sie fand. War sie da tot?«
Natürlich. Davor hatte er Angst. Dass er sie hätte retten können. Hatte denn die Polizei überhaupt nicht mit ihm gesprochen? Oder ihn vernommen?
»Als du gekommen bist, Gregers, war sie schon lange tot. Du hättest nichts tun können, verstehst du?« Sie wusste nicht, wann das Mädchen gestorben war, sie kannte die näheren Einzelheiten nicht, aber sie sah keinen Grund, ihn nicht mit allen Mitteln zu beruhigen.
Nun, da sie sich auf Gregers konzentrierte und nicht auf sich selbst, spürte sie mit einem Mal, dass der Kater vom gestrigen Abend und die hämmernden Kopfschmerzen verflogen waren und sie stattdessen das schiere Entsetzen packte. Ihr Hals schnürte sich zusammen. Konnte so etwas tatsächlich passieren? In ihrem Haus, in ihrem Leben?
»Warum?« Er sah sie flehend an und wusste nicht, dass seine Gedanken ein Echo ihrer eigenen waren. Esther ging etwas durch den Kopf, und einen kurzen Moment lang hatte sie ein schlechtes Gewissen, aber sie verdrängte es gleich wieder. Es handelte sich doch um einen Zufall. Um einen kranken, verrückten Zufall.
In der Cafeteria war das Rascheln von Papieren und das Klackern von Tastaturen zu hören. Bevor Jeppe die Besprechung offiziell beendete, blickte er auf sein von der Polizeikommissarin zusammengestelltes Team. Polizeiassistent Torben Falck war ein erfahrener und tüchtiger Polizist, Polizeiassistentin Sara Saidani ein regelrechter Glücksfall, und Anette wurde man ohnehin nicht so leicht los. Der Einzige, mit dem er Probleme hatte, war Polizeiassistent Thomas Larsen. Er war erst seit einem halben Jahr als Polizeiassistent im Präsidium, schien aber die Karriereleiter blitzschnell hinaufzusteigen. Jeppe hatte versucht, ihm den Spitznamen Karamellbonbon anzuhängen, aber seine sonst so gern frotzelnden Kollegen waren nicht darauf angesprungen. Und Karamell schien leider auch der Lieblingsgeschmack der Polizeikommissarin zu sein.
»Also gut, von heute an treffen wir uns täglich direkt nach den Wachwechseln um acht und um sechzehn Uhr hier in der Kantine, um uns gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen. Zusätzlich natürlich nach Bedarf. Sämtliche Unterlagen und Fotos werden im Büro von Anette und mir gesammelt, eine der Sekretärinnen wird ein Whiteboard für uns vorbereiten. Per Video-Briefing bitten wir um fünfzehn Uhr um Unterstützung durch die übrigen Reviere für die Haus- und Straßenvernehmungen in der Klosterstræde am späten Nachmittag und Abend, so dass wir Zeugenaussagen bekommen, solange die Erinnerungen noch frisch sind.
Falck, du fährst noch einmal ins Krankenhaus und sprichst mit Gregers Hermansen, wenn er dazu in der Lage ist. Und hinterher mit den Inhabern der Cafébar in der Klosterstræde 12, das sind zwei junge Burschen, die Sekretärin hat ihre Namen. Sie haben Gregers Hermansen und Julie Stenders Leiche heute Morgen gefunden und befinden sich ebenfalls im Rigshospital. Sie stehen wegen eines eventuellen Schocks unter Beobachtung, aber soweit ich gehört habe, geht es ihnen ausgezeichnet.«
Polizeiassistent Falck salutierte nach Pfadfinderart mit zwei Fingern an einem imaginären Mützenschirm.
»Larsen fängt damit an, Julie Stenders familiären Hintergrund zu durchleuchten. Freunde, Kollegen, eventuelle Liebhaber, alte Klassenkameraden. Saidani befasst sich wie immer mit Facebook und allem, was mit Computern, Telefonen und den sozialen Medien zu tun hat.«
Sara Saidani sah von ihrem Notebook auf und nickte kurz, ihre dunklen Locken wippten. Larsen sah Jeppe nur mit verschränkten Armen an.
»Anette und ich nehmen Kontakt zu den Eltern auf und besuchen noch einmal Esther de Laurenti. Die Obduktion findet morgen früh statt, das übernehmen wir auch. Beamte in Kopenhagen und Südschweden suchen intensiv nach Caroline Boutrup und ihrer Freundin.« Jeppe schaute auf seine Notizen. »Jemand muss die Überwachungskameras in der Innenstadt überprüfen. Vor den Banken, den 7-Eleven-Kiosken, den Matas-Drogeriemärkten und so weiter. Wer übernimmt das?«
Falck zeigte noch einmal den Pfadfindergruß. Jeppe rutschte auf dem Stuhl nach vorn, um die Lendenwirbel zu entlasten. Dabei sah er, wie Anette ihm mit dem Telefon am Ohr ein Zeichen gab und kurz darauf das Gespräch beendete.
»Das war Mittel- und Westjütland. Sie waren in Sørvad, aber die Familie war nicht zu Hause. Und jetzt rate mal, was die Nachbarn gesagt haben, wohin die Stenders gefahren sind.«
Woher sollte er das wissen?
»Nach Kopenhagen! Die sind hier in der Stadt! Sie wohnen im Hotel Phønix. Ich überprüfe gleich, ob sie auf ihrem Zimmer sind. Ansonsten habe ich die Handynummer des Vaters.« Sie zog sich beim Sprechen die Jacke an und war bereits auf dem Weg zur Treppe, bevor Jeppe sich überhaupt erhoben hatte.
Der träge Vormittagsverkehr auf der Bredgade rauschte im Nieselregen vorbei, als Jeppe und Anette vor dem Hotel parkten. Eine Gruppe japanischer Touristen hatte sich mit Regenschirmen, Regenponchos und – zumindest die Frauen – bizarren weißen Stoffhandschuhen bewaffnet, die Jeppe an seine munteren Electric-Boogie-Tage in den achtziger Jahren erinnerten. Allerdings waren die Japaner wohl kaum auf dem Weg in die Disko.
Das Foyer des Hotels glich mit den Diamanttropfen der Kronleuchter und den schweren Brokatgardinen dem Inneren eines Baisers. Anette würdigte den Springbrunnen, der mitten auf dem weißen Marmorfußboden stand, keines Blickes. Hinter der Rezeption stand ein junger Mann mit einer Polyesterfliege. Das Telefon klingelte ausdauernd, und der Jüngling schien unsicher, wem er Vorrang geben musste. Jeppe beugte sich ein wenig über den Tresen und sprach gedämpft, um unnötige Aufmerksamkeit zu vermeiden.
»Polizei. Wir haben vorhin angerufen. Wir wollen mit Christian Stender sprechen. Wie ist seine Zimmernummer?«
»Einen Moment, bitte, ich bin gleich für Sie da.« Der Rezeptionist griff nach dem Hörer.
»Wir sind von der Polizei, habe ich gesagt. Also hören Sie mir zu.«
Der Rezeptionist bedeutete ihm mit der Hand zu warten. »Augenblick, mein Herr, ich bin sofort bei Ihnen.« Er wandte den Blick ab und griff zum Hörer. Mit routinierter Überheblichkeit begann er, seine einstudierte englische Begrüßungsformel aufzusagen. Doch Jeppe packte ihn unversehens am Arm und drückte fest zu.
Der Rezeptionist blickte erschrocken auf.
»Ich sagte: sofort! Wie heißen Sie, Sie Trottel? Zeigen Sie mal Ihr Namensschild. Nikolaj?« Er schaute zu Anette, die ihn überrascht ansah. Und sich räusperte.
Der junge Mann hinter dem Tresen verhaspelte sich fast vor Schreck. »Zimmer 202. Im zweiten Stock. Der Fahrstuhl ist gleich um die Ecke.«
»Danke, Nikolaj. Und einen schönen Tag noch.«
Auf dem Weg zum Fahrstuhl sah Anette ihren Kollegen fassungslos an.
Sie fuhren hoch und klopften an die Tür von Zimmer 202. Auf Anettes Veranlassung hatte das Hotel Herrn und Frau Stender ohne weitere Erklärung gebeten, auf ihrem Zimmer zu bleiben. Eine kleine, elegante Frau mit grauer Kurzhaarfrisur öffnete. Mit ernstem Gesichtsausdruck und einer Kummerfalte, die über ihrer Perlmuttbrille aussah wie ein Kastenzeichen, begrüßte sie sie und zog sich ein paar Schritte zurück, so dass Anette und Jeppe das stickige Hotelzimmer betreten konnten.
Christian Stender saß in einem gepolsterten Plüschsessel, den Kopf in die Hände gestützt. Die obersten Knöpfe seines Hemds standen offen, so dass seine graumelierte Brustbehaarung und ein ansehnlicher Bauchansatz zu erkennen waren. Ein Paar bequeme Schuhe, die durchaus mal wieder hätten geputzt werden können, stand neben dem Sessel und zeugte von einem Besitzer, der Komfort mehr schätzte als Stil. Er hob den Kopf und blickte kurz auf seine Gäste, bevor er wieder in sich zusammensank. Auf dem Gesicht standen Schweißperlen, die Augen waren klein und rotgerändert.
»Christian ist prompt zusammengebrochen, als der Rezeptionist uns mitgeteilt hat, dass die Polizei mit uns reden will. Er ist überzeugt, dass Julie, seiner Tochter, etwas zugestoßen ist. Meiner … äh, Stieftochter. Sie geht nicht ans Telefon. Ich habe versucht, ihn zu beruhigen, aber er hört nicht auf mich. Es geht um den Einbruch, nicht wahr? Es geht doch um den Einbruch in die Firma?«
»Leider sind wir nicht hier, um über einen Einbruch zu sprechen, Frau Stender. Es tut mir leid, aber ich habe schlechte Nachrichten. Und dabei geht es tatsächlich um Julie.«
Christian Stender schaute von seinem Sessel auf, die Augen so glasig wie die eines Heroinabhängigen. Alles an ihm verharrte im Pausenmodus, reglos abwartend. Jeppe versuchte, den Gesichtsausdruck auf verborgene Hinweise zu lesen, aber er fand nur diese Angst, die Eltern heimsucht, wenn sich ihre schlimmsten Befürchtungen zu bewahrheiten scheinen.
»Es tut mir sehr leid, Ihnen mitteilen zu müssen –« Jeppe kam nicht weiter, da Christian Stender brüllte wie ein Geistesgestörter, den man in eine Ecke gedrängt hatte. Während er schrie, rutschte er vornübergebeugt aus dem Plüschsessel und endete halb auf den Knien in der grotesken Position eines Bittstellers. Sein Gesicht war verzerrt, das Haar lag wie eine fettige Schicht dünner Schnüre über der blanken Glatze. Er glich einem Amateur-Opernsänger bei der Aufführung seiner großen Wahnsinnsszene.
Jeppe registrierte das alles und stellte gleichzeitig fest, dass sein eigener Observationsmechanismus zu einhundert Prozent nüchtern blieb. Keinerlei Ausschlag auf dem Empathiebarometer. Was zum Teufel war mit ihm nicht in Ordnung?
»Wir haben die Leiche einer jungen Frau in der Wohnung von Julie und Caroline gefunden«, schob er zwischen die Ausbrüche des Vaters ein. »Und ich muss Ihnen leider mitteilen, dass es sich dabei um Julie handelt. Wir müssen noch … einige Untersuchungen vornehmen, bevor die Identifikation offiziell ist, aber wir haben keinen Zweifel.«
Die Obduktion und die zahnärztliche Untersuchung wollte er lieber nicht erwähnen.
»Es tut mir sehr leid.« Jeppe hielt inne.
Christian Stender war auf dem Fußboden zu einem schluchzenden Haufen zusammengebrochen. Seine Frau stand hinter dem Stuhl, starrte ihn an und zupfte am Polster.
»Würden Sie uns einen Moment allein lassen?« Ulla Stender sprach leise, aber mit einer unerwarteten Autorität. »Ich bin mir bewusst, dass wir Sie aufs Revier oder so etwas begleiten müssen, aber wären Sie so freundlich, uns einen Augenblick Zeit zu geben, um uns zu sammeln? Allein?«
Jeppe erhob sich und suchte Anettes Blick. Sie verständigten sich wortlos darauf, der Frau diesen Gefallen zu tun, nur froh, das stickige Zimmer und die heftigen Gefühle darin verlassen zu können.
»Wir warten in der Lobby. Lassen Sie sich ruhig Zeit.«
Mehr sagte er nicht. Schloss nur die Tür. Das Letzte, was er sah, bevor die Tür zuging, war die schmächtige Frau, die mit ausgestreckten Armen auf ihren Mann zuging.
Ihr Vater ruft einmal pro Woche an, um sich zu erkundigen, ob alles in Ordnung ist und sie genügend Geld hat. Manchmal geht sie ans Telefon. Er versteht nicht, warum sie nach Kopenhagen ziehen musste, um zu studieren, und vor allem, warum sie nichts Ordentliches studiert. Dänisch kann sie doch schon. Und Aarhus ist doch auch eine große Stadt. Er klingt alt am Telefon.
Sie hat lange gebraucht, um sich in der Stadt auszukennen. Inzwischen weiß sie, wie sie mit dem Rad von der Bibliothek über die Store Kannikestræde zur Universität kommt, sie kennt die beste Ecke des Königlichen Gartens, wenn die Sonne scheint, und den Weg über die Langebro mit ihrem dichten Verkehr und dem gefährlich schmalen Radweg.
Das Leben, nach dem sie sich so gesehnt hat, findet nun überall um sie herum statt. Trotzdem sehnt sie sich mehr denn je danach.
Damals, als sie klein war, waren es immer die aus der fünften Klasse, die beim LuciaFest auf den Umzug mitgehen durften. Sie stand mit einer Mandarine in der Hand am Straßenrand und sah zu, wie die älteren Kinder mit Kerzen und Engelsgewändern an ihr vorbeizogen, und freute sich darauf, irgendwann selbst zu den Großen zu gehören. Doch als sie in die Fünfte kam, erhielt die Schule einen neuen Rektor. Von nun an sollten die Viertklässler am Lucia-Umzug teilnehmen. Jetzt war sie plötzlich zu groß. Immer kam sie zu früh oder zu spät, nie war sie zur rechten Zeit am richtigen Ort.
Irgendwann wird jedoch die Zeit kommen, wo sie endlich mittendrin sein wird, nicht mehr außen vor. Irgendwann muss es doch so weit sein.
4
Vernehmungsraum 6