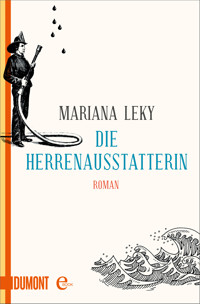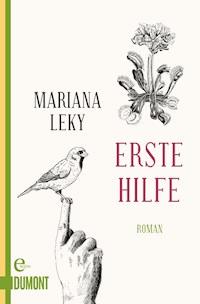Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Alle wirken innerlich blitzblank, nur in unserem Inneren sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa«, denkt sich Kioskbesitzer Armin, als er vergeblich versucht, erfolgreich zu meditieren. Und auch im Inneren der anderen Figuren dieser literarischen Kolumnen herrscht Unordnung: Frau Wiese kann nicht mehr schlafen, Herr Pohl ist nachhaltig verzagt, Lisa hat ihren ersten Liebeskummer, Vadims Hände zittern, Frau Schwerter muss ganz dringend entspannen, ein trauriger Patient hat seine Herde verloren, und Psychoanalytiker Ulrich legt sich mit der Vergänglichkeit an. Kummer aller Art plagt die Menschen, die sich, mal besser, mal schlechter, durch den Alltag manövrieren. Aber der Kummer vereint sie auch, etwa, wenn auf Spaziergängen Probleme zwar nicht gelöst werden, aber zumindest mal an die Luft und ans Licht kommen. Klug, humorvoll und mit großem Sinn für Feinheiten und Absurditäten porträtiert Mariana Leky Lebenslagen von Menschen, denen es nicht an Zutraulichkeit mangelt, wohl aber am Mut zur Erkenntnis, dass man dem Leben nicht dauerhaft ausweichen kann. Die in ›Kummer aller Art‹ versammelten Texte erschienen erstmals als Kolumnen in PSYCHOLOGIE HEUTE.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kummer aller Art plagt die Figuren dieser literarischen Kolumnen: Sie leiden unter Schlaflosigkeit, Liebeskummer, Anspannung, Traurigkeit oder hadern mit der Vergänglichkeit. Doch der Kummer bringt sie auch zusammen, etwa, wenn auf Spaziergängen Probleme zwar nicht gelöst werden, aber zumindest mal an die Luft und ans Licht kommen.
Klug, humorvoll und mit großem Sinn für Feinheiten und Absurditäten porträtiert Mariana Leky Lebenslagen von Menschen, denen es nicht an Zutraulichkeit mangelt, wohl aber am Mut zur Erkenntnis, dass man dem Leben nicht dauerhaft ausweichen kann.
© Birte Filmer
Mariana Leky studierte nach einer Buchhandelslehre Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Sie lebt in Berlin und Köln. Bei DuMont erschienen der Erzählband ›Liebesperlen‹ (2001), die Romane ›Erste Hilfe‹ (2004), ›Die Herrenausstatterin‹ (2010) sowie ›Bis der Arzt kommt.‹ (2013). 2017 veröffentlichte sie den SPIEGEL-Bestsellerroman ›Was man von hier aus sehen kann‹, der in über zwanzig Sprachen übersetzt und für das Kino verfilmt wird.
Die literarischen Kolumnen aus ›Kummer aller Art‹ erschienen erstmalig in Psychologie Heute.
Für die Buchveröffentlichung wurden sie von der Autorin überarbeitet.
Die Autorin dankt herzlich der Redaktion der Psychologie Heute, insbesondere Dorothea Siegle.
Mariana Leky
KUMMERALLERART
Von Mariana Leky sind bei DuMont außerdem erschienen:
Liebesperlen
Erste Hilfe
Die Herrenausstatterin
Bis der Arzt kommt. Geschichten aus der Sprechstunde
Was man von hier aus sehen kann
E-Book 2022
© 2022 DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © Marinavorona/Adobe Stock
Satz: Fagott, Ffm
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-8321-8261-8
www.dumont-buchverlag.de
Flugangst hält einen in der Luft
Es ist Montagnachmittag, ich sollte am Schreibtisch sitzen oder den Schreibtisch zumindest umkreisen. Stattdessen stehe ich auf einer vom Regen aufgeweichten Wiese und umkreise einen Baum, in Gesellschaft eines Zwergpinschermischlings namens Lori. Lori gehört meinem Nachbarn Herrn Pohl, der heute zu unglücklich ist, um Lori auszuführen.
Lori zittert. Das tut sie unentwegt, zu jeder Jahreszeit, ich vermute, dass sich das für Zwergpinschermischlinge so gehört. Seit geraumer Zeit stehen wir hier im Matsch und ich überlege, wie Herrn Pohl zu helfen wäre. Ich möchte Herrn Pohl unbedingt helfen – auch, weil er einer der hilfsbereitesten Menschen ist, die ich kenne. Als gestern ein Kind mit seinem quietschenden Dreirad ungefähr tausend Mal die Straße auf und ab fuhr und schließlich die Nachbarin im ersten Stock das Fenster öffnete und herunterschimpfte, dass sie verdammt noch mal ihren Mittagsschlaf bräuchte, kam Herr Pohl mit einem Fläschchen Öl heruntergeeilt und sorgte dafür, dass das Kind lautlos weiterfahren konnte. Und als mir neulich abends Druckerpapier fehlte, rief ich bei Herrn Pohl an, entschuldigte mich für die späte Störung und fragte, ob er mir mit ein paar Blatt aushelfen könne. »Ich bin sofort da«, antwortete er, lief mit wehendem Bademantel über dem Schlafanzug zu mir herunter und überreichte mir einen kompletten Fünfhunderterpack Papier. »Sagen Sie gerne Bescheid, wenn Sie noch mehr benötigen«, sagte er.
Jetzt braucht Herr Pohl Hilfe, und ich zerbreche mir den Kopf darüber, was ich für ihn tun kann, als plötzlich zwei Jungs im Grundschulalter über die Wiese laufen. Der eine trägt eine Pudelmütze, deren Ränder er sich hinter die Ohren geklemmt hat, was ziemlich lustig aussieht. Die beiden haben Leuchtschwerter dabei, die auf Knopfdruck röhren und blinken können, und unterhalten sich über Superkräfte. Der eine Junge deutet mit seinem Leuchtschwert auf den neben mir bebenden kleinen Hund und fragt, nicht ohne Hohn: »Was ist denn seine Superkraft?«
Ich schaue mitleidig auf Lori und überlege, wie wir würdevoll aus dieser Frage herauskommen, als der Junge mit der Pudelmütze sagt: »Seine Superkraft ist Angst. Wenn der zittert, bebt die ganze Welt.«
Mir leuchtet jede absonderliche Angst ein. Wenn man mir ein paar Minuten Zeit gibt, könnte ich umstandslos auch eine Angst vor Quittengelee oder Hutablagen nachvollziehen. Herr Pohl weiß das, und trotzdem hat es einige Zeit gebraucht, bis er den Mut fand, mir von seiner Angst zu erzählen. Er stand vor meiner Tür und druckste so ausgiebig herum, dass ich schon fürchtete, er würde mir gleich seine Liebe oder einen Banküberfall gestehen. Es war dann aber Platzangst. Herr Pohl fürchtet sich vor Aufzügen, vor öffentlichen Verkehrsmitteln und anderen Gehäusen, die man nicht sofort verlassen kann. Herr Pohl hat sehr viel unternommen, um seine Angst loszuwerden: Er hat sich hintereinander mit drei Verhaltenstherapeuten bewaffnet, mit Meditationskissen, mit progressiver Muskelentspannung, mit Tabletten, die die Angst stilllegen, aber leider auch alles andere, mit knallharter Konfrontation und mit positiven Affirmationen. »Ich werde es einfach nicht los«, sagte Herr Pohl leise und immer wieder, »ich werde es einfach nicht los«, und selten habe ich jemanden so traurig in unserem Hausflur stehen sehen, so müde und innerlich zerzaust.
Die Jungs auf der Wiese versuchen, Lori in einen Leuchtschwertkampf zu verwickeln, aber Lori kann nicht, sie muss sich ganz auf ihre Superkraft konzentrieren, von der weder sie noch ich bislang wussten, dass es eine ist, und ich denke an meine eigenen Ängste. Eine davon ist die vor dem Fliegen. Ich halte Fliegen für vollkommen abwegig. Immer, wenn es gar nicht anders geht und ich in die Luft muss, weil die Deutsche Bahn keine Verbindung nach beispielsweise Alabama anbietet, würde ich mich am liebsten den ganzen Flug über an die Beine der Flugbegleiterin klammern. Es ist mir schleierhaft, warum alle Mitpassagiere so aussehen, als sei Fliegen etwas ganz Gewöhnliches, und jedes Mal frage ich mich, ob sie vielleicht allesamt unter schweren Medikamenten stehen oder mit dem Leben abgeschlossen haben.
Ich frage den Jungen, der von der Angst als Superkraft sprach, ob er glaube, dass das auch für Flugangst gelte. »Klar«, sagt er, »die Flugangst der Passagiere hält das Flugzeug in der Luft.«
Wie schön, denke ich, dass hier auf dieser matschigen Wiese mal jemand so anerkennend über Ängste spricht. Das tut ihnen sicher gut. Immerhin kann es ja sein, dass Angst eine Art Hilfskraft ist. Die ungeschlachte Superhilfskraft irgendeiner verzagten Sehnsucht vielleicht, die mit dem Charme eines Inkassounternehmens versucht, die Belange dieser Sehnsucht durchzuboxen.
Ich überlege, was die Sehnsucht von Herrn Pohl sein könnte. Ich kenne ihn nicht besonders gut, ich mag ihn nur sehr gern. Vielleicht mangelt es Herrn Pohl schlicht an Platz. Vielleicht keilt Herrn Pohl irgendetwas ein, vielleicht demonstriert Herrn Pohls Angst für, wie es in der Fahrschule heißt, etwas mehr Manövrierfähigkeit.
Auf der Wiese wird es dunkler und ungemütlicher, als es sowieso schon ist. Die Jungs schultern ihre Ranzen und verabschieden sich.
Ich sehe Herrn Pohl vor mir, wie er in seiner Wohnung sitzt und auf Lori wartet. Ich kenne Herrn Pohls Wohnung nicht, vielleicht ist er umgeben von sehr viel leerem Papier. Vielleicht sitzt er an seinem Küchentisch, den Kopf in die Hände gestützt, beladen mit seiner blinkenden, röhrenden, vermaledeiten Superkraft, vielleicht bebt unter Herrn Pohls Füßen gerade die Welt, und er weiß nicht ein noch aus.
Lori und ich, wir stehen da, die eine ratlos, die andere bebend, und schauen dem Blinken der Leuchtschwerter beim Verschwinden zu.
Die Nächte, in denen wir nicht schliefen
Als ich heute Morgen die Wohnungstür öffne, höre ich von unten schwere, langsame Schritte auf der Treppe. Da kommt jemand Altes, denke ich. Es ist dann aber Frau Wiese. Frau Wiese wohnt einen Stock über mir und sieht dieser Tage aus wie ein Pirat, weil sie wegen einer Augensache eine Klappe im Gesicht trägt.
Heute sieht sie aus wie ein betagter Pirat, dabei ist Frau Wiese um die vierzig. »Schlecht geschlafen?«, frage ich. »Überhaupt nicht geschlafen«, antwortet Frau Wiese. Ich sage, das sei ja kein Wunder, bei dem Auge. »Nein«, sagt Frau Wiese, »das tut gar nicht mehr weh. Ich habe einfach so kein bisschen geschlafen.«
Frau Wiese und ich sind Expertinnen in Schlaflosigkeit. Wohlgemerkt: in, nicht für. Also setzen wir uns auf den Treppenabsatz und fachsimpeln. Wegen der akuten Schlaflosigkeit fachsimpelt Frau Wiese eher einsilbig.
Frau Wiese hat letzte Nacht alle Phasen der Schlaflosigkeit vorbildlich hinter sich gebracht. Als Erstes hat sie die Augen geschlossen. Keine schlechte Idee, wenn man einschlafen möchte, und eine recht anspruchslose Aufgabe, wenn das eine Auge sowieso schon zu ist.
Frau Wiese hat ihr Auge allerdings schnell wieder geöffnet, weil ihre Gedanken leider kein bisschen an Schlaf dachten, und putzmuntere Gedanken toben sich hinter geschlossenen Lidern besonders gerne aus. Also hat Frau Wiese versucht, sich müde zu lesen. Das, überlegen wir, geht vermutlich am besten mit Büchern, die einen nicht interessieren, und solche hat man selten im Haus. Für den Fall von Schlaflosigkeit sollte man immer Lektüre zu Themen auf dem Nachttisch haben, die man irrsinnig langweilig findet. »Was wäre das in Ihrem Fall?«, fragt mich Frau Wiese, und ich sage: »Guppys und Tiefbau.«
Frau Wiese hat versucht, sich auf ihren Atem zu konzentrieren, was leider meistens zu Atemnot führt, genauso, wie man anfängt zu stolpern, wenn man sich bewusst aufs Gehen konzentrieren soll. In ihrer Not hat Frau Wiese sich sogar dazu hinreißen lassen, Schafe zu zählen, was ja nun wirklich noch nie funktioniert hat, weder bei Frau Wiese noch bei mir. Schon als Kind sprangen vor meinem geistigen Auge keine wolligen Lämmer über einen Zaun. Da standen alte, abgebrühte Schafsböcke auf meiner imaginierten Weide, die sich von einem innerlich gesäuselten »Hopp« so gar nicht beeindrucken ließen. »Da musst du schon früher aufstehen«, blökten die Schafsböcke, und ihr Lachen klang wie Raucherhusten.
Die nächste Phase ist die, in der man beginnt, sich aus purer Missgunst über die zu ärgern, die um einen herum schlafen. Frau Wieses Schwester, die bei Frau Wiese übernachtet und sich bislang als große Geschwisterliebe hervorgetan hatte, manövrierte sich mit jedem ihrer entspannt schlafenden Atemzüge weiter in Richtung mittlere Liebe. Einfach, weil sie so angeberisch schlief. Auch die Katze, die zusammengerollt am Fußende von Frau Wieses Bett lag, rieb ihr mit ihrem virtuosen Schlummern das eigene Schlafversagen unter die Nase.
Die unangenehmste Phase, auch da sind sich Frau Wiese und ich einig, ist die, in der die Sorgen zuschlagen. Sorgen haben in durchwachten Nächten bekanntlich sehr, sehr leichtes Spiel, wie Halbstarke, die auf dem Schulhof einen Erstklässler vermöbeln. Bei Übermüdung kommt einem die Verhältnismäßigkeit abhanden: Alles ist plötzlich gleich furchtbar, die Weltlage genauso wie die unbeglichene Rechnung der GEZ.
Überhaupt: Mahnungen. In schlaflosen Nächten wimmelt es von Mahnungen, sie segeln von oben aufs Bett herunter und sind ohne Unterschrift gültig. Leider haben Sie trotz mehrfacher Aufforderung die Muskelaufbauübungen für den unteren Rücken erneut nicht gemacht. Leider haben Sie es zum wiederholten Mal versäumt, Ihre unglückliche Tante Traudl zurückzurufen. Leider mussten wir feststellen, dass Sie trotz zahlloser Aufforderungen das Rauchen immer noch nicht drangegeben haben. Leider haben Sie es trotz mehrfacher Mahnungen versäumt, nicht alles falsch zu machen.
Frau Wiese stand auf, mit lauter Mahnungen in den Haaren, setzte sich an den Küchentisch und starrte einäugig auf den Tropfen, der am Wasserhahn hing und sich trotz des ausgiebigen Starrens nicht bewegen wollte. Vermutlich weil er schlief.
Sie legte den Kopf auf die Tischplatte. Der Morgen war da. Ein ausgeruhter Bauarbeiter schmiss seinen Presslufthammer an und ein Vogel sein Lied. Letzte Phase: dumpfe Resignation.
Frau Wiese lehnt den Kopf an die Hausflurwand, ich lehne meinen ans Treppengeländer. Wir sitzen da wie zwei windschiefe Eulen.
Wir beschließen, uns bei der nächsten Schlaflosigkeit nicht mit dem Zählen von bockigen Schafen und Atemzügen abzugeben. Wir beschließen, das nächste Mal alle Nächte zu zählen, in denen wir nicht schlafen konnten. In jeweils über vierzig Lebensjahren ergibt das eine stattliche Herde. Wir werden uns die Betten in Erinnerung rufen, in denen wir wach lagen. Wir werden uns daran erinnern, warum wir nicht schliefen. Wir schliefen scheinbar grundlos nicht, wir schliefen wegen Prüfungen nicht, die bestanden oder versemmelt wurden und in jedem Falle mittlerweile egal sind, wir schliefen nicht, weil es zu laut war oder zu leise, zu heiß oder zu kalt, wir schliefen nicht, weil große Lieben im Anflug oder auf dem Absprung waren, große Lieben vor langer Zeit, die jetzt bestimmt schlafen, wir schliefen nicht wegen der Weltlage, wegen des unteren Rückens oder wegen Randale im Oberstübchen, wegen all der auf uns heruntersegelnden Mahnungen, wir schliefen nicht in Ermangelung von Guppys und Tiefbau.
All die Nächte werden wir vorbeiziehen lassen, und darüber werden wir bestimmt verlässlich einschlafen. Wir werden Expertinnen in Schlaf sein. Wir werden alles an die Wand schlafen. Überall, auch auf einem Treppenabsatz im Hausflur.
Bruder Innerlich
Als ich ein Kind war, sind wir oft mit dem Auto in den Urlaub gefahren. Wenn mein Bruder und ich auf dem Rücksitz zu quengeln anfingen und meine Eltern die ewigen Benjamin-Blümchen-Kassetten nicht mehr hören konnten, sagte mein Vater oft: »Macht einfach die Augen zu und unterhaltet euch mit Bruder Innerlich.« Wir hatten keine Ahnung, wer Bruder Innerlich war, aber wir hatten sehr guten Kontakt zu ihm. Das klingt paradox. Ein Paradox, hat der Philosoph Alan Watts geschrieben, »ist eine Wahrheit, die sich auf den Kopf stellt, um auf sich aufmerksam zu machen.«
Auch jetzt ist Sommer, ein stickiger Großstadtsommer, die Unterarme kleben an der Schreibtischplatte, als sei sie mit Fliegenkleber ausgelegt. Deshalb verlege ich den Arbeitsplatz in Achims Café unten im Haus, denn Achim hat immerhin einen Ventilator.
Seinen Gästen gegenüber zeichnet sich Achim dadurch aus, dass er sehr mittelmäßige Witze macht. Wenn man seinen Kaffee bezahlen will, sagt Achim: »Zweihundert Euro, bitte«, und wenn man ein belegtes Brötchen bestellt, tut er immer so, als würde er es runterfallen lassen. Achim sitzt dem Irrglauben auf, dass Witze durch Wiederholung besser werden. Alle lachen trotzdem, weil es schön ist, dass Achim sich jedes Mal so über seine Scherze freut.
Heute allerdings ist die Luft im Café zum Schneiden, und das nicht nur, weil der Ventilator sich seltsam benimmt, er knarrt und dreht sich nur sehr schlapp. Die Luft ist dick, weil Achim und seine Frau sich ganz offenbar streiten. Achim macht zum ersten Mal keinerlei Anstalten, mein Brötchen fallen zu lassen. Er stellt es mir wortlos auf die Theke.
Achims Frau lehnt mit verschränkten Armen an der Wand. »Ich möchte es aber unbedingt«, sagt sie.
Ich setze mich an einen Tisch, und dann kommt heraus, was Achims Frau unbedingt möchte: einen zweiwöchigen Meditationskurs im Harz, und Achim soll mit.
Achim hat Meditieren schon ausprobiert. Ich weiß das, weil wir denselben Meditationskurs abgebrochen haben. Ich hatte den Kurs angefangen, weil es mit Bruder Innerlich nicht zum Besten stand, es war, als führten Bruder Innerlich und ich eine komplizierte Fernbeziehung.
Achim und ich saßen in der letzten Reihe auf bordeauxfarbenen Meditationskissen. Zu Beginn sagte der Mediationslehrer, wir sollten in uns hineinspüren und unserem wahren Selbst begegnen, also vermutlich Bruder Innerlich.
Wenn ich auf Anweisung in mich hineinspüren soll, verlaufe ich mich meistens und lande irgendwo obenrum, in den Gedanken, die dann ihre Stimme verstellen und vorgeben, das wahre Selbst zu sein, und mich ausführlich anpampen. Ich bin nicht über das berüchtigte Meditationsanfängerstadium hinausgekommen: das, in dem die Gedanken auf einen einhacken, die Beine wehtun und Bruder Innerlich sich erschrocken verkrümelt.
Achim ging es ähnlich. Nach der sechsten Sitzung konnten scheinbar alle außer uns einwandfrei meditieren, es sah toll aus, wie sie da saßen, sehr gern hätten wir auch derartig da gesessen, so gleichzeitig entrückt und ganz anwesend. Alle wirkten innerlich blitzblank, nur in unseren Inneren sah es aus wie bei Hempels unterm Sofa.
Als wir in der achten Sitzung sagten, dass Meditation vielleicht leider nichts für uns sei, sah der Meditationslehrer uns an, als hätten wir gesagt, dass wir schweren Brechdurchfall hätten. Er prognostizierte, dass Achim und ich ohne ihn und die Meditation nie unser wahres Selbst kennenlernen würden, nie den No-Mind, nie die Stille. Dafür, dass er Stille so schätzte, sagte der Meditationslehrer sehr viel.
»Einen Tee bitte noch«, sage ich zu Achim. »Meditieren bringt dich in Kontakt mit dir selbst«, sagt Achims Frau. Achim seufzt, stellt den Tee vor mich hin und schaut in die Tasse, als läge auf ihrem Grund ein schöner Traum von letzter Nacht.
Achim und ich sind damals reichlich beklommen aus dem Meditationszentrum geschlichen. Den halben Rückweg lang sagten wir nichts. »Pah«, schnaubte ich schließlich, weil ich bei akuter Verunsicherung oft großlaut und hemdsärmelig werde, »heutzutage muss aber auch alles meditieren, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.« Kurz vor unserem Haus sagte Achim: »Mein Fahrrad ist kaputt. Lust auf Reparieren?«
Wir gingen in den Hinterhof, Achim drehte sein Fahrrad um, es stand mit seinen Rädern in der Luft da wie ein Paradox. Ich holte den Werkzeugkoffer, wir fingen an zu reparieren. Es war Frühherbst, die Kastanie im Hof rauschte im Wind, wir hatten alle vier gut zu tun, Achim, ich, die Kastanie und der Wind. Die Brüder Innerlich waren bester Dinge und ganz auf unserer Seite. Wir haben alle nicht viel gedacht, eigentlich gar nichts. Nur ab und zu hat sich ein Gedanke vorgewagt und verlautbart: »Besser den Schlitzschraubenzieher«, und damit hatte er recht, und dafür sind Gedanken schließlich gemacht: um hilfreiche Hinweise zu geben.
Ich esse mein Brötchen auf. Ich hoffe, Achims Frau kommt auf die Idee, allein zum Meditationskurs zu fahren, und ich hoffe außerdem, dass Achims Fahrrad bald mal wieder kaputtgeht.
Achim kommt an meinen Tisch und räumt ab. Ich sage: »Ich möchte dann auch zahlen«, und um Achim aufzuheitern, sage ich noch hinterher: »Zweihundert Euro, oder?«
Achim guckt finster wie der Harz und lacht nicht. Es ist ja auch einfach nicht lustig. Er schaut nach oben, zum Ventilator. Der knarrt wie ein unwahres Selbst. »Da stimmt was nicht«, sagt Achim, »wollen wir das reparieren?«, und dann knallt es, und ich denke, jetzt ist etwas heruntergefallen, aber es ist nur das Geräusch, das entsteht, wenn ein Bruder Innerlich seine Hand in die des anderen schlägt.
»Nichts lieber als das«, sage ich.
Ich bin ein Anhang
Mein Freund Max war noch nie bei einem Abiturtreffen. Nun jährt sich sein Abitur zum fünfundzwanzigsten Mal. Ich habe ihn überredet, zu dem dazugehörigen Fest zu fahren – und deshalb muss ich jetzt mit. Man soll »mit Anhang« kommen, und da Max derzeit keinen Anhang hat, habe ich mich notgedrungen zur Verfügung gestellt.
Auf der Zugfahrt in Max’ Heimatstadt erzählen wir uns Schulzeitgeschichten. Max erzählt von seinem Chemielehrer, der bei einem Experiment seinen Daumen verloren hatte. Daraufhin, erzählt Max farbenfroh, wurde der große Zeh des Chemielehrers amputiert und dorthin operiert, wo früher der Daumen gewesen war.
Der Chemielehrer trug immer Sandalen mit Socken. Max kassierte eine Fünf nach der anderen, weil er sich nicht auf den Unterricht konzentrieren konnte, sondern den Chemielehrer immer anstarren musste – und zwar nicht den Zehdaumen, sondern die leere Stelle am Fuß des Chemielehrers. »Die Socke warf Falten über dem Nichts«, sagt Max im Zug, immer noch beeindruckt.
Ich erzähle von Oliver, in den ich unglücklich verliebt war und wegen dem ich mindestens drei Kilo Tagebuch vollschrieb, darunter mehrere Gedichte, die ich erfolglos der Bravo zum Abdruck anbot. Oliver aber war, wie alle, in Kati verliebt, in Kati mit dem seidenen Haar und der reinen Haut. Kati und Oliver wollten später nach Miami auswandern. Ich habe Oliver gegoogelt. Er ist nicht in Miami, sondern in einem Bezirksamt in Dortmund.
Wie in mich war auch in Max niemand verliebt. Wie ich hatte auch Max Pickel mit Eiterwipfeln an der Backe und vom Hals abwärts einen aus den Fugen geratenen Pubertätskörper, den er mit zeltartigen T-Shirts zu umspielen versuchte; mit diesen Achtzigerjahre-T-Shirts, auf denen Wörter in eiscremefarbenen Großbuchstaben mit Ausrufungszeichen prangten: FUN! stand da oder NO FEAR! Diese Botschaften sollten unsere Gemütslage betiteln und waren natürlich haushoch gelogen. Jetzt, im Zug, finde ich, dass man eigentlich vor jemandem, der NO FEAR! auf seinem T-Shirt stehen hat, Angst haben sollte. Und ich stelle mir vor, was gewesen wäre, wenn auf unseren T-Shirts wahrheitsgemäß VERZWEIFLUNG! oder FÜRCHTERLICHES UNWOHLSEIN! gestanden hätte, mit Ausrufungszeichen und in Pistazieneisgrün.
Max, erzählt er, war in eine Michaela verliebt (seidenes Haar, reine Haut). Irgendwann traute er sich, sie anzusprechen. Irgendwann stellte er sich direkt vor sie hin, in seinem Zeltshirt und mit einem Satz, den er nächtelang erwogen hatte, einem Satz von, aus Max’ Sicht, so unübersehbarer Schönheit und Wahrheit, dass Michaela dem Satz und auch Max auf der Stelle verfallen würde. Max stand also da, mit all seinem zusammengenommenen Mut, und sagte feierlich: »Michaela, ich habe jetzt übrigens die Bastlerzeitschrift Mechanikus abonniert.«
Max und Michaela hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen von Schönheit. Michaela schaute Max an, als sei er ein mannshoher Pickel, und dann lachte sie ihn aus, sehr lange und sehr laut. Max lief weg, ungewöhnlich behände, alles wackelte beim Weglaufen, nicht nur der Mut, nicht nur der Bauch, sondern das ganze niederträchtige Leben.
Max’ Abiturfest findet in einer Kneipe statt, und weil ich nur der Anhang bin, kann ich in Ruhe zuschauen. Max und ich sind gleich alt. In den Gesichtern seiner Mitschüler meine ich, einerseits noch die U-20-Gesichter erkennen zu können, anderseits erahne ich schon die, die sie in zwanzig Jahren tragen werden.
Es ist ein schönes Fest. Immer wieder höre ich diese beiläufigen Kürzestaussprachen, die ich so nur von Klassentreffen kenne:
»Sag mal, warum hast du eigentlich in der Achten nicht mehr mit mir geredet?« – »Hä? Du hast doch nicht mehr mit mir geredet!«
Oder:
»Ich habe ja damals ziemlich darunter gelitten, dass du immer so Scheiße zu mir warst.«
»Ich war nur Scheiße zu dir, weil ich vollkommen verknallt in dich war.«
Max unterhält sich ausgelassen mit dem sehr zusammengeschrumpelten Chemielehrer, der immer noch Socken in Sandalen trägt, und tatsächlich wirft die eine Socke Falten über dem Nichts.
»Ist Michaela auch da?«, frage ich. »Warte mal«, sagt Max und schaut sich um, »ich glaube, das ist die da hinten.« Er deutet auf eine Frau, die jetzt nicht mehr seidig aussieht, sondern eher nach Dortmunder Bezirksamt. Ich ertappe mich dabei, dass mich das freut.