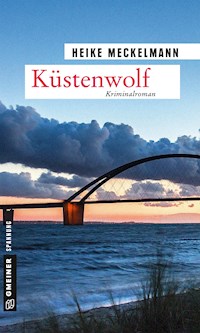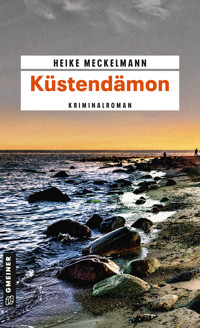
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissare Westermann und Hartwig
- Sprache: Deutsch
Eine Joggerin entdeckt in einem Teich am Ostersoll eine grauenhaft entstellte Leiche. Einige Tage zuvor ist die attraktive Sophie im Park betäubt und entführt worden. Ist sie das nächste Opfer des Killers? Rätselhafte Handy-Hinweise sind die einzige Spur der Kommissare Westermann und Hartwig. Da wird ein weiteres Opfer aufgefunden. Ist der dämonische Mörder ein Serienkiller? Er spielt Katz und Maus und legt Spuren, die verwirrend sind, wie der dunkle Teppich längst vergangener Zeiten, der die Insel umhüllt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heike Meckelmann
Küstendämon
Kriminalroman
Zum Buch
Dämonische Kälte Grausame Fundstücke –Kommissar Westermann und Kommissar Hartwig werden zu ihrem dritten Fall auf die Insel Fehmarn gerufen. Am Ostersoll hatte eine Joggerin eine grauenhaft entstellte Leiche entdeckt. Es wird immer gruseliger, als eine zweite Leiche gefunden wird und die Kommissare entdecken, dass ein junges Mädchen verschwunden ist. Die attraktive Sophie wurde im Senator Thomsen Park von einer schrulligen Unbekannten betäubt und entführt. Ist sie das nächste Opfer des Killers? Die Polizei versucht verzweifelt die Wahrheit ans Licht zu bringen. Doch rätselhafte Handy-Mitteilungen sind die einzige Spur von Westermann und Hartwig. Werden sie die Rätsel lösen und Sophies Leben retten können? Der Killer spielt derweil Katz und Maus mit ihnen. Er legt Spuren, die verwirrend sind, wie der dunkle Teppich längst vergangener Zeiten, der die Insel umhüllt.
Heike Meckelmann wurde in der Nähe von Elmshorn geboren und zog vor mehr als 34 Jahren auf die Insel Fehmarn. Sie betrieb nach dem Studium der Betriebswirtschaft auf der Insel lange Zeit einen Friseursalon und eine Hochzeitsagentur. Viele Jahre arbeitete sie in der Fotografie und nahm als Sängerin ein eigenes maritimes Album auf. Seit 2016 ist sie als freie Autorin auf Fehmarn tätig und schreibt Kriminalromane, die überwiegend auf der Insel spielen und Reiseliteratur. Über 22 Jahre mit einem Fehmaraner verheiratet, bezeichnet sie sich durch und durch als Insulanerin, die ihre Insel genauso liebt, wie die Geschichten, die sie auf der Sonneninsel schreibt.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Christian Horz / shutterstock.com
ISBN 978-3-8392-5642-8
Widmung
Für Papa, der du immer in meinem Herzen bist …
Prolog
Ich bin das Produkt meiner Mutter, und der Dämon tobt in mir.
Leises Schluchzen entkam ihrer Kehle. Sie schnalzte mit der Zunge und schaute hungrig in die Richtung, in der sich der Tisch befinden musste. Sie roch das Vanillearoma des Haferbreis, der selbst den moderigen Geruch ihres Gefängnisses übertünchte, und reckte gierig die Nase in die Höhe. Der Magen rumorte, als sie den Speichel, der sich in ihrem Mund sammelte, ihre Speiseröhre hinunterlaufen ließ. Der Geruch vernebelte ihre Sinne. Der Steißknochen schmerzte, und sie rutschte auf dem verdreckten Boden und dem stinkenden Stroh umher. Die mangelnde Polsterung auf ihrem Po bot nicht genügend Schutz und die Haut schürfte an den nackten Stellen immer mehr auf. Das dünne Höschen hing, nur noch vom Bundgummi gehalten, an ihrem mageren Körper. Mit der freien Hand schuf sie einen Puffer, indem sie die unter ihre Pobacke schob. Sie streckte die Zehenspitzen ihres rechten Fußes aus und versuchte verzweifelt, in die Nähe des Tisches zu gelangen. Es war aussichtslos. Das Möbelstück stand mindestens zwei Meter entfernt. Zwei Meter, die unerreichbar zwischen ihr und dem heiß ersehnten Essen lagen. Niemals komme ich da ran, dachte sie und ließ entmutigt das Bein sinken. Sie wollte ihren Schutzengel um Hilfe bitten, als sie mit Erschrecken feststellte, dass ihr Armband verschwunden war. Das Geschenk ihrer Eltern zu ihrer Konfirmation. Sie hatte es nie mehr abgenommen seitdem, und nun war es nicht mehr vorhanden. Es erschien ihr wie ein Zeichen, ein böses Omen.
Auf einmal bemerkte sie, dass sich etwas im Dunkeln bewegte. Regungslos horchte sie. Sie wusste, auch ohne, dass sie es sah, dass der Nager sich an ihrem Brei zu schaffen machte.
»Na, hast du endlich, was du wolltest, widerliches Biest? Wenigstens lässt du mich jetzt in Ruhe«, keuchte sie, wohl wissend, dass die einzige Nahrungsquelle, die ihr Leben retten sollte, gerade versiegte. Sie stierte resigniert in das schwarze Nichts, aus dem leises Schmatzen zu ihr drang.
*
Das Licht stahl sich schleichend davon. Es versteckte die letzten hellen Fetzen des Tages hinter dunklen Wolken und knorrigen Bäumen. Es gab dem Bodennebel Raum, der feindselig, geisterhaft und übermächtig zwischen den Stämmen hindurchkroch. Wie ein undurchsichtiges Netz legte er sich auf den vermoosten Boden und ließ seine dürren Finger um Bäume und Sträucher wandern. Mara spürte die Kälte, die ihre Beine hochkroch. Die Füße verschwanden bis zu den Knöcheln unter den Schwaden. Der Forst lag um die Zeit einsam da. Niemand würde bei der Arbeit stören. An diesem düsteren Spätnachmittag erschien die Welt für sie in Ordnung. Mara liebte die unheimlichen Orte ihrer Insel. Es gefiel ihr, wenn ein eiskalter Schauer nach dem anderen ihren Rücken hinunterlief. Nur die weit entfernten Schreie einiger Möwen unterbrachen die Stille, die sie daran erinnerte, dass sie sich im Frühlingsmonat April auf der Sonneninsel schlechthin aufhielt. Brechendes Holz knackte unter den Sohlen ihrer Stiefel. Direkt vor ihr flanierte ein paradiesisch aussehender Fasan und streckte die fast 50 Zentimeter langen Schwanzfedern gekonnt in die Luft, um sie wie einen Fächer direkt vor ihr auszubreiten.
Er schien Mara zwar wahrgenommen zu haben, reckte aber ungestört den Schnabel der verhangenen dunklen Wolkendecke entgegen.Seine staksigen Füße tauchten ebenfalls bei jedem filigranen Schritt in die Nebelschwaden ein. Was für eine Erscheinung. Mara lächelte. Sie verharrte an ihrem Platz und lenkte das Kameraobjektiv im Zeitlupentempo in die Richtung des farbenprächtigen Vogels, um ihn nicht zu verschrecken.
Er wirkte zwischen den betagten Bäumen und dem unheimlichen Dunst wie die Fabelfigur eines Mysterythrillers. Sie drückte auf den Auslöser und lauerte, ob das Tier das fremdartige Geräusch registrierte. Mara sah bereits das fertige Bild vor ihrem geistigen Auge. Der Wald in Grautöne getaucht, darin der faszinierende Hahn. Ihr Herz schlug unanständig schnell. Eine Weile betrachtete sie den Fasan, lauschte dem Rauschen der Blätter, dem Knarzen der Äste, die aneinanderrieben. Gierig atmete sie die kühle Seeluft ein und hörte dem geisterhaften Wald zu. Alles erschien surreal. Mara verharrte einen Augenblick in dieser unwirklichen Welt, legte ihre Kamera in den geöffneten Rucksack und betrachtete die Eiche, die ihren knorrigen Stamm emporreckte, der mindestens 100 Jahre auf dem Buckel haben musste. Sie zog den Reißverschluss ihres olivfarbenen Parkas zu und rückte die schwarze Wollmütze über die rötlichen Locken. Entspannt breitete sie die Arme aus und umarmte den uralten Baum. Sie lehnte den Kopf dagegen und spürte die Wärme, die er ausstrahlte. Zufriedenheit erfüllte sie, und für einen Moment schien die Zeit stillzustehen.
Es knackte plötzlich im Unterholz.
Der Fasan war lautlos verschwunden, als sie die Augen verwirrt wieder aufschlug. Das Geräusch drang erneut aus Richtung Steilküste zu ihr herüber. Reflexartig hockte sie sich hin, griff nach ihrem Rucksack und hielt Sekunden später die Kamera in den Händen. Sie betätigte den Zoom des Objektives, näherte sich unauffällig der Stelle, von der das Knacken herrührte. Ein Reh? Vorsichtig schob sie ihren Körper an der Rinde einer Eiche empor und versteckte sich hinter deren dickem Stamm. Hoffentlich sah man sie nicht. Bewegungslos inspizierte sie mit dem Sucher der Nikon das Waldstück. Der Nebel erreichte die unteren Äste und waberte bedrohlich zwischen den Bäumen hindurch. Dann entdeckte sie das Objekt der Begierde. Das ist ein Mensch. Eine Frau! Was macht um diese Uhrzeit jemand im Wald? Maras Herz fing an zu rasen, und sie versuchte, die Person mit dem Objektiv einzufangen. Sie drückte ohne Unterbrechung auf den Auslöser. Wo ist sie? Sie starrte gebannt in die Richtung, in der sie die Person entdeckte, und lauerte auf eine Bewegung. Was passiert da? Seltsam. Ihr Pulsschlag raste unkontrolliert. Sie hörte das Pumpen des Herzschlages in der Schädeldecke. Es war ein aufregendes Gefühl, heimlich eine Fremde zu beobachten. Der Wald übte auf einmal eine ungeheure Faszination auf sie aus, und sie wartete auf ihre Gelegenheit. Unerwartet sah sie auf Augenhöhe einen roten Gegenstand hinter dem Baum vorragen, der ihr einen Schrecken einjagte. Wie gebannt hielt sie die Kamera drauf und löste unbeirrt aus. Hat die sich versteckt? Was macht die um diese Zeit? Nervös zuckte der Finger auf dem Auslöser. Der richtige Moment, was zählt, ist nur der richtige Moment, dachte sie, und ihre Hände schwitzten trotz zunehmender Kälte.
Die Person ließ sich bei dem, was sie beschäftigte, nicht im Geringsten stören. Hoffentlich bemerkt die mich nicht, brütete Mara und machte sich klein. Das Licht verschwand gänzlich hinter den Bäumen, und Mara veränderte die Kameraeinstellungen. Sie wagte kaum zu atmen. Sie wusste, dass ihr nichts anderes übrig blieb, als so lange in ihrem Versteck zu verharren, bis das Schauspiel ein Ende hatte. Unerwartet spürte sie Blicke in ihre Richtung starren. Mara fühlte sich ertappt, hielt eine Hand vor den Mund und verbarg ihren Körper augenblicklich im Schatten der Eiche. Sie presste die Lippen zusammen und blieb regungslos stehen. Hoffentlich hat die mich nicht entdeckt. Es knackte erneut im Unterholz. Die kommt hierher.
Die Fotografin bekam es mit der Angst zu tun. Ich könnte mich als Spaziergängerin zu erkennen geben und mit der Frau ein belangloses Gespräch anfangen. Aber der Blick, den die Rothaarige aussendet, verheißt nichts Gutes. Eilig ging die Fotografin in die Hocke, riss den Rucksack zu sich und verstaute blitzschnell die Kamera.
Sie richtete sich auf, als sie hörte, dass die Schritte näherkamen. Ohne zurückzuschauen, rannte sie fluchtartig weiter. Das Ende des Forstes war nicht in Sicht. Hinter ihr knackten Äste. Es bedeutete, dass die Verfolgerin ihr dicht auf den Fersen zu sein schien. Maras Puls puckerte so laut in der Halsschlagader, dass sie die Hand auflegte, um ihn zu beruhigen. Ohne sich umzudrehen, jagte sie durch das dunkle Gehölz. Plötzlich stolperte sie über einen abgebrochenen Ast. Sie schlug der Länge nach hin. Der Rucksack lag bleischwer auf ihrem Rücken. Wie von Sinnen rappelte sie sich auf und strauchelte durch das Unterholz. Sie hörte das schwere Atmen der Frau unmittelbar hinter sich. Mara japste, hielt sich die schmerzende Seite und hechtete weiter durch das Unterholz. Die Verfolgerin konnte ihr anscheinend nicht so schnell folgen, wie sie wollte. Dann war der Wald endlich zu Ende. Angespannt hetzte sie, so schnell sie in der Lage war, den Privatweg entlang bis zum Parkplatz. Ohne sich ein einziges Mal umzudrehen, riss sie den Wagenschlüssel aus der Tasche und öffnete mit zitternden Fingern die Wagentür. Hektisch zerrte sie den Rucksack vom Rücken und warf ihn auf den Rücksitz.
Mit einem beklemmenden Gefühl in der Magengegend startete sie und drückte das Gaspedal durch. Panisch verließ sie den Parkplatz. Was, wenn die mich verfolgt? Warum bin ich bloß abgehauen? Vielleicht hätte ich mich einfach mit ihr unterhalten sollen. Was für ein Blödsinn. Das war mit Sicherheit eine ganz normale Frau, die im Wald spazieren ging, dachte sie und rauschte die Landstraße Richtung Burg. Aber in Wahrheit war es ihr recht, nicht mit ihr zusammengetroffen zu sein.
Ich wollte längst auf dem Weg nach Lübeck sein. Das war schließlich nur ein Kurztrip auf die Insel, um ein paar Fotos zu schießen, die mir noch für die Ausstellung fehlten. Der Wald schien ihr besonders geeignet, und sie fuhr nach Fehmarn, ohne ihre Eltern zu informieren. Die hätten keine Ruhe gegeben, bis ich bei Kuchen und Kaffee mit ihnen auf dem Sofa gesessen hätte. Aber jetzt ist es egal. Sie schaute auf die Uhr im Armaturenbrett. Ich kann auch hier übernachten und fahre morgen früh nach Lübeck, dachte sie und nickte. Sie tippte auf die Kurzwahltaste ihres Handys, und wenige Sekunden danach meldete sich Melli auf der anderen Seite der Leitung. Mara teilte ihr mit, dass sie auf Fehmarn blieb und die Fotos bearbeiten wollte, um sie ihr per Mail rüberzuschicken. Eigentlich war sie mit ihr in der Pizzeria verabredet, aber sie wollte nur noch nach Hause und die Tür hinter sich absperren. Sie sprachen darüber, die Ausstellung im Senator-Thomsen-Haus vorzubereiten. Ja, das ist eine gute Idee, dachte sie. Ich bleib hier.
»Ich hab beschlossen, auf der Insel zu bleiben«, sagte sie stattdessen. »Ist mir jetzt zu spät, und vielleicht zuckel ich morgen noch einmal in den Wald. Mir ist da wirklich etwas Unheimliches passiert.« Sie erzählte von der Begegnung mit der Frau im Staberforst. »Die geht mir nicht aus dem Kopf, furchterregend, wenn du mich fragst«, flüsterte sie ins Telefon, schüttelte sich und blickte auf die Armbanduhr.
»Kannst auch bei mir schlafen, wenn es dir zu blöd ist, nach Wenkendorf zu fahren. Oder zu gruselig«, antwortete Melli durch den Hörer.
»Ne, lass mal. Das schaff ich wohl. Die halbe Stunde macht mir nichts aus. Ich setze mich gleich hin und bearbeite die Fotos. Da ist bestimmt Spannendes dabei. Das war schon ziemlich angsteinflößend mit der komischen Tussi im Wald, das will ich dir sagen. Ich kann es kaum abwarten, die Bilder durchzusehen. Falls ich fertig werde, schick ich dir heute noch den Ordner mit der Auswahl und der Reihenfolge, in der du die Ausstellung anordnest, wenn ich in Lübeck bin. Wäre das für dich okay?«, fragte Mara.
»Natürlich. Ich freu mich drauf. Du weißt doch, dass ich dir gern helfe. Das ist mir eine Ehre, einer so erfolgreichen Frau unter die Arme greifen zu dürfen«, sagte Melli. Sie verabschiedeten sich. Nachdenklich legte sie das Handy zurück in die Mittelkonsole.
Kurz vor Landkirchen fing der Wagen plötzlich an zu ruckeln und machte Anstalten, stehen zu bleiben. »Verdammt, was ist denn jetzt schon wieder. Nimmt das Theater denn heute gar kein Ende?«
Vorsichtig lenkte sie den Wagen an den Straßenrand, bis er stehen blieb. Sie startete erneut, doch das Auto gab keinen Mucks von sich. »Mist, was mach ich denn jetzt?« Sie starrte auf das Handy in der Mittelkonsole, sah sich um. Keine Menschenseele in der Nähe. Ihr Herz klopfte, als sie sich an die Werkstatt in Burg erinnerte. Soweit sie wusste, hatten die sogar einen Notdienst. Sie griff nach dem Telefon und googelte die Telefonnummer der Autowerkstatt, dann wählte sie. »Ja, hallo, können Sie mich abschleppen, ich bin liegengeblieben … ja genau, der gibt keinen Pieps mehr von sich. Kurz vor Landkirchen … ja, genau … Danke!« Erleichtert drückte sie den roten Knopf und schaltete das Warnlicht ein.
Eine viertel Stunde später rollte der Abschleppwagen heran. Mara stieg aus, erklärte die Sachlage und gab ihm den Wagenschlüssel. »Moment, ich muss meine Sachen noch aus dem Auto nehmen. Können Sie mich nach Wenkendorf fahren oder muss ich mir ein Taxi nehmen?«
»Bringen Sie man Ihre Sachen in meinen Schlepper, ich fahr Sie.« Er zwinkerte ihr mitleidig zu. Mara war beruhigt und stieg auf der Beifahrerseite ein. Ihr Auto verschwand auf der Ladefläche des Abschleppers und sie fuhren Richtung Wenkendorf.
Der Wagen, der hinter ihr im Dunkel währenddessen die ganze Zeit lauerte und den sie nicht bemerkt hatte, folgte ihr wieder …
»Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin«, murmelte Mara leise.
»Das kann aber ein paarTage dauern mit der Reparatur«, entgegnete der Besitzer der Werkstatt. »Wir haben so viel zu tun und keine Leute.«
»Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern«, murmelte sie. »Dann bleibe ich halt noch ein paar Tage länger auf der Insel.«
Als sie in Wenkendorf von der Hauptstraße abbogen, sagte sie: »Sie können mich hier rauslassen, sonst wecken sie noch die ganze Straße auf. Außerdem können Sie hier gut drehen.« Der Mann nickte und hielt am Straßenrand vor einer Biegung. »Ist recht, Mädchen. Und schönen Abend noch. Ich rufe Sie an, wenn der Wagen fertig ist. Ach ja, Ihre Telefonnummer brauch ich.« Mara reichte ihm eine Visitenkarte und lief los.
Alles mucksmäuschenstill – perfekt, dachte sie und huschte, die dunkle Kapuze ihrer Jacke tief über den Kopf gezogen, wie ein Dieb im Dunkeln zum Haus.
Mara steckte leise den Schlüssel ins Türschloss des kleinen Anbaus neben dem Haupthaus und öffnete. Wie schön, dass ich immer ein Domizil auf der Insel habe, wenn ich komme. Geräuschlos drückte sie die Tür wieder hinter sich zu, drehte den Schlüssel zweimal im Schloss um, als könne sie damit das Unheimliche aus dem Staberforst aussperren. Die Fotografin entledigte sich ihrer Stiefel, schlüpfte aus dem Parka und warf ihn achtlos auf die Treppenstufen, die ins ausgebaute Dachgeschoss führten. Dort, direkt unter dem Giebel, stand ihr kuscheliges selbstgebautes Bett. Die freigelegten Dachbalken und der rotkarierte Bettbezug verströmten bayrisches Flair. Sie schlupfte in ihre Norwegersocken und rutschte auf den Holzdielen im Flur entlang.
Im gemütlichen Wohnzimmer stellte sie den geschulterten Rucksack auf den Tisch, riss den Reißverschluss auf und zog die Kamera heraus. Mit einer Hand klappte sie den Deckel des Computers auf, schaltete ihn ein und verband im gleichen Atemzug den Fotoapparat mit dem Laptop. Sie konnte es kaum abwarten, die Ergebnisse ihrer Fotosafari zu sehen. Hektische Flecken zeichneten sich auf ihren Wangen ab. In Sekundenschnelle importierte der Laptop die Fotos auf die Festplatte, und Mara öffnete gespannt den Ordner, den sie mit ›Hexenwald‹ titulierte. Sie nahm einen Finger in den Mund und begann an ihrem Fingernagel zu knabbern. Eilig zog sie den Stuhl vom Tisch weg und ließ sich darauf fallen. Mit unruhigem Blick betrachtete sie die ersten Bilder, als wollte sie sie ins Gedächtnis einlesen. »Wenn das kein Fang ist. Die Aufnahmen sind der absolute Hammer!« Die Fotografin schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte und begann unverzüglich mit ihrer Arbeit. »Wahnsinns Ausbeute! Diese Frau hinter dem Baum ist phänomenal«, sagte sie, wenngleich ihr im selben Moment ein kalter Schauer den Rücken hinunterlief. Mara konzentrierte sich und bearbeitete stundenlang die Fotos. Das wird allem Bisherigen den Rang ablaufen, dachte sie und setzte die Reihenfolge fest. »Das Bild mit der komischen Tante wird das letzte der Serie sein. Die werden sich allesamt gruseln«, murmelte sie. Erleichtert, dass sie ihre Arbeit endlich beenden konnte, sendete sie den fertigen Bilderordner ›Hexenwald‹ ihrer Freundin, die wahrscheinlich sehnsüchtig auf die Ergebnisse wartete, um die Ausstellung zu organisieren. Überrascht schaute sie auf die Uhr. Die Stunden schienen nur so verflogen zu sein. Es war kurz nach Mitternacht. Sie gähnte müde und verspürte auf einmal nagenden Hunger in ihrer Magengegend. Das Abendessen mit Melli war schließlich ausgefallen, und sie hatte nicht registriert, dass sie seit heute Morgen nichts mehr zu sich genommen hatte. Erschöpft stand Mara auf, zog eine wärmende Strickjacke an, die über einer der Stuhllehnen lag, warf ein paar Scheite Holz in den Kachelofen und schlurfte in die Küche. Ihre rotblonden Haare hingen zerzaust vom Kopf, und es wurde Zeit, in die Falle zu hüpfen. Im Kühlschrank tanzten die Mäuse wahrscheinlich Polka, weil niemand etwas besorgt hatte, mit dem man ihn hätte befüllen können. Und somit nichts, das man jetzt zu sich nehmen könnte. Missmutig öffnete sie die Türen des Küchenbuffets, das bereits ihrer Großmutter gehörte, in der Hoffnung, dass sich irgendetwas Essbares in den Ecken versteckte. Allerdings herrschte auch hier gähnende Leere. Nur eine halbleere Packung Müsli stand im Regal über der Spüle. Da sie allerdings keine Milch im Haus hatte, war diese Option ebenfalls wertlos. Nicht ein einziger Keks, jammerte sie. Und trockene Haferflocken – wer mochte schon furztrockene Haferflocken?
Dafür zog sie eine Flasche Rotwein aus dem Holzregal unter dem Küchenfenster, die zum Sammelsurium geschenkter Präsente ihrer Eltern gehörte. Die Flaschen, von denen sie Dutzende besaßen, reichten sie freundlicherweise an Mara weiter, weil sie nicht häufig Wein tranken. Mit der Buddel im Arm und einem geschliffenen Weinglas in der Hand kuschelte sie sich in den dicken Sessel, der ebenfalls ein Erbstück der Oma war. Entspannt lehnte die junge Fotografin sich vor dem Kachelofen zurück, goss Rotwein ins Glas und lauschte dem Knistern der Holzscheite im Ofen. Sie seufzte und streckte die Beine aus. Sie trank und wackelte gleichzeitig mit den Zehen, als Zeichen für anheimelnde Gemütlichkeit. Durch die Wärme im Zimmer und den lieblichen Wein, der ihren Kopf zunehmend schwerer werden ließ, setzte langsam lähmende Müdigkeit ein. Sie gähnte, nahm einen weiteren Schluck, der sich wohlig in ihrem Körper ausbreitete, als es leise, fast unhörbar an der Tür klopfte. Benommen raffte sie sich auf. Wer will denn jetzt noch was? Hoffentlich nicht meine Eltern. Der Alkohol benebelte mittlerweile dermaßen ihre Sinne, dass sie durch den Flur taumelte und unaufhörlich kicherte. Sie wankte zur Eingangstür, wuschelte mit den Händen durch ihre roten Locken und öffnete arglos. Sie sah in unbarmherzige Augen, als sie der Person gegenüberstand und erstarrte …
Einige Zeit vorher
Es war so einfach. Stechende Blicke folgten Mara bis zu ihrem Wagen. Die Kapuze tief über das Gesicht gezogen, lief die Schattengestalt ihr, immer wieder Deckung hinter Bäumen suchend, unauffällig nach. Das war nicht weiter schwierig, da sie sich ganz in Schwarz gekleidet hatte, um im Wald nicht aufzufallen.
Als die Fotografin in ihrem Golf an der Vermummten vorbeiraste, spurtete sie zum eigenen Fahrzeug und jagte hinterher, bis sie Maras Fahrziel erreichte. Ein Lächeln legte sich auf die Lippen der dunklen Gestalt. Es schien an der Zeit, den Hexen den Garaus zu machen …
Die junge Frau bemerkte den Wagen nicht, der sie seit dem Staberforst verfolgte. Die Dunkelheit machte es unmöglich, einen Verfolger auszumachen. Nur wenige Autos waren zu dieser Stunde unterwegs, und sie maß den Lichtern der Fahrzeuge, die hinter dem Abschlepper leuchteten, keinerlei Bedeutung bei, als sie in den Seitenspiegel blickte. Sie fühlte sich mittlerweile wieder sicher.
Am Wegrand unweit eines Bauernhofes in Wenkendorf stoppte das zweite Auto. Mara war ganz offensichtlich zu Hause angekommen. Eisige Blicke folgten der Fotografin, bis sie in dem kleinen Anbau des riesigen Gehöftes verschwand. Die unheimliche Erscheinung aus dem Wald rollte mit dem Wagen auf den Seitenweg, der mehrere Parkplätze im Dunkeln bot. Kein Auto stand auf dem hauseigenen Parkplatz. Sie muss alleine sein, dachte die Person im Wagen. Denn erst, als sie im Inneren des Hauses war, leuchtete eine Lampe in einem der Zimmer auf.
Niemand nahm Notiz von der Gestalt im Auto, dessen Scheinwerfer ausgeschaltet blieben. Der kaum zu erkennende Weg hinter dem Gebäude führte auf den Hof. Was dahinter lag, war nicht einzusehen. Alles stockdunkel. Große düstere Scheunengebäude zeichneten sich im Nachthimmel ab. Kein Mensch weit und breit in Sicht. Nicht einmal ein winziges Fenster, aus dem Licht drang. Das Haupthaus schien ebenfalls im Tiefschlaf zu liegen, wenn es überhaupt bewohnt sein sollte. Keinerlei Gefahr. Niemand registrierte die schwarz gekleidete Figur, die eine Weile später geräuschlos ausstieg und in der Sicherheit der Bäume am Wegrand zum Eingang des Anbaus huschte. Die Augen stets auf das Grundstück und die menschenleere Straße gerichtet, in der eine in die Jahre gekommene Straßenlaterne unwirklich die Gegend erhellte. Leise klopfte die Gestalt gegen die antike Holztür. Ein diffuser Lichtstrahl blitzte wenige Minuten später unter der Tür hindurch.
Es dauerte einen Moment, dann öffnete Mara die Tür. Mit einem: »Pssst«, presste die Besucherin die in Lederhandschuhen steckende Hand auf den Mund der überraschten Fotografin, ein winziger Stich in den Hals, und die Sache erledigte sich wie von selbst. Es ist so einfach! Warum sind Frauen dermaßen neugierig, dass sie sofort jedem die Tür öffnen, ohne geringste Sicherheitsvorkehrungen. Keine Türkette, kein Bewegungsmelder. Wie leichtsinnig. Für mich mehr als eine gelungene Einladung. Sie wird nicht verstehen, dass ich sie in ihr wahres Zuhause schicke. Aber in ihrem nächsten Leben, das von Güte und Liebe zu Gott erfüllt sein wird, kommt alles wieder ins Lot. Problemlos schleppte sie die bewusstlose Mara über den Seitenweg zum Fahrzeug und zog sie in den Laderaum des Autos. Nur ein Hund, der plötzlich wie aus dem Nichts auftauchte und laut anfing zu bellen, hätte das ganze Projekt um Haaresbreite zum Scheitern verurteilt. Eilig schlüpfte die Schattengestalt ins Auto, startete den Wagen und rollte vom Hof.
Die Kamera und der Laptop … Scheiße! Es war nicht mehr möglich, die Gegenstände, die die Wahrheit ans Licht bringen können, an mich zu nehmen. Im Haupthaus leuchtete, durch das Hundegebell aufgeschreckt, eine Flurlampe auf. Später komme ich zurück und hole den Fotoapparat, später. Der Plan ist zu fast hundert Prozent aufgegangen. Vermutlich kann sowieso niemand etwas mit den Fotos auf der Speicherkarte anfangen. Erleichtert über die Beute und dennoch angespannt, was das Equipment anging, fuhr sie zurück. Nach einer halben Stunde rollte der unscheinbare Minitransporter im Schritttempo die Einfahrt hinauf. Vor einem Schuppen stoppte das Auto. Die Fotografin aus der eigenen Wohnung auf das Grundstück zu verfrachten, war ein Kinderspiel. Nun nur noch Vorfreude auf das, was auf die Frau zukommt. Allein die Gedanken versetzten die dunkle Gestalt in euphorische Stimmung. In aller Ruhe zog sie Mara an den Handgelenken hinter sich her, in einen speziell vorbereiteten Raum. Seelenruhig legte sie die Frau ab. Anschließend ließ sie sich auf einem Stuhl nieder, der an einer der kahlen Wände stand. Erwartungsvoll schlug sie die schlanken Beine übereinander, schaute kurz auf ihre Armbanduhr und wartete geduldig.
Mara stöhnte und bewegte flatternd die Augenlider. Sie schnalzte mit der Zunge und schluckte, um den widerwärtigen Geschmack aus ihrem Mund zu entfernen. Nach und nach kam sie zu sich und öffnete die Augen. Wie in Trance versuchte sie, ihren Körper aufzurichten, wobei die Arme immer wieder zur Seite knickten und sie zurück auf ihr kaltes, hartes Lager fallen ließen. Nach mehreren Anstrengungen schaffte sie es in eine sitzende Position. Ihr fehlte Orientierung und sie fragte lallend: »Wo bin ich?« Sie hockte mittig auf einer Metallpritsche in einem mit Dämmplatten ausgeschlagenen Raum. Von der Steindecke hingen Neonröhren, deren grelles Licht in ihren Augen schmerzte. Sie streckte den Kopf in die Höhe und entdeckte einen gewaltigen Spiegel, der ihr erschreckend bleiches Ebenbild zeigte. Geschockt fuhr sie zurück. Sie senkte den Blick und sah sich einer Frau gegenüber sitzen, die völlig entspannt mit verschränkten Armen auf einem Stuhl saß. »Wo … wo bin ich? Wer sind Sie und was wollen Sie?«, stammelte sie. Es kam keinerlei Antwort, nur dieser abgrundböse Ausdruck auf dem Gesicht der Person, der ihr umgehend einen fürchterlichen Schreck einjagte. Panik erfasste sie, und sie versuchte, von der Pritsche zu rutschen. Sie spürte, dass ihre Beine augenblicklich versagten. Hilflos krallte sie sich an die Kante der Metallliege, weil sie ohne Vorwarnung zusammensackte. »Ich habe Durst … Wasser … bitte!« Mara war schwindelig, und sie hielt den Schädel mit beiden Händen, da das Gefühl, gleich zu zerspringen, übermächtig wurde. »Reden Sie!«, schrie sie. Die Fotografin versuchte, ihren Verstand einzusetzen, klare Gedanken zu fassen. Sie konzentrierte sich und stutzte. »Ich kenne Sie doch. Sie sind die, die ich im Wald gesehen habe!« Sofort fiel ihr ein, welche Angst sie im Wald verspürt hatte, weil sie annahm, dass die Rothaarige dort nichts Gutes im Schilde führte. Sie war im Gegenteil ziemlich sicher, sie bei etwas Geheimnisvollem ertappt zu haben. Die Frau, die einen gepflegten Eindruck auf sie machte, erhob sich und kam lächelnd auf sie zu. In ihrem hautengen schwarzen Kleid und den hochhackigen Pumps wirkte sie eher, als wollte sie in wenigen Minuten eine Party aufsuchen. Dann sah sie, wie die Person langsam ein etwa 40 Zentimeter langes Stück dünnen Drahts hinter ihrem Rücken hervorholte und zwischen den Händen hielt. Das Blut in ihren Adern gefror, und sie bekam urplötzlich massive Atemprobleme. Sie zitterte, was augenscheinlich nicht an der Kälte im Raum lag. Maras rotblonde Haare, die ihr ständig Vergleiche zur amerikanischen Schauspielerin Julianne Moore einbrachten, klebten von Angstschweiß getränkt an ihrer Schläfe, und sie strich sie fahrig zur Seite. Starr schaute sie auf den Draht, der sich unaufhaltsam ihrem Gesicht näherte. Er sah aus wie ein grüner Faden. Die Knöchel traten weiß hervor, als sie die Finger immer fester um die Metallkante der Liege krallte. Sie schnaubte, die Nasenflügel bebten, und sie hoffte, dass nicht passierte, was sie tief im Inneren ahnte. Das Lächeln der Frau verzerrte sich zu einer dämonischen Fratze, was ihre letzten Hoffnungen auslöschte.
Sie wollte auf keinen Fall aufgeben und sich ihrer Entführerin widerstandslos ergeben. Es entsprach nicht ihrer Art, sich dermaßen schnell geschlagen zu geben – niemals! Auf einmal erwachten ungeahnte Kräfte. Sie spürte, wie ihr Körper anfing zu kribbeln und die Lähmung verscheuchte, die von ihren Muskeln Besitz ergriffen hatte. Zitternd rutschte sie von der Liege und stand das erste Mal seit Stunden auf ihren Beinen. Wie eine Marionette suchte sie eine standfeste Position, um sich keineswegs kampflos zu ergeben. Sie war sich der ausweglosen Situation, in der sie sich befand, sehr wohl bewusst. Aus den Augenwinkeln schielte Mara in jede Ecke des Raumes, um einen Ausweg oder eine Waffe zu finden, die ihr helfen könnte. Metallschränke standen an den Wänden und medizinisches Besteck lag auf glänzenden Tabletts verteilt. Von der Decke über dem Kopfende der Metallpritsche, auf der sie gelegen hatte, hing ein Kabel, an dessen Ende eine eigenartige Maschine mit einer Trennscheibe hing. Oh mein Gott, das ist eine Säge, eine Autopsiesäge. Was hat die vor? Ein derartiges Gerät war ihr in einer der vielen amerikanischen Autopsie-Sendungen aufgefallen, die sie manchmal anschaute, wenn sie nicht schlafen konnte.
Noch ehe sie weiter darüber nachdachte, sprach die Frau sie gefährlich leise an. »Du bist böse, und das Böse muss zurück ins Reich der Finsternis. Sei im nächsten Leben ein wenig genügsamer. Suche nicht mit deiner Kamera nach Dingen, von denen du keine Ahnung hast. Du weißt nicht, was du damit heraufbeschwören kannst.« Mara zog die Fäuste hoch und versuchte, auf die Rothaarige einzuschlagen. Die Fausthiebe trafen ins Leere. Sie wankte. Die Schlinge, die sich ruckartig um ihren Hals legte, zog sich zu, bevor sie überhaupt in der Lage war, zu reagieren. Sie nahm der Fotografin die Luft genau in dem Moment, als sie schreien wollte.
Das abartige Lächeln und der eingefrorene Blick aus einem eiskalten Augenpaar wirkten erbarmungslos.
Die Luft roch nach schwerem, süßem Honig. Corinna sog gierig die Abendluft in ihre Lungen.
Sie lief auf der Stelle, drehte sich um und sah trippelnd den letzten Sonnenstrahlen nach, die unter einer aufkommenden Wolkendecke hinterm Kirchturm der Sankt-Nikolai-Kirche verschwanden. Verschwitzt und mit gerötetem Gesicht wandte sie sich wieder ihrer Laufrichtung zu. Eigentlich wollte sie zum Strand von Gahlendorf joggen, aber die Arbeit in der Kanzlei hatte ihr heute die allerletzten Kraftreserven aus dem Körper gezogen. Sie blieb völlig ermattet stehen. Keuchend beugte sie ihren Oberkörper vornüber und drückte die Hände in die Taille. Stechender Schmerz hielt sie in gebeugter Haltung gefangen. Sie konnte kaum einatmen. Man sah ihr an, dass Atemnot sie quälte, trotzdem sie versuchte, immer wieder Luft in ihre Lungen zu pumpen. Die düstere Wolkenfront rückte näher. Die Seitenstiche waren das Ergebnis falscher, viel zu flacher Atmung. Sie dehnte ihren Rücken und hoffte, dass die Beschwerden verschwanden.
Die Strecke war normalerweise sehr angenehm, gerade jetzt im April, wo die ersten Knospen der Rapsfelder aufbrachen, ihren einzigartigen schweren und dennoch atemraubenden Duft freigaben. Corinna liebte diese Abende. Niemand störte sie, wenn sie verträumt den allabendlichen Lauf bis zum Strand absolvierte. Kaum ein Fahrradfahrer, der ihren einsamen Weg kreuzte. Und die wenigen, die vorbeiradelten, kannte sie. Vereinzelte Fehmaraner, die zumindest zu dieser Zeit im Frühling nach getaner Arbeit ein paar Momente der Ruhe in der Vorsaison genossen. Corinna presste die Handflächen erneut auf die Oberschenkel und senkte verausgabt den puterroten Kopf. Schweißperlen benetzten die Stirn, und sie zog keuchend Luft in ihre Lungen. Auf einmal spürte sie einen Wassertropfen auf der Nase. »Jetzt fängt es auch noch an zu regnen, ich werd verrückt.« Ohne Vorwarnung platterten die ersten Tropfen auf sie herunter. Ich muss mich unterstellen, bevor ich komplett durchnässt bin, dachte sie und guckte auf die verwitterte Holzbank, die unmittelbar vor dem Gehölz des Ostersolls unter dicht gewachsenen Büschen stand. Das Wäldchen, das versteckt dahinter lag, umgab einen kaum wahrzunehmenden Tümpel, auf dessen Wasseroberfläche es um diese Zeit vor kleinen Tierchen nur so flimmerte. Es war ein Soll, ein sogenannter Teich der Urzeit. Der kleine Wald würde ihr einen gewissen Schutz bieten, solange es regnete. Sie hatte eigentlich keine Ahnung vom geschichtlichen Hintergrund des Solls, aber als sie heute Morgen das Tageblatt aufschlug, entdeckte sie einen nicht uninteressanten Bericht des Heimatforschers der Insel. Nun wusste sie, dass sie hier im Ostersoll im April 1937 in der Süd-Ost-Ecke des Wäldchens den legendären Bürgermeister der Stadt, Claus Lafrenz, mit einem Strang an einem dickeren Ast über dem Soll aufrecht hängend, wie sie es titulierten, aufgefunden hatten. Der Arme erschoss seinen Jagdhund und sich selbst, nachdem er sich eine Schlinge, die an einem dicken Ast hing, um den Hals legte. Wie grausam. Sie entdeckte bisher weder eine Hinweistafel noch einen Gedenkstein. Jetzt fand sie es zunehmend schade. Die Geschichte, die dazu gehörte und die sie interessiert gelesen hatte, war dermaßen mitreißend, dass sie es sich wünschen würde. Und jetzt war obendrein wieder April. Fast wirkte es für sie wie ein Zeichen.
Sie schlängelte sich durch den verengten Eingang. Vereinzelte Mücken, hervorgelockt durch die ersten warmen Tage, suchten nach Nahrung im Feuchtgebiet.
Corinna blieb stehen und zog die Wasserflasche aus dem Gurt, den sie um ihre Hüften geschlungen hatte. Sie zerrte das blaue Frotteeband vom Kopf, wischte damit die Wassertropfen von der Stirn. Gedankenverloren strich sie mit den Händen durch die nussbraunen kurzen Haare. Die Mittdreißigerin setzte die Flasche an die Lippen und leerte sie in einem Zug. Anschließend schaute sie zurück Richtung Burg, das unter der schwarzen Wolkendecke bedrohlich auf sie wirkte. Sie betrachtete die Reflektoren ihrer lachsfarbenen Turnschuhe, als es hinter ihr plötzlich kaum wahrnehmbar knackte.
Erschreckt fuhr sie herum. Corinna spürte auf einmal ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Vielleicht irrte der Geist des Verstorbenen immer noch im Ostersoll herum. Was für ein Blödsinn, schalt sie sich und duckte sich hinter einen dichten Busch.
Vereinzelt fand der Regen einen Weg durch die Bäume und tropfte von den Blättern. Ihr Herz fing erneut unkontrolliert an zu schlagen. Sie versuchte, durch die Gewächse hindurchzuschauen. Allerdings erkannte sie nichts Verdächtiges. Was wäre wenn … Quatsch! Wie sollte hier jemand herumlungern? Hier gibt es rein gar nichts, überlegte sie und schlich trotz des mulmigen Gefühls in ihrer Magengegend entschlossen zu dem Trampelpfad, der ins Innere des Gehölzes führte. Bin doch kein dummes Gör, dachte sie und tippte mit dem Finger gegen die Stirn. Süd-Ost-Ecke des Wäldchens, wo könnte der Baum – pah! Hätte ich das nur überlesen heute Morgen. Trübe schimmerte das Wasser des Teichs, der sich auf der linken Seite des Geländes ausbreitete. Einzelne Regentropfen schlugen auf die Wasseroberfläche auf. Der Tümpel verschlang sie genauso gierig wie die knochig herunterhängenden Äste einer betagten Trauerweide. Corinna fasste nach dem Taschenmesser, das sie griffbereit in ihrer Jackentasche verwahrte, um sich vor Attacken schützen zu können, wenn es notwendig wäre. Es beruhigte sie, den kühlen Griff des Messers in ihrer Hand zu spüren. Sie schritt den Weg entlang, der ungefähr eine Länge von 50 Metern besaß, bevor er vor einer Kette von Gebüsch endete. Sie umkreiste aus den Augenwinkeln den Tümpel, damit nichts Unvorhergesehenes passierte, ohne dass sie es wahrnahm. Gott sei Dank war es im Inneren des Wäldchens einigermaßen trocken, sodass sie hier im Ostersoll den Regen abwarten wollte. Egal, wie unheimlich es auch erscheinen mochte.
Im Wasser des Teiches, auf dem ein milchig trüber Schleier wie eine Fahne entlang zog, lagen von zurückliegenden Stürmen abgebrochene Teile einiger Bäume und dicke Wurzeln, die sich bis ans schlickige Ufer schlängelten. Die umliegenden Felder schimmerten durch die Büsche, und niemand hielt sich in der Nähe auf. Was bin ich für eine Idiotin, dachte sie und schüttelte den Kopf.Langsam umrundete sie das Gewässer. Ihr Puls fuhr auf ein normales Maß runter, obwohl ihr unbehaglich zumute war. Und endlich konnte sie ohne Probleme befreit durchatmen. Die Seitenstiche waren Gott sei Dank verschwunden. Es ist besser, wenn ich mich nach dem Regen sofort auf den Rückweg mache. Wer weiß, wie das Wetter sich entwickelt. Da lass ich mir von so dämlichem Geknacke Angst einjagen. Das war wahrscheinlich ein Hase, der hier irgendwo einen Bau hat.Außerdem knurrt mir der Magen. Corinna sah auf ihre Uhr. Gleich halb sechs. Wird Zeit, dass es aufhört zu regnen. Sie trottete auf dem Pfad weiter und erreichte fast den Eingang des Wäldchens. Versteckt zwischen den herunterhängenden Zweigen der Trauerweide sah sie etwas am Rand des Teiches treiben, das eine eigenartige Form besaß. Es sah aus wie ein im Wasser entsorgter schwarzer Müllsack, der aufgebläht wie ein Ballon an der Oberfläche trieb.
Corinna stakste mitten durch Brennnesseln und zerbrochenen Holzstückchen an die Uferböschung heran. Sie versuchte herauszufinden, um was es sich bei dem Gegenstand handelte. Ihre Sneakers versanken im feuchten Morast, der glucksend in die Schuhe eindrang. Die Nässe sickerte durch die Socken, und ein ekelhaftes Gefühl auf der Haut, das sie schon als Kind hasste, breitete sich in ihr aus. Die dunklen Schatten, die sich mittlerweile bis ins Innere des Gehölzes gefressen hatten, ermöglichten kaum noch eine vernünftige Sicht. Der Regen platterte auf die Blätter und lief in feinen Rinnsalen auf den Boden, der mehr und mehr verschlammte. Sie schob sich den schmalen schlammigen Saum hinunter und schlitterte geradezu auf das moderige Wasser zu. Immer tiefer versanken ihre nagelneuen Sportschuhe im Modder. Reflexartig krallte sie sich an einer der langen Weidenäste fest, um zu verhindern, dass sie mit den Füßen komplett in den Tümpel rutschte. Sie trat erschreckt einen Schritt zurück. Etwas streifte plötzlich ihre nackten Beine, die in kurzen Sporthosen steckten, und hinterließ Kratzer, die an einigen Stellen zu bluten anfingen. Sie fuhr erneut zusammen. Erleichtert atmete sie auf. Ein Ast war der Übeltäter. Ein kleiner Vorsprung im lehmigen Grund machte es ihr leichter, sich zu fangen, um ihr Gleichgewicht wiederherzustellen. Sie unterdrückte den Schmerz und suchte nach einem langen Gegenstand, den sie benutzen konnte, um den vermeintlichen Sack heranzuziehen. Noch einen Schritt. Jetzt hatte sie endlich festen Boden unter den Füßen. Der Regen war mittlerweile durch ihre Klamotten gedrungen und hatte sie bis auf die Haut durchnässt. Sie fröstelte trotz des einigermaßen geschützten Waldes, während außerhalb ein regelrechter Guss runterprasselte. Sie hielt es für besser, so lange im Schutz der Bäume abzuwarten, bis der Regen aufhörte. Aber hier herumzuschnüffeln – daran hatte sie ebenfalls kein allzu großes Interesse mehr.
Allerdings gab es auch keinen guten Grund, den Ort, der ihr immer unheimlicher vorkam, überstürzt zu verlassen. Corinna zog entschlossen den Reißverschluss ihrer blauen Sportjacke hoch und trottete mit verdreckten Sportschuhen und völlig durchnässt Richtung Straße. Sie wollte am Ausgang abwarten, weil sie sich einbildete, schneller von dort verschwinden zu können. Ihre Schritte wurden langsamer, und letztendlich blieb sie unschlüssig auf dem ausgetretenen Pfad stehen. Bin ich blöd, dass ich Schiss vor einem Hasen oder wer weiß was habe? Bockig machte sie auf dem Absatz kehrt. Am Wegrand zum Soll entdeckte sie einen langen knorrigen Ast, der ihr stabil genug erschien, die Erforschung ihrer Entdeckung fortzusetzen. Sie streckte den Arm aus und nahm das Holz an sich. Es knackte erneut im Unterholz. Angespannt drehte sie den Kopf zur linken Seite. Eine Taube, die in einem der Bäume auf einem Ast saß, flatterte wild mit den Flügeln und verließ ihren Platz. Erleichtert lachte Corinna. Sie hatte sich von einem Vogel Angst einjagen lassen. Bewaffnet wie Jean Dark schritt sie mit dem Holzstück an die Uferböschung und suchte nach dem kleinen Absatz, der ihr vor wenigen Minuten Halt gegeben hatte. Ihr Herz puckerte vor Aufregung, und das ungute Gefühl in ihrer Magengegend breitete sich weiter in ihren Eingeweiden aus. Dennoch, die Neugier in ihr war eindeutig stärker als das Muffensausen.
Breitbeinig stellte sie sich hin und begann, mit dem Ast den vermeintlichen Müllsack in Bewegung zu bringen. Der Gegenstand, der träge an der Oberfläche trieb, fing an, unkontrolliert hin und her zu schaukeln. Sie vermutete, dass sich etwas Schweres darunter verbarg, weil sie Schwierigkeiten hatte, das undefinierbare Paket zu bewegen. Wahrscheinlich hat jemand seinen Müll hier einfach entsorgt. Was für eine Schweinerei! Abermals postierte sie ihre Beine auf der Erde, beugte den Oberkörper vornüber und stieß mit Kraft in den im Wasser vorhandenen Gegenstand, um ihn heranzuziehen. Vorsichtshalber hielt sie sich nach dem Stoß mit einer Hand am herunterhängenden Ast der Trauerweide fest und drückte das Gebilde unter die Oberfläche, um es ins Trudeln zu bringen. Im Zeitlupentempo fing der vermeintliche Sack an zu rotieren. Endlich! Zwischen den Bäumen auf dem Rapsfeld erblickte sie aus den Augenwinkeln ein Reh, das neugierig den Kopf reckte und unverwandt in ihre Richtung starrte. Der Regen schien nachzulassen, was Corinna allerdings in ihrem Übereifer nicht bemerkte.
Noch einmal bündelte sie ihre Kraft, stöhnte lautstark, sodass das Reh erschreckt Reißaus nahm, und drückte das Gebilde angestrengt unter Wasser. Dann löste es sich aus seiner Unbeweglichkeit und trieb frei an der Wasseroberfläche. Das Gewicht verlagerte sich, und in dem Moment schob sich die Hülle, die wie eine Decke ausgebreitet dalag, beiseite. Jetzt erkannte sie, was der vermeintliche Plastiksack darstellte. Das ist kein Müllsack, das ist ein Umhang. Ein schwarzes langes Cape aus Stoff. Wolle? Verdutzt hielt Corinna inne und starrte fassungslos auf das pechschwarze Bündel, das auf dem Wasser trieb. Luftblasen stiegen träge blubbernd nach oben, und der Überwurf glitt zur Seite. Was darunter zum Vorschein kam, ließ sämtliche Farbe aus ihrem Gesicht weichen. Vor ihr im Tümpel wurden zwei bleiche Hände und Füße sichtbar, die anscheinend miteinander verschnürt waren und jetzt losgelöst nach oben drangen. Entsetzt entglitt Corinna der Ast. Verstört hielt sie die Hand vor ihren Mund und wich zurück. Sie stolperte über eine Baumwurzel und landete auf ihrem Hintern. Das Wasser schlug erneut Blasen, als der Umhang sich wie von Geisterhand in Bewegung setzte. Die kalkweißen Körperteile verschwanden, das Cape trieb weiter und versank ebenfalls. Der Körper rotierte wie eine Schraube. In Zeitlupentempo wurde der Umriss eines Kopfes an der Wasseroberfläche sichtbar. Ein Gesicht. An den Stellen, an denen sich normalerweise Augen befanden, starrten ihr schwarze Löcher entgegen.
Corinna saß für einen Moment versteinert auf dem schlammigen Grund. Dann löste sich der Schock, und sie stieß einen gellenden Schrei aus, der über die Felder hallte. Geschockt rappelte sie sich auf, rutschte immer wieder auf dem matschigen Boden aus, sodass die Füße ständig zurück ins Wasser glitten. Panisch kämpfte sie gegen das Abgleiten in den Tümpel und hörte überhaupt nicht mehr auf zu schreien. Die Vögel, die auf den Ästen versammelt saßen, schreckten auf und flüchteten. Das war kein Müll, den sie zum Vorschein gebracht hatte, das war unübersehbar eine Wasserleiche.
*
»Ist das schön!«, schwärmte Charlotte überschwänglich, obwohl niemand in der Nähe war. Allein mit sich und ihrer Nikon stand sie auf dem geräumigen Balkon im zweiten Obergeschoss und betrachtete die Stiefmütterchen, die sie erst vor wenigen Tagen in Kübel und Balkonkästen gepflanzt hatte. Sie blickte mit geschultem Auge durch den Sucher ihrer Spiegelreflexkamera und versuchte, die Stimmung des Moments mit dem Blumenarrangement einzufangen. Eigentlich sollte ich ja die Eisheiligen abwarten, aber was soll’s. Wenn es doch so schön ist. Wiederholt drückte sie verzückt den Auslöser. Die ersten weißen Blüten breiteten sich in den Kübeln aus und warteten auf die wärmere Jahreszeit, die ihnen zu voller Pracht verhelfen würde. »Der Mai mit seinen Eisheiligen kann mich mal«, gluckste Charlotte und hielt kichernd die Hand vor den Mund.
»Und der Kontrast mit dem Wasser, ich werd verrückt. Dass ich es noch einmal so gut treffen würde, hätte ich niemals gedacht«, rief sie begeistert und stellte sich barfuß hinter die Blumen. Katrin würde mir eine Moralpredigt halten, weil ich schon wieder barfuß laufe, dachte sie und wackelte mit den blaulackierten Zehen, die ihr wie kleine Edelsteine entgegen blitzten. Grienend ging sie in die Hocke und versuchte, mit den Gewächsen im Vordergrund die Ostsee mit der rotgoldenen Decke der untergehenden Sonne einzufangen. Sie kam hoch, setzte sich seufzend auf einen Gartenstuhl aus edlem Bangkiraiholz und legte die Kamera neben sich auf den Tisch. Dabei ließ sie den Blick über den Sund schweifen, bis hin zu ihrer geliebten Sundbrücke, hinter der gerade der glutrote Ball verschwand. Es sah aus, als wollte die Sonne vor der drohenden Regenwand fliehen, die von Westen heranzog. Sie strich den weißen Leinenstoff ihrer Hose glatt und schloss die hüftlange, mit maritimen Motiven bestickte Strickjacke. Verträumt fuhr sie durch ihre silberfarbenen Haare und klemmte einzelne widerspenstige Strähnen hinter ihre Ohren.
»Wie kitschig und was für ein Glück!«, rief sie und klatschte in die Hände. »Von mir aus können die mich hier mit den Füßen zuerst raustragen, wenn’s denn sein muss. Aber erst viiiel später.«
Die dunkle Wolkenfront zog über den Sund hinweg, und erste Regentropfen fielen auf den mit Holz ausgelegten Balkon. »Das verheißt nichts Gutes«, sprach Charlotte zu sich selbst. Sie kramte Kamera, Glas und Decke vom Tisch und ging zurück ins Wohnzimmer. Wenn es gleich regnet, kriegen die Stiefmütterchen ihren Schluck Wasser, dachte sie und verschloss die Terrassentür. Sie guckte vom Wohnzimmer aus zum Sund und versank in Gedanken. Die Hände hinter dem Rücken verschränkt, wippte sie auf ihren Zehen immer wieder auf und ab, als ob sie ihr Sportprogramm absolvierte.
Der abscheuliche Brand des wunderschön gelegenen, gemütlichen Hauses am Sund lag mittlerweile ein gutes Jahr zurück. Dass ihr Traumhaus einem Brandstifter zum Opfer fallen würde, der eigentlich sie im Visier hatte und genauso gut Katrin hätte umbringen können, brachte sie fast an den Rand des Verstandes. Ihre Nichte und Freunde kämpften mit allen Mitteln einige Wochen, um Charlotte wieder aufzupäppeln. Katrin, die ihretwegen von Hamburg nach Fehmarn gezogen war, wich wochenlang kaum von ihrer Seite und durchlebte Ängste, die für Außenstehende unvorstellbar waren. Sie betete, dass ihre Tante die Vorkommnisse der letzten schweren Übergriffe unbeschadet überstand. Charlotte war stark. Wenngleich sie lange Zeit häufig in Tränen aufgelöst durch die Gegend lief, selten das Haus verließ, es sei denn an den Strand, versiegten die Tränen dann doch irgendwann. Sie erholte sich zusehends. Sie trauerte nicht nur um ihr schönes Domizil am Meer, die Erinnerungen, die in ihm verbrannten, setzten ihrem Gemütszustand ziemlich zu. Dennoch, im Nachhinein dachte sie oft darüber nach, wie viel Glück sie bei allem Unglück gehabt hatten. Das traumhaft gelegene Grundstück fand schneller einen Käufer, als sie gucken konnte. Vom sehr großzügigen Erlös kaufte sie sich mit ihrer Nichte Katrin diese wunderschöne Eigentumswohnung im obersten Stockwerk des exklusiven Neubaus. Kaum zu glauben, dass die Wohnung ebenfalls direkt am Sund lag, nur auf der anderen Seite ihrer geliebten Brücke. So hielt sich der Verlust zumindest in Grenzen. Es blieb obendrein genügend Geld übrig, um einen ruhigen Lebensabend zu verleben. So verbrachte sie mit Katrin, die mittlerweile ihren Platz im eigenen Hochzeitseventbüro gefunden hatte, eine schöne Zeit. Das Leben hatte sie endlich wieder.
Das Telefon klingelte und riss sie aus ihren Gedanken.
»Mhm, schmeckt der gut. Wo hast du den denn her?« Die sportlich schlanke Frau warf ihre langen brünetten Haare zurück und schlürfte den süffigen Rotwein, der im Glas leuchtete wie die blutrote Sonne am Strand von Westerbergen.
»Das verrate ich auf keinen Fall, sonst kommst du noch auf die Idee und kaufst ihn dir selbst und mich brauchst du nicht mehr.« Katrin lächelte, stellte ihr Weinglas auf die Decke und schlang die Arme um seinen Hals. »Küss mich, bester Rotweinkäufer aller Zeiten.« Sie hielt ihm ihre gespitzten Lippen entgegen, und er verspürte Lust, ihren weichen Mund mit den Lippen zu verschließen. »Du hattest wirklich recht«, flüsterte er, »das ist der schönste Sonnenuntergang, den ich seit Langem gesehen habe.« Die Sonne hatte den Flügger Leuchtturm erreicht und legte sich wie ein roter Ball hinter das Leuchtfeuer. Es schien, als stände der gesamte Turm in Flammen. »Traumhaft, finde ich auch. Ich komme schon jahrelang hierher«, sagte sie. »Wenn ich als Jugendliche zum Surfen nach Gold gefahren bin, habe ich oft am Strand geschlafen.«
»Ist das nicht verboten?«, fragte der gutaussehende Mann an ihrer Seite und zog verschmitzt die Augenbrauen hoch. »Ach, was alles so verboten ist. Musst du ja nicht gleich jedem auf die Nase binden, dass ich hier als Jungspund am Strand geschlafen habe. Ist außerdem verjährt und wäre wohl eher eine Ordnungswidrigkeit, denke ich zumindest.« Katrin strich die Decke glatt und streckte ihren wohlgeformten Körper aus.
Der äußerst attraktive Mann, mit dem sie die letzten zwei Stunden hier am Deich auf einer ausgebreiteten Decke verbrachte, um gemeinsam den Sonnenuntergang zu erleben, lachte lauthals. »Möchtest du noch ein Stück Baguette oder ein paar Weintrauben?« Frech wedelte sie mit der Traube und hielt ihm die leckeren Früchte direkt unter die Nase, um sie sofort, wenn er danach griff, feixend wieder zurückzuziehen. Lachend sprang sie auf und lief barfuß den Wall hinunter zum Wasser. »Fang mich, wenn du welche willst. Komm Feigling, fang mich.« Sie blieb an der Wasserkante stehen und lauerte. Er erhob sich erstaunt und folgte gelassen. Seine 1,92 Meter konnte man nicht einfach ignorieren. Katrins Herz fing heftig an zu schlagen. »Musst du einen alten Mann so hetzen?«, rief er und hechtete mit wenigen Schritten auf sie zu. Kreischend preschte sie ins Wasser und stakste, so schnell sie konnte, vom Ufer weg. »Na warte, dich krieg ich. Kinder mit einem Willen kriegen was auf den Po«, hechelte er und folgte ihr prustend durch das flache kalte Nass. Sie schrie, als wäre der Teufel hinter ihr her, und stolperte. Der Länge nach fiel sie samt Jeans und T-Shirt ins kniehohe Wasser. Angestrengt darauf bedacht, die Hand mit den Weintrauben in die Höhe zu halten, damit sie nicht im Salzwasser landeten. Lachend sprang er hinterher und ließ sich neben sie in die eisige See fallen.
»Oh Mann, ist das kalt. Wie viel Grad hat die Ostsee denn? Null?« Er hielt die Hand mit den Trauben fest, führte sie zum Mund und verschlang sie gierig. »Ich hab doch gesagt, ich schnapp dich.« Katrin lachte und schlang erneut ihre Arme um seinen Hals.
»Ne, unser Binnenmeer ist gerade zehn Grad warm«, antwortete sie.
»Du meinst wohl kalt!«, sagte er, dann zog er sie gierig an sich. Ihre Lippen fanden sich zu einem fordernden Kuss, der mehr verlangte. Seine Fingerspitzen fuhren unter ihr nasses Shirt und berührten die Brüste, die sich unter dem durchsichtigen Stoff deutlich abzeichneten. »Lass uns nach Hause fahren«, antwortete er heiser. »Ich will dich.«
»Warum nicht hier?«, entgegnete sie ihm aufreizend. »Weil mir das Wasser zu kalt ist«, lachte er, sprang auf und spritzte eine Fontäne in ihr Gesicht. »Fang du mich, wenn du mich willst«,rief er und stapfte, so schnell ihm möglich war, zurück an den Strand.
Lachend folgte sie ihm und warf sich kichernd neben ihn auf die Decke. Sie schaute zum Himmel und schreckte auf Anhieb hoch. »Sieh mal, da zieht eine gewaltige Wolkenformation hoch. Ich denke, wir sollten gleich einpacken.« Sie reckte ihm ihre feuchten Lippen entgegen, als sein Handy klingelte. Augenblicklich verzog Katrin den Mund, in der stillen Hoffnung, er würde das schrille Läuten ignorieren.
»Ich muss rangehen«, sagte er mit ernster Miene, zuckte mit den Schultern und zog das Mobiltelefon aus der Tasche der Jacke, die dicht bei ihm auf der Decke lag. »Könnte wichtig sein«, antwortete er, als er feststellte, wessen Name auf dem Display stand. »Na Jungchen, was gibt es so Brenzliges, das ich löschen muss? – Was ich tue? – Du holst mich gerade aus der Badewanne«, griente er und sah die sexy aussehende Frau an seiner Seite verheißungsvoll an. Am anderen Ende schien man allerdings weniger gute Laune zu haben als die beiden am Strand von Westerbergen. »Nein – das gibt es nicht – ist gut – wir treffen uns in einer Stunde in der – wo sagtest du – am Ostersoll – ja, ich bin da – bis dann.«
Dirks Mimik veränderte sich schlagartig, und ein besorgniserregend harter Zug umspielte den Mund. Katrin sah ihn erstaunt von der Seite an. Sie wusste mittlerweile, dass der Gesichtsausdruck nichts Gutes bedeutete.
»Mädchen, hör zu, ich werde dich nach Hause fahren. Ich muss sofort weg«, sagte er, während er die nassen Sachen auszog, sich ein Handtuch um die Hüften schlang und seine Jacke über den nackten Oberkörper streifte.
»Wie weg? Können die nicht ein Mal ohne dich klarkommen? Was kann denn so wichtig sein?« Sie hielt blitzartig den Mund. Ihr war klar, dass niemand ihn grundlos aus der kargen Freizeit holte. »Es tut mir leid. Ich weiß, dass du nicht ohne Anlass los musst.« Dennoch verspürte sie fiese Nadelstiche in ihrer Herzgegend. Sie zog ebenso ihre triefende Kleidung vom Körper und schlang die Decke, die vorher am Boden lag, um ihre Schultern.
»Du musst dich zu Hause sofort warm duschen«, versuchte er die Stimmung zu retten. Beide sahen in ihrer Kostümierung irgendwie deplatziert aus.
Es entstand eine kurze Pause, während beide über das Meer schauten und die Regenfront auf sich zukommen sahen.
»Wir müssen sowieso los«, platzte Katrin in die Stille. Dirk nickte.
»Sie haben eine Leiche entdeckt«, sagte Dirk Westermann angespannt. Er wusste, dass sie es in jedem Fall erfahren würde, und sah auch keinen Grund, Katrin nicht augenblicklich reinen Wein einzuschenken. Sie sah ihn entgeistert an.
»Nein, das kann nicht wahr sein. Nicht schon wieder.«
»Doch, leider. Ich muss sofort los. Es tut mir leid, wirklich.« Der Hauptkommissar nahm die Nichte von Charlotte Hagedorn schweigend in den Arm. Sie befreite sich aus der Umarmung, stand auf und kramte ihre Sachen zusammen. Wortlos gingen sie wenige Minuten später zum Parkplatz. Dirk Westermann öffnete den Kofferraum und zerrte eine lange Sporthose und ein T-Shirt aus seiner Sporttasche, die er im Wagen deponiert hatte. »Ich muss mich im Kajüthus erstmal umziehen.«
Als er sich gerade ins Auto setzen wollte, summte das Handy zum zweiten Mal. Das Summen einer bestimmten Melodie zeigte ihm den Eingang einer SMS an. Dirk zog das Telefon aus der Jackentasche, blieb am Wagen stehen und lehnte sich gegen die Karosserie. Stillschweigend betrachtete er das Display, während er mit dem Zeigefinger darüberfuhr. Die Mitteilung einer unbekannten Nummer ließ ihn zweimal hintereinander das Geschriebene lesen.
›Wenn über Kreuz die Sünde liegt, ruht an der Stätte, die nicht der Wahrheitsfindung dient, die Wahrheit in der Tiefe.‹
Westermann wunderte sich, wer ihm auf dem Diensthandy einen derart konfusen Text übermittelte. Er beantwortete die SMS und hoffte auf eine Antwort. ›Was soll mir diese Mitteilung sagen?‹Er wartete auf eine Reaktion, und Katrin wurde schlagartig sauer, als sie sah, dass er nicht einstieg. Wütend schwang sie die Haare zur Seite. Blödmann.
Nur wenige Sekunden später kam die Antwort.
›Wir spielen ein Spiel, und ich bestimme die Regeln. Ich befreie euch …‹Der Kommissar schüttelte den Kopf, steckte das Telefon zurück in die Tasche und stieg ein. Mit keinem Wort erwähnte er die eigenartige SMS. In Gedanken versunken fuhr er schließlich los.
*
Westermann erkannte von Weitem die rotierenden Lichter der Polizeifahrzeuge, die am Rande des Wirtschaftsweges zwischen Burg und Gahlendorf aufleuchteten. Er nahm den Fuß vom Gaspedal und rollte an die Wegbiegung heran. Konzentriert lenkte er den Wagen an den Straßenrand und stellte den Motor aus. Er schob die Pfeife in den Mund und entzündete sie. Es war mittlerweile dunkel, und er knipste die Taschenlampe an, die er ständig in der Jackentasche mit sich trug. Mit wenigen Schritten erreichte er den weitläufig abgegrenzten Bereich. Er blieb stehen und sah sich aufmerksam um. Mit einer Hand knetete er das Kinn und verlagerte die Tabakspfeife in den Mundwinkel. Der konzentrierte Blick glitt über die dunklen Felder, eine schmale Teerstraße und zurück nach Burg, wo Lichtquellen vereinzelter Häuser aus den Fenstern leuchteten. Westermann filterte alle Informationen und verinnerlichte sie. Riesige, freistehende Hallen, ein Traktor auf dem Gelände. Keine Menschen weit und breit. Das kleine Wäldchen lag direkt an der Straße Richtung Gahlendorf.
Es würde auffallen, wenn man hier irgendwen mit dem Auto entsorgte. Es sei denn, wenn es dunkel genug wäre wie gerade in diesem Augenblick. Ihm erschien der Ort perfekt, um jemanden zu beseitigen, ohne verräterische Spuren zu hinterlassen. Links und rechts nichts anderes als Felder, die nach Anbruch der Dunkelheit niemanden interessierten. Wohl aber die, die Böses im Sinn hatten.
Bevor Westermann den Tatort ansteuerte, schritt er die schmale Teerstraße ab, bis das Waldstück zu Ende war. 60, vielleicht 70 Meter breit, mehr nicht, vermutete er. Umgeben von weit gestreckten Weiden, bis hin nach Gahlendorf. Am Schluss der Baumreihe ein eingefahrener Pfad, auf dem er Reifenspuren erkannte, als er mit der Lampe darüber leuchtete. Wahrscheinlich fährt der Bauer hier mit Traktoren entlang. Eventuell versteckte der Täter sein Fahrzeug ebenfalls hier im Schutz der Bäume. Der Hauptkommissar ging grübelnd die Strecke zurück, bis er den Eingang des Ostersolls erreichte, und zog eine qualmende Vanillefahne hinter sich her. Er hob die Banderole an und schob den Körper darunter hindurch. Ein Kollege der Kriminaltechnik reichte ihm Handschuhe und Schuhschutz. Bedächtig schritt er den Pfad entlang, stülpte beides über und näherte sich dem Tümpel. Mindestens acht Beamte der Spurensicherung in weißen Anzügen und zwei Taucher suchten im und um den Teich nach verwertbaren Spuren. Etliche Taschenlampen und aufgestellte Leuchten erhellten den gesamten Tatort. Wahrscheinlich gehen hier täglich Leute spazieren. Obwohl, wer diesen Ort nicht kennt, findet durch den dichten Baumbewuchs kaum heraus, dass es hier einen kleinen See gibt, um den man herumlaufen kann. Ich hätte den Weg glattweg übersehen. Das ist doch eher ein Spazierweg für Menschen, die die Gegend kennen, dachte Westermann und sah sich um. Er zog das schwarze Notizbuch aus der Jackentasche, stellte sich in die Nähe einer der bereits aufgestellten Lampen, nahm den Stift und machte erste Aufzeichnungen. ›Täter könnte ortskundig sein.‹
»Ach nee. Schön, dass du auch da bist« sagte Thomas Hartwig und grinste über das ganze Gesicht. »Gibt ja nicht nur dich«, brummte der Hauptkommissar. »Habt ihr etwas Brauchbares?«, fragte er und stakste zum matschigen Ufersaum hinunter. »Wo ist die Zeugin?«
»Die sitzt völlig aufgelöst im Wagen.« Hartwig deutete auf eines der Dienstfahrzeuge, die hintereinander am Wegrand parkten. »Aber wir haben die Daten aufgenommen. Sie hat nur gesehen, was du auch gleich sehen wirst, und niemanden bemerkt. Willst du mit ihr reden oder können wir sie nach Hause bringen?«
»Schickt sie nach Hause.« Westermann reichte dem Kollegen eine Visitenkarte. »Sie soll mich anrufen, falls ihr irgendetwas einfällt, das uns weiterhelfen könnte.« Hartwig nickte. Wenig später kam er zurück zum Tatort.
»Sonst?« Hartwig wusste sofort, worauf der Kommissar hinauswollte.
»Weibliche Leiche, zwischen Ende 20 und Mitte 30, gefesselt, wahrscheinlich erdrosselt. Wir wissen noch nicht, ob sie ertrunken ist oder vorher ermordet wurde. Sie liegt drei bis vier Tage im Wasser. Genaues kann dir Henning nach der Obduktion sagen.«
»Vorher? Was soll das heißen?« Der Hauptkommissar sah erstaunt auf, und selbst Hartwig, der etwas abseits stand, traute sich einen Schritt näher an die Leiche heran als gewöhnlich.
»Die Tote hat keine Augen mehr«, sagte Kriminaltechniker Henning, der über die Leiche gebeugt war. »Dort, wo die sich eigentlich befinden sollten, sind leere Höhlen.« Westermann starrte Henning an.
»Also kann man nicht von Selbstmord ausgehen.«
Er schüttelte heftig den Kopf.
»Außerdem ist sie so verschnürt, das hätte sie auf keinen Fall alleine bewerkstelligen können. Aber sieh es dir selber an.«
»Habt ihr schon nach Reifenspuren außerhalb des Wäldchens gesucht?«, wandte Westermann sich beiläufig an die Kollegen der Spurensicherung. Hartwig verneinte.
»So weit sind sie noch nicht.«
»Lauft mal die Wege links und rechts des Ostersolls entlang, vielleicht findet ihr Reifenspuren oder Fußabdrücke. Der wird sie ja kaum auf dem Rücken hierher getragen haben«, wies der Hauptkommissar Hartwig an.
»Geht gleich los, sobald wir um den Teich herum fertig sind«, antwortete einer der Kollegen.
»Hat ja leider geregnet. Wer weiß, ob wir überhaupt verwertbare Spuren finden«, sagte Westermann und rutschte die schlammige Grasnarbe entlang. Taumelnd hielt er sich an einem der Äste der Trauerweide fest, um nicht ins Wasser zu stürzen. »Einmal langt mir heute. Ist sowieso merkwürdig. Wieso hat es hier geregnet? In Westerbergen war schönster Sonnenuntergang«, entgegnete der Kommissar aus Oldenburg.
»Hä? Heute hat es nicht geregnet. Aber wieso Westerbergen?« Hartwig sah seinen Vorgesetzten fragend an.
»Geht dich gar nichts an«, winkte er ab und schob die Pfeife von einer Seite auf die andere.
»Hast wohl im Traum mit deiner Süßen in der Wanne gelegen, als ich anrief, was?«
»Ich hab dir schon einmal gesagt, das geht dich gar nichts an.«
Er wusste, dass Thomas sich vor nicht allzu langer Zeit in Katrin verguckt hatte. Beinahe holte ihn das schlechte Gewissen dem Kollegen gegenüber ein. Allerdings – wenn sie ihn wirklich gewollt hätte, wäre sie sehr wahrscheinlich auf seine Avancen eingegangen.
Dirk Westermann konnte das Interesse, das sie ihm am Anfang ihres Kennenlernens entgegenbrachte, selbst kaum glauben. Schließlich war er es, der sie aus einer Laune heraus küsste. Sie war so jung, so lebendig und tat ihm unendlich leid, als sie vor dem brennenden Haus stand und bitterlich weinte.