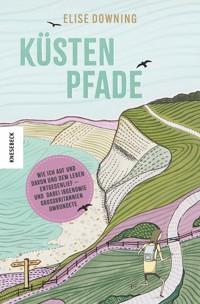
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knesebeck Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Reiseerzählung, die Mut macht einfach loszulaufen Nach ihrem Studium findet sich Elise in einem Leben wieder, das sie nicht erfüllt. Ihr Job, von dem sie immer geträumt hat, langweilt sie, ihre Beziehung mit Greg macht sie unglücklich. Ihre Lösung? Einmal um Großbritannien herumlaufen, 8.000 Kilometer, immer an der Küste entlang – ohne jegliche Lauf-Erfahrung und Kartenkenntnisse und ohne jemals zuvor allein ein Zelt aufgeschlagen zu haben. Was als Flucht beginnt, wird zu einer Reise zu sich selbst, mit überraschenden Begegnungen, unerwarteter Unterstützung und neu gefundenem Selbstvertrauen. In fast einem Jahr sieht sie ganz Großbritannien und auch sich von ihrer wildesten und wunderbarsten Seite. Mitreißend erzählt Elise in ihrem Reisebericht davon, was man erlebt, wenn man den Mut aufbringt, alle Ängste und Zweifel über Bord wirft und einfach losläuft. Ein humorvoller, selbstironischer Blick auf das Leben und die Herausforderungen, die es mit sich bringt. Für alle, die nach Inspiration suchen, über sich hinauswachsen oder einfach ihren ganz persönlichen Greg hinter sich lassen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Aus dem Englischen von Ralf Pannowitsch
Für meinen Großvater, dem Bücher so wichtig waren wie niemandem sonst, den ich kenne.
(Er hätte mit Ihnen geschimpft, wenn Sie Eselsohren in diesen Band gemacht hätten – aber keine Angst, ich habe nichts dagegen.)
INHALT
VORBEMERKUNG DER AUTORIN
SICHERHEITSHINWEIS
KARTE
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
EPILOG
DANK
IMPRESSUM
VORBEMERKUNG DER AUTORIN
Ich habe diese Geschichte so gut und so ehrlich erzählt, wie ich es vermag. Einige Orte habe ich miteinander getauscht, Namen verändert und gelegentlich mehrere Begegnungen zu einer verschmolzen, um die Privatsphäre der Menschen zu schützen, aber ansonsten ist das, was Sie lesen werden, alles wahr. Das menschliche Erinnerungsvermögen ist bekanntlich fehlbar, aber ich schildere die Reise, die ich unternommen habe, die Menschen, denen ich begegnet bin, und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, so, wie ich sie heute wahrnehme. Es sind größtenteils Erinnerungen, die mir für immer lieb und teuer sein werden.
SICHERHEITSHINWEIS
Dieses Buch berichtet davon, wie sich jemand ganz ohne Erfahrung oder Kompetenz durch ein großes Abenteuer hindurchgewurschtelt hat. Es erzählt von einer Idee, die Wirklichkeit wird, ohne dass man einen blassen Schimmer davon hat, was man eigentlich tut. In den meisten Fällen halte ich das für eine gute Herangehensweise. Ich habe meine Zweifel, ob überhaupt jemand wirklich immer weiß, was er eigentlich tut – oder ob es von außen nur so scheint.
Neulich hörte ich mir eine Folge des Podcasts Real Talk Radio an. Der Studiogast schilderte den Weg, der ihn vom Alkohol weggeführt hat. Er sagte: »Du musst nicht schon an Tag eins superstark sein, um bei Jahr zehn anzukommen.« Dieser Satz ist mir im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, dass wir eine solche Haltung auf viele Dinge übertragen können. Man muss eigentlich nur genug wissen, um über den ersten Tag zu kommen oder um den ersten Schritt zu tun. Der Rest ergibt sich dann oft unterwegs. Wenn man immer erst wartet, bis man sich zu 100 Prozent bereit fühlt, kommt man am Ende wahrscheinlich überhaupt nicht vom Fleck.
Eine Einschränkung möchte ich aber trotzdem machen: Wenn Sie vorhaben, eine Menge Zeit unter freiem Himmel zu verbringen, sollten Sie unbedingt lernen, wie man eine Landkarte richtig liest. Das ist kein hübsches Extra, sondern eine absolute Grundbedingung – besonders wenn Sie allein unterwegs sein werden, an abgelegenen Orten und bei widrigen Wetterbedingungen. Auf den folgenden Seiten wird es viele Geschichten geben, die von meiner Unfähigkeit zeugen, eine Karte zu lesen. Nicht nur, dass es meine Reise weitaus schwieriger machte als nötig – es war einfach nur blöd. Zugegeben, am Ende habe ich oft viel Glück gehabt – was manchmal für ein paar lustige Geschichten gesorgt hat –, aber es hätte auch ganz anders ausgehen können.
Kaufen Sie sich eine Landkarte und einen Kompass und lernen Sie, wie man damit umgeht. Es ist nicht so schwer, wie Sie vielleicht denken. Und haben Sie immer eine Taschenlampe griffbereit, wenn auch nur das kleinste Risiko besteht, dass Sie in die Dunkelheit hineingeraten.
So, das war’s mit der Sicherheitsunterweisung. Es ist Zeit, mit der Geschichte loszulegen!
KAPITEL 1
Es war Anfang März an einem nicht weiter nennenswerten Dienstag; ich war bei der Arbeit und schaute auf eine Straßenkarte von Großbritannien. Ich wollte herausfinden, ob wir einem Kunden in den schottischen Highlands etwas liefern konnten. Damals arbeitete ich für eine kleine Londoner Firma. Es war mein erster Job nach dem Studium, und ich hasste ihn!
Ich mochte meine Kollegen. Ich mochte das Feierabendbier am Schreibtisch freitags um 17 Uhr. Ich mochte es, anderen Leuten zu erzählen, dass ich für ein cooles, junges Start-up-Unternehmen arbeitete. Aber jeden Morgen aufzustehen und zur Arbeit zu fahren? Und der Gedanke, all dies Tag für Tag und bis in alle Ewigkeit tun zu müssen? Es ist mir ein bisschen peinlich, das auszusprechen, denn es ist so ein himmelschreiendes Klischee, aber die Vorstellung war echt niederschmetternd und, ehrlich gesagt, unerträglich für mich.
Als ich an jenem Nachmittag vor meinem Schreibtisch saß, ließ ich meine Gedanken schweifen. Ich fragte mich, ob jemand schon einmal die gesamte britische Insel am Küstensaum umrundet hatte. Nicht unbedingt als Läufer, sondern mit dem Rad, im Auto, zu Fuß – wie auch immer. Ich machte die Lieferung fertig, beendete meine Schicht, nahm den Nachtbus, betrat mein WG-Zimmer und ging ins Bett. Als ich am Morgen aufwachte, war der Gedanke immer noch da.
Gab es Leute, die unsere Insel schon mal komplett umrundet hatten? Hatten sie es in einem Ritt getan? Und waren sie dabei allein gewesen?
Nach diesem ersten Schimmer einer Idee ging sie mir nicht mehr aus dem Kopf, und ich begann ernsthaft, darüber nachzudenken. Ich studierte die Küste Großbritanniens und stellte – noch bevor ich mit anderen darüber redete – ein paar Nachforschungen an. So erfuhr ich, dass erst sehr wenige Menschen um die ganze Insel spaziert, geradelt oder gesegelt waren, aber offensichtlich hatte sie noch nie jemand im Laufschritt umrundet. Interessant, dachte ich.
Und da senkte sich ein winziges Samenkorn in mich ein: Wenn nun ich dieser Jemand wäre?
———
Als mir diese Idee kam, war ich seit wenigen Monaten mit Greg zusammen. Es war eine aussichtslose und sehr ungesunde Beziehung, eine Art Rohrkrepierer – wenn man das mal so sagen darf –, aber zu jener Zeit war Greg meine Bezugsperson in Sachen Abenteuer. Ich hatte ihn ein Jahr zuvor auf einem Festival für Outdoor und Reisen kennengelernt, und danach waren wir einander auf Twitter gefolgt. Wir schrieben uns eine Weile, und als ich meinen Hochschulabschluss hatte und nach London gezogen war, begannen wir, uns zu treffen, und verbrachten die Abende damit, Händchen haltend durch Covent Garden zu spazieren und in Kettenrestaurants zu essen.
Greg lebte ein paar Stunden von London entfernt, und wir sahen uns nicht oft, aber wir schickten uns jeden Tag Hunderte Nachrichten. Er hatte so viele riesengroße Träume und Pläne und Ideen, und es war aufregend, mit ihm zusammen zu sein. Von alledem berichtete er mir auf eine Weise, die mich begeisterte und in mir den Wunsch weckte, auch solche Abenteuer erleben zu wollen. Niemand verlangte von mir, mich mit meinem Leben zufriedenzugeben – ich konnte einfach rausgehen und etwas Neues anstoßen. Er öffnete mir die Augen für die Outdoor-Community, für Leute, die wahnwitzige und abenteuerliche Reisen unternahmen, Reisen, bei denen es auf ihre eigene Muskelkraft ankam. Über ganze Kontinente laufen, Ozeane mit Segelbooten überqueren, per Rad einmal um den Erdball fahren … Als ich diesen Leuten, die auch nur so waren wie ich (ja, echt!), im Internet folgte, kam mir der Gedanke: Lag es vielleicht nicht völlig außerhalb meiner Möglichkeiten, so etwas selbst einmal zu versuchen?
Aber mit Greg zusammen zu sein, war nicht nur eine Freude. Meistens war es sogar ziemlich schrecklich. Im Laufe der Monate keimte in mir der Verdacht, dass die Dinge, die er mir erzählte, vielleicht nicht immer ganz der Wahrheit entsprachen. Nichts schien so richtig zu stimmen – egal ob es darum ging, was er zum Frühstück gegessen hatte oder um seine Arbeitsstelle, um Geschichten über seine Familie und seine Freunde, den Swimmingpool, den er offenbar im Garten hatte, die Geschäfte, denen er nach eigenen Angaben nachging, die Promis, mit denen er angeblich seine Zeit verbrachte … Seine Version der Geschehnisse passte nie so recht zu meiner (und anscheinend auch nicht zu der aller übrigen Leute). Zuerst erklärte ich mir das mit bloßen Missverständnissen, aber nach einer Weile fühlte ich mich, als würde ich langsam verrückt werden. Ich lebte in einem dichten Nebel und fand aus ihm nicht heraus, um die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich waren.
Es ist verwirrend, auf diese Zeit zurückzublicken. Unsere ganze Beziehung war durch und durch erbärmlich, aber wenn mir Gregnicht die Augen für all diese Abenteuer und Chancen eröffnet hätte und wenn ich nicht wild darauf gewesen wäre, ihn zu beeindrucken (so ungern ich das heute auch zugebe), hätte ich es vielleicht nicht gewagt, mich auf den Weg zu machen und um ein ganzes Land zu rennen. Hätte ich ohne ihn überhaupt den Wunsch danach verspürt? Da bin ich mir nicht sicher.
Ist es die Sache wert, Monat für Monat in Bussen und Zügen zu weinen, sich an der Schulter von Freunden oder im Pub auszuheulen, ganz außerstande, dieses ungreifbare Gefühl von Scheitern und Unzulänglichkeit und heilloser Verwirrung abzuschütteln, wenn man dafür mitten in dieser Lage die beste Entscheidung seines Lebens trifft? Ist es die Sache wert, sich selbst über ein ganzes Jahr hinweg oder noch länger vollkommen zu verlieren, wenn das am Ende dazu führt, dass man etwas in Angriff nimmt, worauf man so stolz ist wie auf nichts sonst?
Ich habe viel darüber nachgedacht und bin mir immer noch nicht sicher. Aber so ist es gewesen.
———
Greg war der Erste, dem ich etwas von meiner Idee sagte. Eines Morgens auf dem Weg zur Arbeit schickte ich ihm eine Nachricht und teilte ihm mit, dass mir etwas im Kopf herumging.
»Es sind ungefähr 8000 Kilometer«, tippte ich. »Vielleicht kann ich es in ein paar Jahren schaffen? Ich müsste mir ein bisschen Geld zusammensparen und ordentlich trainieren. Na ja, und ich müsste mir erst mal klar darüber werden, was ich da eigentlich vorhabe. Aber in ein paar Jahren könnte ich es vielleicht machen? Was meinst du?«
»Starte im November«, antwortete er. »Lauf in sechs Monaten los, oder du wirst es nie tun.«
Ja, okay. Dann soll es so sein.
Heute sind die Erinnerungen an Greg in der Schachtel »Sehr negative Erfahrungen« sicher verwahrt. Es dauerte eine Weile, aber nun ist der Deckel geschlossen. Mir fällt es schwer, auf jene Zeit zurückzublicken und all die Traurigkeit zu durchsieben, um irgendetwas Positives herauszufischen. Aber wenn ich mich wirklich bemühe, objektiv zu urteilen, dann hat Greg eines richtig gemacht. Hätte er mir nicht gesagt, ich solle schon bald aufbrechen, und hätte ich ihm nicht so bereitwillig zugestimmt, dann würde ich heute bestimmt nicht hier sitzen und diese Geschichte aufschreiben. Hätte ich länger gewartet und mir die Zeit für alle möglichen Vorbereitungen gegönnt, dann wäre ich niemals losgelaufen.
Sechs Monate – das sollte doch reichen, oder? Ich verließ die allzu teure Wohnung, die ich mir mit einer Freundin teilte, und nahm mir stattdessen ein Zimmer in einem Haus mit sechs anderen Bewohnern. Ich dachte, allein die Ersparnisse daraus würden ausreichen, um einmal um die Küste zu kommen. (Wie sich herausstellen sollte, lag ich damit falsch, sehr falsch sogar, aber davon können wir später reden.) Sechs Monate reichten auch locker für die Anschaffung von ein wenig Ausrüstung und einen genaueren Blick auf ein paar Landkarten. Und vielleicht, um zu lernen, wie man eine lange Distanz läuft – was ich bisher noch nie getan hatte.
Der erste November. Das klang gut. Auch wenn es bedeutete, dass ich genau in einen trostlosen englischen Winter hineinlief – das Datum stand.
Als Nächstes erzählte ich es meinen Eltern, die ein wenig irritiert zu sein schienen. Ich bin sicher, sie dachten, es sei bloß eine weitere von meinen vielen lächerlichen Ideen, die sowieso nie verwirklicht würden. Und ich kann es ihnen nicht verübeln. Damals rief ich sie so ziemlich jeden Tag an, um ihnen meine allerneuesten Karrierepläne zu verkünden: Bankerin, Agentin beim MI5, Sozialarbeiterin, Bäckerin, Physiotherapeutin … Und nun stand halt wieder was Neues auf der Liste.
Danach erzählte ich es meinem Chef und meinen besten Freunden. Wir waren ausgegangen und saßen spätabends in einem Biergarten, als es aus mir einfach herausplatzte. Sie nahmen es vermutlich als eines meiner seltsameren Bekenntnisse unter Alkoholeinfluss auf, und das sagt schon eine Menge. Sie hielten es ganz eindeutig für einen lächerlichen Plan. Am verwirrtesten war allerdings mein Bruder Chris. Er war die Sportskanone in unserer Familie und hatte, seit er acht war, an Laufwettkämpfen teilgenommen. Ein Vorhaben wie dieses hatte er wirklich nicht kommen sehen.
Es gab, glaube ich, niemanden, dem es wie der logische nächste Schritt in meinem Leben vorkam.
Wissen Sie, ich hatte nicht die geringsten Voraussetzungen, um einen 8000-Kilometer-Lauf in Angriff zu nehmen. Schon wenn ich diese Zahl hinschreibe, klingt sie für mich brutal – noch heute, wo ich das Ganze ja bewältigt habe. Wenn ich den Leuten davon erzähle, bekommen sie sofort ganz falsche Vorstellungen von meinen sportlichen Fähigkeiten. Nein, sage ich ihnen, im Ernst, ich bin wirklich keine besonders gute Läuferin, und damals war ich es erst recht nicht. Es klingt wie falsche Bescheidenheit, und trotzdem ist es wahr.
Als ich beschloss, einmal rund um mein Land zu rennen, hatte ich erst drei Jahre zuvor mit dem Laufen begonnen. Am Neujahrstag 2013 hatte ich mich zusammen mit meiner Cousine hingesetzt, um ein paar gute Vorsätze aufzuschreiben, und zu meinen gehörte, dass ich einen Halbmarathon laufen wollte. Das kam mir wie eine unermesslich lange Distanz vor. Allein der Gedanke daran, nonstop mehr als zwei Stunden zu rennen … Ich konnte mir echt nicht vorstellen, dass meine Beine jemals dazu imstande sein würden.
Ich war total fixiert auf das Wörtchen »nonstop«, was ein bisschen kurios ist, denn beim Ultrarunning und besonders bei Abenteuer-Laufprojekten sind die Pausen mit am wichtigsten. Man hält an, um ein Foto zu machen, ein Sandwich zu verdrücken, die Wasserflasche aufzufüllen, einen Snack zu knabbern, ein paar Worte mit jemandem zu wechseln, die Landkarte zu studieren und erneut etwas zu futtern. Eigentlich ist es ein bewegliches Picknick. Aber damals waren all meine läuferischen Großtaten geprägt von der Idee, bloß niemals anzuhalten.
Zu jener Zeit lebte ich in Schweden, denn ich absolvierte mein Auslandsstudienjahr in Göteborg, und im Winter hingen die Temperaturen meist bei minus zehn Grad oder noch weniger fest. Ich hatte keine angemessene Joggingausstattung, und da Skandinavien berühmt-berüchtigt für seine hohen Preise ist, konnte ich mir auch keine leisten. Und so startete ich zu meinem ersten Lauf Anfang Januar mit zwei übereinandergezogenen alten Baumwollleggings, einem Sweatshirt aus dem Secondhandladen, einer unförmigen Regenjacke und pinkfarbenen Strickhandschuhen. Ich hatte nicht mal eine Digitaluhr, geschweige denn irgendein GPS-Gerät. Es gibt ein Foto davon, wie ich im März irgendwo meinen ersten 10000-Meter-Lauf absolviere: Ich trage jenes verwaschene alte Sweatshirt und blinzle durch den Schweiß in meinen Augen auf das Ziffernblatt meiner Uhr, um zu sehen, ob ich es in weniger als einer Stunde schaffen würde.
Von Anfang an fühlte ich, dass mir das Laufen schwerfiel, und doch wohnte ihm auch ein gewisser Zauber inne. Es war die Art und Weise, wie Unmögliches mit einem Mal möglich werden konnte – so spürbar, so rasch, direkt vor meinen Augen, nur mit ein wenig Anstrengung. Niemals sonst hatte ich eine solche Erfahrung gemacht. Ich konnte nicht einen Kilometer laufen, und dann konnte ich es doch. Ich schaffte keine fünf Kilometer, und dann gelang es mir doch. Ich begann, wie besessen Texte übers Laufen zu lesen, und meine Ambitionen überstiegen bei Weitem mein Talent. Bevor ich auch nur meinen ersten Halbmarathon hinter mich gebracht hatte, malte ich mir bereits aus, wie ich Marathons und sogar Ultramarathons lief. Das ist schwer zu erklären: Es fühlte sich rundum lächerlich an und zugleich ganz und gar unvermeidlich.
Wenn ich mich dem Training nur mit dem gleichen Enthusiasmus gewidmet hätte, wie ich Texte übers Laufen las und mit anderen über dieses Thema sprach! Im Oktober stand ich plötzlich an der Startlinie für den Great Birmingham Run, und dabei war ich seit Monaten kaum gelaufen. Ich kam irgendwie durch – ohne Zwischenstopp, was natürlich das Allerwichtigste war – und war in Gedanken schon bei einem Vollmarathon. Ich erzählte den Leuten, ich wolle es tun, um Geld für einen wohltätigen Zweck einzuwerben, aber in Wahrheit ging es mir vermutlich bloß darum, aller Welt mitteilen zu können, dass ich einen Marathon laufen würde. Und ganz eindeutig war mein Wunsch, den anderen erzählen zu können, dass ich es geschafft habe, viel größer als mein Wunsch, den Marathon wirklich zu laufen – was zugegebenermaßen keine besonders ehrenwerte Motivation ist.
Beweggründe hin oder her, ich meldete mich jedenfalls für den Milton Keynes Marathon im folgenden Mai an – also nicht mal anderthalb Jahre nach meinem Neujahrsentschluss, gut sechs Monate nach dem ersten Halbmarathon und – obwohl ich es damals nicht hätte vorhersehen können – 18 Monate, bevor ich mich daranmachte, ungefähr 200 Marathons rund um Englands Küsten zu rennen. Wenn ich auf diese Zeitskala zurückschaue, wird mir klar, weshalb jeder ein wenig verwirrt war, wenn er von meinem Plan hörte.
Als der Morgen des Marathons dämmerte, hatte ich erst drei Tage zuvor meine Abschlussarbeit an der Universität eingereicht. Ich hatte praktisch eine ganze Woche in der Bibliothek gesessen und von Gummibärchen, Energydrinks und Hamburgern gelebt, und nun hatte ich auch noch einen leichten Kater, weil wir ausgegangen waren, um die Fertigstellung zu feiern. Ich hätte nicht sagen können, wann ich das letzte Mal gejoggt war. Auf der Fahrt zum Wettkampf hörten wir die Lieblings-Country-CD meines Vaters, und Me and Bobby McGee tönte aus den Lautsprechern. Wie Kenny Rogers sang, war Freiheit nur ein anderes Wort dafür, dass man nichts mehr zu verlieren hatte. Das fühlte sich in meiner Lage passend an.
Um es noch schlimmer zu machen, war ich als purpurfarbener Crayola-Farbstift angezogen. Mein Dad hatte sich nur widerstrebend meinen inständigen Bitten gebeugt, einen ausgefallenen Dress anzuziehen, damit wir mehr Geld einwerben könnten. Nun trug er Feenflügel und ein Ballettröckchen.
Ich war noch nie so weit gerannt, dass ich mir einen Wolf gelaufen hätte. Ich hatte keine Ahnung von Energiezufuhr und versuchte stattdessen, die ganze Strecke nur mit Wasser zu bestreiten. Satte zwölf Kilometer des Rennens legte ich schluchzend und im Gehen zurück, und ein kleines Kind rief mir aus der Menge »Heulstift! Heulstift!« zu. Damit hatten die hämischen Zurufe aber noch kein Ende: Als ich auf der für den Marathon abgesperrten Fahrspur einer Schnellstraße lief (Nebenbemerkung: Wenn Sie keine Schnellstraßen und Kreisverkehre mögen, kann ich Ihnen den Milton Keynes Marathon nicht unbedingt empfehlen), schrien junge Männer aus den Fenstern eines vorbeifahrenden Autos: »Lauf, Dicke, lauf!« Das hatte ich wirklich nicht noch gebraucht. Und als ich mich dem Schlusskilometer näherte, deutlich mehr als fünf Stunden nach dem Start, sprintete jemand mit Flip-Flops an mir vorbei.
Es war keine angenehme Erfahrung und ganz gewiss keine, die in jemandem den Wunsch erwecken könnte, alles aufzugeben, um zehn Monate seines Lebens nichts anderes zu tun, als zu laufen.
Als ich damit begann, den Leuten von meinem blöden Plan zu erzählen, eine Runde ums Land zu rennen, wartete ich nur darauf, dass mich jemand mit der Wahrheit konfrontierte. »Du Hochstaplerin!«, würde man mir sagen. »Was für eine maßlose Selbstüberschätzung! Du hast doch mit Müh und Not einen Marathon auf die Reihe gekriegt! Du bist der heulende Buntstift! Was bringt dich dazu, auch nur die Idee in Betracht zu ziehen, du könntest das tun? So etwas hat vor dir noch niemand gemacht – wieso glaubst du, dass es überhaupt möglich ist?«
Heute lebe ich in einer Blase von Leuten, die jede Minute ihrer freien Zeit damit verbringen, irrwitzige Läufe zu absolvieren, bei schrecklichem Wetter Berge zu erklimmen und per Rad Tagestouren mit dreistelligen Kilometerzahlen zu absolvieren. Damals aber gab es unter meinen Freunden niemanden, der solche Dinge tat. Einige Monate vor meinem Starttermin im November sah ich auf Facebook einen Beitrag von Dave Cornthwaite, der Unbekannte dazu einlud, mit ihm in den Wäldern zu campen. Dave ist vor allem für seine »Expedition1000« bekannt. Bei diesem Projekt wollte er 25 Reisen von mindestens 1000 Meilen Länge (also etwa 1600 Kilometern) mit jeweils verschiedenen nicht motorisierten Transportmitteln unternehmen. In jenem Jahr aber gönnte er sich einen Sommer Auszeit vom Abenteurertum und wollte den Namen, die er in der Liste seiner Facebook-Follower sah, endlich ein paar Gesichter zuordnen. Hier keimte eine Gemeinschaft, die zum Yes Tribe heranwachsen sollte, der inzwischen mehr als 16000 Mitglieder hat.
Und so packte ich an einem windigen Freitagabend im Juni einen Rucksack mit einem riesengroßen und schweren Schlafsack und einer alten Schaumstoffmatte und brach auf, um die Nacht zusammen mit komplett fremden Leuten im Wald zu verbringen. Es klang nach einer tollen Gelegenheit, ein paar Menschen zu treffen, die vielleicht nicht denken würden, dass ich völlig den Verstand verloren hatte. Ich gebe zu, dass es auch nach der Anfangsszene eines Horrorfilms klingt. Das dämmerte mir erst richtig, als ich in Wendover auf den Bahnsteig trat und eine Gruppe von Leuten erblickte, die dort mit Wandergepäck und Campingausrüstung herumstanden. Sie sahen zwar nicht wirklich wie Serienmörder aus – aber geben sich solche Killer nicht immer einen harmlosen Anstrich, um uns zu kriegen?
Spoiler: Es waren keine Serienmörder.
Wir stiegen einen Hügel hinauf, rollten unsere Biwaksäcke aus, und jemand entfachte ein Feuer. Als wir um die Flammen herumstanden und lauwarmes Bier aus Dosen tranken, bat uns Dave, von allen Abenteuern, die wir planten, und den Projekten, an denen wir gerade arbeiteten, zu berichten. So erinnere ich mich noch heute an die frühen Tage des Yes Tribe: ein Ort, an dem man aufregende und furchterregende Dinge mit anderen teilen kann, Dinge, die man unbedingt tun möchte, obwohl man weiß, dass man total ungeeignet dafür ist (oder vielleicht gerade deswegen). Als wir reihum berichteten, spürte ich, wie mein Puls in meinen Ohren wummerte, sodass ich beinahe taub war. Ich war sicher, dass mich die anderen schallend auslachen und aus dem Wald scheuchen würden. Neben Dave gab es unter ihnen noch andere echte Abenteurer mit einem ganz großen A, etwa Sean Conway, der kürzlich als erster Mensch einen Triathlon vom südenglischen Land’s End bis John o’Groats im äußersten Nordosten Schottlands absolviert hatte – er war einmal quer durchs Land gerannt, geradelt und geschwommen. Jawohl, geschwommen. Was würden sie sagen, wenn sie merkten, dass ich bloß eine dumme Gans war, die nicht mal einen Marathon laufen konnte, ohne rumzuheulen, und die jetzt vorhatte, rund um ein ganzes Land zu rennen? Es war einfach lächerlich.
Bald kam ich an die Reihe.
»Ich will einmal rund um Großbritannien laufen«, erzählte ich ihnen. »Ich glaube, dafür brauche ich etwa zehn Monate. Wahrscheinlich starte ich im November.« Und niemand lachte mich aus – im Gegenteil, sie machten mir jede Menge Mut. Natürlich hatte ich ihnen die Geschichte vom heulenden Farbstift verschwiegen und auch nicht gesagt, dass ich eigentlich gar keine Vorstellung von dem hatte, was ich tun wollte. Das mag mir zugutegekommen sein, aber trotzdem … Jeder hatte einfach nur freundliche Worte für mich übrig, und Dave fragte, wie ich dieses Abenteuer mit anderen teilen wolle. Darüber hatte ich noch nicht wirklich nachgedacht, aber als ich wieder zu Hause war, legte ich eine Facebook-Seite an. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, dass es eine große Sache war. Eine richtig große Sache. Eine Sache, die ich durchziehen würde.
Nicht jeder setzte so viel Vertrauen in mich.
Der September kam, und ich war bei Kilometer 30 meines ersten Ultramarathons, den ich mit meiner Freundin Sophie absolvierte. Wir steckten irgendwo in Hertfordshire. Sophie lief ein paar Meter vor mir, und ich stolperte ihr nach und versuchte, so zu weinen, dass sie es nicht mitbekam. Aus irgendeinem Grund hatten wir es nicht für nötig gehalten, uns ernsthaft vorzubereiten, obwohl ich dieses Rennen doch in Angriff genommen hatte, weil es einen wesentlichen Aufbaueffekt für meine Küstentour haben würde. Mein »Training« hatte aus ein paar Acht-Kilometer-Läufen und einem einzigen 25-Kilometer-Lauf in der Woche vor dem Wettkampf bestanden. Ich hatte jedoch einen Blog gelesen, in dem jemand davon sprach, ein 100-Kilometer-Rennen sei »Kopfsache«. Und so nahm ich an, dass auch ich dazu imstande sein würde. Womit ich falschlag. Sophie, die normalerweise viel fitter ist als ich und schon auf eine ganze Reihe von Wettkämpfen zurückblicken kann, zog diese Taktik wesentlich erfolgreicher durch. Das begann schon mal damit, dass sie nicht heulte.
Als ich so durch die Gegend wackelte, schrieb ich Greg eine SMS. Die Tatsache, dass ich beim Laufen Nachrichten abfasste, verrät Ihnen wahrscheinlich schon alles, was Sie über unser Tempo wissen müssen. »Ich schaffe es nicht«, schrieb ich ihm. »Ich möchte aufhören. Ich glaube nicht, dass ich noch wesentlich weiterkomme.«
Greg antwortete mir: »Wenn du bei diesem Rennen aufgibst, verheißt das bestimmt nichts Gutes für deinen Küstenlauf.«
Ich habe es schon gesagt: Wenn man endlich aufhört, jemanden durch rosarot gefärbte Brillengläser zu betrachten, fällt es schwer, all die schrecklichen Erinnerungen an diese Person zu durchforsten und die Situationen herauszupicken, in denen sie vielleicht aufrichtig war. Aber an diesem Tag hatte Greg vermutlich recht. Allerdings hörte ich solche Worte nicht zum ersten Mal. Einige Wochen zuvor hatte mich Sophies Freund bereits gefragt, warum ich glaubte, ich könnte einen zehn Monate langen Lauf durchhalten, wenn ich noch nicht einmal Lust hatte, für diesen einen Ultramarathon ordentlich zu trainieren. Es war eine angemessene Frage – und eine, auf die ich nicht wirklich eine Antwort hatte.
Beim nächsten Kontrollpunkt stieg ich aus. Er befand sich auf einem Friedhof, und ich setzte mich schluchzend auf den Boden, während auf der anderen Seite der Kirche gerade eine Trauung stattfand. Ich hatte mir so sehr gewünscht, diesen Wettkampf zu beenden und damit zu zeigen, dass ich es draufhatte. Ob man nun einen Ultramarathon mit den Beinen oder mit dem Kopf läuft – ich war ganz eindeutig in keinem von beiden stark genug.
In weniger als sechs Wochen wollte ich aufbrechen, um 8000 Kilometer zu laufen. Wenn ich dieses eine Rennen nicht zu Ende brachte, welche Aussicht hatte ich dann, mein großes Abenteuer zu bestehen?
———
Ich hatte mich nie für eine Heulsuse gehalten, aber in diesen paar Wochen vor meinem Start schien ich kaum etwas anderes zu tun, als zu weinen. Auf den Fotos von unserem allwöchentlichen Feierabendbier ist mein Gesicht so feucht, dass es beinahe verschwommen aussieht. Ich fuhr zum Yestival. Dieses Festival hatte Dave für den Yes Tribe aus dem Boden gestampft, nachdem unsere Truppe nach einem Sommer mit Zeltlagern und anderen Outdooraktivitäten stark angewachsen war. Auch auf dem Yestival heulte ich die meiste Zeit. Am Ende holte mich Dave auf die Bühne, wo ich allen erzählen sollte, was ich vorhatte. Plötzlich fühlte es sich sehr real an – und zutiefst erschreckend.
Es war einfach irrwitzig. Ich wusste, dass ich in der glücklichen Lage war, nur für eine Schnapsidee mein ganzes normales Leben zehn Monate lang pausieren zu lassen, aber es kam mir alles so fremd vor. Ich hatte selbst beschlossen, diese Sache durchzuziehen, niemand zwang mich dazu, und eigentlich hätte es total aufregend sein sollen. Ich spürte aber überhaupt keine freudige Erregung. Am liebsten hätte ich es mir doch noch mal anders überlegt, die Arbeit wiederaufgenommen und allen gesagt, dass es nur ein großer Irrtum gewesen sei. Das wäre natürlich peinlich, und meine Freunde hätten es mir nicht einfach so durchgehen lassen, aber noch peinlicher wäre vielleicht, nach einer Woche oder einem Monat auszusteigen? Bestimmt war es besser, das Gesicht zu wahren, indem man es gar nicht erst versuchte, als es ein bisschen auszuprobieren und sich dann eingestehen zu müssen, der Sache nicht gewachsen gewesen zu sein, oder?
Zwei Wochen vor dem Start hörte ich in meiner Firma auf. Ich zog aus meinem Londoner WG-Haus aus und brachte mein ganzes Zeug zurück zu meinen Eltern, wo ich auch die restlichen Tage bis zu meinem Aufbruch blieb. Ich glaube, ich wollte diese Zeit mit abschließenden Planungen verbringen, mit dem Ordnen meiner Ausrüstung; ich wollte mich ganz allgemein startklar machen. Tatsächlich aber tat ich nichts Sinnvolles. Eigentlich wusste ich auch gar nicht, was ich hätte tun sollen.
In den vergangenen Monaten hatte ich mehrmals vor einem weißen Blatt Papier gesessen und einen Plan aufstellen wollen, aber mir war, ehrlich gesagt, nicht klar, wie so ein Plan aussehen sollte. Damals hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie lange ich durchhalten würde, und so schien es mir auch sinnlos, irgendwelche Reiserouten aufzuschreiben. Und der Weg würde ja auch kein Problem sein – ich musste doch immer bloß so laufen, dass ich links von mir das Meer hatte, oder? Ich brauchte mir keine Impfungen abzuholen, keine Fremdsprachen zu lernen, mich nicht über neue Kulturen zu informieren und keine komplizierten logistischen Operationen vorzunehmen, um an den Start zu gehen. Ich musste nur aus meinem Elternhaus in Northampton gehen und einen Zug nach Greenwich nehmen, von wo ich loslaufen wollte. Um auf meiner neuen Website etwas posten zu können, nahm ich eine Karte von Großbritannien und zog mit aller Sorgfalt einen roten Strich einmal um die ganze Insel, immer entlang des Küstensaums. Dann setzte ich für den ersten Tag ein Facebook-Event an, falls irgendjemand sich mir anschließen wollte. Das war es auch schon. Erledigt.
Meine Mutter sagte mir in diesen Tagen oft, dass ihr die Zeit vor meiner Rückkehr nach Hause besser gefallen habe. Sie sah mich lieber in London; da musste sie nämlich nicht hautnah miterleben, wie chaotisch ich war. Während ich dies schreibe und auf jene Wochen zurückblicke, wird mir bewusst, dass sie vielleicht nicht ganz unrecht hatte. Seitdem habe ich mich in einen entschlossenen und leidenschaftlichen Planungsfreak verwandelt. Einen Fünf-Kilometer-Lauf im Park plane ich inzwischen gründlicher als damals meine zehnmonatige Reise. Ich bin schon ein bisschen erstaunt darüber, wie planlos damals alles verlief, aber in diesen Tagen sah ich wirklich nicht, was noch alles zu tun war.
———
Am Sonntag, dem 1. November, nahm ich den Zug nach London und wartete mit meinen Eltern vor dem National Maritime Museum. Wir wollten sehen, ob jemand aufkreuzen würde, um mit mir zu laufen. Meine Entscheidung, ausgerechnet dort zu starten, hatte nichts zu bedeuten. Ich hatte zu keinem Küstenort eine tiefere Beziehung und wusste, dass ich sowieso irgendwo die Themse überqueren musste. Da konnte ich auch gleich in London loslaufen. Ein Freund hatte mich darauf hingewiesen, dass das Museum mit seinem Bezug zum Meer ein passender Ort war, und so hatte ich meinen Entschluss gefasst.
Der Plan lautete, dass ich an jenem ersten Tag 25 Kilometer laufen wollte – von Greenwich nach Dartford. Einige Wochen zuvor hatte ich ja auf Facebook dazu eingeladen, mich auf meiner Anfangsetappe zu begleiten. Der Gedanke, dass sich irgendjemand dafür interessieren würde, kam mir ein wenig anmaßend vor, aber ich hatte den Leuten mit leichter Nervosität mitgeteilt, wir sollten uns um halb elf treffen, um genug Zeit zu haben, Dartford vor Einbruch der Dunkelheit zu erreichen, und für dringende Fälle meine Telefonnummer mit gepostet (was mir rückblickend wie ein selbst verursachter Verstoß gegen den Datenschutz vorkommt).
Es war einer der nebligsten Tage, an die ich mich erinnern kann. Wir konnten bloß zwei, drei Meter weit sehen, und eine halbe Stunde lang bekam ich Anrufe von Leuten, die offensichtlich ganz in unserer Nähe waren. »Wir sind hier, um dich zu verabschieden«, sagten sie, »aber wo bist du?« Sie waren so nahe, dass ich sie manchmal sogar hören konnte, und trotzdem bekamen wir uns nicht zu Gesicht. Ich hatte nicht erwartet, dass es derart herausfordernd sein würde, allein schon meinen Startpunkt zu finden. Aber vielleicht war es ja ein passendes Omen für das, was noch kommen sollte. Schließlich hatten uns alle gefunden, und wir hingen leicht verlegen eine Weile herum. Ich dachte, dass ich wohl etwas sagen müsste, wusste aber nicht recht, was.
Und dann liefen wir ohne großes Brimborium los. Siebzehn Leute begleiteten mich an jenem ersten Tag; dazu kamen noch meine Freundinnen Mimi und Harriet auf Kinderrollern, die sie in der Garage von Harriets Eltern gefunden hatten. Sie hielten ungefähr 100 Meter durch, bis sie es aufgaben und in einen Pub gingen – Rollerfahren ist offensichtlich anstrengender als Laufen.
Wir Übrigen liefen auf dem Themseweg weiter, der im Nebel gespenstisch still dalag; immer mit Kurs nach Osten rannten wir an einigen Klärwerken vorbei, das Kraftwerk von Barking stach auf der anderen Seite des Flusses aus dem Nebel hervor, und Einkaufswagen schaukelten auf dem Wasser. In der Zeit, die ich wohl lieber mit nützlichen Vorbereitungen hätte verbringen sollen, hatte ich etwas gebacken, und so pausierten wir auf halbem Wege, um selbst gemachten Rocky-Road-Kuchen und Haferriegel zu verzehren. Alle waren darüber erfreut, mal abgesehen von meinem Vater, der die Tupperware-Dosen hatte tragen müssen, als wäre er eine wandelnde Einmann-Verpflegungsstation. Hier und dort setzten sich Leute aus unserer Gruppe ab, weil sie zum warmen Abendessen nach Hause wollten, mit Freunden verabredet waren oder daheim noch Dinge zu erledigen hatten, ehe es am nächsten Tag wieder mit der Arbeit losging. Das wirkte alles ganz normal, und ich beneidete sie. Nie hätte ich gedacht, dass ich einmal auf jemanden neidisch sein würde, der an einem Sonntagnachmittag seine Wäsche macht.
Die Route, die ich vorgesehen hatte, verlief bis nach Erith an der Themse entlang und folgte dann der A206 bis nach Dartford. Weil dieser Abschnitt streng genommen kein Teil der Küste war, hatte ich keine allzu großen Skrupel, eine Abkürzung zu nehmen. (Wie ich in den nächsten Wochen entdecken sollte, machte mir das nie große Kopfschmerzen. Es gibt eine Menge Puristen, die immer der festgelegten Route folgen wollen, aber ich gehöre offensichtlich nicht dazu.) Eines kann ich wohl mit Sicherheit sagen: An einer zweispurigen Schnellstraße mit Mittelstreifen entlangzulaufen, hatte ich nicht unbedingt vor Augen gehabt, als ich mir die idyllischen Tage an der Küste ausgemalt hatte. Außerdem taten mir die Beine weh – 25 Kilometer wollen erst einmal gelaufen sein. Und mein Gepäck, das ich zum ersten Mal auf dem Rücken trug, hatte auf der Haut zu scheuern begonnen. Heute lache ich darüber, wie sehr ich damals über den dünnen roten Strich im unteren Rückenbereich jammerte. Ich ahnte nicht, was mich noch erwartete – in den nächsten zehn Monaten würde ein flammendes Inferno auflodern, das keine Wund- und Heilsalbe der Welt besänftigen konnte.
Aber ich hatte es geschafft! Tag eins meines Abenteuers war vorüber! Ich war unterwegs auf meiner Route! Ich hatte diese Sache in Angriff genommen! Nun gab es kein Zurück mehr!
Und nie zuvor war mir die ganze Idee so bescheuert vorgekommen.
KAPITEL 2
Auf der Welt gibt es eine Menge unglaublicher Orte. Schöne, exotische, betörende Orte. Atemberaubende Panoramen, faszinierende Landschaften, unwiderstehliche Pfade – alles durchdrungen von Geschichte und Kultur und einem Hauch von Wunder. Orte, bei denen man sich vorstellen kann, dass hier ein Abenteuer seinen Anfang nimmt.
Und dann gibt es Dartford. 109000 Einwohner, 29 Kilometer Luftlinie vom Londoner Zentrum, Geburtsort von 50 Prozent der Rolling Stones. Die Stadt ist dem Erfolg des nahe gelegenen Bluewater Shopping Center zum Opfer gefallen, und wenn man sie in einem Wort beschreiben müsste, dann mit diesem: »grau«. Und obwohl es all diese anderen erstaunlichen Orte gibt, die nur darauf warten, dass jemand des Weges kommt und sie erkundet, war doch ausgerechnet Dartford mein erstes Etappenziel.
Sieben aus unserer Truppe waren die ganze Strecke mitgelaufen, und nun beschlossen wir den Tag feierlich mit einem Abendessen in einer Filiale der Pub-Kette Wetherspoons, denn sonst schien nirgendwo etwas geöffnet zu haben. Diese erste Nacht verbrachte ich mit meinen Eltern im Holiday Inn, und irgendwie hatte alles den Abenteuerfaktor null. Am nächsten Morgen aßen wir das maximal mittelmäßige Rührei vom Frühstücksbuffet und fuhren, um Tag zwei zu beginnen, zurück zum Bahnhof, wo ich am Vortag mit dem Laufen aufgehört hatte. Es waren ja noch meine ersten Kilometer, und ich wollte nicht gleich das Gefühl bekommen, zwischendurch etwas ausgelassen zu haben.
———
Bevor es weitergeht, möchte ich noch eine kurze Erklärung einschieben. Ich habe ja schon gesagt, dass ich das Glück hatte, in einer Position zu sein, in der ich sogar mit dem Gedanken spielen konnte, meinen Job hinzuschmeißen, um ein Jahr lang durch die Gegend zu rennen – einfach nur, weil mir der Sinn danach stand. Ich war jung, ich hatte keine Verpflichtungen, und falls alles schiefgehen sollte, würde ich immer noch ein Elternhaus haben, in das ich zurückkehren konnte.
Es ist schwierig, über Glück zu reden. Oft höre ich jemanden sagen: »Je härter ich arbeite, desto glücklicher werde ich.« Das stimmt in gewissem Maße, aber ich spüre auch sehr deutlich, dass es jenes Sicherheitsnetz aus Privilegien ist, welches es möglich oder zumindest viel, viel einfacher macht, den Sprung ins Unbekannte zu wagen und etwas unheimliche, »mutige« Entscheidungen zu treffen. Man hat in der Lotterie das große Los gezogen, wenn man mit diesem Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit aufgewachsen ist, und ich bin sehr dankbar dafür, dass es in meinem Fall so war.
Meine Familie ist keineswegs besonders wohlhabend. Mein Vater ist Gärtner, und meine Mutter arbeitet in einem Café. Sie leben in den Midlands in einer Doppelhaushälfte mit Kieselputz an den Wänden. Ich ging in eine ziemlich miese öffentliche Schule, und in den Ferien fuhren wir fast immer nach Wales und übernachteten in Zelten, in die es reintropfte. Aber es ist unvorstellbar, dass ich jemals kein Bett hätte und kein Essen bekäme, wenn ich in mein Elternhaus zurückkehre. Wenn ich mal schlecht gewirtschaftet hatte und echt auf dem Trockenen saß, konnte ich zu Hause anrufen und meine Eltern bitten, mir aus der Klemme zu helfen. Mein Vater konnte mich nur retten, weil er immer sehr genügsam gelebt hat und mit Geld umgehen konnte. Vielen Menschen ist es aber gar nicht möglich, etwas beiseitezulegen. Egal wie umsichtig sie auch sind und wie viele Coffees to go oder Avocados sie nicht kaufen – es bleibt einfach nichts übrig als Beweis dafür, dass sie gut mit Geld umgehen können.
Mit all diesen Gedanken im Hinterkopf finde ich es wirklich empörend, dass manche Leute unglaubliche Reisen unternehmen, von denen andere nur träumen können, und dann nichts Besseres zu tun haben, als herumzujammern und die schwierigen Momente melodramatisch aufzubauschen. Aber die Sache soll doch Spaß machen! Ihr habt es euch selbst ausgesucht! Genießt es! Hört auf mit dem Jammern! Wisst ihr denn nicht, was für ein Glück ihr habt?
Und trotzdem … trotzdem war es manchmal einfach scheußlich. Neben all den guten Erlebnissen gab es auch viele Augenblicke, in denen ich fror, mich einsam fühlte und Angst hatte. Ich möchte diese Geschichte wahrheitsgetreu und unbeschönigt erzählen, aber bitte glauben Sie mir: Selbst wenn ich darüber klage, dass ich drei Monate lang nasse Füße hatte, war mir doch stets bewusst, wie glücklich ich mich schätzen konnte, überhaupt auf dieser Reise zu sein. Harte Arbeit spielt ganz sicher eine Rolle, aber Zufall und Glück sind viel entscheidender.
———
Nun aber zurück zu Tag zwei.
Ich gebe zu, dass es vermutlich nicht okay ist, mit 23 Jahren in einem Parkhaus einen Wutanfall zu bekommen (eigentlich ist es schon jenseits des zehnten Geburtstags daneben). Und doch ertappte ich mich genau dabei. Ich hatte an jenem Tag nur etwa zehn Kilometer zu laufen, bis nach Gravesend. Mein Weg führte mich immer an der Themse entlang, bis ich nach einigen Tagen – hoffentlich – das Meer erreichen würde.
Am Vortag war ich nur mit der Hälfte meines Gepäcks unterwegs gewesen, da meine Eltern das restliche Zeug schon mit dem Auto an den Zielort gebracht hatten, ehe sie zurückgekommen waren, um mit mir gemeinsam zu laufen. Jetzt, im Parkhaus des Dartforder Bahnhofs, versuchte ich zum ersten Mal, mein ganzes Gepäck zu verstauen. Ich hatte meinen Rucksack nur deshalb ausgewählt, weil die Abenteuerreisende Anna McNuff kürzlich mit genau dem gleichen von einem Ende Neuseelands zum anderen gelaufen war. Sie wusste offensichtlich, was sie tat, und so hatte ich die Ausrüstungsliste, die sie in ihrem Blog gepostet hatte, schamlos und beinahe bis ins letzte Detail übernommen. Vor jenem ersten Tag war ich allerdings noch nie mit dem Rucksack gerannt, und noch weniger hatte ich geübt, alle meine Siebensachen hineinzustopfen.
Ich will jetzt nicht so tun, als hätte dahinter irgendeine Logik gesteckt – ich war damals schlicht und einfach nicht gut organisiert. Und doch bin ich fest überzeugt, dass meine Unwissenheit in diesem Fall ein Segen war. Mit einem schweren Rucksack zu rennen, ist nämlich ziemlich hart: Es fühlt sich an, als würde man durch Sirup laufen; es zieht einen runter und scheuert den Rücken wund. Gott sei Dank hatte ich nie Trainingsläufe mit Gepäck gemacht und all dies nicht schon vor meinem Start herausgefunden.
Letztendlich war es wohl sogar gut, dass ich in jenem Parkhaus hockte und versuchte, auch meinen Schlafsack noch in den Rucksack zu zwängen. Es war eine Arbeit für zwei: Ich presste den Inhalt des Rucksacks nach unten, während meine Mutter versuchte, die Schnur festzuziehen und einen Knoten zu machen. Das klappte nicht gerade gut, und obwohl es ganz und gar nicht die Schuld meiner Mutter war, musste sie den größten Teil der Vorwürfe einstecken. Ich aber konnte nur an eines denken: Wie froh wäre ich gewesen, jetzt nicht hier sein zu müssen!
»Ich will das alles nicht«, schrie ich meine Mutter, meinen Vater oder eigentlich niemanden konkret an. »Ich will einfach nur nach Hause!«
Ich stampfte durch das Parkhaus davon (und war mir, ehrlich gesagt, nicht sicher, welche Richtung ich gerade einschlug). Dann marschierte ich schnurstracks über eine Grünfläche voller Brennnesseln – und humpelte mit geröteten Knöcheln und angeknackstem Ego zurück.
»Ich will das alles nicht«, sagte ich noch einmal, diesmal allerdings schon ruhiger.
»Musst du ja auch nicht«, entgegnete mein Vater. »Du kannst doch einfach mit uns nach Hause kommen.«
Aber das konnte ich nicht. Es ist sowieso schon ziemlich seltsam, dramatisch den Job hinzuwerfen und sämtlichen Freunden und Bekannten zu verkünden, dass man einmal rund um ein ganzes Land rennen will. Zumindest wenn man nicht mal ein sehr guter Läufer ist. Da war es keine Option, sich schon am zweiten Tag geschlagen zu geben. Ich mag meine Freunde sehr, aber sie sind nicht dafür bekannt, übergroßes Verständnis für blödsinnige Entschlüsse zu zeigen. Wenn ich jetzt nach Hause gefahren wäre, hätte ich das nie wieder ausbügeln können.
Vielleicht nur, um das Gesicht zu wahren, hievte ich also schließlich den Rucksack hoch (meine Mutter hatte ihn, während ich meinen Trotzanfall auslebte, dazu überreden können, sich zu schließen) und setzte einen Fuß vor den anderen, bis ich in Gravesend ankam. Meine Eltern liefen mit, und ich klagte und jammerte die ganze Zeit – wirklich eine Freude für alle Beteiligten.
Wir gingen zusammen einen Kaffee trinken, und dann machte sich meine Mutter auf, um einen Tennisball für mich zu kaufen. Jemand hatte uns erzählt, das sei ein absolut wichtiger Ausrüstungsgegenstand und wirke wie eine tragbare Faszienrolle. Stattdessen kam sie mit einem Quietschehund zurück (offenbar hatte sie nichts finden können, das einem Tennisball ähnlicher sah), und dann mussten wir uns auch schon trennen. Meine Eltern nahmen den Zug zurück nach Dartford, wo sie ihr Auto geparkt hatten; dann würden sie nach Hause fahren und morgen wieder bei der Arbeit sein. Zurück im normalen Leben.
Ich aber konnte mein Abenteuer noch nicht abbrechen, ich musste wenigstens einen Versuch wagen, obwohl ich am liebsten mit ihnen nach Hause gefahren wäre.
———
Ich hatte mir vorgenommen, unterwegs immer zu zelten, und zwar aus zwei Gründen:
Ich dachte einfach, das macht man bei einem Abenteuer so, und
etwas anderes hätte ich mir gar nicht leisten können.
Dave hatte mir großzügig angeboten, mir für die Dauer meiner Reise sein Zelt zu leihen – ein superleichtes Nordisk für eine Person, das gerade mal gut 800 Gramm wog. Ich gab ein hübsches Sümmchen für einen Schlafsack aus, dessen Hersteller behaupteten, er werde mich bei Temperaturen bis zu minus zwei Grad warm halten, und dachte darüber nicht mehr groß nach.
Nachdem ich mir schon ihre Ausrüstungsliste geklaut hatte, freundete ich mich mit Anna McNuff an, die durch ganz Neuseeland gelaufen war. Eines Abends nach der Arbeit traf ich mich mit ihr auf einen Kaffee. Es war ein paar Wochen vor meinem geplanten Starttermin. Sie fragte mich mit großem Interesse nach all meinen Plänen und wirkte ziemlich entsetzt, als sie erfuhr, dass ich eigentlich noch gar keine hatte, vom allerersten Tag mal abgesehen. Sie nahm ihren Laptop heraus und machte sich daran, mir bei der Planung des ersten Monats zu helfen. Mit Feuereifer begann sie, Tabellen auszufüllen, und sah dabei echt effizient aus, während ich neben ihr saß und mich ein wenig benommen fühlte.
Anna war nicht nur einmal längs durch Neuseeland gerannt (die Bräunungsstreifen und die Scheuermale waren immer noch sichtbar), sondern sie war in sechs Monaten auch durch alle 50 Bundesstaaten der USA geradelt, und das war nur die Spitze des Eisbergs in ihrem an beeindruckenden Heldentaten reichen Lebenslauf. Sie ist Abenteuern ganz eindeutig nicht abgeneigt. Anna erzählte mir, man solle sich, wenn man einen Schlafplatz für die nächste Nacht sucht, am besten nach einem Hügel umschauen. Wir sahen auf der Karte einen Plum Pudding Hill, und sie meinte, das könne doch ein guter Schlafplatz für die zweite oder dritte Nacht sein. Ich stimmte ihr sofort zu, ohne zu bedenken, dass ich noch nie allein wild gezeltet hatte und eine vermutlich irrationale, aber doch sehr handfeste Angst vor Serienmördern hegte. Man weiß ja, dass Serienmörder es lieben, an menschenleeren Küstenpfaden zu lauern und auf die 1:10000000-Chance zu warten, dass alle Jubeljahre mal eine einsame Läuferin vorbeikommt und beschließt, ausgerechnet hier zu zelten.
Anna sagte mir auch, ich solle auf all die Freundlichkeit gefasst sein, die mir unterwegs ganz sicher begegnen werde. Fremde, die mich zu sich nach Hause einladen, die meilenweit fahren, um mir eine Kleinigkeit zu essen zu bringen, die sich stundenlang über Landkarten beugen und mir freudig ihre Hilfe dabei anbieten, die beste Route durch ihre Gegend zu finden. Natürlich vertraute ich Anna, aber glauben konnte ich es ihr trotzdem nicht. So was passiert doch nicht in Großbritannien, dachte ich bei mir. Solche Dinge geschehen in anderen Ländern, aber doch nicht bei mir um die Ecke.
Aber sie sollte recht behalten, und eigentlich hatte es ja auch schon begonnen. Hatte Dave mir nicht sein Zelt geliehen? Opferte Anna mir nicht einen freien Abend, um mich zu beraten? Es dauerte aber noch einige Wochen, bis ich mir eingestand, dass sie wirklich wusste, wovon sie sprach.
———
An einem sonnigen Samstag im Sommer vor meiner Reise wanderte ich mit Greg durch die South Downs.
Bald nachdem ich aller Welt von meinem bevorstehenden großen Abenteuer erzählt hatte, hatten wir uns wegen irgendeiner Sache überworfen und mehrere Monate nicht miteinander gesprochen. Es war zu einem Streit gekommen, ich weiß nicht mehr, weshalb. Wahrscheinlich das Übliche – ich hatte ihn gefragt, wann wir Zeit miteinander verbringen könnten, und zur Antwort bekommen, wie schwierig und unvernünftig ich doch sei. Er hatte meine Handynummer blockiert und mich grübeln lassen, was genau ich falsch gemacht haben könnte.
Dann waren wir uns auf der Geburtstagsparty eines gemeinsamen Freundes über den Weg gelaufen, und danach hatte er mir in einer SMS geschrieben, dass er mich immer noch liebe. Ich muss es ihm geglaubt haben, denn nun waren wir hier, machten einen großen Spaziergang und versuchten, alles wieder in Schwung zu bringen.
Wir kamen an Belle Tout vorbei, einem aufgegebenen Leuchtturm, aus dem man ein Bed & Breakfast gemacht hatte. Er steht auf den Kreidefelsen an der Landspitze Beachy Head. Es war ein schöner Ort, der direkt aufs Meer hinausging, und zu beiden Seiten erstreckten sich die weißen Klippen.
»Lass uns hier übernachten«, hatte Greg gesagt. »Ich komme und laufe diesen Abschnitt mit dir zusammen, und dann können wir die Nacht im Leuchtturm verbringen.«
Als ich wieder zu Hause war, setzte ich mich hin und rechnete aus, wann ich ungefähr dort ankommen würde (die detailliertesten Planungen, die ich vor meiner Abreise überhaupt anstellte). Es würde ziemlich früh auf meiner Reise sein, irgendwann Ende November. Als ich auf die Zimmerreservierungen schaute, sah ich, dass man dort mindestens zwei Nächte bleiben muss. Ich schrieb ihnen eine E-Mail, erklärte mein Vorhaben und fragte, ob wir eventuell nur für eine Nacht buchen könnten.
»Das hört sich nach einer fantastischen Herausforderung an, Elise. Wir würden Ihnen das Zimmer gern kostenlos zur Verfügung stellen – bitte bestätigen Sie einfach nur das Datum.«
Das hatte ich nicht erwartet, und ich war außer mir vor Freude – wirklich total aus dem Häuschen. Ein kostenloser Aufenthalt in einem Leuchtturm?! Ich erhielt diese Nachricht, als ich mitten in meiner Angstphase vor der Reise steckte, und sie gab mir einen winzigen Schimmer Hoffnung, dass meine Idee vielleicht doch nicht rundum schrecklich war.
Und sie gab mir zu denken. Menschen, die ein Hotel führen, ein Bed & Breakfast oder eine Herberge – nun ja, sie sind auch bloß Menschen. Wenn ich ihnen erzähle, was ich vorhabe, würden sie mir vielleicht ein Zimmer für eine Nacht geben, im Winter beispielsweise, wenn es bei ihnen sowieso ruhig zugeht. Nicht zuletzt wäre es eine gute Gelegenheit, wieder ein paar Leute kennenzulernen und mein Projekt bekannter zu machen, statt zehn Monate einsam und allein in einem Zelt zuzubringen. Ich hoffte auch, dass die Begegnung mit anderen Menschen es mir ermöglichen würde, mehr Geld für die beiden karitativen Einrichtungen einzuwerben, die ich mir ausgesucht hatte – Young Minds, eine gemeinnützige Organisation, die sich der mentalen Gesundheit von Kindern widmet, und Beyond Food, die von Obdachlosigkeit betroffene Menschen unterstützt. Fundraising war nicht der wichtigste Antrieb für meinen großen Lauf und auch nicht der ursprüngliche Grund für meine Entscheidung, aber wenn ich diese große Herausforderung annahm und einige Menschen sich dadurch bewogen fühlten, für Projekte zu spenden, die mir wichtig waren, dann wollte ich mich darüber ganz bestimmt nicht beklagen. Alle Spenden wanderten direkt an die gemeinnützigen Organisationen, ich nahm nichts davon, um irgendwelche Kosten meiner Reise zu decken, und ich war eifrig bemüht, die Menschen zum Spenden zu ermuntern.
Es fiel mir schwer, darum zu bitten, aber allmählich begann ich, zu begreifen, dass die Leute meist sowieso nur helfen, wenn sie helfen wollen. Ich versuchte ihnen so viel Freiraum wie möglich zu geben, damit sie auch sagen konnten: Nein, eigentlich möchten wir hier nicht helfen. Ich verschickte immer nur E-Mails, die man leicht ignorieren oder mit einem höflichen »Nein, tut mir leid« beantworten konnte. Ich rief nicht an und tauchte auch nicht plötzlich auf der Türschwelle eines Bed & Breakfast auf, um die Leute unter Druck zu setzen.
Und tatsächlich wurden viele meiner Nachrichten ignoriert, und es gab oft ein »Nein, danke«, aber ich war auch jedes Mal total überwältigt, wenn jemand »Ja« sagte, wenn er bereit war, mich zu beherbergen und meine Reise damit hundertmal besser machte, als sie sonst gewesen wäre. Mehr noch: Ich bin sicher, dass es diese Zusagen waren, die mein Projekt überhaupt erst gelingen ließen – neben all den anderen Leuten, bei denen ich am Ende übernachten durfte: bei Freunden von Freunden, bei Familien, die meine Facebook-Videos gesehen hatten, und bei örtlichen Laufvereinen.
Hätte ich den ganzen Winter in meinem Zelt hausen müssen – mit der um vier Uhr nachmittags untergehenden Sonne, dem endlosen Schlamm, den ständig nassen Füßen und all den Serienkillern, die sich meiner Ansicht nach in den Büschen versteckten –, dann hätte ich bestimmt schon nach zehn Kilometern alles hingeschmissen.
Das erste »Ja« kam vom Clarendon Royal Hotel in Gravesend. Noch bevor mir klar wurde, welche Angst ich vorm Campen hatte, wusste ich, dass es in den ersten Tagen, in denen ich noch durch bebautes Gelände im Randgebiet von London lief, schwer sein würde, einen Platz zum Zelten zu finden.
Nachdem ich also meine Mutter und meinen Vater zum Abschied umarmt hatte (das allein ist schon ein Zeichen dafür, dass es ein bedeutsamer Tag war, denn normalerweise haben wir es nicht so mit Kuscheln und Drücken) und in den Supermarkt gegangen war, um mir ein paar Kleinigkeiten zum Essen zu holen, steuerte ich das Clarendon an, um dort die Nacht zu verbringen. Beim Einchecken stellte mir die freundliche Dame an der Rezeption ein paar Fragen zu meinem Vorhaben. Es war mir ein bisschen unangenehm, ihr erzählen zu müssen, dass es erst Tag zwei war und ich noch nichts auch nur annähernd Bemerkenswertes getan hatte. Sie zeigte mir den Weg zu meinem Zimmer, und dann stand ich da – ganz für mich allein. Das war es jetzt also!
Es fühlte sich alles so lächerlich banal an. Wenn man die Abenteuerberichte von anderen Leuten liest, dann haben sie in den ersten 48 Stunden gewöhnlich schon eine Rettung per Hubschrauber durchgemacht oder einen Berglöwen in die Flucht geschlagen; sie sind in die Rituale eines indigenen Stammes eingeweiht worden, beinahe ertrunken oder haben leichte Erfrierungen davongetragen. Ich hingegen hatte nichts anderes getan, als mit einer Auswahl von Leuten, die ich schon kannte, am Rande einiger Fernstraßen entlangzulaufen; ich hatte in mehreren großen Supermarktketten eingekauft und bei Costa Coffee ein Stück trockenen Kuchen gegessen. An jenem Abend nahm ich ein Bad, packte meinen Rucksack übungshalber ein paarmal ein und aus und musste unwillkürlich darüber nachdenken, dass dies vielleicht das sanfteste, bequemste und eindeutig unabenteuerlichste Abenteuer aller Zeiten war.
Ich hatte beschlossen, nicht um die Halbinsel Hoo und die Isle of Sheppey zu laufen. Erstere ist, genau genommen, ja größtenteils noch Bestandteil der Themsemündung und nicht der Meeresküste, und bei Letzterer handelt es sich um eine Insel, obwohl sie durch eine Brücke mit dem Festland verbunden ist. Das bedeutete, dass der nächste Zwischenhalt auf meinem Weg nach Osten, der Küste entgegen, Rochester war. Nach zweieinhalb Tagen vorbei an Schrottbergen, Graffiti und Kraftwerken stieß ich endlich auf so etwas wie eine Landschaft. Darüber muss ich echt aus dem Häuschen gewesen sein, denn als ich auf einem Grasstreifen vor einem ziemlich schäbig aussehenden Acker stand, beschloss ich, ein Video aufzunehmen. Es sollte das erste von vielen sein, und ich kann Ihnen ohne das geringste Zögern versichern, dass mir bei der Abfassung dieses Buches eines am schwersten fiel – mir all diese Videotagebücher sozusagen zu Recherchezwecken noch einmal anschauen zu müssen. Das war insgesamt eine schmerzliche Erfahrung, aber auf dieses erste Video traf es ganz besonders zu. Ich erinnere mich, dass mein Bruder, nachdem ich es hochgeladen hatte, wissen wollte, warum ich vor der Kamera eine völlig andere Stimme habe. Damit lag er nicht falsch.
Hätten Sie mich vorher gefragt, ob ich jemals Selfie-Videos auf Facebook hochladen würde, wäre die Antwort ein klares »Nein« gewesen. Schon der Gedanke daran war absolut beschämend. Ich war überzeugt, die Leute würden mich niedermachen und mit faulen Tomaten beschmeißen, weil ich so peinlich war. Aber vielleicht driftete ich ja ohnehin schon so weit fort von allem, was auch nur entfernt einer Komfortzone ähnelte, dass es nur ein weiterer Tropfen im Ozean war, wenn ich dieses Video postete.
Was auch immer mich antrieb: Am Abend von Tag drei zögerte ich nicht lange, sagte mir, dass ich über meinen Schatten springen müsse, und veröffentlichte das Video dann auf Facebook. Ironischerweise postete ein Troll ausgerechnet zu diesem ersten Video etwas Schreckliches (was wirklich erstaunlich war, denn damals hatte ich ja erst um die 100 Follower). Das wurde aber durch all die freundlichen Kommentare mehr als aufgewogen, und später hat nie wieder jemand etwas Gemeines geschrieben.
Diese Videos wurden schließlich zu einem wichtigen Bestandteil meiner Reise, so seltsam das auch klingen mag. Der Kamera einige Minuten lang etwas zu erzählen, kostete viel weniger Mühe als das Verfassen eines Blogeintrags, und wie sich herausstellte, schauen sich die Leute solche Filmchen auch lieber an, als einen Text zu lesen. Auf meiner Facebook-Seite wuchs die Zahl hinter dem »Gefällt mir« stetig an. Ich konnte gar nicht glauben, dass sich jemand wirklich für das interessierte, was ich trieb, und ich stellte mir meine Mutter vor, wie sie diese Videos immer und immer wieder anschaute und damit die Klickzahlen in die Höhe trieb. Aber natürlich war das nicht so. Hinter jedem »Gefällt mir« stand eine Person – Menschen, die mich Tag für Tag anspornten, die ein Stück mit mir gemeinsam liefen, auf meiner





























