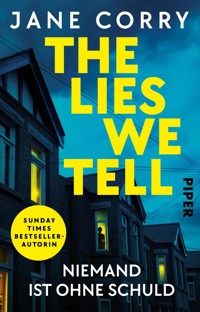2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als die junge Anwältin Lily Ed heiratet, hofft sie auf einen Neuanfang. Sie möchte die Geheimnisse der Vergangenheit hinter sich lassen. Doch als sie ihren ersten wichtigen Fall annimmt, fühlt sie sich merkwürdig von ihrem Klienten angezogen. Einem Mann, der des Mordes angeklagt ist. Einem Mann, für den sie bald alles riskiert. Doch ist er wirklich unschuldig?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 640
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Als die junge Anwältin Lily Ed heiratet, hofft sie auf einen Neuanfang. Sie möchte die Geheimnisse der Vergangenheit hinter sich lassen. Doch als sie ihren ersten wichtigen Fall annimmt, fühlt sie sich merkwürdig von ihrem Klienten angezogen. Einem Mann, der des Mordes angeklagt ist. Einem Mann, für den sie bald alles riskiert, weil sie seiner Version des Tathergangs glaubt. Doch ist er wirklich unschuldig?
»Ein scheinbar nicht enden wollender Strudel aus Katastrophen und Täuschungen. Das macht süchtig.« The Washington Post
»Ein packender Thriller – voller origineller Twists« Sunday Times
Über die Autorin
Jane Corry ist Journalistin und unterrichtet Kreatives Schreiben. Nachdem sie drei Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis gearbeitet hatte, schrieb sie ihren ersten psychologischen Thriller. Lass mich los ist zum Teil von ihren Erfahrungen dort inspiriert.
JANE CORRY
LASS
MICH
LOS
Psychothriller
Aus dem Englischen von
Angelika Naujokat
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 12/2017
Copyright © 2016 by Jane Corry
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel My Husband’s Wife bei Penguin Books, an imprint of Penguin Random House UK, London.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by Diana Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Nadine Lipp
Umschlaggestaltung: t. mutzenbach design, München
Umschlagmotiv: © shutterstock_jantima14
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
e-ISBN 978-3-641-20834-9V001
www.diana-verlag.de
Ich widme dieses Buch zu gleichen Teilen meinem unglaublichen Ehemann Nummer zwei, Shaun, mit dem es nie langweilig wird, der mich zum Lachen bringt und mir den Freiraum zum Schreiben lässt, und meinen wundervollen Kindern, die mich jeden Tag aufs Neue inspirieren.
PROLOG
Metall blitzt auf.
Mir dröhnen die Ohren.
»Es ist siebzehn Uhr, Sie hören die Nachrichten.«
Die Stimme der Radiosprecherin zwitschert fröhlich von der Kieferkommode herüber, die beladen ist mit Fotos (Urlaube, Abschlussfeiern und Hochzeiten).
Mein Kopf tut höllisch weh. Mein rechtes Handgelenk auch. Aber es ist der Schmerz in meiner Brust, der mir Angst einjagt. Und das Blut.
Ich sinke zu Boden. Die Kälte der schwarzen Platten tut gut. Ich beginne zu zittern.
An der Wand über mir hängt ein Gemälde mit einem weißen italienischen Haus, an seiner Fassade rankt sich purpurfarbene Bougainvillea empor. Ein Andenken an die Flitterwochen.
Kann eine Ehe mit Mord enden? Selbst wenn sie nicht mehr existiert?
Dieses Bild wird das Letzte sein, was ich sehe. Doch vor meinem inneren Auge zieht noch einmal mein Leben vorbei.
Es stimmt also, was man über das Sterben sagt: Die Vergangenheit kehrt zurück und begleitet dich.
THE DAILY TELEGRAPH
DIENSTAG, 20. OKTOBER 2015
Der Künstler Ed Macdonald wurde erstochen in seinem Haus aufgefunden. Es wird vermutet, dass …
ERSTER TEIL
Fünfzehn Jahre zuvor
1
LILY
SEPTEMBER 2000
»Nervös?«, fragt Ed.
Er schüttet Rice Krispies in eine Schüssel: sein Lieblingsfrühstück. Eigentlich mag ich sie auch – allerdings ohne Milch. Als Kind war ich besessen von den Figuren mit den Elfengesichtern, die auf der Packung abgebildet sind, und dieser Zauber wirkt noch nach.
Aber heute ist mir nicht nach Essen zumute.
»Nervös?«, wiederhole ich, während ich mir vor dem winzigen Spiegel neben der Spüle meine Perlenohrringe anstecke. Unsere Wohnung ist klein. Kompromisse waren unumgänglich.
Weswegen denn?, hätte ich beinahe hinzugefügt. Weil ich nun eine verheiratete Frau bin? Frisch verheiratet in einem brandneuen Jahrhundert? Oder weil wir uns mehr Zeit für die Wohnungssuche hätten nehmen sollen? Wir sind nun in den falschen Teil von Clapham gezogen, der direkte Nachbar ist ein Alkoholiker und die zwei Zimmer und das Bad sind winzig.
Oder sollte ich nervös sein, weil dies mein erster Arbeitstag nach unseren Flitterwochen in Italien ist? Eine Woche Sizilien mit jeder Menge Marsala, gegrillten Sardinen und dicken Pecorinoscheiben.
Vielleicht bin ich ja nervös wegen all dieser Dinge.
Eigentlich liebe ich meine Arbeit. Bis vor Kurzem lag der Schwerpunkt meiner Anwaltstätigkeit noch auf dem Arbeitsrecht, und ich habe Menschen – vor allem Frauen – geholfen, die man zu Unrecht entlassen hatte. Ich habe ein Herz für Benachteiligte und Außenseiter. Beinahe hätte ich mich für die Sozialarbeit entschieden wie mein Vater, doch dank einer resoluten Berufsberaterin in der Schule und, sagen wir mal, gewissen Ereignissen in meinem Leben bin ich nun hier. Fünfundzwanzig Jahre alt und frisch gebackene Rechtsanwältin mit Mindestlohn.
»Wir versetzen Sie ins Strafrecht«, hatte mir mein Chef – sozusagen als Hochzeitsgeschenk – verkündet. »Wir sind der Ansicht, dass Sie dafür gut geeignet sind.«
Und daher bereite ich mich nun auf meinen ersten Gefängnisbesuch vor. Ich soll einen Mann treffen, der wegen Mordes einsitzt.
Ed zeichnet mal wieder irgendetwas. Sein Kopf ist leicht nach links gebeugt, während er auf seinem Notizblock herumkritzelt, neben ihm die Müslischale. Mein Mann zeichnet andauernd. Das hat mir gleich gefallen. »Werbung«, antwortete er mit einem reumütigen Schulterzucken auf meine Frage, was er beruflich macht. »Im Kreativbereich. Aber eines Tages werde ich mich nur noch der Kunst widmen. Das hier ist bloß vorübergehend. Um die Rechnungen zu bezahlen.«
Ein Mann, der weiß, was er will. Ein Ziel vor Augen hat. Aber da habe ich mich in gewisser Hinsicht getäuscht. Wenn Ed zeichnet oder malt, vergisst er alles um sich herum. Jetzt gerade weiß er nicht mal mehr, dass er mir eine Frage gestellt hat. Doch mit einem Mal ist es mir wichtig, sie zu beantworten.
»Nervös? Nein, ich bin nicht nervös.«
Er nickt, aber ich bin mir nicht sicher, ob er mich wirklich gehört hat.
Ich nehme seine linke Hand – die, an der der glänzende goldene Ehering steckt – und frage mich, warum ich ihm nicht sage, was ich wirklich empfinde. Wieso gebe ich nicht zu, wie elend ich mich fühle? Ob es daran liegt, dass ich so tun will, als seien unsere Flitterwochen noch gar nicht zu Ende?
Oder daran, dass ich vorzugeben versuche, keine Angst vor dem zu haben, was mich an diesem Morgen erwartet? Ein Schauer läuft mir über den Rücken. Letzten Monat hat ein Anwalt einer anderen Kanzlei Stiche in beide Lungen davongetragen, als er einen Mandanten in Wandsworth besuchte. Das kommt vor.
»Wir müssen los«, sage ich, und die Angst verleiht meiner hellen Stimme eine Schärfe, die ich so gar nicht beabsichtigt hatte. »Sonst kommen wir beide zu spät.«
Er erhebt sich nur widerwillig von dem wackeligen Stuhl. Mein frisch angetrauter Ehemann ist groß, schlaksig und hat eine fast schon zaghafte Art, sich fortzubewegen, ganz so, als wäre er in Wahrheit lieber woanders. Als Kind war sein Haar wohl so golden wie meins heute (»Als wir dich zum ersten Mal sahen, wussten wir sofort, dass wir dich ›Lily‹ nennen würden«, erzählte meine Mutter immer wieder), aber nun ist es rotblond. Und er hat dicke Finger, die so gar nicht zu dem Künstler passen wollen, der er so gern wäre.
Jeder Mensch braucht einen Traum. Die Lilie ist ja ein Sinnbild für Schönheit und Anmut. Obenherum sehe ich dank meines naturblonden Haars und meines »eleganten Schwanenhalses«, wie es meine inzwischen verstorbene Großmutter freundlicherweise ausdrückte, eigentlich auch ganz okay aus, aber weiter unten findet sich bei mir kein schlanker Stiel, sondern immer noch jede Menge Babyspeck. Egal, was ich auch anstelle, ich benötige Kleidergröße 44 – und auch da passe ich manchmal nur mit Ach und Krach hinein. Eigentlich sollte es mir ja egal sein. Ed behauptet, die paar Pfund zu viel gehörten eben zu mir. Das ist nett gemeint. Glaube ich zumindest. Aber sie machen mir zu schaffen. Haben es immer schon getan.
Beim Hinausgehen fällt mein Blick auf die vielen Glückwunschkarten zu unserer Hochzeit, die in ihren Umschlägen an Eds Plattenspieler lehnen. Mr. und Mrs. E. Macdonald. Der Name kommt mir so fremd vor.
Mrs. Ed Macdonald.
Lily Macdonald.
Ich habe eine halbe Ewigkeit geübt, meine neue Unterschrift zu vervollkommnen, das »Y« durch eine schwungvolle Schleife mit dem »M« zu verbinden, dennoch kommt es mir irgendwie nicht richtig vor. Die Namen passen nicht besonders gut zusammen. Ich hoffe, dass das kein schlechtes Omen ist.
Jede dieser Karten erfordert noch ein Dankesschreiben, bis Ende der Woche sollten alle auf dem Postweg sein. Wenn meine Mutter mir eins beigebracht hat, dann ist es Höflichkeit.
Eine der Karten ziert ein besonders um Aufmerksamkeit heischendes Gekritzel in türkisfarbener Tinte. »Ich war mal mit Davina zusammen«, erklärte Ed, kurz bevor sie auf unserer Verlobungsfeier auftauchte. »Aber jetzt sind wir nur noch Freunde.«
Davina mit ihrem wiehernden Lachen und den kunstvoll gestylten kastanienbraunen Locken, die sie wie ein Modell der englischen Präraffaeliten aussehen ließen. Davina, die als Eventmanagerin arbeitete und Partys organisierte, die von all den »angesagten Mädchen« besucht wurden. Davina, die ihre veilchenblauen Augen zusammenkniff, als wir einander vorgestellt wurden, ganz so, als frage sie sich, warum Ed sich mit einer großen, dicken, strubbelköpfigen Frau abgab.
Kann ein Mann überhaupt mit einer Frau befreundet sein, mit der er einmal zusammen war?
Ich beschließe, die Karte meiner Vorgängerin als letzte zu beantworten. Ed hat schließlich mich geheiratet und nicht sie.
Eds warme Hand drückt nun die meine, als spüre er mein Bedürfnis nach Zuspruch. »Wird schon gut gehen«, sagt er.
Im ersten Moment frage ich mich, ob er von unserer Ehe spricht. Doch dann fällt es mir wieder ein. Mein erster Mandant, ein verurteilter Straftäter. Joe Thomas.
»Danke.« Eigentlich bin ich froh, dass Ed nicht auf meine gespielte Tapferkeit hereingefallen ist. Aber andererseits beunruhigt es mich auch irgendwie.
Wir schließen die Wohnungstür ab und gehen mit schnellen Schritten den Hausflur im Erdgeschoss entlang. Eine Tür öffnet sich und ein kleines Mädchen mit langen, dunklen Haaren, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden sind, tritt mit seiner Mutter heraus. Ich bin ihnen schon einmal begegnet, doch als ich sie grüßte, grüßten sie nicht zurück. Beide haben wunderschöne olivfarbene Haut und bewegen sich mit einer Anmut, als würden sie schweben.
Gemeinsam treten wir in die kalte Herbstluft hinaus. Und dann bewegen wir uns alle vier in dieselbe Richtung, doch Mutter und Tochter sind uns rasch ein Stück voraus, weil Ed beim Gehen etwas in sein Skizzenbuch kritzelt. Die Kleine ist das Ebenbild ihrer Mutter, außer dass diese einen zu kurzen schwarzen Rock anhat, während das Mädchen – das offenbar irgendetwas haben will und deshalb quengelt – eine marineblaue Schuluniform trägt. Wenn Ed und ich einmal Kinder haben, werden wir ihnen auf jeden Fall beibringen, nicht zu quengeln.
Als wir uns der Haltestelle nähern, beginne ich zu zittern. Es ist zwar kühl, aber ich zittere nicht deshalb. Nach einer Woche purer Zweisamkeit ist die Vorstellung, acht Stunden ohne Ed überstehen zu müssen, ein wenig beängstigend.
Das geht mir auf die Nerven. Vor nicht allzu langer Zeit war ich unabhängig. Das Alleinsein machte mir nichts aus. Doch seit ich vor einem halben Jahr (es kommt mir viel länger vor!) bei einer Party Ed begegnet bin, fühle ich mich gestärkt und geschwächt zugleich.
Wir bleiben stehen, und ich wappne mich für das Unvermeidliche. Mein Bus geht in die eine Richtung, seiner in die andere. Ed ist auf dem Weg zur Werbeagentur, um sich Werbekampagnen einfallen zu lassen, damit die Leute etwas kaufen, was sie gar nicht kaufen wollen.
Und ich bin in meinem marineblauen Kostüm und sonnengebräunt auf dem Weg zum Gefängnis.
»Wenn du erst einmal da bist, wird es nicht mehr so beängstigend sein«, sagt mein frisch angetrauter Ehemann – ich hätte niemals gedacht, dass ich dieses Wort einmal aussprechen würde! –, bevor er mir einen Kuss auf den Mund gibt.
»Ich weiß«, sage ich, bevor er sich zu seiner Bushaltestelle aufmacht.
Zwei kleine harmlose Lügen nur. Damit sich der andere besser fühlt.
Aber genau auf diese Weise beginnen manche Lügen. Klein und harmlos. In bester Absicht. Bis sie zu groß werden und man nicht mehr mit ihnen klarkommt.
2
CARLA
»Warum?«, sagte Carla mit quengeliger Stimme, ließ sich zurückfallen und zog dabei an der Hand ihrer Mutter, damit sie stehen blieb und nicht weiter Richtung Schule ging. »Warum muss ich denn da hin?«
Wenn sie weiter so einen Aufstand machte, würde sich ihre Mutter vielleicht vor Erschöpfung geschlagen geben. Letzte Woche hat es funktioniert, auch wenn es ein Heiligentag war. Mamma war weinerlicher als sonst. Aber das war an Geburtstagen, Heiligentagen, Weihnachten und Ostern immer der Fall.
»Wo ist nur die Zeit geblieben?«, stöhnte sie dann meist mit ihrem starken Akzent, durch den sie sich von all den anderen Müttern ihrer Schulkameraden unterschied. »Neuneinhalb Jahre ohne deinen Vater. Neun lange Jahre.«
Seit sie denken konnte, wusste Carla, dass ihr Vater oben im Himmel bei den Engeln war. Was daran lag, dass er nach ihrer Geburt irgendein Versprechen gebrochen hatte.
Einmal hatte sie gefragt, was für ein Versprechen es war.
»Eins, das man nicht wiedergutmachen kann«, antwortete Mamma schniefend.
Wie die schöne blaue Teetasse mit dem goldenen Griff, dachte Carla. Sie war ihr vor ein paar Wochen aus der Hand geglitten, als sie das Geschirr abtrocknete. Mamma hatte geweint, weil die Tasse aus Italien stammte.
Es war traurig, dass Papà bei den Engeln war. Aber sie hatte ja immer noch ihre Mamma! Einmal hielt ein Mann im Bus sie beide für Schwestern. Mamma lachte. »Er wollte mir nur schmeicheln«, sagte sie mit roten Wangen. Doch an diesem Abend durfte Carla ausnahmsweise einmal länger aufbleiben. Da begriff sie, dass es eine hervorragende Gelegenheit war, Mamma um etwas zu bitten, wenn sie gute Laune hatte.
Allerdings traf dies auch zu, wenn Mamma traurig war.
Seit das Schuljahr begonnen hatte, wünschte Carla sich sehnlichst ein Raupenfedermäppchen aus weichem, grünem, pelzigem Stoff, wie die anderen Kinder in ihrer Klasse eins hatten. Dann würden die vielleicht endlich aufhören, sie zu hänseln. Anders zu sein war schlecht. Anders bedeutete kleiner als alle anderen in ihrer Klasse. Knirps! (Ein komisches Wort, das nicht im Kinderwörterbuch stand, das ihr Mamma auf ihr Drängen hin im Secondhandladen an der Ecke gekauft hatte, der auch gebrauchte Bücher führte.) Anders bedeutete dichte, schwarze Augenbrauen und langes, lockiges, schwarzes Haar zu haben. Zottelcarla! Anders bedeutete, einen Namen zu haben, der fremd klang.
Carla Cavoletti.
Oder »Spagoletti«, wie sie die anderen Kinder nannten.
Zottelcarla Spagoletti!
»Warum können wir heute nicht zu Hause bleiben?«, fuhr sie fort. In unserem richtigen Zuhause, hätte sie beinahe hinzugefügt. Nicht das in Italien, von dem ihr Mamma andauernd erzählte, das sie, Carla, aber noch nie gesehen hatte.
Mamma blieb kurz stehen, als ihre Nachbarin mit dem goldblonden Haar vorbeiging, und warf ihr einen missbilligenden Blick zu.
Carla kannte diesen Blick. Es war der gleiche, den ihr die Lehrer in der Schule zuwarfen, wenn sie die Neunerreihe nicht konnte. »Ich kann auch nicht gut mit Zahlen umgehen«, hatte Mamma mit einer verächtlichen Handbewegung gesagt, als Carla sie bat, ihr bei den Hausaufgaben zu helfen. »Aber das ist egal, so lange du nicht zu viel Kuchen isst und fett wirst. Frauen wie wir müssen nur schön sein.«
Der Mann mit dem blitzblanken Auto und dem großen braunen Hut sagte Mamma andauernd, dass sie schön war.
Wenn er zu Besuch kam, weinte Mamma nie. Sie trug ihre langen, dunklen, lockigen Haare offen, besprühte sich mit ihrem Lieblingsparfüm – Apple Blossom – und brachte ihre Augen zum Strahlen. Der Schallplattenspieler wurde angestellt, und ihrer beider Füße wippten im Takt, auch wenn Carlas nicht sehr lange mitwippen durften.
»Zeit fürs Bett, cara mia«, sagte Mamma immer viel zu schnell mit einer Singsangstimme. Und dann musste Carla ihre Mutter und den Gast allein im Wohnzimmer zurücklassen, wo sie unter den Fotos ihrer Familie, die an den rissigen Wänden hingen, tanzten. Oft erschienen Carla die kalten Gesichter aus den Fotos im Traum und jagten ihr Angst ein – das unterbrach dann die Tanzerei und machte Mamma böse. »Du bist zu alt für solche Träume. Du weißt doch, dass du Larry und mich nicht stören sollst.«
Vor einer kleinen Weile war Carla mit einem Schulprojekt nach Hause gekommen, bei dem die Eltern im Mittelpunkt standen. »Meine Mutter und mein Vater«, war es überschrieben. Als sie Mamma voller Begeisterung davon erzählte, erntete sie nur Zungenschnalzen, gefolgt von einem Tränenausbruch, bei dem ihre Mutter den Kopf auf den Küchentisch legte. »Ich muss unbedingt irgendetwas für den Klassentisch mitbringen«, beharrte Carla. »Ich will nicht die Einzige sein, die nichts mitbringt.«
Schließlich hatte Mamma das Foto des stocksteif dasitzenden Mannes mit dem weißen Kragen und dem strengen Blick von der Wand genommen. »Wir werden Papà in die Schule schicken«, verkündete sie mit einer Stimme, die so klang, als wäre ihr ein Lutschbonbon im Hals stecken geblieben. Carla mochte Lutschbonbons. Der Mann mit dem blitzblanken Auto brachte ihr oft welche in einer weißen Papiertüte mit. Aber sie blieben an ihrer Hand kleben, und es dauerte immer eine halbe Ewigkeit, bis sie den Fleck wieder abgewaschen hatte.
Carla hielt das Foto ehrfurchtsvoll in der Hand.
»Ist das mein Großvater?«, fragte sie, obwohl sie die Antwort schon kannte. Mamma hatte es ihr oft genug gesagt. Aber es war gut zu wissen. Gut, sich sicher sein zu können, dass sie einen Großvater hatte wie ihre Klassenkameraden, auch wenn ihrer weit weg, irgendwo in den Hügeln um Florenz, lebte und niemals zurückschrieb.
Carlas Mutter wickelte das Foto in einen orange-roten Seidenschal, der nach Mottenkugeln roch. Carla konnte es kaum erwarten, es in die Schule mitzunehmen.
»Das ist mein Nonno«, verkündete sie stolz.
Doch alle lachten. »Nonno, Nonno«, skandierte ein Junge. »Wieso hast du keinen Opa wie wir? Und wo ist dein Vater?«
Das war kurz vor dem Heiligentag, als sie ihre Mutter überredet hatte, sich bei der Arbeit krankzumelden. Einer der besten Tage ihres Lebens! Sie packten etwas zu essen ein und machten ein Picknick in einem großen Park, wo Mamma Lieder sang und ihr von ihrer Kindheit in Italien erzählte.
»Meine Brüder haben mich immer zum Schwimmen mitgenommen«, sagte sie mit verträumter Stimme. »Manchmal haben wir Fische für das Abendessen gefangen und dann gesungen und getanzt und Wein getrunken.«
Carla – selbst ganz trunken vor Glück, weil sie für einen Tag der Schule entkommen war –, wickelte sich eine dunkle Haarsträhne ihrer Mutter um den kleinen Finger. »War Papà auch schon dabei?«
Mit einem Mal erlosch das Strahlen in den Augen ihrer Mutter. »Nein, mein Spatz. War er nicht.« Dann packte sie die Thermoskanne und den Käse weg und faltete die Decke mit dem roten Schottenkaro zusammen. »Komm, wir müssen wieder nach Hause.«
Und mit einem Mal war es nicht mehr der beste Tag ihres Lebens.
Der heutige sah auch nicht gerade toll aus. Die Lehrerin hatte sie gewarnt, dass es gleich zu Beginn zwei Tests geben würde. Mathe und Buchstabieren. Zwei ihrer gefürchtetsten Fächer. Carlas Griff um die Hand ihrer Mutter wurde immer fester, je näher sie der Bushaltestelle kamen.
»Du magst klein sein für dein Alter«, hatte Larry neulich Abend gesagt, als sie dagegen protestiert hatte, früh zu Bett zu gehen, »aber du bist sehr willensstark, nicht wahr?«
Na und?, hätte sie beinahe erwidert.
»Du musst nett sein zu Larry«, sagte Mamma ständig. »Ohne ihn könnten wir hier nicht wohnen.«
»Können wir bitte-bitte beide zu Hause bleiben?«, flehte Carla ihre Mutter jetzt an.
Doch Mamma wollte nichts davon wissen. »Ich muss zur Arbeit.«
»Aber wieso denn? Larry wird es bestimmt verstehen, wenn du dich mal nicht mit ihm zum Mittagessen treffen kannst.«
Mamma drehte sich auf der Straße um und wäre dabei fast gegen einen Laternenmast gelaufen. Für einen Moment wirkte sie beinahe wütend. »Weil ich trotz allem noch ein bisschen Stolz besitze, mein Spatz.« Ihre Augen hellten sich auf. »Außerdem mag ich meinen Job.«
Mammas Arbeit war sehr wichtig. Sie musste dafür sorgen, dass unscheinbare Frauen hübsch aussahen! Sie arbeitete in einem großen Laden, der Lippenstifte und Wimperntusche und besondere Lotionen verkaufte, die einen wundervollen »Teint« zauberten und die Haut verwöhnten, wie Mamma sich ausdrückte. Manchmal brachte sie auch Pröbchen mit nach Hause und schminkte Carlas Gesicht. All dies war wichtig, um schön zu sein, damit sie eines Tages auch einen Mann mit einem blitzblanken Auto finden würde, der mit ihr im Wohnzimmer tanzte.
Mamma war Larry im Laden begegnet. Sie vertrat an jenem Tag eine kranke Kollegin am Parfümstand. Kranksein war gut, wenn es bedeutete, dass du einspringen kannst, erklärte ihr Mamma. Larry war in den Laden gekommen, um Parfüm für seine Frau zu kaufen. Die war auch krank. Und nun tat Mamma der Frau einen Gefallen, weil sie Larry wieder glücklich machte. Er war schließlich auch gut zu Carla, nicht wahr? Brachte ihr Süßigkeiten mit.
Aber jetzt, als sie auf die Bushaltestelle zugingen, wo die Frau mit dem goldblonden Haar wartete (die Nachbarin, die laut Mamma zu viel Kuchen aß), wollte Carla etwas anderes.
»Darf ich Larry fragen, ob er mir ein Raupenfedermäppchen kauft?«
»Nein.« Mamma vollführte eine weit ausholende Geste mit ihren langen Armen und den roten Fingernägeln. »Das darfst du nicht.«
Das war ungerecht. In Gedanken fühlte und streichelte Carla schon den weichen Flaum und hörte die Raupe zu ihr sagen: Ich sollte dir gehören. Dann werden uns alle mögen. Komm, Carla, du findest schon einen Weg.
3
LILY
Um zum Gefängnis zu gelangen, muss ich die U-Bahn-Linie District Line bis zur Endstation nehmen und anschließend noch ziemlich lange mit dem Bus fahren. Das sanfte Grün auf dem Liniennetzplan verleiht mir ein Gefühl von Sicherheit – ganz anders als das knallige Rot der Central Line, das förmlich nach Gefahr schreit. Gerade hält meine Bahn in Barking, wo die Strecke überirdisch verläuft, und ich blicke durch das regenverhangene Fenster auf den Bahnsteig hinaus auf der Suche nach vertrauten Gesichtern aus meiner Kindheit.
Doch da sind keine. Nur Scharen von übermüdet dreinblickenden Pendlern, die an runzelige Krähen in Regenmänteln erinnern, und eine Frau mit einem kleinen Jungen in einer adretten rot-grünen Uniform.
Es gab einmal eine Zeit, in der ich nicht weit von hier ein normales Leben geführt habe. Ich sehe das Haus immer noch vor mir: Kieselrauputz, in den 1950er-Jahren erbaut, primelgelbe Fensterrahmen, die aus der Menge der cremefarbenen in der Nachbarschaft hervorstachen. Ich erinnere mich noch daran, wie ich an der Hand meiner Mutter die Hauptstraße hinunter zur Bücherei ging. Entsinne mich mit erstaunlicher Klarheit, wie mir mein Vater erzählte, dass ich bald einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester bekommen würde. Endlich! Endlich würde ich wie die anderen in meiner Klasse sein, die aus aufregenden, lauten, lebhaften Familien kamen, wo es ganz anders zuging als in unserem ruhigen Leben zu dritt.
Aus irgendeinem Grund fällt mir das quengelnde kleine Mädchen in der marineblauen Uniform aus unserem Haus ein und ihre Mutter mit den vollen Lippen, der schwarzen Mähne und den makellosen, weißen Zähnen. Die beiden hatten heute Morgen Italienisch gesprochen. Ich war versucht, stehen zu bleiben und ihnen zu erzählen, dass wir gerade unsere Flitterwochen in Italien verbracht hatten.
Ich mache mir oft Gedanken über das Leben anderer Menschen. Was für einen Job mag diese wunderschöne Frau wohl haben? Arbeitet sie vielleicht als Model? Doch heute kehren meine Gedanken rasch wieder zu mir selbst zurück. Zu meinem eigenen Leben. Wie sähe dieses wohl aus, wenn ich doch Sozialarbeiterin geworden wäre? Wenn ich nach meinem Umzug nach London an jenem Abend nicht mit meiner neuen Mitbewohnerin zu dieser Party gegangen wäre, sondern Nein gesagt hätte, wie ich es für gewöhnlich tue? Wenn ich meinen Wein nicht auf dem beigen Teppich verschüttet hätte? Und der freundliche Mann mit dem rotblonden Haar (»Hallo, ich bin Ed«), der dunkelblauen Krawatte und der gebildeten Stimme mir nicht beim Aufwischen geholfen und erklärt hätte, der Teppich sei seiner Ansicht nach eh zu trist und könne ein bisschen Farbe gut gebrauchen. Wenn ich nicht (aus Nervosität) so betrunken gewesen wäre, dass ich ihm vom Tod meines Bruders erzählt habe, als er sich nach meiner Familie erkundigte? Was, wenn dieser humorvolle Mann, der mich zum Lachen brachte, aber auch ein guter Zuhörer war, mir nicht bei unserer zweiten Verabredung einen Heiratsantrag gemacht hätte? Und wenn seine künstlerisch angehauchte, privilegierte Welt (die so ganz anders war als die meine) mir nicht eine Fluchtmöglichkeit vor den Schrecken der Vergangenheit geboten hätte …
Erzählst du mir auch die Wahrheit über deinen Bruder? Die Stimme meiner Mutter dringt durch die Schwärme der Pendlerkrähen und zieht mich an einem unsichtbaren Schlepptau nach Devon, wohin wir aus London gezogen waren.
Ich raffe meinen Erwachsenenmantel fester um mich und befördere ihre Stimme aus dem Fenster. Ich muss sie mir jetzt nicht anhören. Ich bin erwachsen. Verheiratet. Ich habe einen verantwortungsvollen Job. Und dieser Verantwortung sollte ich nun Rechnung tragen, anstatt meine Gedanken in die Vergangenheit abschweifen zu lassen. »Sie müssen sich in die Gegenseite hineindenken«, sagte der Seniorpartner immer, »und der Staatsanwaltschaft einen Schritt voraus sein.«
Ich rutsche auf meinem Sitz hin und her, um mir etwas mehr Platz zwischen zwei kräftigen, in grauen Hosenstoff gehüllten Knien rechts und links von mir zu verschaffen, und öffne meine prall gefüllte Aktentasche, um eine Mappe hervorzuziehen, was in einem proppevollen Wagen gar nicht so einfach ist. Während ich die Zusammenfassung des Falls überfliege, um mein Gedächtnis aufzufrischen, versuche ich, den Text mit der Hand vor fremden Blicken zu schützen (eigentlich sollen wir keine Schriftstücke in der Öffentlichkeit lesen).
VERTRAULICH
PRO-BONO-MANDAT
Joe Thomas, 30, Versicherungsvertreter. 1998 wegen Mordes verurteilt, weil er Sarah Evans, 26, Modeverkäuferin und Freundin des Angeklagten, in kochend heißes Badewasser gestoßen hat. Todesursache: Herzversagen in Kombination mit schweren Verbrühungen. Nachbarn bezeugten, eine heftige Auseinandersetzung gehört zu haben. Blutergüsse an der Leiche lassen darauf schließen, dass das Opfer gewaltsam in die Badewanne gestoßen wurde.
Was mir dabei am meisten zu schaffen macht, ist die Sache mit dem Wasser. Ein Mord sollte mit etwas Scheußlichem wie einer scharfen Klinge oder einem Stein oder Gift, wie bei den Borgias, begangen werden. Aber ein Bad in der Wanne sollte doch eigentlich sicher sein. Wohltuend. Wie die waldgrüne District Line. Wie Flitterwochen.
Der Wagen rüttelt hin und her, und ich werde erst gegen das Knie zu meiner Linken und dann gegen das zu meiner Rechten geschleudert. Meine Unterlagen verteilen sich über den feuchten Boden. Ich sammle sie erschrocken auf, aber es ist bereits zu spät. Der Mann zu meiner Rechten reicht mir die Zusammenfassung des Falls zurück, jedoch nicht ohne einen Blick auf die ordentlich getippten Zeilen geworfen zu haben.
Mein erster Mordprozess hätte ich am liebsten gesagt, wenn auch nur, um den misstrauischen Ausdruck in seinen Augen zu verscheuchen.
Doch stattdessen werde ich feuerrot und stopfe die Unterlagen rasch wieder zurück in meine Aktentasche. Wenn mein Chef das mitbekommen hätte, wäre ich auf der Stelle entlassen worden.
Allzu bald hält die Bahn, und es ist Zeit auszusteigen. Zeit, zu versuchen, einen Mann zu retten, den ich bereits verabscheue, wo ich doch viel lieber in Italien wäre.
Wann immer ich an ein Gefängnis denke, stelle ich mir so etwas wie in der Art von Colditz vor. Aber gewiss keine lange Auffahrt, die mich an den Riesenschuppen von Eds Eltern in Gloucestershire erinnert. Ich bin nur ein einziges Mal dort gewesen, aber das hat mir gereicht. Die Atmosphäre war eisig – und das lag nicht an der fehlenden Zentralheizung.
»Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind?«, frage ich den Taxifahrer.
Er nickt, und ich kann sein Grinsen spüren, auch wenn ich es von hinten nicht sehe.
»Jeder ist überrascht, wenn er das Gebäude sieht. War mal ein Privatanwesen, bis die Strafvollzugsbehörde Ihrer Majestät es übernommen hat.« Dann wird seine Stimme finster. »Jetzt gibt’s da drin einen Haufen verdammter Irrer – und ich spreche nicht nur von den Verbrechern, die eingebuchtet wurden.«
Ich beuge mich nach vorn. Angesichts dieser interessanten Information verfliegt meine anfängliche Sorge, die Taxifahrt auf die Spesenrechnung zu setzen (der Bus fuhr wider Erwarten nicht weit genug). Natürlich wusste ich, dass es im Gefängnis von Breakville einen hohen Anteil an Psychopathen gibt und dass man sich dort auf psychologische Betreuung spezialisiert hat. Aber die Kenntnisse der Leute vor Ort konnten ja durchaus nützlich sein.
»Meinen Sie damit die Angestellten?«, frage ich vorsichtig.
Er gibt ein Schnauben von sich und fährt weiter die Auffahrt hinauf, vorbei an einer Häuserreihe mit Sozialwohnungen. »Das kann man wohl sagen! Mein Schwager hat vor seinem Zusammenbruch in dem Laden als Wärter gearbeitet. Hat da drüben gewohnt.«
Er macht eine Kopfbewegung in Richtung der Häuser. Dann lenkt er den Wagen um eine weitere Kurve, und zu meiner Linken erhebt sich eines der schönsten Häuser, das ich jemals gesehen habe. Mein Blick wandert über hübsche Schiebefenster und prächtiges gold-rotes Efeu hinweg, das an der Fassade hinaufrankt. Ich vermute, dass das Gebäude aus der Edwardischen Epoche stammt. Es bildet auf jeden Fall einen krassen Kontrast zu den Mietcontainern zu meiner Rechten.
»Sie müssen sich da anmelden«, erklärt mir der Taxifahrer und zeigt auf das Haus. Ich krame in meiner Tasche herum, fühle mich verpflichtet, ihm ein Trinkgeld zu geben, schon allein weil er so auskunftsfreudig war.
»Danke«, sagt er mit einem Mal etwas munterer, doch da ist ein besorgter Ausdruck in seinen Augen. »Machen Sie Gefängnisbesuche?«
Ich zögere. Ist es etwa das, wofür er mich hält? Einen Gutmenschen, der es als seine Pflicht ansieht, sich der Frevler anzunehmen?
»In gewisser Weise.«
Er schüttelt den Kopf. »Seien Sie vorsichtig. Diese Typen – die sind nicht ohne Grund da drin.«
Und dann ist er fort. Ich sehe zu, wie das Taxi die Auffahrt hinunter verschwindet – meine letzte Verbindung zur Außenwelt. Erst als ich auf das Haus zugehe, fällt mir ein, dass ich vergessen habe, mir eine Quittung ausstellen zu lassen. Wenn ich nicht einmal das zustande bringe, wie viel Hoffnung besteht dann für Joe Thomas?
Und, viel wichtiger noch, hat er es überhaupt verdient, Hoffnung zu hegen?
»Zucker? Tesafilm? Chips? Scharfe Gegenstände?«, herrscht mich der Mann auf der anderen Seite der Glastrennwand an.
Im ersten Moment glaube ich, mich verhört zu haben. Der Anblick des schönen Hauses war erleichternd, dieses Gefängnis würde gar nicht so schlimm sein wie befürchtet. Doch als ich läutete, wies mich ein Mitarbeiter an, über das Gelände zurückzugehen, vorbei an den Mietcontainern und auf die hohe Mauer mit den Stacheldrahtrollen zu, die ich zuvor gar nicht bemerkt hatte. Mit klopfendem Herzen schritt ich daran entlang bis zu einer kleinen Tür.
Bitte läuten stand auf einem Schild.
Ein wenig kurzatmiger, als mir lieb war, gehorchte ich. Die Tür öffnete sich automatisch, und ich fand mich in einem kleinen Raum wieder, der sich nicht sonderlich von dem Wartebereich eines bescheidenen Inlandsflughafens unterschied. Auf einer Seite befand sich eine Glastrennwand, an der ich nun stand.
»Zucker, Tesafilm, Chips, scharfe Gegenstände?«, wiederholt der Mann und wirft dabei einen Blick auf meine Aktentasche. »Spart Zeit, wenn Sie es herausnehmen, bevor man Sie durchsucht.«
»Ich habe nichts davon bei mir … Aber welche Rolle würde es spielen, wenn ich die ersten drei hätte?«
Seine kleinen Knopfaugen bohren sich in meine. »Aus Zucker kann man Fusel herstellen. Mit Tesafilm jemanden knebeln. Und die Chips haben Sie vielleicht dabei, um jemanden zu bestechen oder sich beliebt zu machen. Glauben Sie mir, ist alles schon vorgekommen. Zufrieden?«
Er scheint es auf jeden Fall zu sein. Die Sorte kenne ich. Erinnert mich an meinen Chef. Der genießt es auch, dafür zu sorgen, dass Leute sich unbehaglich fühlen. Es ist ihm zwar gelungen, aber etwas in mir – eine Stärke, von der ich nicht wusste, dass ich sie besitze – bringt mich dazu, mich der Situation gewachsen zu zeigen.
»Wenn Sie mit ›jemanden‹ Ihre Insassen meinen, so fürchte ich, dass die heute Pech haben«, entgegne ich, »denn ich habe nichts von Ihrer Liste bei mir.«
Er murmelt etwas, das wie »verdammte Strafverteidiger« klingt, bevor er auf einen Knopf drückt. Eine andere Tür öffnet sich, und eine Wärterin tritt heraus. »Arme hoch«, fordert sie mich auf.
Das Ganze erinnert mich erneut an einen Flughafen, außer dass hier nichts piept.
»Öffnen Sie bitte die Aktentasche.«
Ich folge ihrer Aufforderung. Darin befinden sich eine Reihe von Unterlagen, meine Schminktasche und eine Rolle Pfefferminz.
Die Frau hält die beiden Letzteren in die Höhe wie Trophäen. »Die muss ich konfiszieren, bis Sie uns wieder verlassen. Ihren Schirm auch.«
»Meinen Schirm?«
»Potenzielle Waffe«, entgegnet sie knapp, doch ich bemerke eine gewisse Freundlichkeit in ihrer Stimme, die dem Mann hinter der Abtrennung fehlte.
»Hier entlang, bitte.«
Sie führt mich durch eine weitere Tür, und ich finde mich zu meiner Überraschung in einem recht hübschen Hofgarten wieder. Männer in Robin-Hood-grünen Jogginghosen und passenden Oberteilen pflanzen Goldlack. Meine Mutter tut das Gleiche in Devon – das hat sie mir gestern Abend am Telefon erzählt. Wahrscheinlich tun dies noch wer weiß wie viele andere Menschen auf dieser Welt, aber ganz offensichtlich bedeutet eine Tätigkeit, die einen verbindet, noch lange nicht, dass man etwas gemeinsam hat.
Einer der Männer wirft einen Blick auf den Ledergürtel um die Taille der Wärterin. Daran sind ein Schlüsselbund und eine silberne Pfeife befestigt. Wie wirksam wären diese, wenn uns die Männer angreifen würden?
Wir überqueren den Platz in Richtung eines weiteren Gebäudes. Meine Begleiterin nimmt den Bund von ihrem Gürtel, wählt einen Schlüssel aus und öffnet die Tür zu einem weiteren Eingangsbereich. Vor uns befinden sich zwei weitere Türen. Doppeltüren und dazu noch Doppeltore, die nur wenige Zentimeter Abstand voneinander trennen. Sie schließt sie auf und hinter uns gleich wieder zu. »Vorsicht, klemmen Sie sich nicht die Finger.«
Vor uns erstreckt sich ein Flur. Auf beiden Seiten sind weitere Türen, ausgeschildert mit »Trakt A«, »Trakt B« und »Trakt C«.
Eine Gruppe von Männern in orangefarbenen Trainingsanzügen kommt auf uns zu.
Einer der Männer – kahl, mit einer glänzenden Glatze – nickt der Wärterin zu. »Morgen, Miss.«
Dann starrt er mich an. Alle tun das. Ich spüre, wie ich feuerrot werde.
Nachdem sie vorbei sind, frage ich: »Dürfen die Insassen einfach so herumlaufen?«
»Nur wenn sie ihren Trakt mit einem bestimmten Ziel verlassen – beispielsweise um in den Kraftraum zu gehen, in die Kapelle oder zum Unterricht. Das erfordert weniger Überwachung, als wenn Wachleute Gefangene aufgrund gewisser Umstände einzeln begleiten müssen.«
Ich verkneife mir die Frage, um welche Umstände es sich dabei handelt, doch ehe ich mich versehe, kommt mir eine andere Frage über die Lippen.
»Dürfen sie sich die Farben selbst aussuchen, die sie tragen? Dieses Orange, zum Beispiel?«
»Das zeigt, in welchem Trakt sie untergebracht sind. Stellen Sie ihnen bloß nicht solche Fragen, sonst denken sie noch, Sie hätten Interesse an ihnen. Manche dieser Männer sind gefährlich klug. Sie werden versuchen, Sie für ihre Zwecke zu benutzen und sich mit Ihnen anzufreunden, um Sie auf ihre Seite zu bringen oder damit Sie weniger wachsam sind. Und ehe Sie sich versehen, bekommen sie Informationen aus Ihnen heraus, ohne dass Sie es merken, oder sie bringen Sie dazu, Dinge zu tun, die Sie nicht tun sollten.«
Das ist doch lächerlich! Welcher Idiot würde schon auf so etwas hereinfallen? Wir bleiben stehen. Die Tür zu Trakt D. Ich trete hindurch, und die Wärterin schließt sie sorgfältig hinter uns ab. Dann führt sie mich in ein Büro.
Zwei junge Männer sitzen an einem Schreibtisch. Kurze Haare, fragende Augen.
»Rechtsbeistand für Mr. Thomas«, sagt meine Begleiterin. Sie betont das »Mr.« auf eine Weise, dass es sarkastisch klingt.
»Bitte hier unterschreiben«, fordert mich einer der beiden Männer auf. Sein Blick wandert von meiner Aktentasche zu meinem Busen und wieder zurück zur Aktentasche. Ich bemerke, dass vor uns ein Boulevardblatt mit einem leicht bekleideten Model liegt. Der Mann schaut auf seine Uhr. »Sie sind fünf Minuten zu spät.«
Das ist nicht meine Schuld, bin ich versucht zu sagen. Ich wurde durch Ihre Sicherheitsvorschriften aufgehalten. Aber etwas sagt mir, dass es besser ist, den Mund zu halten. Es mir für die Kämpfe aufzusparen, die wirklich wichtig sind.
»Hab gehört, dass Thomas Rechtsbeschwerde einlegen will«, sagt der andere Mann. »Manche Leute geben einfach nie auf, was?«
Hinter uns ertönt ein höfliches Hüsteln. Ein großer, kräftig gebauter, dunkelhaariger Mann mit einem kurzen, gepflegten Bart steht in der Bürotür. Doch statt mich anzustarren, schenkt er mir jetzt ein dünnes Lächeln und streckt mir die Hand entgegen. Sein Händedruck ist fest. Man merkt ihm den erfahrenen Verkäufer immer noch an.
Er sieht nicht wie ein typischer Gefangener aus – oder zumindest nicht wie die Sorte, die ich mir vorgestellt habe. Im Gegensatz zu dem Wärter neben mir, auf dessen Arm ein rot-blauer Drachenkopf prangt, hat er keine sichtbaren Tattoos. Mein neuer Mandant trägt eine teuer aussehende Armbanduhr und blank polierte, braune Lederschuhe, die sich von den Turnschuhen der anderen Männer abheben und so gar nicht zu seiner grünen Gefängnisuniform passen. Ich habe das Gefühl, dass dieser Mann eher an Sakko und Krawatte gewöhnt ist. Tatsächlich bemerke ich erst jetzt, dass unter dem vorschriftsmäßigen Sweatshirt ein weißer Hemdkragen hervorschaut. Sein Haar ist kurz, aber gut geschnitten, lässt eine hohe Stirn über dunklen Augenbrauen erkennen. Der Ausdruck in seinen Augen deutet auf jemanden hin, der skeptisch und hoffnungsvoll zugleich und dabei auch ein wenig nervös ist. Seine Stimme entpuppt sich bei seinen ersten Worten als tief und selbstbewusst, klingt aber weder primitiv noch kultiviert. Er könnte ein Nachbar sein. Ein Anwaltskollege. Oder der Manager eines Restaurants aus der Gegend.
»Ich bin Joe Thomas«, sagt er und lässt meine Hand los. »Danke, dass Sie hergekommen sind.«
»Lily Macdonald«, erwidere ich. Mein Chef hatte mir geraten, Vor- und Nachname zu benutzen. (»Auch wenn Sie Distanz wahren müssen, sollten Sie es vermeiden, überheblich zu wirken. Es ist nicht leicht, das richtige Gleichgewicht zwischen Anwalt und Mandant zu halten.«)
Ich lese eine stille Bewunderung in Joe Thomas’ Gesicht und erröte erneut – dieses Mal allerdings weniger aus Angst, sondern vielmehr aus Verlegenheit. Bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen mir ein Mann Aufmerksamkeit schenkte, wusste ich nie, wie ich darauf reagieren sollte. Und hier, wo es eindeutig fehl am Platz war, vermochte ich noch weniger damit umzugehen. Da ist immer diese spöttische Stimme aus Kindertagen in meinem Kopf, die ich einfach nicht loswerde. Dicke Lily. Pummel. Mops. Eigentlich kann ich es immer noch nicht glauben, dass ich einen Ehering trage.
»Folgen Sie mir«, sagt einer der Wärter mit angespannter Stimme.
Joe Thomas und ich gehen gemeinsam den Flur hinunter in einen kleinen Besuchsraum. Das vergitterte Fenster geht auf einen betonierten Innenhof hinaus. Alles hier drin ist grau: der Tisch, die Metallstühle auf beiden Seiten, die Wände. Es gibt nur eine Ausnahme: ein Poster mit einem Regenbogen, darunter in violetten Großbuchstaben das Wort HOFFNUNG.
»Ich warte dann draußen vor der Tür«, sagt der Wärter. »Sind Sie damit einverstanden?« Jedes Wort ist mit einer Abscheu überzogen, die sich gegen uns beide richtet.
»Gefängniswärter sind nicht besonders versessen auf Strafverteidiger«, hatte mich mein Chef gewarnt. »Die glauben, dass sie ihnen ins Handwerk pfuschen. Dass sie versuchen, Leute rauszupauken, deren Einbuchten die Polizei und die Staatsanwaltschaft jede Menge Blut, Schweiß und Tränen gekostet hat.«
Unter diesem Aspekt betrachtet, konnte ich seinen Standpunkt verstehen.
Joe Thomas sieht mich fragend an. Ich stähle mich, um seinen Blick zu erwidern. Ich bin zwar groß, aber er ist größer. »Besuche finden in der Regel in Sichtweite, aber nicht unbedingt in Hörweite eines Wärters statt«, hatte mein Chef hinzugefügt. »Insassen tendieren dazu, mehr preiszugeben, wenn sich kein Wärter im Raum aufhält. Aber die Gefängnisse handhaben das auf unterschiedliche Art und Weise. Einige lassen Ihnen keine Wahl.«
Dieses hier schon.
Nein, das bin ich nicht, hätte ich am liebsten geantwortet. Bitte bleiben Sie bei mir.
»Ja, geht in Ordnung. Vielen Dank.« Meine Stimme scheint einer anderen zu gehören. Einer, die tapferer ist. Die mehr Erfahrung in diesen Dingen hat.
Der Wärter sagt: »Klopfen Sie an die Tür, wenn Sie fertig sind.« Dann geht er raus.
Und wir sind allein.
4
CARLA
Die Zeit wollte einfach nicht vergehen. Carla schaute zu der Wanduhr im Klassenzimmer. Der große Zeiger war auf der Zehn und der kleine auf der Zwölf. Bedeutete das nun, dass es zehn Minuten nach zwölf war? Oder zwölf Minuten nach zehn? Oder etwas völlig anderes, denn Mamma sagte immer: »In diesem Land ist alles anders.«
Carlas Blick wanderte über die Tische um sie herum hinweg. Jeden zierte ein grünes Raupenfedermäppchen, und alle platzten sie förmlich vor Bleistiften, Buntstiften, Filzstiften und Füllhaltern mit echter Tinte. Ach, wie sie ihr eigenes billiges Plastikmäppchen mit dem hakeligen Reißverschluss und dem einsamen Kugelschreiber darin hasste! Doch das war leider alles, was Mamma sich leisten konnte.
Kein Wunder, dass sich niemand mit ihr anfreunden wollte.
»Carla!«
Die Stimme der Lehrerin ließ sie zusammenzucken.
»Vielleicht kannst du es uns sagen!« Sie zeigte auf das Wort an der Tafel. »Was bedeutet dieses Wort?«
P Ü N K T L I C H? Dieses Wort war ihr noch nie begegnet, obwohl sie jeden Abend im Bett im Kinderwörterbuch las. Sie war bereits bei »D« angelangt.
D für dünn.
D für duschen.
D für Drama.
Carla hatte die Bedeutung jedes Wortes gewissenhaft in einem Heft aufgeschrieben, das unter ihrem Kopfkissen lag, und ein kleines Bild dazu gezeichnet, um sich besser daran erinnern zu können, was es bedeutete.
»Duschen« war leicht, auch wenn Mamma die Nase darüber rümpfte. »Drama« dagegen schon schwieriger.
»Carla!« Die Stimme der Lehrerin klang nun schärfer. »Träumst du schon wieder vor dich hin?«
Leises Lachen erklang um sie herum. Carla errötete. »Sie weiß es nicht«, ertönte im Singsang die Stimme des Jungen hinter ihr. Dann – ein bisschen gedämpfter, damit es die Lehrerin nicht hören konnte: »Zottelcarla Spagoletti!«
Das Lachen wurde lauter.
»Kevin«, mahnte die Lehrerin, allerdings nicht so streng wie zuvor bei Carla. »Was hast du gesagt?«
Doch ohne eine Antwort abzuwarten, wandte sie sich wieder Carla in der zweiten Reihe zu und durchbohrte sie mit ihrem Blick. Carla hatte sich diesen Platz ausgesucht, weil sie begierig darauf war, etwas zu lernen. Aber es waren immer die, die hinten saßen, die störten und ungestraft davonkamen.
»Buchstabiere es, Carla. Mit welchem Buchstaben fängt es an?«
»P.« So viel wusste sie. Dann ein »U«, oder? Und dann …
»Komm schon, Carla.«
»Punktlicht.«
Das Kreischen und das Gelächter, das um sie herum ausbrach, war ohrenbetäubend. »Ich bin zu Hause nur bis ›D‹ gekommen«, versuchte sie ihnen zu erklären, doch es half nichts. Ihre Stimme wurde übertönt von dem Lachen und der lauten Klingel, die in diesem Moment erschallte. Sogleich wurden hektisch Bücher weggepackt, Füße schlurften über den Boden, und die Lehrerin rief irgendetwas über eine neue Regel, die zur Mittagszeit fürs Spielen galt.
Mittagszeit? Dann musste es zehn nach zwölf sein und nicht zwölf nach zehn! Carla blieb sitzen und genoss für einen Moment die Ruhe und den Frieden in dem nun leeren Klassenzimmer.
Kevin hatte seine grüne Raupe auf dem Tisch liegen lassen.
Sie blinzelte ihr zu. Charlie, sagte sie. Ich heiße Charlie.
Sie schlich mit angehaltenem Atem auf Zehenspitzen hinüber und strich über seinen flauschigen Pelz. Und dann steckte Carla Charlie langsam, ganz langsam, weil ihr bange zumute war, in ihre Bluse. Mamma sagte, dass sie schon bald ihren ersten Büstenhalter benötigen würde. In der Zwischenzeit musste sie mit einem Unterhemd auskommen. Aber man konnte immer noch Sachen darin verstecken, genauso wie Mamma es oft mit Papiergeld »für Notfälle« machte.
»Du gehörst jetzt mir«, flüsterte sie, als sie ihre Strickjacke überzog. »Er hat dich nicht verdient.«
»Was machst du denn hier?« Eine Lehrerin steckte ihren Kopf zur Tür herein. »Du solltest in der Kantine sein. Mach dich auf den Weg!«
Carla setzte sich in einiger Entfernung von den anderen Kindern hin, in dem Bewusstsein, dass sich Charlie an ihre Brust schmiegte. Sie ignorierte die üblichen gehässigen Bemerkungen (»Hast du nicht deine eigenen Spaghetti mitgebracht, Carla?«) und arbeitete sich durch eine Schüssel mit zähem Fleisch. Als es Zeit war, um auf dem Schulhof zu spielen, begab sie sich ans hintere Ende, setzte sich dort auf den Asphalt und versuchte, sich unsichtbar zu machen.
Normalerweise überkam sie ein Gefühl von Traurigkeit, fühlte sie sich ausgeschlossen. Aber heute war es anders. Denn jetzt hatte sie ihre eigene grüne Raupe, die sich so warm und tröstlich anfühlte an ihrer Haut. »Wir passen aufeinander auf«, flüsterte Carla.
Aber was ist, wenn sie herausfinden, dass du mich mitgenommen hast?, erwiderte Charlie flüsternd.
»Ich werde mir was einfallen lassen.«
Auuuuu!
Der Schlag gegen ihren Kopf kam völlig überraschend, denn Carla hatte nicht gemerkt, dass ein Fußball auf sie zusauste. Ihr schwirrte der Kopf, und es kam ihr so vor, als würde ihr rechtes Auge gar nicht mehr ihr gehören.
»Alles in Ordnung? Geht es dir gut, Carla?« Die Stimme der Lehrerin schien von weither zu kommen. In der Ferne sah sie ein wenig verschwommen, wie eine andere Lehrerin Kevin ausschimpfte. Der, dem die Raupe Charlie in Wahrheit gehörte.
»Kevin! Hast du denn eben nicht zugehört? Ballspiele sind in diesem Teil des Schulhofs verboten! Sieh nur, was du angerichtet hast!«
Das ist unsere Chance, zischte Charlie. Sag ihr, dass du nach Hause willst, dann können wir uns aus dem Staub machen, bevor sie merken, dass ich weg bin.
Carla rappelte sich auf, wobei sie sich hütete, allzu plötzliche Bewegungen zu machen, damit ihr neuer Freund nicht auf Wanderschaft ging. Sie verschränkte die Arme, um Charlies Umrisse zu verbergen, und rang sich ein Lächeln ab. Ein tapferes Lächeln, wie sie es immer vor dem Spiegel übte. Das war ein Trick, den sie von Mamma gelernt hatte. Jeden Abend, bevor der Mann mit dem blitzblanken Wagen eintraf, verwandelte sich der Gesichtsausdruck ihrer Mutter einige Male, während sie in den Spiegel der Frisierkommode blickte. Ein freudiges Lächeln, wenn er pünktlich war. Ein etwas traurig wirkendes Lächeln, wenn er zu spät kam. Dann dieses Lächeln mit leicht zur Seite geneigtem Kopf, wenn sie ihn fragte, ob er gern noch ein Glas hätte. Und schließlich das Lächeln, das nie in ihren Augen ankam und mit dem sie Carla ins Bett schickte, damit sie sich allein mit Larry etwas Musik anhören konnte.
Nun setzte Carla ein trauriges Lächeln auf. »Mein Auge tut weh. Ich möchte nach Hause.«
Die Lehrerin runzelte die Stirn und nahm sie mit ins Schulsekretariat. »Wir müssen deine Mutter anrufen, um sicherzustellen, dass sie auch daheim ist.«
Aiuto! Hilfe! Daran hatte sie nicht gedacht. »Unser Telefon funktioniert nicht, weil wir die Rechnung nicht bezahlt haben. Aber Mamma ist zu Hause.«
»Bist du dir da auch ganz sicher?«
Der erste Teil entsprach der Wahrheit. Mamma wollte Larry von dem Telefon erzählen, wenn er das nächste Mal vorbeikam. Dann würde er dafür bezahlen, damit es wieder funktionierte. Aber was den zweiten Teil anging – dass ihre Mutter zu Hause war –, da hatte sie gelogen, denn Mamma war bei der Arbeit.
Doch sie musste es irgendwie schaffen, nach Hause zu kommen, bevor man Charlie in ihrer Schulbluse entdeckte.
»Hier ist eine dienstliche Telefonnummer angegeben«, verkündete die Lehrerin, die eine Mappe geöffnet hatte. »Versuchen wir sie mal für alle Fälle.«
Sie war geliefert. Zitternd lauschte sie der Unterhaltung.
»Verstehe.« Die Lehrerin beendete das Telefonat und wandte sich dann seufzend wieder Carla zu. »Wie es scheint, hat sich deine Mutter den Tag heute freigenommen. Weißt du, wo sie ist?«
»Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Sie ist zu Hause!« Die Lüge kam ihr so leicht über die Lippen, dass es ihr fast vorkam, als hätte sie ihr jemand in den Mund gelegt. »Ich kann allein gehen«, fügte sie hinzu und richtete ihr gesundes Auge auf die Lehrerin.
»Es ist nicht weit.«
»Ich fürchte, das darf ich nicht erlauben. Gibt es sonst noch jemanden, den wir anrufen können? Vielleicht einen Nachbarn, der deine Mutter herbringen kann?«
Carla fielen die Frau mit dem goldblonden Haar und ihr Mann ein. Aber Mamma und sie hatten noch nie mit ihnen gesprochen. »Wir müssen für uns bleiben«, sagte Mamma immer. Larry wollte es so. Er wollte sie beide für sich allein haben.
»Ja«, sagte Carla verzweifelt. »Mammas Freund. Larry.«
»Kennst du seine Telefonnummer?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Miss, Miss!« Eins der anderen Kinder aus ihrer Klasse klopfte an die Tür. »Kevin hat Tom geschlagen!«
Die Lehrerin gab ein Stöhnen von sich. »Ich komme.« Auf dem Weg nach draußen gingen sie an der Frau vorbei, die in ihrer Klasse aushalf. Sie war neu und trug ständig Sandalen, auch wenn es regnete. »Sandra, bitte bringen Sie Carla hier nach Hause, ja? Sie wohnt nicht weit weg. Offenbar ist ihre Mutter daheim. Kevin? Hör sofort damit auf!«
Als sie mit der Sandalenfrau in ihre Straße einbog, begann sich Carla plötzlich wirklich wackelig auf den Beinen zu fühlen. Ihr Auge tat weh, und sie hatte Schwierigkeiten, es offen zu halten. Und da war ein pochender Schmerz über ihrer Augenbraue, dass ihr davon der ganze Schädel brummte. Aber viel schlimmer noch war die Gewissheit, dass Mamma nicht da sein würde und sie dann zurück in die Schule musste.
Keine Sorge, flüsterte Charlie. Ich werde mir etwas einfallen lassen.
Da sollte er sich aber besser beeilen!
»Kennst du den Zahlencode?«, fragte die Sandalenfrau, als sie am Haupteingang zu ihrem Gebäude ankamen. Natürlich. Die Tür schwang auf. Aber als sie dann vor ihrer Wohnungstür mit der Nummer 7 standen, öffnete niemand.
»Vielleicht ist meine Mutter mal kurz weg, um Milch zu holen«, sagte Carla verzweifelt. »Ich kann ja mit dem Ersatzschlüssel aufschließen, und wir warten drinnen auf sie.«
Carla machte es immer so, da Mamma in der Regel erst nach ihr nach Hause kam. Dann vertrieb sie sich die Zeit bis sie eintraf mit Aufräumen (weil ihre Mutter morgens immer so in Eile war) und begann schon, Risotto oder Nudeln zu kochen. Einmal, als ihr schrecklich langweilig war, warf sie einen Blick unter Mammas Bett, wo sie »besondere Dinge« aufbewahrte. Dort war auch ein Briefumschlag mit Fotos, und auf jedem Foto war derselbe junge Mann mit einem schief sitzenden Hut auf dem Kopf und einem selbstbewussten Lächeln. Etwas sagte ihr, dass sie besser kein Wort darüber verlieren sollte. Wenn Mamma nicht zu Hause war, holte sie sie aber hin und wieder hervor.
Nun musste sie (nachdem sie auf einen Stuhl vom Korridor geklettert war) jedoch feststellen, dass der Schlüssel nicht an seinem gewohnten Platz auf dem Türsims lag. Nummer 7. Eine Glückszahl, sagte Mamma, als sie einzogen. Sie müssten nur noch darauf warten, dass das Glück eintraf.
Wenn sie doch nur einen Schlüssel für die Hintertür neben den Mülltonnen auf der Rückseite hätte. Aber der Ersatzschlüssel war für Larry, damit dieser in die Wohnung kam, wann immer er sich ein wenig mit Mamma ausruhen wollte. Ihre Mutter witzelte, dass es fast schon sein Privateingang im Parterre sei!
»Ich kann dich nicht hierlassen«, sagte die Sandalenfrau mit einem jammernden Tonfall, ganz so, als wäre das Carlas Schuld. »Wir müssen wieder zurückgehen.«
O nein. Bitte nicht. Kevin jagte ihr Angst ein. Genauso wie die anderen Kinder. Charlie, tu doch was!
Und dann vernahm sie plötzlich das Geräusch schwerer Schritte, die auf sie zukamen.
5
LILY
Joe Thomas sitzt mir gegenüber und notiert etwas auf einem Blatt Papier.
Ich streiche mir die Haare aus dem Gesicht, versuche, den Kohlgeruch zu ignorieren, der vom Gang draußen hereinzieht, und werfe einen Blick auf das Geschriebene, als Joe das Blatt in die Mitte des Tisches schiebt.
Klage
Gericht
Zelle
abgebrüht
Sein Charme ist verflogen. »Was haben diese vier Wörter wohl gemeinsam?«, knurrt er und legt den Stift demonstrativ beiseite. Er will offensichtlich, dass ich nach seinen Regeln spiele.
Für jeden anderen mag das nervenzermürbend sein, doch dank meines Bruders habe ich eine Menge Übung in solchen Dingen, die mir nun zugutekommt. Als Daniel noch am Leben war (ich muss mich auch heute noch überwinden, dies auszusprechen) und wir zusammen aufwuchsen, da hatte er ein Faible für Wortspiele, Spiegelwörter, Silbendreher oder schrieb auch mal Wörter und ganze Sätze auf dem Kopf, falsch herum oder in einer seltsamen Reihenfolge.
Er kann nichts dafür, sagte unsere Mutter immer. Aber ich wusste, dass er sehr wohl etwas dafür konnte, denn wenn wir zwei allein waren, schrieb mein Bruder ganz normal. Das ist ein Spiel, sagten seine Augen, aus denen der Schalk hervorblitzte. Mach mit! Wir gegen die!
Und nun vermute ich, dass Joe Thomas auch ein Spiel mit mir spielt. Das ist wie ein Ansporn für mich, und ich fühle mich mit einem Mal stark. Er hat sich nämlich die Falsche ausgesucht. Ich kenne sämtliche Tricks. Auf diesem Gebiet macht mir so schnell keiner was vor.
»Das sind Wörter, die bei gleicher Schreibweise unterschiedliche Bedeutungen haben. ›Gericht‹ beispielsweise ist eine Mahlzeit oder ein Organ der Rechtsprechung. ›Abgebrüht‹ kann jemand sein, der abgestumpft oder gefühllos ist, oder etwas, das mit heißem Wasser behandelt wurde. Es gibt also für etwas verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, wollen Sie mir DAS damit sagen?«
Joe Thomas schlägt die Hacken zusammen. Klack, klack. »Genau. Wenn die Menschen das nur bedenken würden.«
Er gibt ein kleines, humorloses Lachen von sich. Als ob die, die nicht so denken, etwas Wichtiges im Leben verpassen.
Ich frage mich, wer wohl das violette Poster mit dem HOFFNUNG-Schriftzug aufgehängt hat. Vielleich ein wohlmeinender Wärter? Oder einer dieser Idealisten, die Gefängnisinsassen besuchen? Mir wird klar, dass es hier drin alle möglichen Arten von Leuten gibt.
Wie zum Beispiel meinen Mandanten.
Ich könnte selbst etwas Hoffnung gebrauchen. Ich blicke auf meine Unterlagen. »Dann lassen Sie uns doch gleich einmal bei ›abgebrüht‹ in seiner zweiten Bedeutung bleiben. Im Bericht heißt es, dass die Verbrühungen ihrer Freundin so schlimm gewesen sind, dass sich ihre Haut in dem kochend heißen Wasser abgeschält hat.«
Da ist nicht einmal ein Zucken in Joe Thomas’ Gesicht. Aber was erwarte ich? Er muss inzwischen an diese Beschuldigungen und Gegenbeschuldigungen gewöhnt sein. Darum geht es ja in diesem speziellen Gefängnis. Man könnte es auch »Diskussion« nennen. Psychologen, die sich mit Gefangenen über ihre Verbrechen unterhalten. Andere Männer, die in anderen Gruppen das Gleiche tun. Ein Vergewaltiger, der zu erfahren verlangt, warum ein anderer dessen Mutter die Kehle aufgeschlitzt hat. Und Letzterer Ersteren attackiert, weil er an der Gruppenvergewaltigung einer Dreizehnjährigen beteiligt war.
Mein Chef hat sich ein Vergnügen daraus gemacht, mich ins Bild zu setzen. Es war beinahe so, als wollte er mir Angst einjagen. Und trotzdem spüre ich nun, da ich hier im Gefängnis bin, wie mich eine ungebetene schleichende Neugierde überkommt. Wieso hat Joe Thomas seine Freundin in kochend heißem Wasser umgebracht?
Falls er es denn wirklich getan hat.
»Schauen wir uns noch einmal die Beweismittel der Staatsanwaltschaft bei Ihrem Prozess an«, sage ich.
Er wirkt ungerührt, ganz so, als seien wir im Begriff, eine Einkaufsliste durchzugehen.
Ich sehe auf meine Notizen hinab, auch wenn ich damit eher versuche, für einen Moment seinem Blick zu entgehen, als mein Gedächtnis, aufzufrischen. Ein guter Anwalt benötigt ein gutes Gedächtnis, und ich erinnere mich an jedes Detail. Manchmal wünschte ich, es wäre anders. Doch gerade jetzt ist es von entscheidender Bedeutung.
»Sarah und Sie sind wenige Monate, nachdem Sie sich in einem Pub kennengelernt haben, zusammengezogen. Vor Gericht haben ihre Freunde von einer Achterbahnbeziehung gesprochen. Sarahs Eltern haben im Zeugenstand ausgesagt, Sie hätten sie stark kontrolliert und sie habe Angst gehabt, dass Sie ihr wehtun könnten. Der Polizeibericht belegt, dass Sarah Sie einmal angezeigt hat, weil Sie sie die Hintertreppe hinuntergeschubst und ihr das rechte Handgelenk gebrochen haben. Sie hat die Anzeige allerdings später wieder zurückgezogen.«
Joe Thomas nickt einmal kurz. »Das ist richtig. Sie ist gefallen, weil sie betrunken war, obwohl sie versprochen hatte, keinen Alkohol mehr anzurühren. Aber sie hat zunächst mich beschuldigt, weil sie nicht wollte, dass ihre Familie erfährt, dass sie wieder an der Flasche hängt.« Er zuckt mit den Schultern. »Trinker können schreckliche Lügner sein.«
Als ob ich das nicht wüsste!
»Aber eine ihrer früheren Freundinnen hat ebenfalls Anschuldigungen gegen Sie erhoben. Sie sollen sie gestalkt haben.«
Er gibt ein kleines verächtliches Schnauben von sich. »Ich würde das nicht als ›Stalking‹ bezeichnen. Ich bin ihr nur ein paarmal gefolgt, um herauszufinden, ob sie wirklich dorthin geht, wohin sie angeblich gehen wollte. Aber sie hat es sich ja ohnehin anders überlegt und die Anschuldigungen zurückgenommen.«
»Weil Sie sie bedroht haben?«
»Nein. Weil ihr klar geworden ist, dass ich ihr folge, weil sie mir etwas bedeutet.« Er wirft mir einen ausdruckslosen Blick zu. »Aber ich habe sie schon bald danach in die Wüste geschickt.«
»Warum?«
»Weil ich mir nichts mehr aus ihr gemacht habe. Sie hat nicht nach meinen Regeln gelebt.«
Wenn das keine passende Antwort für einen Kontrollfreak ist!
»Und dann sind Sie Sarah begegnet.«
Er nickt. »Ein Jahr und zwei Tage später.«
»Sie scheinen sich da sehr sicher zu sein.«
»Zahlen und Daten sind meine Stärke.«
Er sagt dies offensichtlich nicht, um damit anzugeben. Es klingt eher wie eine Feststellung, die so offensichtlich ist, dass sie eigentlich keiner Erwähnung bedarf.
Ich fahre fort. »Am Abend ihres Todes wollen Ihre Nachbarn Schreie gehört haben.«
Joe schüttelt den Kopf. »Die Jones? Die beiden hatten was gegen uns und hätten alles Mögliche ausgesagt. Das habe ich meinem Anwalt damals auch so geschildert. Wir hatten jede Menge Probleme mit ihnen, nachdem wir eingezogen waren.«
»Glauben Sie, sie haben sich das ausgedacht? Warum sollten sie das tun?«
»Woher soll ich das wissen? Aber wie schon gesagt, wir sind nicht gut miteinander klargekommen. Ihr Fernseher war immer zu laut. Wir haben nie unsere Ruhe gehabt. Wir haben uns bei ihnen beschwert, aber das war ihnen egal. Später wurden sie richtig unangenehm. Fingen an, uns zu drohen. Und Abfälle in unseren Garten zu werfen.« Er presst für einen Moment die Lippen aufeinander. »Mich des Mordes zu beschuldigen ging dann allerdings doch ein bisschen zu weit.«
»Was ist mit Ihren Fingerabdrücken auf dem Boiler?« Ich deute auf die fraglichen Zeilen im Bericht. »Die Staatsanwaltschaft behauptet, Sie hätten die Wassertemperatur auf die höchste Stufe eingestellt.«
Seine dunklen Augen blinzeln nicht einmal. »Ich habe das doch schon alles meinem damaligen Verteidiger erklärt. Muss ich es wirklich noch einmal wiederholen? Die Flamme ging immer aus, also musste ich sie ständig neu zünden. Natürlich waren meine Fingerabdrücke auf dem Boiler.«
»Also wie ist Sarah gestorben, wenn Sie sie nicht umgebracht haben? Wie erklären Sie die Blutergüsse auf ihrem Körper?«
Er beginnt, mit den Fingern wie zu einem lautlosen Rhythmus auf den Tisch zu trommeln. »Hören Sie. Ich werde Ihnen genau sagen, wie es passiert ist. Aber Sie müssen es mich auf meine Weise tun lassen.«
Ich begreife, dass dieser Mann die Kontrolle einfach haben MUSS. Ich werde ihm für eine Weile den Gefallen tun. Mal sehen, was ich dabei herausfinde. »Meinetwegen.«
»Sie kam abends spät von der Arbeit zurück. Es war schon zwei Minuten nach acht, als sie endlich da war. Für gewöhnlich war sie pünktlich um sechs zu Hause.«
»Wie können Sie sich da so sicher sein?«
Sein Gesichtsausdruck verrät, dass ich etwas Dummes gesagt habe. »Weil sie exakt elf Minuten benötigte, um vom Geschäft nach Hause zu gehen. Das war einer der Gründe, weshalb ich sie ermutigt habe, den Job anzunehmen, nachdem wir zusammengezogen waren. Es war einfach praktisch.«
Ich weiß aus den Akten, dass Sarah Modeverkäuferin war. »Fahren Sie fort«, ermutige ich ihn.
»Sie war betrunken. Das war offensichtlich.«
»Inwiefern?«
Wieder dieser Blick.
»Sie konnte kaum noch gerade stehen. Sie stank nach Wein. Und wie sich herausstellte, hatte sie auch noch eine halbe Flasche Wodka intus, aber das Zeug ist nicht so leicht zu riechen.«
Ich werfe einen prüfenden Blick in meine Unterlagen. Er hat recht. Ihr Blutalkoholspiegel war hoch. Aber das ist kein Beweis, dass er sie nicht getötet hat. »Und dann?«
»Wir haben uns gestritten, weil sie so spät kam. Ich hatte wie immer das Abendessen vorbereitet. Lasagne mit Knoblauch, Basilikum und Tomatensoße. Das war natürlich alles trocken und ungenießbar geworden. Also haben wir uns gezankt. Und wir sind zugegebenermaßen dabei etwas laut geworden. Aber niemand hat geschrien, wie die Nachbarn behaupteten.« Sein Gesicht trägt einen entrüsteten Ausdruck. »Und dann hat sie sich auf den Küchenboden erbrochen.«
»Weil sie betrunken war?«
»Tun Leute das nicht, wenn sie einen zu viel hatten? Ekelhaft. Danach schien es ihr besser zu gehen, aber da klebte überall Erbrochenes an ihr. Ich habe ihr geraten, ein Bad zu nehmen, und ihr gesagt, dass ich es wie immer einlaufen lassen würde. Aber sie wollte nichts davon hören. Hat mir die Tür vor der Nase zugeknallt und das Badradio laut gestellt. Radio 1. Ihr Lieblingssender. Also habe ich sie in Ruhe gelassen und sauber gemacht.«
Ich unterbreche ihn. »Haben Sie sich denn keine Sorgen gemacht, dass sie in ihrem Zustand unbeaufsichtigt ein Bad nahm?«
»Anfangs nicht. Wie gesagt, es schien ihr besser zu gehen, nachdem sie sich übergeben hatte. Sie wirkte nüchterner. Und was blieb mir schon übrig? Ich hatte Angst, sie würde mich wieder bei der Polizei anzeigen. Sarah war sehr einfallsreich.«
»Und wann haben Sie nach ihr gesehen?«