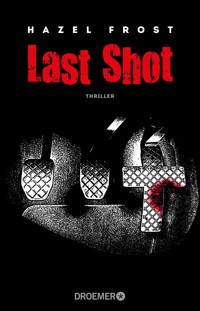
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Rache-Geschichte und Familien-Tragödie: Der adrenalingeladene Thriller »Last Shot« von Hazel Frost ist extrem cool, schockierend, schonungslos und spannend. Der smarte Russe Dima war nur mal kurz für kleine Jungs. Als er zum Wagen seiner Familie zurückkommt, sind sein Vater und seine Schwestern tot – durch Kopfschüsse aus nächster Nähe eiskalt hingerichtet. Vom jüngsten Familienmitglied, der sechsjährigen Mathilda, fehlt jede Spur. Dima hat nicht die leiseste Ahnung, in was seine Familie verwickelt war. Er weiß nur, dass er Mathilda finden muss – und den Mörder. Eine gnadenlose wie halsbrecherische Verfolgungsjagd durchs bayrische Voralpenland nach München beginnt, an deren Ende für Dima alles, was ihm noch geblieben ist, auf dem Spiel steht …Atemloser Thrill vom Feinsten! Spannend, tragisch und in jeder Hinsicht ungewöhnlich. Der Thriller »Last Shot« von Hazel Frost ist genauso aufwühlend wie unterhaltsam. Für die Fans von Luc Bessons »Léon, der Profi« und »Breaking Bad«. »Hazel Frost baut Höllen von heute – gewalttätig, bizarr, riskant, aber vor allem: sehr originell!« Thomas Wörtche
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Hazel Frost
Last Shot
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Rache-Geschichte und Familien-Tragödie: Der adrenalingeladene Thriller »Last Shot« von Hazel Frost: extrem cool, schonungslos und spannend.
Der smarte Russe Dima war nur mal kurz für kleine Jungs. Als er zum Wagen seiner Familie zurückkommt, sind sein Vater und seine Schwestern tot – durch Kopfschüsse aus nächster Nähe eiskalt hingerichtet. Vom jüngsten Familienmitglied, der sechsjährigen Mathilda, fehlt jede Spur. Dima hat nicht die leiseste Ahnung, in was seine Familie verwickelt war. Er weiß nur, dass er Mathilda finden muss – und den Mörder.
Eine gnadenlose wie halsbrecherische Verfolgungsjagd durchs bayrische Voralpenland beginnt, an deren Ende für Dima alles, was ihm noch geblieben ist, auf dem Spiel steht … Atemloser Thrill vom Feinsten!
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Prolog
JETZT
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
DAVOR
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
DANACH
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Epilog
Danksagung
Für Lino
»Auch wenn es dein Ego erschüttert, aber das ist nicht das erste Mal, dass ich eine Knarre vor der Nase habe.«
Pulp Fiction
Nur ein Idiot könnte total glücklich sein.
Mario Vargas Llosa
Prolog
Manche Tage sind schicksalhaft. Andere sind verregnet. Wieder andere sind beides zugleich.
Es regnete. Auf dem Boden kriechend, floh sie vor mir. Den gebrochenen rechten Arm zog sie nach wie ein überflüssiges Anhängsel. In dem nassen Dreck hinterließ sie eine Schleifspur. Sie machte nur geringe Fortschritte. Langsam folgte ich ihr. Die Austrittswunde auf der Rückseite ihres rechten Oberschenkels war groß und ausgefranst. Ein Geschoss mit »Mannstopp-Wirkung«. Früher wusste ich über solche Ausdrücke nicht Bescheid. Aber seitdem ich sie kannte, hatte sich so einiges geändert. Jetzt waren wir wieder hier. An dem Ort, wo alles anfing. Die Waffe hielt ich immer noch in der Hand. Angeekelt starrte ich sie an. Früher hätte ich sie weggeworfen. Aber jetzt wusste ich es besser: Ich steckte sie ein. In meiner Tasche raschelten die Plastikverpackungen. Die Verbände und die Glock waren Blutgeschwister. Ursache und Wirkung: Das traurige Ergebnis bewegte sich immer noch weg von mir. Verkrampft, mühsam.
Die gute Nachricht für sie war, dass sie nur wenig Blut verlor. Es vermischte sich mit dem braunen Wasser in den Pfützen, reicherte vielleicht den Eisengehalt an. Die schlechte Nachricht war, dass sie nicht weit kommen würde. Im Zweifelsfall würde ich sie daran hindern. Sie keuchte, robbte schief von mir weg. Aus den Zentimetern wurden Millimeter. Ihre Jeans: ein einziger fleckiger Fetzen. Auf dem Rücken ihrer schwarzen Lederjacke glitzerten winzige, transparente Perlen. Ich trat neben sie, beugte mich zu ihr hinab. Die Tropfen liefen mir in die Augen. Sie würde nicht sehen, dass ich weinte.
Die schwarzen Haare klebten ihr am Kopf. Der Regen, das Zwielicht verliehen ihnen einen fast überirdischen Glanz. Vorsichtig griff ich nach ihrem linken Arm. Sie leistete keinen Widerstand mehr. Hatte den Kampf aufgegeben. Alles an ihr war weich und nachgiebig. Als ich sie behutsam umdrehte, stöhnte sie. Der Schmerz verzerrte ihr Gesicht. Ich strich ihr ein paar Strähnen aus der Stirn. Die Berührung meiner Finger öffneten ihr die Augen. Sie wollte lächeln, aber es gelang ihr nicht.
»Du. Hilfst du mir?« In ihrer Stimme gab es mehr Hoffnung, als ich ertragen konnte. Es war ein Kraftakt, aber ich schüttelte den Kopf.
Für einen Moment lang sahen wir uns einfach nur an. Meine Hände wollten sie streicheln, aber ich zwang sie zur Untätigkeit.
Wenn Menschen so schwer verletzt sind, dass sie Hilfe brauchen, hat das nichts Heroisches mehr. Da ist nur noch nackte Angst, Verzweiflung, Resignation. Ein Unfall hinterlässt die Opfer beschämt. Weil sie andere brauchen, weil man sie anstarrt, weil sie nicht mehr Herr ihrer selbst sind. Das hier war kein Unfall, aber das Ergebnis war vergleichbar. Ich musste es wissen. Ich war ein Experte für Kontrollverluste. Ich hatte einen Beruf daraus gemacht. Gelegentlich war ich der Herr der Kontrolle.
»Lässt du mich sterben?« Ihre Lippen zitterten.
Ich schüttelte den Kopf.
Ein enttäuschter Ausdruck erschien in ihren Augen.
Ich griff nach ihrer gesunden Hand, tastete nach dem Puls. Mein Zeige- und Mittelfinger auf ihrer Haut. Sie war kalt. Kälte, die nicht nur von außen kam. Es erinnerte mich an unsere erste Berührung.
Ich fing an zu zählen.
»Hilf mir!«
Zu leben? Oder zu sterben? Eine einzige Grauzone, und ich hatte mich entschieden. Ich schüttelte den Kopf.
»Bitte.« Sie hatte noch nie zuvor »bitte« gesagt. Es jetzt zu hören ließ mich erschaudern. Ich hatte immer gewollt, geträumt, dass sie mich um etwas bitten würde. Heute war es zu spät. Warum sprach sie noch mit mir? Ich konnte mich so nicht konzentrieren.
»Bitte?« Ihr Fragezeichen vermischte sich mit den Tränen, die ihr aus den Augen liefen. Sie hatte erst ein Mal vorher geweint. Und ich musste erkennen, dass man Tränen sehr wohl von Regentropfen unterscheiden kann. Ohne Unterlass fielen sie auf ihr schönes Gesicht. Ihr perfektes, sonst so unbewegliches Gesicht. Warme und kalte Rinnsale liefen an ihren Wangen hinab in durchsichtigen Schlieren. Ihr Puls wurde schwächer. Das nächste »Bitte« hatte keinen Ton mehr. Nur noch eine lautlose Bewegung der immer heller werdenden Lippen. Sie war zu kraftlos zum Sprechen.
Ich fühlte eine leichte Nervosität. Ich wollte nicht zu viel riskieren. Noch zeigte sie keinerlei Anzeichen eines Schocks. Es galt, den richtigen Moment abzupassen. In meinem Kopf sandte ich die Botschaft aus: Lass los! Lass endlich los. Aber eine Frau wie sie würde es mir nicht leicht machen. Vom ersten Moment unseres Zusammentreffens an war nichts leicht gewesen. Die Blutzirkulation war nur noch ein schwaches Pochen unter ihrer Haut in großen Intervallen. Ihre Augenlider zuckten. Lass los! Sie wurde bewusstlos, so wie der Abend in die Nacht übergeht. Langsam, ein sanftes Gleiten. Ich beugte mich ganz nah zu ihr hinunter, horchte an ihrem leicht geöffneten Mund, an ihrer Nase. Sie atmete noch. Ihr Duft wurde von dem der nassen Erde überlagert.
»Ich liebe dich.« Meine Stimme klang erstickt. Aber ich wollte das Richtige tun.
Ich drehte ihren Kopf zur Seite. Aus meiner Tasche holte ich die Verbände heraus, riss die erste Verpackung auf. Ihr rechtes Bein winkelte ich an. Die weiße Gaze wickelte ich um ihren Oberschenkel. Nur langsam breitete sich darauf ein rötlicher Schimmer aus. Ihren rechten Arm fixierte ich mit weiteren Bahnen. Alle anderen Verletzungen würden warten müssen.
Dann schob ich meine Arme unter sie und hievte uns gemeinsam hoch. Der Regen machte uns schwer. Der Regen, das Leben und unser Schicksal. Ich fühlte mich hilflos und lahm, aber ich musste stark sein. Das hier war das Ende. Unser Ende. Ich würde sie einliefern. Danach würde ich sie ausliefern.
Mathilda: »Ist das Leben immer so hart oder nur, wenn man ein Kind ist?«Léon: »Es wird immer so sein.«Léon der Profi
JETZT
1.
Dima hasste Autofahrten. Die Enge, in der er zur Bewegungslosigkeit verdammt war. Manchmal für Stunden. Sein Vater, Youri, hatte auf dieser Fahrt bestanden. Und Dima fügte sich. Weil er seinen Vater liebte. Mehr als alles andere. Endlose Stunden verharrte er auf dem Rücksitz, obwohl er sich gern bewegte. Lieber lief, sprang, sich überschlug. Parcours. Er war ein Naturtalent, schnell, wendig, ausdauernd und kraftvoll. Auch die schwierigsten Sprünge gelangen ihm. Hindernisse zu überwinden war sein Element. Still zu sitzen, empfand Dima als qualvoll. Sie hatten Berlin verlassen, Leipzig noch im Dunkeln passiert und nach einer Pause München angesteuert. Hinter München hatte Dima das Interesse und den Überblick verloren. Sie waren in ländliche, dann in bergige Regionen vorgedrungen. Noch einmal las Dima das Wort »Schliersee« auf einem Schild. Das Gewässer schien unruhig, weil der Regen darauf prasselte. Nebelschwaden waberten durch jedes Tal. Die Landschaft wurde einsam, das Wetter schlechter. Bis Youri auf einem Parkplatz hielt. Irgendwo im Nirgendwo.
»Ich muss mal.« Das waren die letzten Worte, die Dima zu seinem Vater sagte.
Mit einer leichten Geste hatte dieser ihn weggewunken. »Beeil dich.«
Er sprach kaum, ermüdet von der langen Fahrt. Lale lächelte ihm zu, Mathilda war an ihrer Seite eingeschlafen. Dima stieg aus und blickte sich kurz um. Entschied sich, nicht zu den Bäumen hinüberzulaufen. Er brauchte Luft, rannte über den winzigen Parkplatz und schlug sich in die Büsche. Und weil die Luft ihn belebte und der Regen ihn erfrischte, übersprang er seitlich einen Zaun, überquerte eine Weide im Zickzack, erklomm zwei Felsen mit Hocksprüngen. Die Landschaft geizte nicht mit Abwechslung. Sie forderte ihn heraus. Er musste sich bereits deutlich vom Wagen entfernt haben, als er sich ermahnte, zurückzukehren. Sein drängendes Bedürfnis verflüchtigte sich durch die Bewegung. Er schalt sich für den unangekündigten, langen Ausflug und rannte zurück.
Dima:
Dimas Leben bis zu diesem Zeitpunkt war schnell zusammengefasst: Glück mit leichten Abstrichen. Er war der heiß ersehnte Prinz, der auf Händen getragen wurde, das jüngste Kind. Er war jung, klug, er sah gut aus. Kaum Körperfett, jede Menge Muskeln und Sehnen verteilten sich auf einen Meter zweiundachtzig. Er war schlank, seine Gesichtszüge ebenmäßig, sein Mund sinnlich, fast zu schön für einen Mann. Er trug sein blondes Haar lang und fasste es meistens zu einem Pferdeschwanz zusammen. Dima wurde in Russland geboren. Er war ein Jahr alt, als seine Familie nach Deutschland emigrierte. In Berlin lebte es sich gut. Für Dima war Deutschland sein Heimatland. Dimas Vater liebte ihn abgöttisch. Seine Mutter kannte Dima nicht. Sie verschwand früh aus seinem Leben oder tauchte nie spürbar darin auf. Er besaß keine, wirklich keine Erinnerung an sie. Eine Mutter hatte ihm nie etwas bedeutet, bis andere in der Schule davon sprachen, bis Mütter seine Freunde abholten, bis sie ihre Söhne vor der Schule küssten, obwohl diese sich peinlich berührt abwandten. Dima war die »Idee einer Mutter« fremd. Was ihm vertraut war, waren Frauen. Viele. Dima nannte sie nicht Frauen, weil sein Vater sie nicht so nannte. Er nannte sie Nutten, weil sein Vater sie so nannte. Dimas Zuhause war ein Puff. Seine Schwestern nannten es Club, sein Vater nannte es Bordell.
Dima mochte Superhelden wie fast jeder Junge in seinem Alter. Jeder bewunderte Superman, aber er verehrte den abgründigen Spawn. Den grausamen, einsamen, untoten Spawn, der, um seine Frau aus dem Jenseits wiedersehen zu können, ein entstelltes, enthäutetes Äußeres in Kauf nahm, der sich mit dem Fürsten der Hölle anlegte, der ein lebendiges, feuerrotes Kostüm besaß. Dimas lebendiges Kostüm war sein Körper. Genauso, wie Spawns roter Umhang intelligenter wurde und ein Eigenleben entwickelte, wurde Dimas Körper leistungsstärker. Er war es, der Superkräfte besaß. Seit er denken konnte, bewegte er sich gern. Es gab keinen Winkel im Haus seines Vaters, den er nicht erkundet hätte. Ob hoch oder tief, ob nah oder fern, Dimas Entdeckerlust kannte keine Grenzen. Wenn seine Schwester Ayla einem bärtigen Freier den Schwanz lutschte, Lale ihm dabei mit der flachen Rechten auf den Hintern schlug und mit der anderen Hand im Haar wühlte, lag Dima oben auf dem Kleiderschrank, um sich kein Geräusch entgehen zu lassen. Leise verließ er sein Versteck mit einem gewagten, abgefederten Sprung. Manchmal schaute ihn seine Schwester tadelnd an. Das männliche Glied hatte sie noch im Mund. Dima kroch auf Fingerspitzen und Zehen zum Ausgang, verließ das Zimmer mit einem Hechtsprung und rollte sich auf dem Teppich im Flur ab. Das leise Klacken der sich schließenden Tür hörten seine Schwestern nur, weil sie wussten, dass es geschah. Sein Ziel bestand darin, möglichst unauffällig und elegant in allen Lebenslagen den Ort zu wechseln. Überall zu sein und doch unsichtbar. Wie ein Tier, eine Katze, wie ein Luchs. Dima bewegte sich ruhig und elegant, wenn er ein Ziel vor Augen sah, mit explosiver Geschwindigkeit. Hindernisse überquerte er geschmeidig, leichtfüßig.
Wenn es ihm im Puff langweilig wurde, wechselte er nach draußen, wo er jeden Stein, jede Stufe, jeden Baumstamm, jede Barriere als Herausforderung betrachtete, die es zu überwinden galt. Dima trainierte Liegestütze und Klimmzüge, beid- und einhändig. Auf seiner Bauchmuskulatur konnte man Ziegel zerschlagen, auch wenn das noch nie jemand probiert hatte. Seine Leistungen in der Schule waren gut bis befriedigend. Er hatte Zeit, viel Zeit und den Wunsch nach einer wahren Heldenaufgabe. Dima war Spawn, allein der Grund zu leben fehlte ihm. Spawn hatte Wanda. Aber Dima hatte niemanden. Liebe zu einer Frau, was war das? Er erfuhr es mit achtzehn. Es war seine erste Liebe und seine letzte. Alles, was danach kam, war ein Abklatsch, ein schaler Nachgeschmack auf seine erste Faszination. Sie tauchte plötzlich auf, völlig unerwartet. Dima konnte der Tatsache nichts entgegensetzen, dass seine erste große Liebe nichts mit Spawns Wanda gemein hatte. Wanda war groß, feminin und atemberaubend schön. Aber seine Angebetete war all das nicht. Sie war klein, dunkel und hart. Sie bedurfte keiner Hilfe. Sie brauchte niemanden. Schon gar nicht Dima. Sie duldete Dima als Einzige nicht in ihrem Zimmer. Es gelang ihm nie, sich an ihr vorbeizuschleichen, sie heimlich zu beobachten, wie er es bei den anderen tat. Wenn sie ihn erwischte, wie er es dennoch versuchte, warf sie ihn mitten im Akt mit einer entschiedenen Geste still und fast nebensächlich hinaus. Nichts entging ihr. Alle Nutten warnten Dima vor ihr, aber nicht das Verbot machte sie für ihn interessant, sondern dass er sie wie ein verschlossenes Kästchen öffnen wollte. Weil sie ihn als Mann nicht zu bemerken schien, beging er einen halbherzigen Selbstmordversuch. Vielleicht musste er auf die andere Seite wechseln, so wie Spawn, bevor seine Angebetete ihn erhören würde. Wenigstens war sie es, die ihn im Badezimmer fand. Dima musste sich im Nachhinein eingestehen, dass er einen Hilferuf aussandte und nicht mehr. Einen Hilferuf an sie. Noch während sie seine rechte Pulsader zudrückte – die Linke hatte er verfehlt – und sein Blut über ihre Hände floss, kanzelte sie ihn mit »Idiot« ab. Immerhin ignorierte sie ihn danach nicht mehr. Und so brachte sie ihn, Dima, eine Woche später schließlich zum ersten Mal zum Höhepunkt. Aus reiner Gnade. Noch trug er die weißen Bandagen an seinen Handgelenken. Sie tat es, wie jemand ein Mittagessen zubereitet: routiniert, pragmatisch, emotionslos. Und gerade das faszinierte Dima mehr als alles andere. Danach ging sie. Sie verlangte keine Gegenleistung, und als Dima diese Gegenleistung endlich erbrachte – ohne ihre konkrete Anleitung wäre es ihm gar nicht möglich gewesen –, nahm sie seinen Liebesdienst gleichgültig hin, seufzte ein wenig, schrie kaum, wischte sich mit seiner Unterhose den Samen von ihrem Bauch, zog sich an und verließ das Zimmer. Dima konnte nicht vergessen, wie sich ihre Hüftknochen berührten, seine und ihre. Diese Härte und das Weiche daran, das erschütterte ihn bis ins Mark. Dima wusste, dass sie trotz ihrer Vereinigung unglücklich war, wenn er auch den Grund dafür nicht kannte. Er machte es sich zu seiner Aufgabe, sie zu erobern, ihr Unglück zu mildern. Schob wie Sisyphos den Felsbrocken den Berg hinauf, um ihn Mal für Mal wieder hinunterrollen zu sehen. Er arbeitete sich viele Jahre lang daran ab, bis sie verschwand. Plötzlich, schlagartig, schmerzhaft wie ein Unfall, bei dem man eine Gliedmaße verlor. Dima suchte sie, aber er fand keine Spur von ihr. Sie zu treffen machte Dima nicht glücklich, aber es gab seinem Leben einen Sinn. Dass sie ihn einfach verließ, das war seine erste Begegnung mit dem Unglück.
Sie hinterließ ihn ratlos, einsam, verwirrt. Jetzt war sie nur ein fernes Verlangen in Dimas Brust; er wurde über dem Kummer erwachsen und fühlte sich seitdem seltsam vom Leben entfremdet. Dima hatte noch nie gearbeitet, keinen Beruf erlernt. Mitte zwanzig hatte er einen halb fertigen, fantastischen Roman verfasst, zwei großformatige abstrakte Bilder gemalt, Bekannten bei ihren künstlerischen oder handwerklichen Projekten geholfen; er spielte leidlich Gitarre, traf sich mit Freunden zum Parcours an öffentlichen Plätzen. Es mangelte ihm nie an Beschäftigung. Er besaß alles: Eine Familie, die ihn liebte, genug Geld, das sein Vater wie selbstverständlich zur Verfügung stellte, um sich alle Wünsche zu erfüllen, Kraft und die Zuversicht der Jungen, aber das, was ihm immer fehlen würde, war sie. Dima hatte fast alles, aber er ahnte bereits, dass er fast nichts besaß.
Er stoppte in vollem Lauf. Etwas stimmte nicht. Er erkannte es schon von Weitem. War der Himmel über ihm eine Mischung aus Grau und Dunkelgrau, zog sich nun in seiner Brust etwas Finsteres zusammen. Dima dachte nur an seinen Vater, der ihn aufgezogen, geliebt hatte, ihm nie einen Wunsch abschlug. Wenn er Dima ansah, blitzte Stolz in seinen Augen auf. Jetzt sah Dima nichts mehr in den Augen seines Vaters. Völlig inhaltslos starrten sie auf die fein zersplitterte Windschutzscheibe. Es war dieser leere Ausdruck, der ihn mehr verstörte als das exakte, kleine Loch in der Stirn seines Vaters. Ein dünner Faden Blut zeichnete einen geraden Strich an dessen Nasenwurzel hinab. Der Regen, der immer noch auf das Auto prasselte, wirkte wie ein Weichzeichner, der so gar nicht zur Situation passte. Das Wasser perlte an der seitlichen Fensterscheibe ab. Mit dem Handrücken wischte Dima mechanisch hin und her. Innen klebten feine rote Tropfen. Außen Bewegung, Leben, innen Ruhe, Tod. Dimas Kleidung war durchnässt, seine Haare klebten ihm an der Stirn. Das Wasser lief ihm in den Kragen. Er bemerkte es nicht. Nur widerstrebend löste er seinen Blick von Youri, seinem Vater. Dima beugte sich nach vorn, näherte sein Gesicht bis auf wenige Zentimeter dem Glas. Er konnte sich nicht dazu bringen, die Fahrertür zu öffnen. Er wollte es, aber er vermochte es nicht. Etwas hielt ihn davon ab. Auf dem Beifahrersitz saß seine Schwester Ayla. Ihr Gesichtsausdruck war das exakte Gegenstück zu dem seines Vaters. Sie trug das gleiche Mal auf der Stirn. In der Heimat ihres Vaters, Aserbaidschan, hätte es ein Henna-Kreis sein können, nur einen Zentimeter nach oben verrutscht.
Dima wischte sich das Wasser aus dem Gesicht. Die Autotür hinter seinem Vater stand offen. Es war ein Sog: Dimas Füße bewegten sich wie von selbst. Seine Schritte machten auf dem nassen Untergrund unnatürlich laut schmatzende Geräusche, als er die Motorhaube umrundete und die Fahrerseite passierte. Der Sitz hinter dem seines Vaters war leer. Wo war Mathilda? Dima beugte sich in den Wagen hinein, und für einen Augenblick hoffte er auf ein Wunder. Durch das Dach abgeschirmt, trafen die Regentropfen nicht sein Gesicht. Die gegenüberliegende Fensterscheibe fehlte. Glasstückchen hatten Lales Körper besprenkelt. Sie war ebenfalls tot. Ihr Kopf ruhte schief auf der Kopfstütze. Ihr Leib schien sich durch die unnatürliche Lage verdoppelt zu haben. Ihre weiten Kleider bedeckten Polster und Fußraum wie die Ballonseide eines Fallschirms. Die Arme hingen leblos an ihr hinab. Dima erinnerten sie an die Tentakel eines toten Tintenfischs am Strand. Blut sammelte sich auf dem Sitz, es leuchtete an der Kopflehne, auf Lales Hinterkopf. Dima wusste mit unverrückbarer Gewissheit, dass er auf Lales Stirn wie bei ihrer Zwillingsschwester ein Einschussloch finden würde.
Er erhob sich, starrte für einen Moment in den bleigrauen Himmel hinauf. Sein Vater, seine Zwillingsschwestern: tot. Und er, Dima, war am Leben. Warum? Und wo war Mathilda? Das Begreifen kam plötzlich. Die Gewissheit, allein zu sein – neben ihm ein Grab aus Metall, nur Tod –, übermannte ihn. Und Dima bemerkte, wie seine Blase endlich nachgab. Wie der heiße Urin an seinen Beinen hinablief, in seine Schuhe eindrang. Wie er in die Knie ging, weil ihn nichts mehr aufrecht hielt. Wie er zu Boden sank, sein Kopf hart auf die Karosserie aufschlug, wie er zur Seite kippte und neben dem Reifen zu liegen kam. Wie der Regen weiter auf sein Gesicht fiel und er dennoch nichts davon spürte, wie der Geruch nach Gummi, Erde und Feuchtigkeit ihn ummantelte wie eine feste Substanz. Wie er darauf wartete, ohnmächtig zu werden, sich aufzulösen, zu verschwinden von diesem Platz, von dieser Erde. Wie nichts davon passierte. Wie jeder Atemzug schmerzte, die Kälte langsam an ihm hinaufkroch. Wie seine rechte Hand nach dem nassen Dreck griff, in dem sein Gesicht lag, wie seine Finger krampften und er sich nach einer Ewigkeit erhob. Erheben musste. Und schwankend davonging. Es war Dimas zweite Begegnung mit dem Unglück.
2.
Wenn du jemanden ficken willst, fick ihn richtig! Heute war der Tag, und sie kannte die Stunde. In ihrem Leben gab es keine fließenden Übergänge mehr. Nur noch harte Konturen. Sie zog ihre Kapuze tiefer ins Gesicht. Das Wetter passte zum Anlass. Es passte zu ihrem Leben. Es war ihr Wetter: Regen. Schon seit Stunden, ohne Unterlass. Sie war sich sicher, dass er kommen würde. Natürlich zu früh, um die Gegebenheiten zu überprüfen. Und er würde seine Familie mitbringen. Obwohl er Berlin nicht gern verließ. Sie sah die Örtlichkeiten ganz klar vor sich: den Parkplatz, ein Teil geschottert, der andere Teil nicht mehr als ein aufgeweichter Acker. Den Zaun, das Feld, die Straße, die hier eine scharfe Kurve machte. Selbst wenn jemand vorbeikam, würde er den Parkplatz schnell passieren. In dieser einsamen Gegend ohnehin ein unglaublicher Zufall. Wer kam schon diesen Berg herauf? Die Wanderzeit war vorbei, die Kühe ins Tal getrieben. Hier gab es nichts mehr, was den Weg hinauf lohnte. Außer diesem Treffen, auf das Youri nicht verzichten würde. Nicht verzichten konnte oder wollte.
November forderte dafür einen Gefallen ein, und er war ihr ohne Zögern bewilligt worden. November vernahm Dezembers Stimme durch das Telefon.
Diese flüsterte: »Die Ware ist gerade angekommen.« Dann ertönte nur noch das Besetztzeichen. Dezember legte auf, und November ahnte bereits, warum: Dezember hatte Angst.
November wusste, dass Youri erst zwei Tage später mit einem Anruf rechnete. Diese Verzögerung würde sie zu ihrem Vorteil nutzen.
Beim zweiten Telefonat war Youris Stimme ihr noch immer ganz vertraut.
»Marokko«, sagte sie ins Telefon. Über dem Hörer lag ein Taschentuch. Er würde ihre Stimme nicht erkennen.
»Galina«, antwortete er mit einem leichten Zögern.
Und sie nannte ihm Ort und Zeit. Er würde die weite Reise nicht mögen. »Diesmal kommst du nicht allein. Bring deine Töchter mit! Und deinen Sohn. Nur sie. Es ist sehr wichtig«, befahl sie ihm.
»Warum?«
Doch sie antwortete nicht; sie legte einfach auf. Ohne Dezember, die sie einst so hasste, wäre ihr all das hier versagt geblieben. November musste sich eingestehen, dass nichts im Leben ohne Konsequenzen blieb.
November:
November kannte sich mit diversen Dingen gut aus: unter anderem mit Schusswaffen, Männern und mit Zigaretten. Sie konnte nicht kochen, nicht weinen oder länger als unbedingt notwendig in einem Bett liegen. Sie trug Männerunterwäsche, hatte auf ihrer linken Körperhälfte einige unansehnliche Narben und eine Aversion gegen Fellatio. Sie besaß gegen zahlreiche andere Dinge eine Abneigung (Orangen, Bärte, Temperaturen über dreißig Grad), was sie jedoch noch nie daran gehindert hatte, all dies gelegentlich zu akzeptieren. Sie hätte gern einen bestimmten Menschen gekannt: ihren Vater. Sie hatte nur einen einzigen Menschen in ihrem Leben geliebt: ihre Mutter. Durch einen unglücklichen Zufall hatte ihre Mutter die falschen Menschen kennengelernt, die falschen Entscheidungen getroffen und die falschen Drogen genommen. Sie war zu früh gestorben, was gut für sie selbst, aber unendlich schrecklich für ihre Tochter war. Das Ausmaß des Schreckens begriff diese erst spät, andeutungsweise jedoch schon in anderer Form, als sie mit zwölf Jahren zum ersten Mal Herrenbesuch bekam. Damals trug sie noch einen anderen Namen, und die Männer um sie herum sprachen Russisch. Später sprachen die Männer Deutsch oder die universelle Sprache Geschlechtsverkehr. November sprach gut Russisch, akkurates, wenn auch nicht akzentfreies Deutsch; sie sprach fließend Geschlechtsverkehr. Ein Freier hatte ihr als vorzeitiges Hochzeitsgeschenk eine alte Makarow vermacht. November erschoss ihn zum Dank damit. Die Sache wurde als Unfall eingestuft. Keiner der Beteiligten benötigte Aufmerksamkeit. Für eine Verurteilung war November noch zu jung. Das enttäuschte sie. An ihrem Leben änderte sich nichts. Sie würde noch zahlreiche Waffen, darunter zwei Heckler & Koch, eine Steyer, eine Mauser und eine Glock, besitzen und diese gut kennen und beherrschen lernen. Die spärliche Freizeit zwischen den Ficks vertrieb sie sich mit heimlichen Schussübungen auf leere Flaschen und Dosen im Wald und damit, ihren Zuhälter zu hassen. Mit harten, düsteren Trash-Metall-Platten und Dostojewski. Die Brüder Karamasow, ein altes, zerfleddertes Taschenbuch-Exemplar mit kaum lesbarer Widmung auf der ersten Seite, war die einzige ernst zu nehmende Hinterlassenschaft ihrer Mutter. November kannte es auswendig, auf Russisch und Deutsch. Sie übersetzte es sich selbst, sagte sich Passagen im Kopf auf, wenn sie einem geschwätzigen Rentner die Eier leckte, wenn ein dicker Schalterbeamter sie von hinten nahm, wenn ein nervöser Friseur nur reden wollte. Sie hatte nicht das Gefühl, etwas anderes lesen, kennen oder verstehen zu müssen.
November traf eine Entscheidung. Sie war ein konsequenter Mensch. Sie würde ein paar Leben beenden. Wovon November hingegen nichts ahnen konnte: Überraschenderweise sollte sie mindestens ein Leben retten. Sie würde entgegen ihrer Gewohnheit beim Orgasmus laut schreien, eine Frau küssen und den Süden Deutschlands kennenlernen. November konnte es nicht gefallen, aber sie würde jemanden um Hilfe bitten müssen.
Nach dem Tod ihrer Mutter kannte November nur sich selbst, sie mochte nur sich selbst. Es lag ihr nichts daran, Gutes zu tun. Jemand sollte sie im Stich lassen. Es würde sie nicht überraschen.
Sie stellte gleichmütig fest, dass sie Youri schon so lange hasste, dass es sie fast mit Langeweile erfüllte. Sie hatte gelernt, nicht mehr zu viel darüber nachzudenken. Nur gelegentlich ereilten sie noch die Ausläufer ihrer Erinnerung. So, wie die letzten Wellen einer großen Erschütterung der Wasseroberfläche am Seeufer mit einem leisen Plätschern ankamen. Für sie war es eine Frage der Entscheidung. Der Klarheit. Der Bestimmung. Sie fürchtete nichts mehr. Alles, was sie einmal gefürchtet hatte, war ihr bereits passiert. Erstaunlicherweise war sie nicht nur immer noch am Leben, sondern sogar besser als je zuvor. Es machte sie nicht zufriedener. Mit Gleichmut verfolgte sie ihr Ziel.
Sie vernahm das Geräusch eines sich nähernden Wagens, zog sich noch mehr an den Rand der kleinen Schonung zurück. Durch ihre schwarze Kleidung würde sie an diesem grauen Tag gut zwischen den Bäumen verborgen sein. In ihrer Tasche tastete sie nach der Glock. Eine gute Waffe. Fast ein Freund. Nur ihr, der Pistole, konnte die ständige Feuchtigkeit zusetzen. Aber die Waffe war zuverlässig. Warum sollte sie heute versagen? Man konnte alles planen, aber jede wichtige Situation verlangte ein Mindestmaß an Vertrauen. Und Glück.
Der schwarze Porsche Cayenne bog auf den Parkplatz ein. Ein Berliner Kennzeichen. Sie verzog den Mund zu einem Lächeln. Es gab keinen Zweifel: Er war wirklich gekommen, deutlich vor der Zeit. Die Reifen knirschten über den Schotter, hielten dann auf dem erdigen Teil des Platzes an. Hier hatte man einen guten Blick über das Feld, die Straße. Aber das würde ihm auch nichts mehr nutzen. Er wähnte sich in Sicherheit. Eine Tür öffnete sich kurz. Ein Junge sprang heraus und rannte über das Feld. Sie erkannte ihn, und es entsprach nicht ihrem Plan, dass er sich vom Auto entfernte. Aber sie hatte gelernt, die Dinge so zu nehmen, wie sie sich präsentierten, und das war selten ideal. Sie sah seine Gestalt über das Feld verschwinden, dann ging sie zielsicher und ruhig auf das Auto zu und waltete ihres Amtes: Ankläger, Richter und Exekutor vereint in einer Person, nur einen klaren Gedanken im Kopf: Wenn du jemanden ficken willst, dann fick ihn richtig!
Sie entsicherte die Glock und hielt sie mit beiden Händen nach unten gerichtet. Sie passierte den Wagen von hinten nach vorn, geduckt, richtete sich vor der Motorhaube auf und schoss. Einmal, tock!, richtete den Lauf ein paar Zentimeter weiter nach links aus, noch ein Schuss, tock! Sie sah sein Gesicht und ihr Gesicht. Den Ausdruck darauf nahm sie nicht wahr. Sie schoss gut, sie zielte präzise, weil alles andere undenkbar war. Sie ging nach links, vier lange Schritte, erblickte durch die leicht getönte hintere Seitenscheibe zwei weit aufgerissene Augen, zielte dazwischen und ein wenig darüber, drückte ab. Zeitgleich mit ihrem Schuss splitterte die Scheibe, zerriss etwas das Leder ihrer Jacke. Ein stechender Schmerz brannte sich in ihren linken Oberarm. Kurz sah sie in das ihr bekannte Gesicht, bis es nach hinten wegsackte. Ruhig umrundete sie den Kofferraum des Wagens, öffnete die hintere Tür. Im Inneren herrschte Stille, Lale oder Ayla – so genau konnte man das nie sagen – lag auf dem Rücksitz ausgestreckt. Sonst nichts, niemand. Die andere Schwester lehnte wie angenagelt vorn an der Kopfstütze. Auch Youri rührte sich nicht mehr. Er hatte in Berlin sterben wollen. Jetzt tat er seinen letzten Atemzug hier am Ende der Welt auf diesem Berg. Sogar seinen letzten Wunsch hatte sie ihm verwehrt. Sie behielt die Glock im Anschlag, begab sich an Youris Fahrertür, beugte sich nach vorn, bis ihr Gesicht fast die Scheibe berührte, und genoss für einen langen Moment Youris leeren Gesichtsausdruck. Leise flüsterte sie die Worte: »Dem Hund einen hündischen Tod!«
Danach steckte sie die Waffe ein. Entspannte ihre Arme, verbarg ihre Hände in den Taschen. Nur ein paar Minuten waren vergangen. Noch etwas fehlte, und sie würde es sich holen.
Es war kaum zu glauben, aber das Geräusch klang eindeutig: Ein weiterer Wagen näherte sich. Der Motor dröhnte. Sie kannte sich nicht gut aus, doch hätte sie es nicht besser gewusst, hätte sie geglaubt, es müsse sich um einen alten Pkw handeln. Geduckt lief sie auf die kleine Lichtung am Rande des Parkplatzes zu. Ihre Mitfahrgelegenheit kam gerade an. Nur wusste diese nichts davon. Waren alle wichtigen Entwicklungen in ihrem Leben bis auf Youris Tod zu früh geschehen – der Verlust ihres Vaters, ihre Schwangerschaft, der Tod ihrer Mutter –, setzte sich heute das Motto fort: Auch er kam zu früh. Sie wartete geduldig, weil die Umstände nie ideal waren, und ungeduldig, weil noch einer von ihnen lebte.
3.
Ich wollte mal richtig die Sau rauslassen. Für meine Verhältnisse. Also behielt ich den Wagen einfach nach der Inspektion und befand mich auf dem Weg zum Ferienhaus meiner Eltern. Ich fuhr über Miesbach und Schliersee, bog dann ab nach Bayrischzell. Hier führte die Straße tiefer in die Berge. Immer, wenn man dachte, es ginge nicht mehr weiter, kam doch noch ein Weg, ein Pfad. Der Sprinter röhrte im dritten Gang. Ich würde ihn am Feldweg zum Haus meiner Eltern im Wald stehen lassen. Nicht, dass der Wagen irgendjemanden gestört hätte. Auch wenn er auffällig wie eine rosa Kuh aussah.
Aber kaum jemand kam hier herauf. Nicht um diese Jahreszeit. Der Sommer war längst vorbei, und die Wintersaison hatte noch nicht begonnen. Meine Eltern weilten gerade in Casablanca, und meine Geschwister zog es nicht mehr in die Berge. Ich kam mir vor wie ein Ökoschwein. Das war das Letzte, was ich sein wollte. Aber mit dem Fahrrad hier heraufzufahren war sogar mir eine Nummer zu selbstlos und groß. Ich brauchte ein paar Tage Ruhe und Einsamkeit, auch wenn meine Eltern mal wieder ein Riesendrama darum gemacht hätten. Aber sie wussten nichts von diesem Ausflug, und dabei sollte es auch bleiben. Ich hatte mein Insulinbesteck eingepackt und nicht die Absicht, vor der Zeit abzudanken. Auch wenn sich mein Leben momentan beschissen anfühlte. Und daran war ausnahmsweise nicht der Zucker schuld.
Corinnes Mails wurden zunehmend emotionsloser, waren sie es doch schon vorher in einem gewissen Ausmaß gewesen. Ich konnte mir kaum noch etwas vormachen. Ich war in eine Frau verliebt, die meine Existenz nur am Rande wahrnahm. Aber ich war hilf- und machtlos. Hatte sich zufällig eine liebenswerte, humorvolle oder mitfühlende Zeile in unsere Korrespondenz verirrt, war ich Corinne wieder mit Haut und Haar verfallen. Sie wirkte so perfekt. Dieses Aufblitzen von Menschlichkeit bei ihr ließ mich vermuten, dass noch ganze Welten in ihr versteckt sein mussten, die es zu entdecken galt. In realistischen Augenblicken wusste ich allerdings mit erschreckender Klarheit, dass ich einseitig und unglücklich verliebt war. Und dass sich daran in naher oder ferner Zukunft voraussichtlich nichts ändern würde. Corinne spielte mit mir. Sie nahm meine Zuneigung zu ihr überhaupt nicht wahr. Dennoch gab es keine Minute, keine Sekunde, in welcher ich nicht an sie dachte. An das, was sie geschrieben oder gesagt hatte. Wenn ich nachts einsam im Bett lag, verlangend und unbefriedigt, erregte mich allein der Gedanke an ihre Präsenz. Jedes erdachte Szenario bereicherte meine sexuellen Handlungen, die ich an mir selbst vornahm. Corinne hatte mich abhängig gemacht. Oder ich mich von ihr.
In der Kurve schaltete ich einen Gang runter. Den schwarzen Wagen hätte ich fast übersehen, so übermächtig hatte sich Corinne in meinem Gehirn, in meiner Wahrnehmung festgesetzt. Aber dann bremste ich doch und beugte mich zum Beifahrersitz hinüber. Eine Tür des schwarzen Wagens stand offen. Es regnete in Strömen. Alles in allem wirkte die Situation mehr als seltsam. Also fuhr ich langsam zurück und lenkte den Sprinter auf den Parkplatz.
Ich bin Rettungssanitäter. Und wenn ich irgendetwas Gutes über mich zu sagen weiß, dann ist es, dass ich Menschen gern helfe. Vielleicht benötigte jemand meine Dienste. Deshalb stieg ich aus. Und ja: Jemand brauchte mich. Aber es war nicht das, womit ich gerechnet hatte.
4.
Ich hatte noch keine drei Schritte auf den schwarzen Geländewagen zu gemacht, als eine kleine, dunkle Person auf mich zukam. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass auf dem Rücksitz des Porsches eine Gestalt lag. Die Person, die immer näher kam, war eine Frau, durchnässt und klein. Sie trug eine graue Kapuze, eine schwarze Lederjacke und hielt tatsächlich eine Waffe in der Hand. Fuck!, dachte ich und verspürte einen Moment lang ein intensives Fluchtbedürfnis. Oder handelte es sich vielleicht nur um ein Spielzeug, mit dem sie auf mich zielte? In meinem Kopf suchte ich krampfhaft nach Erklärungen, aber hier war etwas ganz und gar nicht richtig, und das spürte ich. Sollte ich wegrennen oder bleiben? Ich war ausgestiegen, um zu helfen. Das war mein Job, meine Berufung. Ich durfte jetzt nicht schwach werden.
»Hau ab!«
Ihre Waffe hatte sie auf meinen Körper gerichtet. Ihre Augen wirkten absolut ausdruckslos. Ich nahm einen Akzent wahr. Sie hatte nicht »hau ab!«, sondern »chau ab!«, gesagt. Ihre Stimme klang tief und rau.
»Gleich«, antwortete ich. Damit drehte ich mich von ihr weg und beugte mich in die offene Tür des Porsches. Ich war nervös. Ich zitterte.
»Steig wieder in deinen Wagen ein!«
Ich versuchte, sie einfach zu ignorieren. Aber hier auf dem Rücksitz gab es für mich nichts mehr zu tun. Ich tastete nach dem Puls am Hals der jungen Frau. Nichts. Nur kalte Haut.
Was soll ich sagen? Tote machen mich nicht froh, aber sie schockieren mich auch nicht. Ich habe schon so viele Zeitgenossen sterben sehen. Schrecklich waren schreiende, stöhnende Menschen oder solche, die – so wie jetzt – mit einer Waffe auf mich zielten. Ich erhob mich und ging zur Fahrertür.
»Hey! Lass das. Die sind alle tot.« Woher wollte sie das wissen? Ihre Stimme kam mir jetzt ganz leise vor. Ein Befehl, der eigentlich eine Drohung war.
Ich öffnete die Fahrertür.
Der Schuss ließ mich zusammenzucken. Erde spritzte neben meinen Füßen auf. Das Geräusch war erstaunlich leise. Es glich eher einem »Plopp«. Nur der Querschläger hinterließ einen pfeifenden Hall wie die Raketen bei einem Silvester-Feuerwerk. Ich hatte meinen Körper fast nicht mehr unter Kontrolle, als ich kaum hörbar antwortete: »Gleich.«
Der Mann auf dem Vordersitz hatte mitten in der Stirn ein akkurates Loch, keinen Puls. Bei seiner Beifahrerin sparte ich mir die Prüfung. Ich benahm mich damit zwar nicht professionell, aber sie sah genauso tot aus wie die anderen. Unter der Haut ihres Halses pulsierte nichts. Ihr Gesicht wirkte wie aus Wachs modelliert, der Körper hing völlig spannungslos im Gurt. Die Augen standen offen, starrten leer. Für einen Moment verwirrte mich die Tatsache, dass die Beifahrerin genau die gleiche Frisur, sogar die gleiche Kleidung wie die junge Frau auf dem Rücksitz trug. Sie wirkte wie ein Duplikat.
Wackelig auf den Beinen und am ganzen Körper zitternd, richtete ich mich auf. Ich wagte kaum, mich zu ihr umzudrehen. »Die sind alle tot«, stammelte ich.
»Sag ich doch.« Sie hatte es bereits gewusst.
»Okay. Jetzt gehe ich wieder.« Ich versuchte zu lächeln. Der Versuch misslang. Meine Füße bewegten sich nicht.
Ich steckte fest, obwohl ich wegwollte.
Finster starrte sie mich über den Lauf ihrer Waffe hinweg an. Dann zeigte sie mit einer Hand zwischen meine Beine. »Du hast da einen Fleck.«
Sie hatte recht. Ich war kein Held. »Ich habe eine Scheißangst vor dir!«, versuchte ich zu erklären. Nur mit Mühe gelang es mir, nicht in die Hose zu pinkeln. Stress war ich gewohnt, aber nicht diese Art von Stress.
Mit dem Lauf ihrer Waffe wies sie zur Rückseite des Wagens hin. Es gab niemanden mehr zu retten. Mein Mut schrumpfte zu bloßer Gehorsamkeit. Ich folgte ihrem Wink.
»Mach auf!«
Ich drückte das Schloss, aber der Kofferraum öffnete sich nicht.
Ihre Hand gebot mir Einhalt. Sie winkte mich ein paar Schritte zur Seite. Ich blieb stehen. Sie gab zwei präzise Schüsse auf das Kofferraumschloss ab. Plopp, plopp. Was war das? Ein Schalldämpfer? Ohne mich aus den Augen zu lassen, hob sie mit dem Ellbogen die Klappe an. Mit einem kurzen Blick erfasste sie die Lage, wechselte die Waffe in ihre linke Hand, um mit der anderen eine schwarze Reisetasche aus dem Kofferraum zu ziehen. Erst jetzt sah ich, dass Blut über ihre Finger lief. Unser Treffen hatte kaum länger als fünf Minuten gedauert, aber es kam mir vor wie eine Ewigkeit.
»Los!« Ihre Waffe zeigte mir den Weg. Sie dirigierte mich zu meinem Wagen. »Halt!«
Fragend sah ich sie an.
»Geh erst mal pinkeln!«
»Wo?«, fragte ich sie, als habe ich alle Fähigkeiten zum selbstständigen Denken bereits vor langer Zeit verloren.
Sie zuckte mit den Schultern. »Da!«
Und weil sie immer noch diese echte Knarre in der Hand hielt, drehte ich mich einfach um, öffnete dankbar den Reißverschluss meiner Hose und versuchte, an den Hinterreifen des Sprinters zu pinkeln. Aber es passierte nichts. Die Aufregung. Ich war es nicht gewohnt, unter Waffengewalt Wasser zu lassen. Es kam mir in den Sinn, dass es mir vergleichsweise wenig ausmachte, einer gefährlichen, fremden Frau meinen nackten Hintern zu zeigen. Mit einem lauten »Ratsch!« zog ich den Reißverschluss zu. »Ich kann das so einfach nicht.« Dann drehte ich mich um, nicht erleichtert, aber froh, immer noch am Leben zu sein, und wartete auf den nächsten Befehl.
»Einsteigen. Fahren!«
Sie kannte nur Kommandos. Und mir blieb nicht viel anderes übrig, als ihr zu folgen. Sie stieg auf der Beifahrerseite ein und stopfte die Tasche in den Fußraum. Ich rieb mir mit dem Ärmel über das nasse Gesicht. Als die Scheibenwischer die ersten Streifen durch die Fluten von Regenwasser zogen, startete ich den Motor. »Wohin?«, fragte ich sie.
»Wo wolltest du hin?« Sie war nicht dumm. Von jemandem, der vielleicht gerade drei Menschen ermordet hatte, war nicht weniger zu erwarten.
»Nur einen Ausflug machen«, antwortete ich ausweichend.
»WO wolltest du hin?« Das »hin« klang scharf.
»Zum Ferienhaus meiner Eltern.«
»Dann fahr jetzt endlich, Arschloch!«
Ich legte den Rückwärtsgang ein und fuhr an. Immer noch betrachtete sie mich. Ihre Augen waren genauso schwarz wie ihr Haar. Ihre Haut schien leuchtend und klar, ihr Gesicht fast weiß. Keine Regung konnte ich darin erkennen.
»Was?«, fragte ich sie. Es machte mir Angst, dass sie mich anstarrte. Noch brauchte sie mich, aber was würde danach kommen?
»Netter Arsch«, antwortete sie. Sie sah nach vorn. Die Pistole lag auf ihrem Knie.
5.
»Das ist ein Schwimmbadausweis.«
Der kleine, dunkle Mann mit den großen Augen und den langen Wimpern drehte das laminierte Stück Papier erstaunt herum, als sehe er es zum ersten Mal. Kamilla Rosenstock stellte nüchtern fest, dass der Ausweis im Vergleich zu ihr selbst wasserabweisend war.
»Oh«, äußerte der kleine, attraktive Mann. Er war kurz vor dreiundzwanzig Uhr noch hier aufgetaucht. In einem klapprigen Auto, das einer Sardinenbüchse glich. Auf der Straße gab es bereits kaum mehr ein Durchkommen. Der Parkplatz war völlig zugestellt: Polizei, Feuerwehr, Gerichtsmedizin, das volle Programm. Nur der Notarzt zog unverrichteter Dinge wieder ab. Der Regen ruinierte so ziemlich jede Spur. Wetter und Leben waren gelegentlich eine Zumutung. Jetzt stand der kleine Mann vor ihr und starrte sie durchdringend an. Umständlich holte er seinen Geldbeutel hervor, steckte den Ausweis weg, nicht ohne einen anderen aus der sichtlich großen Auswahl an Karten und Dokumenten hervorzuholen.
»Hören Sie. Das ist eine Ermittlung, und ich habe jetzt wirklich keine Zeit.« Weil diese Ermittlung eine höchst unklare Sache war. Diffizil. Ein Auftragsmord – wahrscheinlich – in Verbindung mit dem organisierten Verbrechen. Man vermutete internationale Zusammenhänge – vielleicht –, weshalb nach dem LKA das BKA eingeschaltet worden war. Die Augen halb zusammengekniffen, hielt sie den neuen Ausweis von sich weg, den er ihr reichte. »Nein.« Sie schüttelte den Kopf. Irgendeine Payback-Karte. Der Typ würde sie noch in den Wahnsinn treiben. Aber hier ging es zu wie auf einem Bazar, der Platz wurde mitten in der Nacht von zwei Lichtwagen hell erleuchtet, überall blitzten Blaulichter auf, hier Absperrband, dort ein provisorisch aufgebautes Zelt und kein unbeschäftigter Kollege in Sicht, der jetzt an ihrer Stelle diesen penetranten Menschen abwimmeln könnte. Es war spät, ihre Frisur durch den Regen bereits ruiniert. Ihre Schuhsohlen hatten sich im Matsch festgesaugt. Wahrscheinlich stellte sich eine Reinigung der italienischen Markenware als unmöglich heraus.
Ein anderer Ausweis, jetzt grün und aus Papier, was sie zwang, sich weit nach vorn zu beugen. »Horst Horst?!?« Sie benötigte sicher noch keine Brille. Lächerlich. Die Lichtverhältnisse waren einfach schlecht.
Der gut aussehende kleine Mann nickte. Nur widerstrebend überließ er ihr den Ausweis – für einen Moment zogen sie beide dran –, dann gab sein Besitzer nach. Nun erkannte sie kurzsichtig den offiziellen Stempel einer Polizeibehörde und dass der Mann vierundfünfzig Jahre alt war. Mit Anerkennung musste sie feststellen, dass er sich gut gehalten hatte. Sein Haar war dicht und schwarz, seine Gesichtszüge weich und neutral. Er hätte für Anfang vierzig durchgehen können. Nur sein Name klang wie eine alberne Erfindung. »Das ist meine Ermittlung, mein Fall.« Es war ein spektakulärer Fall, und sie würde ihn nicht an einen gut aussehenden, dahergelaufenen Mittfünfziger abtreten, den sie noch nicht einmal richtig kannte. Falls er das nicht akzeptierte, sollte er sie richtig kennenlernen.
Kamilla:
Kamilla Rosenstock war fünfundvierzig Jahre alt. Ihre Nachbarn munkelten, sie sei zu gut aussehend, um klug zu sein, und zu klug, um gut auszusehen. Sie hatte ein Mal Pot geraucht, eine Abneigung gegen Vorhäute und war ein Mal vergewaltigt worden. Sie trug keine Spitzenunterwäsche, keinen Ehering, besaß keine PaybackKarte, schmutzige Fingernägel ekelten sie. Ihre beste Freundin hatte sie schon häufig schmachtend angesehen: »Wenn ich nur so gut aussähe wie du.« Aus ihrem Mund klang es wie ein Versprechen. Im echten Leben empfand Kamilla es als eine Zumutung. Kamillas Freundin war im Gegensatz zu ihr klein, rundlich, mit unreiner Haut und flacher Brust. Sie trug Röcke, die die Kürze ihrer Beine unvorteilhaft betonten, und zu lange Strickjacken. Aber sie wusste Kamillas Stilbewusstsein zu schätzen und erkannte ihre Schönheit neidlos an. Sie war die Einzige, die Kamilla nie Vorwürfe machte. Nicht offen und nicht insgeheim. Selbst Kamilla machte sich ständig Vorwürfe wegen ihres guten Aussehens. Gutes Aussehen war keineswegs Geschmackssache, es war in Kamillas Augen ein Fluch. Schon in der Schule hatten ihre Klassenkameradinnen mit Neid auf ihre gut entwickelten Brüste gestarrt, die Jungen mit fast tierischem Verlangen. Kein BH konnte verbergen, dass da Großes heranwuchs. Kamillas Körper war schlank und hochgewachsen genug, dass sie in der Fußgängerzone mit vierzehn Jahren angesprochen worden war, ob sie nicht für eine Agentur modeln wolle. Kamilla hatte scheu den Kopf geschüttelt und schnell das Weite gesucht. Nicht einmal ihrer Mutter hatte sie von dem Angebot erzählt. Bis heute schämte sie sich für ihre blonden langen Haare. Sie hatte sich ebenfalls dafür geschämt, als sie kurz und rot waren. Kein Schnitt und keine Farbe konnten darüber hinwegtäuschen, dass es dichte, schöne Haare waren. Den Mut zu einer Glatze besaß sie nie. Sie mochte ihre langen Beine nicht und machte sich jahrelang in Gegenwart anderer Menschen klein. Das führte sowohl zu Haltungsschäden als auch dazu, dass sie hässliche weite Kleidung trug und ihre Essgewohnheiten änderte. Weniger zu essen erbrachte jedoch nicht das gewünschte Ergebnis − einen Wachstumsstopp. Kamilla wurde größer und schöner. Unaufhaltsam. Die Männer betrachteten sie wie ein Rudel Wölfe das Reh. Kamillas Flucht vor sich selbst und den anderen bestand in dem regelmäßigen Besuch der örtlichen Schwabinger Stadtteil-Bibliothek. Sie saß dort allein. Sie las alles, sie las viel, und sie las es genau. Altersbeschränkungen hielten sie von keiner Lektüre ab. Ihr Selbstbewusstsein wurde besser, ihre Augen wurden schlechter. Es war der nette, vollschlanke Junge mit der Hornbrille am Schalter mit dem Verlängerungsstempel, der sie hinter den Mülltonnen am Mitarbeitereingang vergewaltigte. Er kannte alle Titel. Kamilla besuchte fortan eine andere Bibliothek. Ihren Eltern erzählte sie nichts davon. Sie machte mit etwas Abstand zu dem Erlebnis ihre Erfahrungen mit One-Night-Stands. Keiner ihrer Partner interessierte sich für Philosophie oder theoretische Physik. Kamilla interessierte sich nicht mehr für Sex. Sie wollte sich nur unterhalten. Aus purem Trotz schrieb sie sich weder für ein Kommunikationsstudium noch für Philosophie oder Betriebswirtschaftslehre ein, sondern entschied sich für eine Laufbahn bei der Polizei. Ihr Visus lag knapp über den dienstlichen Mindestanforderungen. Selbstverteidigung, einfarbige Uniformen, verbeamtete Autorität; all das erschien ihr attraktiv. Nachdem sie die Prüfung mit Bravour gemeistert hatte, schlug sie eine Karriere im mittleren Dienst ein. Etwas Unspektakuläreres konnte sie sich nicht vorstellen. Bei einer BKA-Fortbildung zur Daktyloskopie, dem Verfahren zur Auswertung von Fingerabdrücken, lernte sie den Mann kennen, der Vater ihrer vier Kinder wurde, ein Faible für teure Importwagen und wenig Ehrgefühl besaß. Aber er hatte eine beschnittene Vorhaut, einen unterhaltsamen Humor und saubere Fingernägel. Für Kamilla war das mehr, als sie erwarten konnte. Kamilla wollte keine Nachkommen. Aber er produzierte mit ihr ein Kind nach dem anderen. Sie redete sich die exponentielle Fortpflanzung schön: Viele Kinder waren gut, weil sie nicht zu einer großen, gut aussehenden Blondine passten.
An einem Samstagnachmittag beschloss sie, mit ihrem Äußeren offensiv umzugehen. Sie ging fortan besonders aufrecht, trug, wann immer es keine Uniformpflicht gab, extrem feminine, teure Kleidung, die ihre Maße − 85, 65, 90 − unterstrich. Sie schminkte sich, betonte mit Schwarz ihre mandelförmigen Augen, legte Lippenstift in Nude-Tönen auf. Sie zitierte freimütig Hegel und Wittgenstein, wann immer sich die Möglichkeit bot, formulierte nur noch mit einer gewissen Arroganz und genoss den Umstand, dass sie ihre Mitmenschen nun auf der Distanz hielt, die ihr Sicherheit und Deckung bot. Kamilla wollte nicht gut aussehen, wollte nicht schlau sein oder für eine dieser Eigenschaften bemerkt werden, aber wenn es nicht zu vermeiden war, wollte sie sich wenigstens dahinter verstecken. Kamilla lebte getrennt, war überarbeitet und dauermüde. Weil sie von panischer Angst vor den Wechseljahren geplagt wurde, zog sie sich ständig zu dünn an, damit sie Hitzewallungen auf jeden Fall von ganz normalem Schwitzen unterscheiden konnte. In seltenen ruhigen Momenten fühlte sie sich leicht depressiv. Aber Kamilla hatte sich daran gewöhnt, sah in ihrer Karriere die Flucht nach vorn, vielleicht auch einfach nur eine Beschäftigung, die sie vom Nachdenken abhielt, und wusste, dass sie jede Minute – und sei sie auch noch so anstrengend – vor den Wechseljahren intensiv erleben musste.
Er schüttelte den Kopf: »Mein Fall. Gott sei es geklagt. Es tut mir leid.« Das Bedauern des kleinen, attraktiven Mannes klang echt.
Kamilla fühlte sich veranlasst, Klarheit zu schaffen: »Sie könnten diesen Fall gern haben, glauben Sie mir. Er ist brutal und verwirrend. Er bereitet mir jetzt schon Kopfzerbrechen. Aber leider sind Sie zu spät dran, und wie Sie wissen, bestraft solche wie Sie das Leben. Bitte gehen Sie und kommen Sie nicht wieder!«
»Sprechen Sie mit meinem Chef!«
Kamilla Rosenstock holte ein Mal tief Luft und lächelte mit allem Charme, zu dem sie fähig war. »Das werde ich gern tun. Morgen oder übermorgen, Herr …« Nochmals versuchte sie, die auf dem Ausweis eingeprägten, schwarzen Schreibmaschinenbuchstaben mit zusammengekniffenen Augen zu lesen. »Horst Horst.«
»Wie der Fotograf.«
Fragend sah sie ihn an. »Horst Horst. Wirklich?«
Er nickte emphatisch.
»Das tut mir leid. Bitte gehen Sie! Sie stören meine Kreise, Herr Horst! Horst«, murmelte sie.
Aber er heftete sich an ihre Fersen, hantierte umständlich mit seinem Geldbeutel herum und machte keinerlei Anstalten, von diesem Parkplatz zu verschwinden.
Kamilla Rosenstock tippte mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf seinen klatschnassen Trenchcoat und bemühte sich um Festigkeit. »Ich habe hier drei Leichen, und falls Sie nicht dazugehören wollen, dann suchen Sie jetzt das Weite!«





























